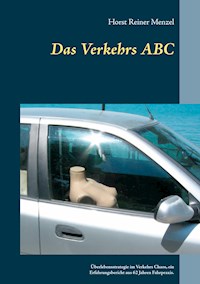Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor erzählt den Aufstieg der Tuchmacher-Stadt Spremberg in der Niederlausitz, von den Anfängen der Industrialisierung über die Kriegs- und DDR-Nachkriegsjahre, bis in die Neuzeit, mit vielen historischen Hintergründen, Anekdoten, schmunzel und liebes Geschichten, wie sie das Leben schreibt. Es war wichtig, weil die meisten Zeitzeugen schon verstorben sind und wenig Informationen hinterlassen haben. Doch genauso wichtig, wie die Gedenkfeiern gegen den Krieg und das Leiden der sechs Millionen KZ-Toten sind, muss uns immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, was damals geschah. Aber man sollte die Leiden der deutschen Bevölkerung, auch nicht vergessen, denn das waren nicht alles Nazis. Die meisten waren ganz normale Menschen und es darf genauso wenig in Vergessenheit geraten, wie die Schandtaten der Besatzungsmächte, die das ganze deutsche Volk für die Ereignisse der Hitler Diktatur bestrafen wollten. Insbesondere sind hier die Sowjets zu nennen, die sich widerrechtlich ein Stück Polen aneigneten und im Potsdamer Abkommen, ihren Machtbereich bis an die innerdeutsche DDR-Grenze ausdehnten. Wenn man Geschichte richtig deutet, ist niemals nur ein Volk das alleinig Schuldige. Es sind immer mehrere beteiligt, Ursachen und Wirkungen zu verstehen, das ist die Botschaft, die dieses Buch vermitteln will. Es gab keinen Grund für Napoleon Bonaparte ganz Europa zu überfallen und zu zerstören, außer seiner unbegrenzten Machtgier. Auch nicht für die Gräuel, welche der Kommunismus über die Völker gebracht hat. Ebenso haben die Völker Europas die Juden über Jahrhunderte verfolgt. Es waren nicht die ersten Juden-Pogrome, welche die Nazi-Verbrecher zu verantworten haben. Es waren viele kleine Bausteine, die man in ganz Europa aufsammeln kann, welche dazu geführt haben. Auch die Katholische Kirche hat der halben Welt ihren alleinseligmachenden Glauben aufgezwungen und im Dreißigjährigen Krieg, halb Europa entvölkert. Man hat bedenkenlos die indigenen Völker überfallen, in ganz Nordamerika die Indianer abgeschlachtet. Alle sind schuldig, in fast jedem Staate der Erde. Alle diese Ereignisse haben unendliches Leid über die Bevölkerungen gebracht, das muss endlich, und zwar von allen Völkern aufgearbeitet werden. In den USA werden Schwarze erschossen, das ist nur die Fortsetzung des Leides der schwarzen Sklaven. Und auch die Israelis scheinen nicht viel aus ihrer eigenen Geschichte gelernt zu haben und können mit den Völkern, in ihrem gelobten Land keinen Frieden machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die handelnden Personen
Vorwort
Einführung
Gedicht: Die Spreeballade
Gedicht: Die Bücherwurm Jacke
Erster Teil
Kapitel 01 Der vertauschte Prinz
Kapitel 02 Gottlob Gentner
Kapitel 03 Gerda und Werner
Gedicht: Das Kochsdorfer Kreuzchen
Gedicht: Maiandacht
Kapitel 04 Leonore Hortense
Gedicht: Lebensquell
Kapitel 05 Die Gasanstalt
Kapitel 06 Die Plinse
Kapitel 07 Das Mittagessen
Kapitel 08 Der unterirdische Gang
Kapitel 09 Die Tuchmachergilde
Kapitel 10 Die Michelsons
Kapitel 11 Die Gründung der Firma Richard
Kapitel 12 Sorgenfalten
Kapitel 13 Die Katholische Kirche-
Kapitel 14 Das Versprechen
Kapitel 15 Die Liebe und viel Menschliches
Kapitel 16 Rückblick: Der Brand
Kapitel 17 Die Hochzeit des Jahres
Kapitel 18 Die Rückkehr der Helden
Kapitel 19 Die Familie Sinapius
Kapitel 20 Verlockungen des Nichterlaubten
Kapitel 21 Die Elektrifizierung
Kapitel 22 Erna und Josef
Kapitel 23 Explosion und das Krankenhaus
Kapitel 24 Gesellschaft für Stromerzeugung
Kapitel 25 Die große Überschwemmung
Kapitel 26 Die Braunkohle
Zweiter Teil
Kapitel 27 Bahnen – Denkmäler und andere Ereignisse
Kapitel 28 Die Spremberger Originale
Kapitel 29 Spremberger Familien , Vereine u. Geschäfte
Gedicht: Die Perle der Lausitz
Gedicht: Gedicht: Bienenfleiß
Gedicht: Die Wege des Lebens
Kapitel 30 Die Sorben und das Brauchtum
Gedicht: Nun ruhen alle Wälder
Kapitel 31 Die jüdischen Mitbürger der Stadt
Kapitel 32 Die Festung Spremberg
Kapitel 33 Spremberg Historisches
Anhang 1 Adress-Buch Spremberg von 1932
Anhang 2 Streifzug durch die Perle der Lausitz
Anhang 3 Stadtansichten Märkischer Bote
Die handelnden Personen:
Gottlob Gentner
Schlossermeister Spremberg
Gustav Neumann
Schmied in Spremberg
Paula Neumann
Seine Frau
Gerda (Gerdi)
Seine Tochter
Werner Schmidt
Handwerker und Fuhrknecht
Florian Bethke
Apotheker
Emma Bartels
Freundin von Gerda
Fix Hänschen
Der schlimme „Finger“
Jakob Michelson
Tuchmacher Fabrik
Gertrud Michelson
Seine Frau
Hermine Michelson
Tuchmacher-Tochter
Alfred Richard
Weber aus der Oberlausitz
Carl Richard
Weber sein Bruder
Hans Wieland
Elektro-Ingenieur
Waltraud Gerster
Oma von Hermine
Leonore Hortense
1.Tochter von Mahlmanns
Magda-Helene
2.Tochter von Mahlmanns
Louise Mahlmann
Frau von Otto Mahlmann
Otto Mahlmann
Mühlenbesitzer
Markus Mahlmann
1. Sohn des Müllers
Berthold Mahlmann
2. Sohn des Müllers und Katholischer Pfarrer
Nowka
Nachbar von Florian Bethke
Georg Schmidt
Tanzlehrer
Erna Heinze
Ehefrau des Fabrikanten Heinze
Gottfried Heinze
Tuch-Fabrikant
Alexander Heinze
Sohn der Heinze‘ s
Josef Biermann
Vater vom kleinen Alexander
Anna Sinapius
Anna Tochter der Familie →
Wilhelm Sinapius
Tuchwarenfabrikant
Emma Sinapius
seine Frau
Stadt Medikus
Doktor Theo Malade
Superintendent
Karl Ludwig Beppel Ev. Kirche
Firmen
C. & A. Richard
Betrieb
Fleischerei Kadach
Polske
Berg Drogerie Polske
Julius Merle
Gemischtwarenladen
Adolf Budich
Frisörmeister
Werner Kadach
Fleischwaren
Schmidt Julius
Kolonialwaren
Berthold Gäßner
Weinstube
Georg Andreas Krause
Badehaus und Altwarenhandlung
Otto Kanisch
Schuhgeschäft
Fritz Großmann
Molkereiwaren Heinrichsfelder-Allee
Metag Hans
Schneiderei
Wilhelm Hübel
Kaufhaus
Rotes Kreuz
Hilfsorganisation
Paul Mörmann
Fotografen Geschäft vormals Thiem & Heppert
Werner Wieland
Ingenieur
Gerhard Branske
Kohlengruben
Albert von Voigt
Kapitalanleger
Vorwort
Ein paar Leser werden anmerken: Nun Herr Autor, hören Sie doch endlich auf, wir schreiben das Jahr 2020 und wollen davon nichts mehr wissen, vom Krieg, Elend und Zerstörung usw. Ja so dachte ich lange Jahre und viele meiner Zeitgenossen auch, doch dann kamen mir Zweifel, sollte man nicht der Nachwelt etwas hinterlassen, ein mahnendes Beispiel geben, ja, wer sollte es denn noch tun? Die meisten Zeitzeugen sind schon verstorben und was sie an Informationen hinterlassen haben, ist in alle Winde zerstreut. Das war für mich der Anlass dieses Buch zu schreiben, das waren mir die vielen Stunden wert, die ich für Recherche und bei der Niederschrift aufwendete. Doch genauso wichtig, wie in jedem Jahr, immer wieder Gedenkfeiern gegen den Krieg und das Leiden der sechs Millionen KZ-Toten stattfinden, muss uns immer und immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, was damals geschah, auch in der Kleinstadt Spremberg in der Nieder-Lausitz. Aber genauso, sollte man die Leiden der deutschen Bevölkerung, auch nicht vergessen und das waren nicht alles Nazis. Die meisten von ihnen waren ganz „normale Menschen“ wie Sie und ich. Das ist mein Anliegen und es darf genauso wenig in Vergessenheit geraten, wie die Schandtaten der Besatzungsmächte, die das ganze deutsche Volk für die Ereignisse der 12 Jahre Hitler Diktatur bestrafen wollten. Insbesondere sind hier die Sowjets zu nennen, die sich widerrechtlich ein schönes Stück Polen aneigneten und im Potsdamer Abkommen, ihren Machtbereich bis an die Oder/Neiße Linie ausdehnten.
Wenn man aber Geschichte richtig deutet, ist niemals nur ein Volk das allein Schuldige. Es ist wie in einer Ehe, oder unter Freunden, die sich streiten. Es sind immer mehrere beteiligt, nie nur einer allein, der eine mehr und der andere weniger. Ursachen und Wirkungen zu verstehen, das ist die Botschaft, die dieses Buch vermitteln will. Es gab keinen Grund für Napoleon Bonaparte ganz Europa zu überfallen und zu zerstören, außer seiner unbegrenzten Machtgier. Es gab auch keinen Grund für Hitler und Stalin, das arme, kleine Polen unter sich aufzuteilen. Damals wurde der Grundstein gelegt, auch für alles, was danach geschah, einschließlich der Gräuel, welche der Kommunismus über die Völker gebracht hat. Ist das alles auch schon vergessen? Es gab auch keinen Grund für die Völker Europas, die Juden über Jahrhunderte zu verfolgen, sie sind genauso Menschen wie du und ich, nicht besser und nicht schlechter. Es waren nicht die ersten Juden-Pogrome, welche die Nazi-Verbrecher zu verantworten haben. Aber es waren viele kleine Bausteine, die man in ganz Europa aufsammeln kann, welche dazu geführt haben. Es gab auch keinen Grund für die Katholische Kirche, der halben Welt ihren alleinseligmachenden Glauben aufzuzwingen. Das waren nicht nur die Kreuzritter mit Feuer und Schwert, oder die Inquisition mit ihrem Psychoterror, ganz zu schweigen vom Dreißigjährigen Krieg, der ganz Europa entvölkerte. Es gab auch keinen Grund, die indigenen Völker zu überfallen zu töten und in ganz Nordamerika, die Indianer abzuschlachten. Wir sind alle schuldig, in fast jedem Staate der Erde, alle diese Ereignisse haben unendliches Leid über die Bevölkerungen gebracht, das muss endlich, und zwar von allen Völkern aufgearbeitet werden. Und wenn fast an jedem Tag in den USA ein Schwarzer erschossen wird, so ist es nur die Fortsetzung des Leides der schwarzen Sklaven, die man heute in einer angeblich aufgeklärten Welt, immer noch diskreditiert, verprügelt und tötet. Und wenn Sie mich fragen, auch die Israelis scheinen nicht viel aus ihrer eigenen Geschichte gelernt zu haben, statt mit den Völkern, in ihrem gelobten Land Frieden zu machen, töten sie und werden getötet, wann hört das alles endlich auf?
Der Autor
Einführung
Die Spree und ihre Nebengewässer gehören zu den Einzugsgebieten der Dame, der Havel und der Elbe, die bei Hamburg in die Nordsee mündet. In ihrem Oberlauf durchmisst die Spree aus ihren drei Quellen gespeist, die Braunkohlenreviere der Nieder-Lausitz. Ihnen fielen in den vergangenen 40 DDR-Jahren, durch die rücksichtlose Ausbeutung, tausende von uralten bäuerlichen Anwesen zum Opfer. Ganze Ortschaften wurden wegen der Braunkohle weggebaggert. Einer der schönsten Nebenflüsse auf dem wir Paddler vom Kanuverein Einheit Spremberg, in den 50er Jahren gepaddelt sind, der „Schöps“, wurde einfach weggebaggert und verkam zu einem öden Kanal, der sein Wasser der Spree zuleitete. Man erkühnte sich in der damaligen Hauptstadt der DDR in Berlin sogar, ganz Spremberg wegzubaggern und die Menschen in alle Winde zu zerstreuen. Was der Krieg und der Kommunismus nicht zerstört hatten, setzte sich nach der Wieder-Vereinigung Deutschlands rigoros fort. Ocker ist ein Farbstoff, der sich bildet, wenn eisenhaltiges Wasser mit Sauerstoff in Berührung kommt, dann fällt er aus. Er färbte jahrzehntelang die Spree dunkelbraun. Erst als sich der vom Tourismus lebende Spreewald zur braunen Jauche verfärbte, wurden die weisen Herrschaften in Berlin wach, denn es hätte ja nicht viel gefehlt und die Brühe wäre am Kanzleramt vorbeigeflossen. Endlich kam Bewegung in die märkischen Kodderschnauzen:
„Mir und mich vawechslich nich, dat kommt bei mich nich vor.
Der Fluss der Deutschen Hauptstadt wurde gerade noch rechtzeitig gerettet, doch seine Regenerierung wird noch einmal ein Jahrhundert beanspruchen, weil weiterhin eisenhaltiges Wasser die Spree braun färbt.
Die Spreeballade
Springlebendig, lieblich quillt die junge Spree,
aus ihrer Lausitz-Heimat dreifach Quelle,
durchfließt nach Norden reisend manchen See,
lebenspendend überwind`t sie jede Schwelle.
Belebend, labend Mensch und Natur,
schwinget durch Felder, Wald und Flur,
anzuschauen gar lieblich ist sie auch,
in die Havel ergießt sich dann ihr Lauf.
Einst trieb sie in Bautzen ein Wasserrad,
zu speisen viele Brunnen in der Stadt,
die Wasserrohre, gedrechselt aus Holz,
das Hebewerk war des Bürgers Stolz.
Jene, die früh in diese Idylle kamen,
sagten „Spree am Berge“, des Städtchens Namen.
Weißes- und Mühlenwehr, halten ihren Lauf,
ein kleines Weilchen, in ihrem Streben auf.
Einst murmelte sie durch den Schwanenteich,
nahm ihren Weg entlang des Georgenberg's,
trieb viele Räder des Tuchmacher-Handwerk's,
begradigt zum Kanal, welch übler Streich.
Am Georgenberg wuchs einst der Kirchenwein,
dort ruh‘ n schon lange der Ahnen Gebein,
„Was ihr jetzt seid, das waren wir.
Was wir jetzt sind, das werdet ihr.“
Am Weißen-Wehr, da teilt sich ihr Nass,
jetzt träg geworden von dem Aderlass,
glücklich treffen sich die ungleichen Brüder,
umschlungen an der Liebesinsel wieder.
Befreit rauscht liebliche Landschaft dahin,
auf nach Cottbus, dahin steht ihr der Sinn,
Branitzer Park und Spreewald's Inselwiesen,
hier endlich, dürfen frei ihre Wasser fließen.
Schwielochsee, Lebensraum für seltene Tiere,
schon steht sie den Berlinern vor der Türe,
langsam strebt sie zum großen Strome,
windet sich durch die Regierungszone.
So munter sie hüpfte in jungen Tagen,
muss sie im Alter das Kanalsein ertragen,
ihr Lebenslauf endet entrückt ihrem Sinn,
träge schiebt sie sich zu der Havel hin.
Könnt' uns gar viele Geschichten erzählen,
von Märchen - Feen und der Menschen-Geschick,
wie sie darben, sich in Drangsalen quälen,
in ihrem Hasten und Streben nach Glück,
von tiefen Wassern und des Lebens Lauf' s,
sind sie doch alle mit Spreewasser getauft.
Der Fluss der Energieerzeugung
Den zweiten Teil in dem Gedicht,
ja, den mag ich selber nicht,
hoff noch zu meinen Lebenszeiten,
bald ihn wieder auszustreichen.
Der Fluss des Todes
Der Braunkohle Schreckgespenster lachen,
Zauberwort, Arbeitsplätze müssen wir schaffen,
dafür machen sich Politiker zum Affen,
Selbstbetrug, alle wollen nur endlos raffen.
Braune Brühe, Lebendiges nicht zu sehen,
alles tot, denn hier kann nichts überleben,
was hat nur des Menschen Größenwahn,
dem einst so herrlichen Flusse angetan.
Der Fluss der Mahnung
Was Wunder, wenn Bürger die Nase voll haben,
niemand kann wie früher in der Spree baden,
nutzen den Menschen paar Arbeitsplätze mehr?
leidet doch die Lebensqualität allzu sehr.
Es darf so nicht weiter gehen auf Erden,
Mensch und Natur müssen wieder Eines werden,
Mahnung! „künftiger“ Generationen wegen,
sollten „heutige“ dieses Kleinod sauber pflegen.
Rei©Men
Spremberg ist in seiner einzigartigen landschaftlichen Schönheit im Urstromtal der Spree gelegen, ein Kleinod wie man es in der Lausitz selten findet. Das Stadtbild und seine Straßenanlage, hat sich seit dieser frühesten Besiedlungsphase, in der Innenstadt nicht viel verändert. Die Spree hat sich seit Jahrmillionen tief in das Tal eingegraben und teilt sich vor der Stadt in zwei Arme, zu der großen und der kleinen Spree auf, die sich hinter der Stadt im sogenannten Veilchental wieder vereinen. Die höchste Erhebung bildet der Georgenberg, welcher das Stadtbild, mit dem ins Auge springenden Bismarkturm prägt. In früheren Jahrhunderten gehörten Weinberge zum Stadtbild von Spremberg und auch in der Umgebung wurde Wein angebaut. Man glaubt es kaum, selbst auf den Feldern in Slamen standen die Weinstöcke und lieferten den sogenannten Landwein. Auf der Slamer Höhe erinnert der Straßenname, „Weinberg“ an diese Zeit. Die Chronisten berichten „dass es ein rechter Krätzer“ gewesen sei, „der wie eine Säge durch den Hals ging.“ Aber die Leute wussten sich zu helfen und verfeinerten den Trinkgenuss mit Zutaten aus Honig und Gewürzen. Sogar die Kirchen mischten mit und bekamen den Abendmahlwein kostenlos zugeteilt. Die 1867 in Betrieb genommene Bahnstrecke Berlin-Cottbus-Spremberg-Görlitz-Hirschberg-Breslau, bewirkte dann einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung, Spremberg war mit der Welt verbunden. Der Roman handelt vom Aufstieg der Stadt Spremberg um 1855, und den tiefen Fall einer der reichsten und schönsten Städte in der Lausitz. Das Tuchmacher-Handwerk wurde so gründlich zerstört und die Stadt und das Umfeld, werden noch Jahrzehnte für den Wiederaufbau der einstigen Industriestadt benötigen.
In grauer Vorzeit, vor 250 Millionen Jahren gab es in Mitteleuropa zirka Fünfzig Kaltzeiten, eine der Letzten war die, welche man heute die Eiszeit nennt. Während der Wintersaison schneite es mehr, als in Sommer wegtaute, dieses Eis erstreckte sich über den ganzen Kontinent, von Grönland bis in die Lausitz. Die Gesteinsschichten aus Ton, Sand und Braunkohle, wurden vom Eis übereinander und untereinander geschoben, und erreichten eine Mächtigkeit von vier- bis fünfhundert Metern. Zurück blieben die Muskauer Faltenbogen, die heute noch Zeugnis für diese Ereignisse ablegen. Die Findlinge jener Urzeiten lagerten sich nach der Eisschmelze, in Milliarden großen und kleinen rundgeschliffenen Granit-Steinblöcken, den sogenannten Findlingen in unserer Heimat ab. Fast alle Menschen die sich hier ansiedelten, bauten sich daraus erst ihre Höhlen und Häuser und später Straßen und Einzäunungen, die wir heute noch überall bewundern dürfen. Die Braunkohle, so umstritten sie sein mag, wird bis heute noch als Hauptenergieträger für die Stromerzeugung genutzt, und war die Grundlage für die Industrialisierung in der Region. Die Umgebung von Spremberg, ist inzwischen durchlöchert wie ein Käse, von den unzähligen kleinsten und größeren Kohlegruben bis zu den riesigen Tagebauen, die bis ganz dicht an die Stadt heranreichen. Selbst um die ganze Stadt herum gab es Kohlegruben. Die sogenannten Pulsberger Brüche sind da noch in guter Erinnerung. Sie reichten bis in die Heinrichsfelder Allee an die Stadt heran. Rechts von der Karl-Marx-Straße und im Wiesenweg, wo heute Häuser stehen, wurde vor Jahrzehnten noch Kohle abgebaut. So muss sich niemand wundern, dass nach der Erfindung der Dampfmaschine, die industrielle Spremberger Tuchmacherei einen ungeahnten Aufschwung erfuhr. Vom Leineweber, der mit seiner ganzen Familie gegen das Verhungern ankämpfte, bis zum Industriearbeiter, war es ein weiter Weg und unsere Vorfahren waren seit zweihundert Jahren dabei gewesen.
Der erste Teil des Buches, entspringt teilweise der Fantasie des Autors, beruht aber in Ermangelung von Überlieferungen der Chronisten, auch auf den geschichtlichen Fakten, welche nur die „Geschichten“ der „hohen Familien des Adels“ notierten, die uns hier nicht zu interessieren haben. Sie geht dann über in eine Zeit, in der erstere in Vergessenheit versank, und eine die uns reale Überlieferungen hinterließ, in das sogenannte Industriezeitalter. Wenn sich Legenden bilden, werden sie meistens als Märchen abgetan. Dabei haben sie in vielen Fällen reale Hintergründe, was wie ein Märchen aus uralter Zeit klingt, erfährt diesen Tatsch, erst durch die Weitergabe über Generationen und von Mund zu Mund. Es liegt ein Briefchen in jedes Menschen Kopf, und ein jeder schreibt es ein ganz kleines bisschen um. Bei jedem Lesen verändert es sich wieder ein wenig. Was danach in Jahrhunderten als Nachricht übrigbleibt, ist nur noch Sage. Die Gebrüder Grimm haben den Volksmärchen nachgespürt und sie für die Ewigkeit aufgeschrieben. In Afrika, wo man des Schreibens und Lesens nicht mächtig war, gab es die Erzählkultur. Meistens waren es ältere Männer, die „Geschichtenerzähler“, welche die Ereignisse und Familiengeschichten von Generation zu Generation weitergaben. Der amerikanische Journalist Alex Haley, ein Nachkomme afrikanischer Sklaven, versuchte in den 1960er Jahren herauszufinden, von wo seine Vorfahren in Afrika verschleppt worden waren. Aus den Erzählungen seiner Großmutter wusste er, wie sein Großvater in Afrika gekidnappt wurde und schrieb diese Informationen alle auf. Dann reiste er nach Afrika, an die sogenannte Goldküste, und dort von Stamm zu Stamm, eines Tages fand er einen Erzähler, der ihm bis in kleinste Details die Geschichte von der Verschleppung des Häuptlingssohnes erzählte, der eines Tages nicht mehr von einem Jagt-Ausflug zu seinem Stamm zurückkehrte. Er kannte sogar noch den Namen des Mannes, den Namen des Großvaters von Alex Haley.
Im Fernseher laufen nur noch Gewaltkrimis. Doch die Vergangenheit lehrt, dass der sogenannte Verbraucher noch nie gefragt wurde, was er gern sehen oder lesen möchte. Zugegeben, in der Ära des Medienzeitalters und der Bücherschwemme, wird es immer schwerer, wieder etwas Neues zu finden, über das noch nicht geschrieben wurde. Doch gerade diese Entwicklung macht das Lesen von Büchern wieder attraktiv. Allerdings sollte man nicht wahllos auf ungefähre Belletristik zurückgreifen, sondern erst einmal herumstöbern, was es so auf dem Büchermarkt gibt. Ich habe mir für diese Recherche im „Hinterkopf“ ein Stichwörterverzeichnis aufgebaut, auf das ich bei der Auswahl von Büchern, Filmen und Fernsehsendungen zurückgreifen und innerhalb von Sekunden eine Auswahl treffen kann. Das sind z. B. die Klassiker, Historiker, Sach- und Wissensbücher oder Naturfilme. Danach kommen ferne Länder, Schicksal- und Familien- Geschichten, die das Leben schreibt. Was ich nicht mag, kommt in meine Negativliste, wie Krimis, Kriegsorgien und allzu fantastische Science-Fiction Fantasien. Doch nun zu diesem Buch:
In meinen Büchern und Gedichten, habe ich immer nur von Dingen geschrieben, die ich selbst erlebt oder sorgfältig recherchiert habe. Dinge die unglaubwürdig oder zu spinnert sind, kamen darin nie vor. Dieser Roman erzählt die Geschichte meiner Heimatstadt Spremberg in der Lausitz, beginnend in der nachnapoleonischen Zeit nach 1815. Soweit konnte ich auch die Lebensläufe einiger Spremberger und die meiner eigenen Vorfahren zurückverfolgen. In „Die Tuchmacha“ wird die historische Geschichte der Kleinstadt auf der Spreeinsel in ihrer Blütezeit, und die ihrer reichen Tuchmacherfamilien bis zum Zusammenbruch 1945 erzählt.
Die Bücherwurmjacke
Alte Jacken sind wie Eselsohren,
über die sich jeder amüsiert,
man hat sie aus Verseh'n verloren,
zufällig beim Lesen arrangiert.
Doch zu jeder richt'gen Leseratte,
gehört nun mal `ne alte Jacke,
gemütlich schmökern in 'nem Wolleflor,
erhebt den Geist und steigert den Komfort.
Jedoch allmählich mit der Zeit,
schlottern die Ärmel auch schon weit,
du dich in ihr immer wohler fühlst,
wenn du in den Folianten wühlst.
Schön bequem und ausgebeult,
treu sie ihren Zweck erfüllt,
es ist die Patina, die sie so ehrt,
perfekt passt sie zum Steckenpferd.
Kriegst du langsam graue Haare,
kommt auch sie dann in die Jahre,
wärmt sie dich noch immer prächtig,
hält dich warm, auch mitternächtlich.
Hast sie dann ganz abgewetzt,
schenkt man dir zum Weihnachtsfest,
aus dem großen Ausverkauf,
eine neue woll'ne Haut.
Die Altgediente schaut beleidigt drein,
du machst das mit, nur so zum Schein,
denkst: wart`, wir geh'n in meine Klause,
dort sind wir beide doch zuhause.
Rei©Men
So, nun wünsche ich Ihnen eine schöne Lesestunde, ich muss nun noch mein beschädigtes Selbstbewusstsein pflegen gehen und ein paar mea culpa beten, weil ich damals meine geliebte Heimatstadt verlassen habe, möge der Leser darüber urteilen was richtig war.
Erster Teil
Kapitel 01 -Der vertauschte Prinz-
Der Marktplatz von Spremberg ist wohl der Kristallisationspunkt der Stadt. Heut noch laufen alle Ein- und Ausfallstraßen hier zusammen. Um ihm herum entwickelte sich die gesamte Stadt im Laufe der Jahrhunderte zu einem bedeutenden Industriezentrum in der Lausitz. Die Ersterwähnung von Spremberg geht einer alten Urkunde zufolge auf das Jahr 1301 zurück.
Um ihn herum hatten sich die großen Hotels angesiedelt. Im Jahre 1852, hatten sich anonyme Angehörige des sächsischen Königshauses, im „Thumann Hotel“ auf einer Reise eingemietet, weil eine Dame hochschwanger war und die Geburt unmittelbar bevorstand. Die hohe Dame kam nieder, gebar jedoch, statt einer langersehnten Tochter, einen weiteren Erbprinzen. Dem Spremberger Töpfer-Meister Lehmann und seiner Ehefrau, wurde am selben Tage, statt eines Sohnes ein weiteres Mädchen geboren. Beide Paare waren ob des erneuten Pechs enttäuscht. Doch die Hebamme, die beide Kinder entbunden hatte wusste Rat. Sie besprach sich kurz mit den Elternpaaren und ruckzuck, ohne dass es jemand merkte, wurden die beiden Kinder ausgetauscht. Das Mädchen wuchs nun als feine Prinzessin des sächsischen Königshauses auf und der betrogene Prinz unter dem Namen August Lehmann, bei den armen Bürgern der Stadt. Außer seinen Eltern wusste niemand, dass er einst „von königlichem Blut“ abstammte. Doch als er 21 Jahre alt war, erzählten ihm seine „Pflegeeltern“ diese Geschichte, weil sie zu sehr auf ihrem Gewissen lastete. Enttäuscht zog er in die Fremde und kehrte erst Jahre später in seine Heimat zurück. Seine Zieheltern waren gestorben und niemand glaubte ihm seine Geschichte. Wieder hörte man jahrelang nichts mehr von ihm, doch eines Tages kam ein Mann aus Hoyerswerda nach Spremberg und übernachtete im Hotel Thumann. Abends saß man noch bei Gesprächen beisammen und der Gastwirt gab nach einigen Körnchen zu viel, am Stammtisch die alte Geschichte zum Besten. Der Gast horchte auf und erinnerte sich auf dem Friedhof in Hoyerswerda, ein Grabkreuz gesehen zu haben, dass die Inschrift trug: Hier ruht der hoch-edle Prinz von Sachsen, August Lehmann, geboren in der Stadt Spremberg in der Niederlausitz. Möge er den Frieden finden, der ihm im Leben nicht beschieden war.
Kapitel 02 -Gottlob Gentner-
Um das Jahr 1700 kam der damals zwanzigjährige Schlossergeselle Erdmann Gottlob Gentner nach Spremberg. Er war „auf der Walz“ in der Stadt hängengeblieben, irgendwie gefiel sie ihm ganz gut und er blieb. Bei der Schlosserwitwe Maria Dorothea Schulze bekam er Arbeit, weil sie für die Weiterführung des Betriebes einen Schlosser benötigte. Bald loderte bei den beiden nicht nur das Schmiedefeuer, sondern auch die Liebe brannte in ihren Herzen. Bald darauf machten sie einen „Knopf drauf“ und heirateten. Das Geschäft ließ sich gut an und Gottlob wurde schon bald als Meister in das Innungsbuch eingetragen. Die Ernennung kostete ihn ein paar Fässer Bier, welche aber die „Stadt bezahlte“, wie er schmunzelnd am Stammtisch erwähnte. Wie, die Stadt, wurde er gefragt: Ja, meinte er, ich muss dafür sorgen, dass auf dem Rathausturm die richtige Zeit angezeigt wird, sonst fangt ihr morgens nicht zur rechten Zeit an zu arbeiten. Dafür bekomme ich einen Obolus und den haben wir heute weggesoffen. Und nun muss ich jeden Tag einmal den Turm hochsteigen und die Rathausuhr mit der Kirchenuhr abgleichen, sonst haben wir zwei verschiedene Zeiten und die Faulenzer richten sich morgens immer nach der Uhr die nachgeht und abends nach der die vorgeht. „Ja aba, wennich nu von Grausteen nach hier komme, schaffe ich‘ s manchma in eener Stunde und das andre mal brauchich zehn Minuten länga,“ „Ja weeste Karle, do musste ebe en bisschen schneller loofen, denn holste die Zeit wieda rin. Und wende inne nächste Zeit wieda moal nach Grausteen kummst, bringst ma de Zeit mit, denn kannich se ooch offen Rathausturm instelle.“
Solche und andere, ähnliche Gespräche machten die Runde, trotzdem wusste keiner so ganz genau, wie die genaue Uhrzeit zustande kam. Aber der kleine Disput löste nicht nur in Spremberg immer wieder Diskussionen aus, denn überall in der Welt konnten die genauen Uhrzeiten, die sich ja nach den Gestirnen richten, nur von Astronomen festgestellt werden. Die Frage war nun, wenn man die genaue Zeit auf einer Uhr hatte, wie konnte man sie über weite Strecken transportieren? Das war Gottlob eigentlich egal, denn er las sie immer von der Kirchturmuhr ab. Doch schon nach kurzer Zeit musste er wieder hoch, um die Rathausuhr nachzustellen. Soviel er auch an der Rathausuhr nachregulierte, alle paar Stunden liefen die beiden Uhren wieder falsch, die Frage war nur, welche der beiden die falsche Zeit anzeigte. Eines Tages führte er darüber ein Gespräch mit dem Küster der Ev. Kirche und wie erwartet hatte der Mann das gleiche Problem mit seiner Turmuhr, der Unterschied in der Ganggenauigkeit, so hatte er beobachtet, betrug pro Tag bis zu fünf Minuten. Nebenbei erzählte er, dass ein Engländer ein sogenanntes Chronometer gebaut hatte, der sich als Zeitmesser immer weiterverbreitete, aber sehr teuer wäre. „Man sollte ma en Uhrmacha froage, valleicht wees der mehr drieba.“ Beim nächsten Stammtisch kam das Thema zur Sprache, doch der ortsansässige Uhrmacher reparierte hauptsächlich Pendeluhren und auch mal eine Kaminuhr. „Nur reiche Leute,“ meinte er, haben Taschenuhren und die gehen alle ziemlich ungenau.
Aber meinte er: „Ich werde mal nachlesen, was es inzwischen Neues gibt.“ In der nächsten Woche, kam er mit einer Information zurück, die zu denken gab. Der englische Zimmermann John Harrison hatte schon 1759 ein Chronometer für die Schifffahrt gebaut, der eine Genauigkeit von ein bis fünf Sekunden pro Tag anzeigte. Das reichte, um den Längengrad auf hoher See zu bestimmen. Es dauerte dann noch einige Jahre, bis man in Spremberg eine solche Präzisionsuhr anschaffen konnte. Bis dahin schaute man auf die Sonnenuhr und synchronisierte weiterhin die Turmuhren in der Stadt. Diese Aufgabe hatten nun aber die Uhrmacher übernommen und den Schlosser holte man nur, wenn gröbere Arbeiten anstanden. Als Gottlieb starb, übernahm sein Sohn Johann die Schlosserei und führte sie in eine eher schon moderne Faktorei über, in der man Spinnmaschinen herstellte. Ein erster Versuch von der Handspinnerei, zur industriellen Fertigung von Garnen zu kommen, wurde hier unternommen. Als Dank für diese Leistung erhielt er eine Staatsprämie in Form einer modernen Drehbank, die allgemein die Bewunderung der Schlosserkollegen erregte. In der Folge ließ er von der Baufirma Mittag ein Gebäude errichten, in welchem eine Wollspinnerei, eine Tuchwalke und eine Tuchrauerei arbeitete. In diesem Gebäude wurden hauptsächlich die von der Firma Gentner gefertigten Tuchmachereimaschinen getestet. In der dritten Generation übernahm sein Sohn Theodor die Firma. Er hatte an der Technischen Hochschule in Charlottenburg Maschinenbau studiert und wandelte den Betrieb seines Vaters in eine größere Maschinenfabrik um, in der alles hergestellt wurde, was zur industriellen Fertigung von hochwertigen Tuchen, an modernen Maschinen und Anlagen benötigt wurde. Selbst das Spremberger Gaswerk trug seine Handschrift. Um die Jahrhundertwende übernahm dann sein Sohn Kurt die Firma. Er war ebenfalls Maschinenbauer, ein anerkannter Sachverständiger und führte noch ein Büro für Patentangelegenheiten. Eine Bilderbuchgeschichte die ihres Gleichen sucht, in 100 Jahren, von der einfachen Schlosserei in vier Generationen zur führenden Maschinenfabrik, im weiten Umland aufzusteigen, das konnte sich sehenlassen.
Kapitel 03 -Gerda und Werner-
Der Ochsenkarren blieb einfach so im Dreck stecken. Alle die dem Treck mit ihrer Habe folgten, kamen ins Stocken und die Fuhrwerke schlossen auf. Der Kutscher versuchte noch einmal, das Sechsergespann wieder in Fahrt zu bringen und schlug wie ein wilder auf die Tiere ein, mehrere starke Männer griffen in die Speichen der Räder, doch es rührte sich einfach nichts mehr. Ja, meinte langsam und gedehnt der Ochsen-Werner, so nannten sie ihn, weil er sich bestens mit der Zucht von Rindern und speziell mit Zugtieren, - Holz und Eisen auskannte: „Do wern mer woll ebedo übernaochten müsse.“ Insgeheim nannten sie ihn alle „Den Ochs“ und wenn er es mitbekam, grunzte er in sich hinein, um seinen Ärger nicht erst hochkommen zu lassen. Er war ein schwerer, großknochiger Mann von hohem Wuchs, handwerklich und im Umgang mit Tieren intelligent, aber er sprach unendlich langsam. Sein stattlicher Wuchs, seine schwarzen Haare, die breiten Schultern und der muskulöse Oberkörper beeindruckten so manche Frau. Doch er hatte trotz vieler Avancen und amouröser Angebote der holden Weiblichkeit, sein sanftmütiges Gegenüber noch nicht finden können. Die Richtige war einfach noch nicht dabei gewesen.
Fixhänschen dagegen, kleinwüchsig aber quicklebendig, rothaarig und beredt, wurde nur von seinen flinken Fingern überholt, wenn er die Fidel in die Hand nahm. Jetzt meinte er: „Dere muschte nonit mer dresche, de kunne nimmer fort. Siescht net, dasse Speich broche isch.“ Erst jetzt schauten die Umstehenden auf die Räder und bemerkten, dass unter Wasser ein Radreifen inmitten der Spreefurt abgesprungen war. „Tcho, do wern mer woll de Woage ablode müsse“, meinte der langsame Ochsen-Werner noch gedehnter als sonst, womit er wohl andeuten wollte, dass es länger dauern würde, bis man weiterziehen konnte. Hänschen schaute sich flink wie er war um und suchte nach einem trockenen Plätzchen. Da bot sich eigentlich nur die Wiese vor dem Berghang an, der sich vor ihnen hochreckte. Alles war stark bewaldet und versprach, dass man genügend Feuerholz, vielleicht auch Wildkaninchen, Beeren und Pilze finden würde. Direkt gegenüber befand sich eine freie Fläche mit Gras bewachsen und dahinter zog sich ein Weinberg den Hang hinauf. Das war der richtige Platz zum Rasten, er besprach sich kurz mit Werner, dann lenkte er die anderen Wagen auf den Rastplatz, wo die Tiere gleich anfingen zu grasen, als sie ausgespannt waren. Am Wasser standen die Wasch-Weiber aufgereiht nebeneinander. Sie hatten die Röcke hoch aufgerollt, die Ärmel aufgekrempelt und schlugen Wäsche auf die Ufersteine. Bei jeder Bewegung machten sich ihre Rundungen reizvoll auf die Reise und wenn sie sich dann noch ab und zu nach vorn bückten, hüpfte so manches Männerherz in die Hose. Nach ein paar Minuten hatte sich eine gaffende Menge aus der kleinen Stadt, um dem Treck herum am Ufer angesammelt. Jeder wollte helfen und gab gut gemeinte Ratschläge, doch es gab auch Filous, die nach schneller Beute Ausschau hielten, die Fuhrleute vom Geschehen abgelenkten, genau beobachteten und sich im hinteren unbeobachteten Teil der Wagenreihe zu schaffen machten.
Eine etwas größere Waschfrau, die fast alle überragte, überschaute diese Aktivitäten vom anderen etwas höheren Ufer und kam zum Ochsen-Werner hinüber, um ihn zu warnen, denn sie hatte beobachtet, wie ein paar stadtbekannte „Schlitzohren“, die sie aus dem Umfeld kannte, weil sie dem Ortsbüttel schon ein paarmal bei kleinen Diebereien aufgefallen waren, an einem Wagen herumfummelten. „Du Großa, pascht ma besser uff eier Geschirr uff, sonscht räumens die Gambler ab.“ „Hoh hoh“, dehnte sich der Ochsen-Werner zu seiner vollen Größe auf und schaute nach hinten, sodass sie ein wenig zurücktreten musste und nun zu ihm aufschaute. „Du fängst glei mei Pratze ein, schleich di von dannen“, fuhr er einen der Burschen heftig an, „Pascht do hinte moal besser uff ihr Trantüten“, brüllte er seine Kutscher an. Damit machte er gleich allen klar, wer hier der Boss war. Gerda, die Tochter des Schmiedemeisters Gustav Neumann war beeindruckt, denn diesmal hatte er nicht so lähmend langsam gesprochen. So war es immer, wenn er wütend wurde und ihm verbal die „Gäule“ durchgingen. „Ond dank da schen, dass uffgpascht hascht.“ Die „Schmiede-Gerda“, wie sie genannt wurde, sah als „Fachfrau“ natürlich gleich, was passiert war und bot an ihren Vater zu unterrichten, damit er mit dem Stellmacher vorbeikommen sollte, um den Schaden zu beheben. „Ne, ne, wir ham Ersatzräder mit, aber ich würde dann gern mittem kaputte Rad bei eich rumkomm.“ „Doa könnst ma glei mei schweren Wäschekorb trage helfe.“ „Gutt, des mache mir so.“
Die Fuhrknechte hatten inzwischen den Wagen abgeladen und ihn mit einer Wagendeichsel hoch gehebelt. Das Rad war dann schnell ausgetauscht und die Wagenkolonne hatte sich gegenüber auf der Wiese aufgestellt. Dann luden sie das kaputte Rad und die Schmiede-Gerda, mit ihrer Wäsche auf einen mitgeführten Pferdewagen und ab ging es über den Marktplatz in die Kleinstadt hinein. Ihr Vater staunte nicht schlecht, als die Fuhre in seinem Hof anhielt. Der Ochsen-Werner stemmte den Waschkorb auf die Schulter und fragte: „Wo soller denn hin.“ „Komm mit, unsre Trockenwiese iss ums Haus rum.“ Scheinbar unabsichtlich ging sie ihm nicht voraus, sondern dirigierte ihn mit ein paar Zurufen, dabei beobachtete sie heimlich das Muskelspiel seines starken Oberkörpers. Als hätte er es bemerkt drehte er sich um, worauf sie schnell wegsah, aber es war zu spät, ein breites Grinsen lief über sein Gesicht, ‚sollich oder sollich nich‘, dachte er, doch dann trat er der ‚Katze auf den Schwanz: „Wir machen noaocheer noch en Feier, wege de Mucken, ond daozu wern ma noch was braote, magst net komme?“, fragte er. Sie überlegte nicht lange und sagte zu. Ihr Vater würde bestimmt wieder meckern: „Zu so ehm fremde Kerl gest, kimmer dir bessa um den Altgesell, damits do amol weitergeht, mit de Noachfolge inne Schmiede“. Aber was kümmerte sie das dumme Geschwätz des Vaters, er musste ja den dummen Kerl, der nur auf die Schmiede scharf war, nicht heiraten. Ein Leben lang hatte er sie spüren lassen, dass sie kein Junge geworden war, der das Geschäft weiterführen konnte. Sie lief schnell zu ihrer Mutter, erzählte ihr alles und bat sie den Vater zu beruhigen, denn die litt ebenso unter diesem unmöglichen Verlangen ihres Mannes. „Hoat halt nich sollen sein“, meinte sie zur Tochter, „mir ham ebe kei Kinda mer bekomme, der Vata tut imma so, als ob ich aleene Schuld wer.“
Gerda wandte sich ab und ging Richtung Schmiede. Dort hatte sich in der Zwischenzeit einiges getan, der Ochsenwerner hatte das Rad in die Schmiede getragen und werkelte an der Werkbank herum. Auf dem Boden stand sein Werkzeugkasten, darin sah sie mehrere Schnitzmesser, Hobel, Stecheisen, Bohrer und Kleinwerkzeuge. Er hatte das kaputte Rad auseinandergenommen und fertigte offensichtlich gerade aus Eschenholz die Ersatzteile an. Ihr Vater zog am Blasebalg und drehte den eisernen Radreifen im Schmiedefeuer um ihn zu erhitzen. Dadurch sollte der Umfang geweitet werden, damit er auf den Holzreifen draufpasste. Als er sie sah, sagte er „Geh Gerdi, hol en Eima mit Wassa zum lösche“. Gerda hatte ihm ja schon oft genug bei dieser Arbeit geholfen und kannte sich damit aus. Werner half dem Schmied nun beim herumdrehen des eisernen Radreifens durch das Feuer und nach weiteren 10 Minuten legten sie den Reifen um die Holzfelge. Werner hielt ihn mit der Zange und ihr Vater klopfte erst vorsichtig, bis der Reifen überall über das Holz gerutscht war und dann hieben sie immer heftiger draufschlagend, den Reifen parallel auf die Felge hinunter. „Jetz, Gerdi löschen“, die Gerdi lief nun um das Rad herum und goss das Wasser auf das heiße Eisen, sodass es verdampfte, zischte, der Eisenreifen sich wieder abkühlte und um die Holzfelge zusammenzog. „Fertich, Gerdi lauf zu Gäßner und hol uns n‘ Krug Bier. Wie heischte eijentlich, das war ja ne‘ schnelle Arbeit. Wo haste denn das g‘ lernt?“ Werner hatte bisher noch keinen zusammenhängenden Satz gesagt und auch der Schmied war richtig maulfaul in seine Arbeit vertieft gewesen. Das fiel beiden erst jetzt auf, sie schauten sich an und lächelten. „Ich bin der Werner“, meinte er zurückfallend, in seine langsame gedehnte Sprechweise, „Mir hatte ins Dorf wo ich herkomm kein Schmied und och keenen Stellmacha nich. Da musste ma alles Zeugs selba mache“, meinte er ausweichend, denn dass er das Handwerk gelernt hatte, wollte er noch nicht verraten. „Ja, aba manches Zeugs kann ma nich lerne, das muss ma habe.“ „Ja, so isses“, meinte der Ochsenwerner. „Na denn proscht“, sagte die Gerdi, die inzwischen zurückgekommen war, reichte ihrem Vater den Bierkrug und der machte dann die Runde. „Was bin ich dir schuldig?“, fragte Werner. „Na“, meinte Gustav, „weil du so toll geholfen hast, 5 Mark, isses so recht?“. „Ja danke und auch für die schnelle Hilfe“. Danach verabschiedete sich die Gerdi von den anderen, mit der Bemerkung, dass sie noch die Wäsche aufhängen muss. Als er ihr den Korb abgeladen hatte und sie allein waren, vergewisserte er sich, weil er sicher sein wollte, dass sie auch kam. „Also dann bis noacheer“, „Ja. ich bring noch meine Freundin mit“. Ein bisschen hatte er wohl doch „Feuer gefangen“, denn nun hatte er auch ihr familiäres Umfeld kennengelernt und überdachte seine persönliche Situation. Er kam aus einer armen, kleinen Leinen-Weberfamilie und wollte raus, aus der Enge und der ewigen Schufterei zwischen Webstuhl und Schergestell. Nach den vier Jahren, wo er in der Lehre in einer Stellmacher-Schmiede, nur für Kost und Logis geschuftet hatte, wurde er entlassen, weil der Meister angeblich keine Arbeit mehr für ihn hatte, denn ab jetzt hätte er ihn bezahlen müssen. Der wollte nur einen neuen Stift einstellen, weil das billiger war, als einen Gesellen zu bezahlen. Da kam es ihm gelegen, dass gerade eine Fuhrwerk-Kolonne an der Werkstatt angehalten hatte, weil an den Wagen ein paar Reparaturen gemacht werden mussten. Er fragte nach und wurde zunächst für Essen und Trinken als Fuhrknecht mitgenommen. Bei ihren Fahrgeschäften, kamen sie oft auf der durch Spremberg führenden Zuckerstraße vorbei, die von Schlesien bis ins Rheinland verlief. Von dort aus verband sie Mitteldeutschland mit dem Norden Europas. Dort war die „Hanse“ zu Hause, die weltweit erste und bisher die einzige Wirtschaftsgemeinschaft, die zu großem Wohlstand und Reichtum gekommen war. Er war jetzt 25 Jahre alt und hatte durch seinen neuen Beruf halb Deutschland kennengelernt. Inzwischen hatte ihm seine Fuhrmeisterei einen ganzen Wagenzug anvertraut, eine enorme Verantwortung für einen so jungen Menschen, doch es hatte sich für ihn gelohnt, denn er verdiente sich einen schönen Batzen Geld. Eigentlich wollte er diese Arbeit noch ein Weilchen machen, dann in seinem Handwerk die Meisterprüfung ablegen und die „Herumzieherei“ aufgeben.
Das Kochsdorfer Kreuzchen
Das Sühnekreuz unter der Fichte,
Leuchtet im goldenen Abendlichte.
Ein leichter, seidener Schimmer lag,
Ruhsam über dem verlöschenden Tag.
In vulkanischer Glut zu Stein geworden,
Kam der Findling aus dem hohen Norden.
Ein namenloser Steinmetz in grauen Tagen,
Erschuf das Kreuz umwoben von Sagen.
Von grober Hand gehauen in Granit,
War Zeuge schon im Dreißigjährigen Krieg,
Heerscharen lagerten an dieser Stelle,
Labten sich an der Kochsa Quelle.
Seit langem schon das Kreuzchen zierte,
Diese Landstraße, die in die Ferne führte.
Ein Handelsweg aus der Vergangenheit,
Verband er einst Völker in uralter Zeit.
Volksmund erzählt an dieser Stätte,
Sich eine Moritat begeben hätte.
Mahnung dem Wanderer in Stein gehauen,
Auf all seinen Wegen auf Gott zu vertrauen.
Rei©Men
Als sie dann vor der Stadtmauer am Lagerfeuer saßen, kamen auch viele neugierige Stadtleute hinzu, die sich für den Wagenzug interessierten, denn man wollte sich die Neuigkeiten, welche die weitgereisten Fuhrleute mitbrachten, nicht entgehen lassen. Gerdis Mutter war eine herzensgute Seele, ein Familienmensch, wie der Volksmund sagt und hatte Bedenken angemeldet ihre Tochter ohne „Anstandswauwau“ zu der fremden, verwilderten Männerschar gehen zu lassen, denn „anständige“ Frauen setzten sich nicht einfach so zu umherziehenden Fuhrknechten. Sie instruierte sie noch einmal bezüglich der möglichen Gefahren im Umgang mit den sexuell ausgehungerten Männern, die monatelang durch die deutschen Lande zogen und sich selten länger, als einen Tag lang in den Städten aufhielten. Nun hatte sie ja Werner selbst kennengelernt, er machte auf sie einen guten Eindruck, doch da konnte sich auch sie, als erfahrene Frau irren. Vorsichtshalber verlangte sie von der Tochter, ihre Freundin Emma mitzunehmen. „Lauf mal schnell rüber zu den Bartels und frag, ob sie mitgehen würde.“ Gerda überlegte nicht lange, denn sie wusste, dass sich auch ihre Mutter gegenüber dem Vater, in dieser Angelegenheit verantworten musste. Er war zwar ein gutmütiger Mensch, doch wenn es um seine Tochter ging, die im heiratsfähigen Alter war, passte er auf wie ein Luchs, wenn sich einer an sie heranmachen wollte. Außerdem hätte er es gern gesehen, wenn sie ihm einen Nachfolger für seinen Betrieb ins Haus gebracht hätte, denn, dass es mit dem Altgesellen nichts würde, hatte er inzwischen wohl eingesehen. Deshalb ging er, wie es seine Gewohnheit war, vor dem Abendessen noch eine Runde an der Spree entlang und kam natürlich bei den Fuhrleuten vorbei. Werner sah ihn kommen und bot ihm gleich ein Bier an, dass man aus der Stadt für den Abend herbeigeschafft hatte, denn die Fuhrleute waren immer sehr durstig und wie man weiß, hilft dagegen auf die Dauer, nur ein gewaltiger Humpen Bier. Nach dem ersten langen Zug, der die Kehle netzte, fragte Werner: „Sag ma, habta viel Arbeit inner Stadt“, in seinem Ober-Lausitzer Jargon. Gustav antwortete ausweichend: „Weißt du, von den paar kleinen Reparaturen an den Fuhrwerken, die hier durchkommen, könnten wir nicht leben.“ „Gustav, ich will ehrlich sein, von meinem Lehrbetrieb wurde ich entlassen, als ich ausgelernt hatte. Als Lehrling war ich dem Meister und seiner Familie als billige Arbeitskraft gut genug zum Werkstatt aufräumen und für die schweren Schläge mit dem Schmiedehammer, wenn es darum ging Eisen in Stahl zu verwandeln. Der Meisterin musste ich auf dem Acker helfen und am Sonntag noch die Schuhe der ganzen Familie putzen. Für all das bekam ich nur das Essen und einen Schlafplatz. Nicht einmal für meine Kleidung wollten sie aufkommen, die mussten noch meine Eltern bezahlen. Nur an Weihnachten gab man mir dann ein kleines Trinkgeld. Jetzt hat er wieder einen neuen nützlichen Idioten, der ihn nichts kostet. Seit sieben Jahren bin ich jetzt unterwegs und überlege, wie es weitergehen soll.“ Bevor Gustav antworten konnte, tauchten Gerda und Emma auf. Als sie Gustav am Feuer sitzen sahen, drehten sie sich auf dem Absatz um und wollten unauffällig verschwinden. Doch Werner hatte die beiden auch bemerkt und sprang ihnen hinterher. Es gab eine kurze Diskussion, dann kamen sie alle drei zurück ans Feuer. Gustav, ich hab‘ deine Tochter, ä‘ und ihre Freundin einjeladn sich herzusetzn, du hascht doch wohl nix dagejen?“ Sie hatten über ein paar Steine, zum Sitzen Bohlen rund um das Feuer gelegt und Werner bat nun die Mädchen sich niederzusetzen. „Mutter sucht dich scho, se meint s‘ esse wer fertich“, sagte Gerda zu ihrem Vater. „Und du, magscht heut nix esse?“ fragte er zurück. Gerda schaute nun hilflos zu Boden, doch Werner hatte gemerkt, dass Gustav von seiner Einladung zum Essen nichts wusste und sprang ein: „Gustaf, se kenne bei uns da esse, ich hab‘ genug Brot und Fleisch hole lasse.“ „Also gut Werna, i lass de Mädels in deine Obhut zurück und umme zehne kommese heim.“ „Da hoam wa mindestens drei Stunde zum Amüsiere Zeit“, stellte Emma fest, als Gustav gegangen war und die beiden kicherten, wie es junge Mädchen tun, wenn sie etwas vorhaben, was die Alten nicht gern sehen. „Hascht du schon moal eenen jeküsst?“ fragte Emma weiter. Gerda lief rot an und wusste nicht, was sie erwidern sollte. Dann sagte sie: „Also nich richtich, das wa mehr so en rumprobiere, keener traute sich richtich.“ Emma lachte lauthals auf: „Was, du hascht noch nie mit nem‘ Kerl rumgemacht, dat globich nich?“ „Ne, da muss schon der richtige komm.“ „Und der Werner gefällt dir?“ „Ja schon, aba ich wees nich, oppa och will?“ „Mensch, dann mach da doch enfach annen rann. Denn setzta enfach neben den und denn rücksten immer näher uff de Pelle“, gab Emma weitere Ratschläge. „Und wenna nich will.“ „Da machste ihm een pa Komplimente, weeste, stell da nich so an. Da sachste: ‚Du hast so scheene Ogenbraun‘ und steichst ihn mal sachte übas Haar. Wat meenste denn, warum ma dir enjelade hat, der iss scharf uff dir?“
Maiandacht
Der Wonnemonat hat sich viel Schönes ausgedacht,
Grün erschlägt uns in Auen und Fluren über Nacht,
wohin sich staunendes Auge auch bewundernd wendet,
der Frühlingmaler hat das triste Wintergrau beendet.
Bienen summen, Sonnenflirren, Grillen zirpen,
Bächlein plätschern lustvoll durch den Wiesenrain,
Lerchen hoch in den Lüften miteinander flirten,
warte, bald schon wird bei ihnen Hochzeit sein.
Wiesen und Äcker atmen betörenden Maienduft,
Hochgefühle laden uns zum Verweilen ein,
Frühlingsluft, Lebenserwachen, neue Liebeslust,
verzaubern, Mensch wie musst du glücklich sein.
Rei©Men
Nach dem ausgiebigen Essen mit den Fuhrknechten, die ihren beträchtlichen Hunger stillten, hatten sich weitere Bürger aus der Stadt und auch ein paar ledige Frauen am Feuer eingefunden, die mit ihnen herumschäkerten und offensichtlich noch Appetit auf eine „Nachspeise“ hatten. Emma hatte sich gleich den hübschesten und offensichtlich unerfahrensten jungen Burschen, mindestens im Umgang mit Frauen geschnappt und man sah, dass sich da etwas anbahnte, dass so nicht geplant war. Doch der Wonnemonat Mai, ließ nicht nur das Gras sprießen, sondern auch die Herzen der Menschen und die Blumen auf den Wiesen erblühen. Gerdas Sorgen hatten sich schon ganz am Anfang zerstreut, denn Werner kannte ja seine Fuhrknechte, die immer auf ein amouröses Abenteuer aus waren und hielt demonstrativ seine Hand über Gerda, die allen signalisierte, ‚Das hier ist mein Revier‘ und ich bin der Platzhirsch. Doch entgegen allen Erwartungen Gerdas, sah er sie nicht einmal an, sondern unterhielt sich leise mit ihr, erzählte, wo er herkam, berichtete von den Verhältnissen, die in Nieder-Schlesien bei den armen Webern herrschten und wie sie versuchten sich mit ihren Familien am Leben zu erhalten. Beschrieb ihr ausführlich seine Kindheit und Jugendjahre, wo er tagtäglich 10 Stunden beim Spinnen und Weben mit der ganzen Familie schuften musste, um den Lebensunterhalt zu sichern. Dann kam seine Schmiede- und die Stellmacherlehre, die ihn zum Mann gemacht hatte und der er seine heutige Statur verdankte. Dabei schaute er sie immer ziemlich ergeben an, so wie – wenn man sich etwas Wunderschönes wünscht, das Geschenk aber in weiter Ferne liegt, für ihn unerreichbar war und er nicht hoffen durfte, es jemals zu bekommen. „Weißt du Gerda, ich überleg‘ schon lang mit dere Fuhrwerkerei ufzuhöre und sesshaft zu werde. Aba da müsst ich wieda für andere schuffte und dat will ich nich mehr“. Gerda hatte lange zugehört, ohne etwas zu sagen, es folgte eine lange Pause, in der sie sich nur ansahen. Dann löste sich die Spannung und ein unsichtbarer Funken sprang über, der sie unvermittelt wie ein Blitz getroffen hatte. Sie fragte ihn ziemlich schüchtern, ob er sie nachhause bringen würde, denn es war nun schon ziemlich spät geworden. Ein kurzes, glückliches Lächeln überzog sein struppiges Gesicht mit seinem Dreitagebart. Er nahm sie an der Hand, zog sie zu sich hoch, legte seinen Arm um ihre Hüfte und dann gingen sie, ohne ein weiteres Wort zu wechseln, im stillen Einverständnis „des mit ihnen Geschehenen“ in Richtung Töpfergasse. Im dunklen Hauswinkel bekam Gerda dann den ersten richtigen Kuss ihres jungen Lebens. „Du“, sagte er, „wir müssen morgen früh weiter, willste uff mich warten, ich bin in een paar Wochen wieda hier und such ma ne Arbeit.“ „Du“, sagte sie, „ich kann ja ma mit Vata reden, der wees schon lange nich mehr wie er mit de Arbeit rumkomme soll und nu wirta ja och langsam älta.“ Ein zu langer Abschiedskuss folgte und das war nicht nur ein Kuss, sondern ein Versprechen, dass sie sich gaben. Es war wie eine Verlobung nur ohne Ringe. Am nächsten Morgen entschlüpfte sie schnell noch mal der elterlichen Aufsicht, um sich von Werner zu verabschieden. Der fiel nicht nur für sie tränenreich aus, eine kleine Strecke gingen sie noch händchenhaltend nebeneinander her, denn auch Werner zeigte Gefühle. Endlich ließ er sie los, drehte sich dann noch mehrmals nach ihr um und winkte ihr zu, doch dann verschwanden die Fuhrwerke endgültig in der Gartenstraße und in Richtung Kochsdorf aus ihrem Sichtfeld. Als sie nachhause kam, beichtete sie ihrer Mutter ihre Erlebnisse und berichtete ihr von der kleinen Flamme, der ersten zarten Liebe ihres Lebens, von der der Dichter Friedrich Schiller in den schönsten Fersen reimt:
O! zarte Sehnsucht, süßes Hoffen,
Der ersten Liebe goldne Zeit,
Das Auge sieht den Himmel offen,
Es schwelgt das Herz in Seligkeit,
O! daß sie ewig grünen bliebe,
Die schöne Zeit der jungen Liebe!
Kapitel 04 -Leonore Hortense-
Florian Bethke der Feldscher von Graf Harald, war zudem auch Apotheker und kannte sich mit der Herstellung von Arzneien, Gewürzen und Spirituosen bestens aus. Er hatte das herumziehen von Schlacht zu Schlacht, die angeblich alle geschlagen werden mussten, endgültig satt und wollte sesshaft werden. Außerdem hatte er sich in das hübsche Fräulein Leonore Hortense Mahlmann verguckt, eine Tochter des Mühlenbesitzers Otto Mahlmann, der an der oberen Spreespitze, genau da wo sich die Spree in zwei Arme teilte, eine Wassermühle betrieb. Warum sie das tat, wird wohl für ewig ihr Geheimnis bleiben, denn es gab eigentlich keinen Grund plötzlich von der geraden Flusslinie abzuweichen und nahezu winkelrecht nach rechts abzubiegen, um dann gegen die Abhänge des Georgenberges zu stoßen, denn dort gab es keinen Durchlass oder einen Weg, den die Spree weiter hätte talwärts fließen lassen können. Deshalb floss sie an der Straße nach Slamen im engen Bogen wieder nach links, dann unterhalb des Georgenberges in Richtung Forster-Straße und weiter ins Veilchental, wo sie sich dann wieder mit ihrer Schwester vereinigte. Sie hatte auf der relativ kurzen Strecke bestimmt eingesehen, dass man sich auf dem Wege zum Meer besser vereint durchschlagen sollte. Doch die Wege des Wassers sind geheimnisvoll und nach Jahrmillionen, da sie sich von den Bergen kommend, auf ihrem Lauf ein Urstromtal schaffend, immer tiefer eingruben und nicht mehr nachvollziehbar, die Landschaften prägten. Diese Zeugnisse des in Äonen immer wieder Leben schaffenden Urstromtales der Spree für Millionen Individuen, wird wohl für ewig ein Geheimnis von Mutter Natur bleiben. Durchziehende Ureinwohner dieser Epoche, sahen jedoch genügend Gründe, sich auf der Spreeinsel niederzulassen, denn hier waren sie vor vagabundierenden Abenteurer-Gruppen relativ sicher, denn die mussten die Wassermassen erst einmal überwinden, um in die Ansiedlung zu kommen.
Die Hauptspree fließt aus der Mitte des Bildes fast geradeaus mitten durch die Stadt. Die Abzweigung der kleinen Spree nach rechts, ist deutlich sichtbar, ebenso die Wiedervereinigung im Norden der Stadt und der Marktplatz. Quelle: Stadtarchiv
Lebensquell
Aus dem Wasser kommt das Leben!
Dunst steigt hinauf zu Himmelshöhen,
Wetter und Wind die Wolken bewegen,
reinigen Land und Luft mit dem Regen.
Vor grauer Zeit begann sein Werden,
im tiefen, kühlen Grund der Erden.
Aus rauer Kluft da springet silberhell,
hervor, ein lieblich zarter Bergesquell.
Labt und tränket manches Lebewesen,
Rinnsal um Rinnsal zum Bache streben,
viele Flüsschen zum Flusse werden,
Ströme fließen den Meeren entgegen.
Pflanzen und Tiere den Lebensquell hegen,
doch wir Menschen erkennen nicht den Segen,
den Mutter Natur mit dem Wasser gegeben.
sonst würden wir es wie ein Heiligtum pflegen.
Rei©Men
Was aus diesen Urzeiten erhalten geblieben ist, hat wohl auch das Wort „Grenze“ geprägt und diese Grenzen sind es, welche die Menschheit trennend entzweien und bis in unsere Tage immer wieder zu Zwistigkeiten und zu Kriegen führen.
Die Genehmigung des Landesherrn, Friedrich Wilhelm des IV, hatte er aufgrund seiner Verdienste erhalten. Nun suchte er in seiner Heimatstadt Spremberg nach einem geeigneten Standort zur Errichtung eines entsprechenden Hauses. An die Häuser des Marktplatzes anschließend und hinten mit dem Blick über die Stadtmauer auf den Georgenberg, fand und kaufte er ein brachliegendes Grundstück, dass nach den Wirren der napoleonischen und dem Deutsch-Dänischen und der österreichischen Kriege um 1866 nicht wieder bebaut worden war, nachdem durchziehende Truppen das Gebäude bei einem Streit nach einem Saufgelage aus Unachtsamkeit angezündet hatten. Herr und Frau Nowka, die Nachbarn zum Marktplatz hin, hatten die Ruine den Vorbesitzern abgekauft und benutzten das hintere zur kleinen Spree sich hinziehende Grundstück als Garten, der sich bis an die Stadtmauer zur kleinen Spree hinzog und nun etwas verwildert aussah, weil sich anscheinend niemand richtig darum kümmerte. Als diese beiden Voraussetzungen geschaffen waren, wollte er als Nächstes um seine Herzdame werben. Mit dem Vater, dem Müller Mahlmann, war er schon übereingekommen, wie hoch die Mitgift sein würde, das war eine weitere Grundlage seines Planes, sich hier als Apotheker niederzulassen, denn ohne diese flüssigen Mittel konnte er den Apotheken-Neubau nicht stemmen. Sinnigerweise passte wohl nicht rein zufällig der Name Mahlmann zu dem reichen Mühlenbesitzer, weil es erst wieder weiter flussabwärts eine andere Mühle gab. Der Landesherr hatte außerdem verfügt, dass sich kein weiterer Apotheker, Zuckerbäcker, Gewürzkrämer, Destillierer und oder dergleichen Gewerbetreibender, in der Stadt niederlassen durfte. Ausgenommen waren die öffentlichen Jahrmärkte, wo sich allweil Bänkelsänger, Gaukler, Barbiere und sonstige Scharlatane breitmachten. Mit dieser Anordnung wollte der Landesherr wohl sicherstellen, dass die Bevölkerung so gut wie möglich und von einem erprobten Fachmann, medikamentös versorgt wird. Auch die ortsansässigen Ärzte waren glücklich, dass es in der aufstrebenden Tuchmacherstadt, nun bald einen richtigen „Pillendreher“ geben würde, der sein Handwerk verstand, denn bisher waren sie gezwungen gewesen, die Arzneien selber herzustellen oder von weither kommen zu lassen.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, lag die medizinische Versorgung der Spremberger Bevölkerung noch im Argen und wurde von Barbieren, Feldscheren und Kurfuschern, betrieben. Die Bevölkerung war nicht bereit die hohen Honorare der Ärzte zu bezahlen und überließ die Kranken eher den Pfuschern, die den studierten Ärzten Konkurrenz machten, sodass die im Markgräflichen Amt um eine Gehaltserhöhung bitten mussten, weil sie von ihren Einkommen nicht leben konnten.