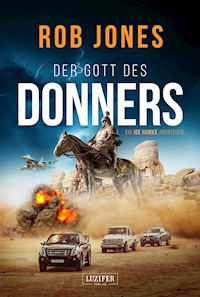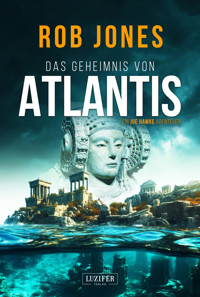Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe Hawke
- Sprache: Deutsch
Trotz der furchtbaren Verluste, die das ECHO-Team während der Suche nach Atlantis hinnehmen musste, bleibt ihnen keine Zeit zu trauern. Ein lange verloren geglaubtes Artefakt, welches mit einem verschollenen Schatz der Inka in Verbindung steht, wurde vor der Küste Kolumbiens entdeckt. Während Sir Richard Eden, der Leiter des ECHO-Teams, noch im Koma liegt, Ryan Bale als vermisst gilt und ihr Inselrefugium in Trümmern liegt, muss Joe Hawke ein erschöpftes und dezimiertes Team gegen einen Feind anführen, der einen der größten Schätze auf Erden an sich reißen will … und noch etwas sehr viel gefährlicheres, das seit Jahrhunderten mit ihm in Zusammenhang steht. Von Cartagena über die Seitenstraßen Limas, von Machu Picchu bis zu erloschenen peruanischen Vulkanen und noch viel weiter ist es nur die Freundschaft, welche Hawke und seinem Team die Kraft gibt, gegen das drohende Ende der Welt anzukämpfen … Atemlose Action, verknüpft mit mythologischen Themen, und ein gehöriger Schuss Humor machen Rob Jones' Schatzjägerreihe zu einem absoluten Geheimtipp für Fans von James Rollins, Andy McDermott oder Clive Cussler.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
DIE VERGESSENE STADT DER INKA
Joe Hawke Abenteuer – Band 8
Rob Jones
übersetzt von Madeleine Seither
This Translation is published by arrangement with Rob Jones.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Für R
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: THE LOST CITY Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Madeleine Seither
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-897-3
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
Während sich die gleißende tropische Sonne rasch in Richtung Westen bewegte, hob sich Capitán General José Fernández de Santillán der spanischen Galeone San José ein Fernrohr ans Auge und betrachtete den Horizont mit einem wachsenden Gefühl der Furcht. Er wusste, dass sich die Briten im Bereich vor der Küste Cartagenas aufhielten, in einem Geschwader unter dem Kommando des verwegenen Engländers Charles Wagner segelten, aber wo genau blieb ein Geheimnis.
Was sie wollten, war jedoch kein Geheimnis.
Das Gold.
Doch die Briten hatten kein Recht darauf, weil die Spanier es zuerst entdeckt hatten. Sie hatten mit den Inkas darum gekämpft und gewonnen. Die Reichtümer, die er über die Meere nach Spanien transportierte, war nicht für die britische Schatzkammer gedacht. König Philipp V. hatte das sehr deutlich kundgetan. Santillán hatte Gerüchte über den depressiven König und dessen Neigung, allnächtlich vom italienischen Kastraten Farinelli in den Schlaf gesungen zu werden, gehört, doch während das auf den Hof beschränktes Hörensagen war, könnten die Befehle rund um den Schatz kaum deutlicher sein. Er sollte mit dem verlorenen Schatz der Inkas im Laderaum nach Spanien zurückkehren, so schnell die vorherrschenden Westwinde die San José tragen konnten. Und keine Fehler.
Und dann sah er sie, direkt auf seine Flottille zusegeln. Er nahm das Fernrohr weg, um sich das Auge zu reiben, dann richtete er es wieder auf die fremden Schiffe am dunstigen Horizont. Kurz fragte er sich, ob Wagner seine Strategie geändert hatte und sich darauf vorbereitete, seine Schiffe zu wenden, doch dann wurde klar, dass sie sich nur in Gefechtsposition begaben und sich seiner Flottille näherten, so schnell der Wind sie trug.
Capitán de Corbeta Martinez de Medina stellte sich neben ihn und hoffte, sein Gesicht spiegelte die Angst, die er im Bauch aufsteigen spürte, nicht wider. »Wie lange noch, Capitán?«
»Wir hätten früher in See stechen sollen«, sagte Santillán ruhig. Er war sich bewusst, dass die Augen und Ohren seiner Mannschaft heute schärfer denn je wären.
Er steckte das Messingfernrohr ein und ging zu den Stufen zum Vorschiff. Er wollte seinen Männern zeigen, wie ein gelassener, besonnener Kommandant mit Feindeinwirkung zur See umging, aber innerlich war er nicht so sicher. Die Briten genossen einen grimmigen Ruf auf See, ein Erbe der jahrhundertelangen Dominanz der English Royal Navy. Nun griffen sie ihn en masse an, und es war Zeit, zu handeln, sonst würde er alles verlieren, vom Gold bis zu seinem Ruf, und vielleicht sogar sein Leben.
»Teilt die Flotte auf!«, befahl Santillán. Der Wellengang nahm so schnell zu, wie die Lücke zwischen ihm und den Briten kleiner wurde.
Der Korvettenkapitän sah in nervös an. »Ist das klug, Capitán?«
»Folgen Sie meinem Befehl, Kommandant«, blaffte der Kapitän. Kurz darauf war der Anweisung gehorcht und vom Steuermann Folge geleistet worden. Santillán sah mit steinernem, ungerührtem Blick zu, wie sich die kleine Galeonsflottille im schwül-heißen Ozean teilte und sich in eine Defensivposition auffächerte.
Die Flotte zu teilen war eine fragwürdige Taktik, aber Santillán wusste, dass viele seiner Schiffe bis zum Rand mit dem Inka-Schatz beladen und die Briten ihnen überlegen waren. Selbst wenn sie eine Niederlage erlitten, könnte so wenigstens ein Teil der Schatzflotte entkommen, und vielleicht hätte ein kleiner Teil des verlorenen Inkagolds eine bessere Chance, nach Madrid zu gelangen.
Bruder Lorenzo eilte zum Kapitän. Sein Gesicht war ein Durcheinander aus gequälter Unsicherheit. »Sie dürfen nicht zulassen, dass sie den Schatz bekommen, Capitán!«
»Das habe ich nicht vor, Bruder. Gehen Sie jetzt besser unter Deck, bevor ihnen eine Kanonenkugel den Kopf abschießt.« Er wandte sich von dem religiösen Mann ab und rief einen weiteren Befehl, als die britischen Schiffe in Reichweite kamen. »Bringen Sie uns auf Gegenkurs, Steuermann! Wir schießen auf ihr Heck und reißen sie so auf. Am Hintern sind die Planken am dünnsten.«
Bevor er den Schießbefehl geben konnte, kamen ihm die Briten zuvor und feuerten mit aller Macht und Gewalt. Ihre Kanonenkugeln flogen durch die Luft und trafen die San Joaquín, eines der spanischen Schiffe steuerbordseitig von ihnen, trennten die Spitze ihres Fockmasts sauber ab und rissen die Takelage in Fetzen. An Deck drängten sich die Männer im Versuch, das Feuer einzudämmen und das Schiff zu kontrollieren, aber Capitán Villanueva schaffte es, zu wenden und in die aufziehende Dämmerung zu fliehen.
Das erfreute Santillán, und jetzt waren sie an der Reihe. »Feuer!«, rief er und hielt sich fest, als die mächtigen Kanonen unter ihm ihre Rache über die tropischen Wellen verschossen. Im nächsten Moment krachten sie steuerbordseitig in den Bug eines der britischen Schiffe.
Ruhig hielt sich Santillán das Fernrohr ans Auge und betrachtete das Chaos auf dem britischen Deck mit Vergnügen, doch die Heiterkeit verging ihm schnell, als er sah, wie sie eine neue Salve abfeuerten. Zuerst kamen das Blitzen der Kanonen und das Aufsteigen von Rauch, und dann, eine Sekunde später, das Brüllen, tief wie Donner. Das Geräusch raste über den Ozean und traf seine Ohren.
Und dann trafen die Kanonenkugeln ein anderes Schiff der spanischen Flottille, krachten in sein Heck und machten Kleinholz aus den Offiziersquartieren. Die Verwüstung regnete als Wolke aus Gischt und Rauch aufs Wasser herunter, und Männer auf Deck bemühten sich hektisch darum, die Feuer zu löschen. Gleich darauf schossen die Briten eine weitere Salve ab. Dieses Mal schlug sie direkt unter der Backbordklüse ein Loch ins Vorderdeck. Im nächsten Moment folgte eine gewaltige Explosion, die das Vorderdeck in die Luft fliegen ließ und den Bug abriss.
»Sie haben das Munitionslager getroffen!«, sagte Santillán, dessen Mundwinkel sich nach unten zogen. Achtlos wischte er sich mit dem Seidenärmel seines Hemdes den Schweiß von der Stirn und machte einen Schritt rückwärts zum Ruder. »Wir müssen ihnen sofort zu Hilfe kommen!«
Ringsumher krachten jetzt Kanonenkugeln in ihre Schiffe und gingen in gewaltigen Feuerbällen auf. Ein unsicherer Ausdruck überkam Capitán de Corbeta Martinez de Medinas Gesicht. »Die Briten sind uns massiv überlegen, Capitán. Und wie es aussieht, wollen sie uns entern!«
Santillán wandte sich ihm zu und hob die Stimme. »Wir haben Männer im Wasser, also halten Sie den Mund, Mann! Wenn Sie auch nur einen Moment glauben, dass ich sie im Stich …«
Ehe er seinen Satz aussprechen konnte, ertönte eine tiefe, furchterregende Explosion unter ihrem Deck und schien sogar das Meer um sie herum zum Erzittern zu bringen. »Oh mein Gott!«, sagte Santillán. »Sie haben das Schießpulverlager getroffen!« In der nächsten Sekunde wurde die Galeone von einem gewaltigen Feuerball verschlungen. Überall quoll Rauch auf, und die Flammen der Explosion leckten am Hauptmast hinauf und hatten das Leersegel in Brand gesteckt. Es war ein wahres Schlachtfeld. Santillán keuchte, als er den Albtraum betrachtete, der sich vor ihm abspielte, unter seinem Kommando.
Ein junger Offizier kam zu ihm gerannt, atemlos, und die Panik stand ihm deutlich ins teerverschmierte Gesicht geschrieben. »Capitán, wir nehmen Wasser auf.«
Einen Moment lang starrte Santillán ihn an. Dann begann die San José, schwer nach Backbord zu krängen. Er wandte sich an Medina. »Geben Sie Befehl. Alle Mann von Bord!«
»Ja, Capitán!«
Während der Kommandant den Matrosen befahl, die Ruderboote und die Pinasse vorzubereiten und die Männer von Bord gehen zu lassen, kam Bruder Lorenzo zu ihm getrabt. Er rang die Hände, und sein rundes, verschwitztes Gesicht war eine Studie verwirrter Panik.
»Was ist, Bruder?«
»Sie haben die Männer von Bord befohlen!«
»In der Tat.«
»Aber was ist mit dem Schatz, Capitán?«
»Der Schatz wird zum Meeresboden sinken und nur die Haie bereichern, Bruder. Und wenn Sie nicht in eins der Ruderboote steigen, werden Sie sich dazugesellen.«
»Aber Capitán! Der König hat der Kirche einen großen Teil dieses Schatzes versprochen!«
»Dann mag der König zum Meeresgrund schwimmen und ihn persönlich holen!«
Zwischen dem schnellen Herannahen der Briten und dem langsamen Versinken der San José im warmen Wasser der Karibischen See, wanderte Santilláns Blick über das brennende Schlachtfeld des mitsamt dem Inkagold untergehenden Schiffes. Einen Moment lang fragte er sich, ob dieser Schatz je geborgen würde, dann hob er den Blick zum Himmel und sprach ein stilles Gebet.
Kapitel 1
Cartagena – Gegenwart
Die kolumbianische Sonne brannte ohne Gnade auf die alte Kolonialstadt herab. Sie war 1533 von den Spaniern gegründet worden, die sie nach Cartagena benannt hatten, und die kleine Bucht war seit fünftausend Jahren ein sicherer Ort für Menschen. Heute war die Hafenstadt ein geschäftiger Ort, der hauptsächlich vom Tourismus am Leben erhalten wurde.
Das Museo Naval Del Caribe, oder Marinemuseum der Karibik, versteckte sich in der Altstadt Cartagenas, weit hinter den Stadtmauern aus dem sechzehnten Jahrhundert. Cartagena war eine der schönsten Kolonialstädte in ganz Lateinamerika, aber dem Mann mit der Totenkopfmaske, der auf dem Vordersitz eines uralten Hyundai-Kleintransporters durch die drückende Luftfeuchtigkeit der Hintergassen der Altstadt rumpelte, war all das egal.
»Wir sind fast da«, sagte er und schob ein neues Magazin in seine Heckler & Koch MP5. »Zieht die verdammten Masken runter.«
Die anderen beiden Männer gehorchten, und kurz darauf, als sie um die letzte Kurve fuhren und gegenüber dem Museum anhielten, waren ihre Gesichter von gruseligen Halloweenmasken verdeckt.
»Kein Wachpersonal bei der Tür«, sagte der Mann mit der Frankensteinmaske.
Der dritte Mann, der eine Scream-Ghostface-Maske trug, wandte sich an Totenkopf. »Genau, wie Sie vermutet haben, Boss.«
Totenkopf auf dem Vordersitz betrachtete die Straße vor sich, dann überprüfte er mittels des Spiegels den Bereich hinter ihnen. »Nicht vergessen, rein und wieder raus«, sagte er und ließ damit keinen Spielraum für spätere Ausflüchte. »Dann bringen wir das Objekt zum Syrer und sehen weiter, klar?«
»Und Sie denken, man kann dem Syrer trauen?«, fragte Frankenstein.
Totenkopf antwortete nicht sofort. In Wahrheit hatte er keine Ahnung. Der Syrer war zu ihm gekommen, nicht andersherum. Er hatte eloquent von seinem Lebenstraum gesprochen und ihm versichert, dass er die Manpower liefern konnte, die man brauchte, um eine solch anspruchsvolle Aufgabe zu verwirklichen.
Der Syrer hatte durch Totenkopfs Beteiligung an früheren Museumsüberfällen und anderen Rauben von ihm gehört. Er wusste jetzt, hatte er geduldig erklärt, wo es mehr Gold und Schätze als sonst wo auf der Welt gab. Mehr Edelsteine als sich ein Mann in seinen wildesten Träumen ausmalen konnte.
Totenkopf hatte zugehört und an den passenden Stellen genickt. Er hatte alle richtigen Schlagworte gehört, Inka, verlorener Schatz, Gold, Smaragde, und dann einige Worte, die ihn beunruhigten: Hisbollah, Freiheitskämpfer, Rache … Aber der Syrer hatte das überzeugende Argument vorgebracht, dass sie nur gemeinsam in der Lage waren, den Schatz zu finden, und er hatte sogar mit gedämpfter Stimme davon gesprochen, dass sich noch etwas viel Besseres zwischen dem verlorenen Gold versteckte. Totenkopf hatte der Partnerschaft widerstrebend zugestimmt. Wenn es ihm an einem fehlte, dann war es Manpower.
Und was Vertrauen betraf … da hielt er sich an Aesop und traute nie dem Rat eines Mannes in Schwierigkeiten. Der Syrer sah aus, als hätte er mehr Schwierigkeiten als die meisten Menschen, aber Totenkopf hatte nicht daran gerührt. Er wollte den Mann nicht mit zu vielen unverschämten Fragen vergraulen.
Er drehte sich zu Frankenstein um. »Trau nicht mal deinem eigenen Spiegelbild«, sagte er misslaunig. Dann wandte er sich an den gefesselten und geknebelten Mann auf dem Rücksitz. »Dem würdest du doch zustimmen, nicht?«
Der Mann sah Totenkopf mit Angst in den Augen an, gab aber wegen des um seinen Mund gebundenen Knebels keine Antwort. Die vielen Schläge, die er durch die Hand von Totenkopf und seinen Freunden erhalten hatte, hatten ihn gelehrt, diese Männer nicht zu reizen, und nun saß er in passiver Stille da. Er träumte davon, ihrem Griff zu entkommen, aber sein Wert für sie war zu groß, und sie ließen ihn nie aus den Augen.
Ein fester Stoß in die Rippen riss ihn aus seinem Tagtraum, und er war sich plötzlich bewusst, dass die anderen Männer jetzt über sein knebelbedingtes Unvermögen, zu antworten, lachten.
»Dachte ich mir doch, dass du zustimmen würdest«, sagte Totenkopf, drehte sich im Sitz um und schlug ihn mit dem Griff seiner Waffe bewusstlos. Er drehte sich zurück und wandte sich an die maskierten Männer. »Gehen wir.«
Totenkopf überprüfte, ob die Maske sicher saß, dann sprang er aus dem Transporter. Ihre vorherige Probe zahlte sich aus, da sie in unter dreißig Sekunden durch die Eingangshalle und oben auf der Treppe waren, und nur zwei tote Wachleute zurückließen.
Sie suchten das Obergeschoss des Museums nach einem Anzeichen der Zielperson ab, und ihre Jagd wurde verkürzt, als ihre Beute sie entdeckte und zu entkommen versuchte.
»Da ist er!«, sagte Frankenstein und zeigte auf eine Tür am Ende des Flurs. Ein Mann in einer Leinenjacke bewegte sich schnell darauf zu. »Wir brauchen ihn lebend!«
Totenkopf befahl seine Männer vor, und sie stürmten mit ihren Maschinenpistolen durch den kurzen Museumsflur. Eine Frau, auf deren Nase eine Brille balancierte, öffnete die Tür, um nachzusehen, was all das Theater sollte, überlegte es sich aber anders, als sie die Waffen sah, und verschwand wieder in ihrem Büro.
***
Héctor Barrera schlug die Tür zu, drehte den Schlüssel im Schloss, und lehnte sich, um Atem ringend, dicht an die Wand. Stress verschlimmerte sein Asthma, und sein Herzschlag raste jetzt mit Siebenmeilenstiefeln dahin, während sein sich sein verängstigter Verstand überschlug, um eine Möglichkeit zu finden, seinen Verfolgern zu entkommen.
Er wusste, wer sie waren, und hatte sie erwartet. Aber nicht so. Er hatte sich ein Geschäftsmeeting vorgestellt. Einen netten Plausch und eine einfache Transaktion. Ihr bekommt die Maske, und ich bekomme den mit Hundertdollarscheinen vollgestopften braunen Briefumschlag.
Nach einigen kurzen Atemzügen spürte er, wie seine Brust enger wurde, und das Geräusch seines schrillen Keuchens füllte jetzt den stillen Raum.
»Gib uns die Maske«, sagte eine Stimme auf Spanisch. Barrera fand, der Akzent klang mexikanisch, aber mit einem Hauch guatemaltekisch. Sicher war er nicht, aber der Mann war bestimmt kein Einheimischer. Dann erklang die Stimme eines anderen Mannes, diesmal auf Englisch.
»Wir wissen, dass du sie hast, alter Mann. Gib sie uns, dann lassen wir dich am Leben.«
Die zweite Stimme war rau, aber deutlicher. Niederländisch oder neuseeländisch vielleicht. Doch bevor sein Verstand weiter darüber nachdenken konnte, gab es einen Schlag gegen die Tür, und er spürte, wie sie im Rahmen bebte. Er hörte Fluchen, dann spürte er, wie jemand gegen das untere Türpaneel trat, doch das hielt stand.
»Letzte Chance, sonst machen wir es auf die harte Tour«, sagte die raue Stimme.
Wieder rasten Barreras Gedanken, während er sich anstrengte, einen Ausweg zu finden. Ihm gegenüber, in der Rückwand des Büros, war das Fenster, aber er war im zweiten Stock und es gab keine Feuerleiter. Hinter dem Glas lag nichts als ein langer Sturz auf den Asphalt und eine sehr harte Landung.
»Wer seid ihr?«, sagte er, um Zeit zu schinden. »Was wollt ihr von mir?«
»Du weißt, wer wir sind, Barrera. Halt uns nicht zum Narren. Wir wollen die Maske von der Galeone, und wir wissen, dass du sie hast.«
Ehe Barrera antworten konnte, wurde wieder geflucht, dann erklang ein Schuss. Er erschreckte sich fast zu Tode, als die Kugel das obere Türpaneel nur wenige Zentimeter von seinem Kopf entfernt durchschlug und sich in seiner Karte Kolumbiens neben dem Fenster an der Wand bohrte.
»Na schön … na schön, sie ist hier. Bitte tötet mich nicht.«
»Eine Kugel an dich verschwenden?«, sagte Totenkopf.
Die Tür öffnete sich langsam, und Totenkopf half ihr mit einem festen Fersentritt nach. Sie schlug so fest gegen die Wand, dass sie wieder zuzufallen begann und einen zweiten Tritt brauchte.
Barrera ging verängstigt rückwärts. Er drückte sich eine goldene Maske an die Brust, als würde die ihn kugelsicher machen. Zu sehen, dass sie Masken – einen Totenkopf, einen Frankenstein, und einen Geist – und Waffen trugen, entsetzte ihn.
Der vordere Mann zog seine Totenkopfmaske ab, und seine dunklen Augen richteten sich auf die funkelnde Goldmaske in den zitternden Händen des Akademikers. Er starrte das antike Artefakt an.
»Du!«, sagte Barrera.
»Wie ich sehe, hast du sie«, sagte Totenkopf.
»Es war nicht leicht, sie aus dem Tresor zu bekommen. Bitte … Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast.«
»Das stimmt«, sagte Totenkopf, während er ihm die Maske aus der Hand riss. »Du hast alles getan, was ich von dir brauche.«
Ein nervöses Lächeln umspielte Barreras bebende Lippen. »Und die Abmachung?«
»Eine Sache musst du noch für mich tun, Héctor.«
»Was immer du willst!«
Totenkopf schenkte ihm ein grimmiges Lächeln und hob die Maschinenpistole. »Stirb.«
»Nein!«
Der Schuss erklang im kleinen Büro, und Héctor Barrera stolperte rückwärts gegen seinen Schreibtisch. Er drehte sich um und versuchte, sich daran festzuhalten, um nicht umzufallen, aber es war umsonst. Der stechende Schmerz in seiner Brust und sein geminderter Blutdruck zwangen ihn auf die billigen Vinylfliesen seines Büros hinab, und dann lag er auf der Seite und starrte mit Todesqualen in die Welt hinauf.
Aus seiner neuen, seitlichen Perspektive sah er zu, wie der Mann mit der Totenkopfmaske zu ihm kam, und streckte eine zitternde Hand als letztes Flehen um sein Leben aus, doch er erhielt keine Gnade. Nur eine zweite Kugel.
»Da hast du deine mistige Abmachung«, sagte der Mann, zog die Totenkopfmaske wieder auf, und schlug die Tür hinter sich zu, während Barreras Leben in die Dunkelheit entglitt.
Kapitel 2
Elysium
Joe Hawke drehte sich um, um ein letztes Mal den Grabstein anzusehen, und schüttelte ungläubig den Kopf. Maria Kurikova war tot, und Ryan war verschollen und totgeglaubt. Hawke zog vermisst vor, weil das wenigstens Hoffnung auf sein Überleben ließ, wie gering auch immer. Weit weg, über dem Atlantik, lag ihr Anführer, Sir Richard Eden, in einem Londoner Krankenhaus im tiefen Koma. An Bord der USS Harry S. Truman hatte sich sein Zustand erheblich verschlechtert, und er war direkt nach London geflogen worden.
Um die Zerschlagung ihres Teams komplett zu machen, war Alex Reeve wegen einer Einschusswunde in der Schulter in einem Militärkrankenhaus in Washington, D.C. Einer der Männer aus dem Black Hawk war nicht zum Helikopter zurückgekommen und hatte den Raketenangriff der F18 überlebt. Er hatte versucht, Alex mit dem Sturmgewehr zu töten und sie verwundet, aber Kim Taylor hatte ihn aus der Deckung des schwarzen Rauchs, der vom Hubschrauberwrack aufstieg, mit einem Doppelschuss ausgeschaltet.
Sie hatte ihm gesagt, dass sie sowieso zurückgehen musste. Auf dem Flugzeugträger war sie von ihrem Vater wegen seiner neuen Position als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten zurückbeordert worden. Nachdem er Anfang November die Wahl gewonnen hatte, erachtete man es aus Sorge über Entführung und Erpressung nicht länger für sicher, dass seine Familie in der Weltgeschichte herumreiste.
Alex würde sich erholen und kräftiger werden, und Hawke hatte die Hoffnung, dass Richard Eden das Gleiche täte, aber was ihn wirklich fertigmachte, war Maria. Mit dem Gefühl von Ungerechtigkeit und Wut hatte er mehr zu kämpfen, als er es für jemanden mit einer so schwierigen und gewalttätigen Vergangenheit wie seiner eigenen für möglich gehalten hatte. Er hatte viele gute Freunde im Kampf sterben sehen, und noch mehr der PTBS oder der Flasche zum Opfer fallen, aber ein junges Paar so aus der Welt gehen zu sehen, war ihm an die Nieren gegangen.
Er seufzte und starrte zum Komplex hinauf, der einmal das Elysium-Hauptquartier gewesen, jetzt aber kaum mehr als eine ausgebrannte Hülle war. Er konnte sich noch immer kaum dazu bringen, zu glauben, was Alex ihnen über den Apache-Angriff und den Trupp von Spezialeinsatzkräften, die mit einem Black Hawk am Nordstrand gelandet waren, erzählt hatte. Das alles wirkte wie aus einem Albtraum. Er hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, um den Ort wieder in Schuss zu bringen, aber sie mussten es wenigstens versuchen. Es war ihr Zuhause. Wenigstens waren einige der unteren Geschosse noch intakt.
Er schlenderte vom Grab fort, nahm sein Kukri-Messer, und schärfte die nepalesische Armeewaffe weiter, schliff die Klingenkante mit einem Wetzstahl.
Lea kam herüber und setzte sich neben ihm auf die kleine Bank, einige Meter von der frisch umgegrabenen Erde entfernt. Die Irin hatte die Augen geschlossen, während die sich wiegenden Palmen über ihrem Kopf das Sonnenlicht unterbrachen und gefleckte Schatten auf ihr emotionsloses Gesicht warfen. »Was jetzt?«
»Ich geb ihn nicht auf«, sagte Hawke. »Nicht, solange ich es nicht sicher weiß.«
»Joe …«
Er sah wieder zu den Gräbern: Olivia Hart, Sophie Durand, Bradley Karlsson, Ben, Alfie, Sasha, und jetzt Maria. Die Liste wuchs. Ihr Opfer war hier im Zentrum Elysiums markiert, auf ihrer geheimen Basis, von den Palmen beschattet. Es war der einzige Bereich, der dem brutalen Angriff auf die Insel völlig unversehrt entkommen war. Hawke wollte dagegen ankämpfen, aber nun manifestierte sich der Gedanke an Ryans Grab in seinem Verstand, genau dort neben den anderen. »Nein … nicht, solange ich es nicht sicher weiß«, flüsterte er.
Er sah aufs Meer hinaus, wo Cairo Sloane auf ihrem Windsurfboard über die Wellen flitzte. Ein heller Fleck Scarlet vor dem umwerfend türkisfarbenen Ozean. Dieser Ort fühlte sich nicht mehr wie ein Paradies an.
Lea bemerkte seinen Blick, der Scarlet übers Wasser verfolgte. »Nichts scheint eine Wirkung auf sie zu haben. Zumindest nicht so, wie auf den Rest von uns.«
»Cairo Sloane gehört zu einem anderen Menschenschlag«, sagte er fast automatisch und sprach dann mit mehr Gefühl weiter. »Ohne Maria wäre ich nicht an den Dreckskerl Matheson rangekommen. Sie war diejenige, die all das für mich beleuchtet hat. Ich schulde ihr so viel, und jetzt ist sie tot.«
Lea hob eine Hand und legte sie sanft auf seinen Arm. »Es ist nicht deine Schuld, Joe.«
»Wenn nicht meine, wessen dann?«, sagte er mit lauterer Stimme, als er beabsichtigt hatte. »Ich war derjenige, der die Operation geleitet hat. Ich hab sie an diesen Ort gebracht. Sie hat meine Befehle ausgeführt, als sie getötet wurde. Genau wie mit Sophie und Olivia.«
»Wir sind keine Kinder, Joe. Wir alle kennen die Risiken. Maria war eine äußerst erfahrene FSB-Agentin. Das kannst du ihr nicht absprechen. Wenn du sagst, dass alles deine Schuld ist, dann sagst du damit nur, dass sie nicht in der Lage war, eigene Entscheidungen zu treffen.«
Hawke antwortete nicht, sondern schob ihren Arm weg und stand auf. Natürlich hatte sie recht. Maria Kurikova war kein Kind gewesen. Sie war eine höchst kompetente Agentin des russischen Geheimdienstes und ein respektiertes Mitglied des ECHO-Teams gewesen. Sie hatte gelebt, wie sie es wollte, und sie war gestorben, während sie etwas getan hatte, das sie liebte, aber nichts davon machte es Hawke und seinem gequälten Verstand leichter.
Dem Verstand, in dem sich jetzt die furchtbaren Ereignisse auf der Seastead und sein Versagen, das mysteriöse Orakel zu töten, überschlugen. Zu wissen, dass Dirk Kruger und Dragan Korać tot waren, schenkte ihm fast gar keinen Trost, wenn er bedachte, welchen Preis das Team ihr Tod gekostet hatte. Nicht einmal, dass Reaper Kamtschatka ausgeschaltet oder Maria Luk in einen so elenden, brutalen Tod geschickt hatte, vermochte es, der Welt ein Gefühl von Fairness oder Balance zu verleihen; nicht angesichts des schrecklichen Verlusts, den sie mit Ryans und Marias Tod erlitten hatten.
Maria.
Seit der nun berüchtigten Seastead-Schlacht hatte er sich leer gefühlt. Ihr Tod hatte ihn getroffen wie nichts zuvor. Er wollte sich nicht fragen, warum er so reagiert hatte, ob er vielleicht mehr als Freundschaft für sie empfunden hatte. Er wusste, dass er Lea liebte, also lag es vielleicht nur daran, dass er sich zu weit von seinen Tagen bei den Special Forces entfernte und nicht mehr so mit dem Tod umgehen konnte, wie man es ihm vor so vielen Jahren antrainiert hatte. Aber zusammen mit Liz fühlte es sich schlicht so an, als würde jemand das Messer in der Wunde drehen. Er brachte es nicht über sich, darüber nachzudenken, was passieren könnte, falls Lea je verletzt würde.
Hawke liebte Lea. Zumindest glaubte er das. Es war eine komplizierte Angelegenheit. Jedenfalls war es seit Maria Kurikova Tod eine komplizierte Angelegenheit. Und dann war da noch Alex Reeve. Er war kein Idiot. Er wusste, wie die Amerikanerin für ihn empfand, oder glaubte zumindest, es zu wissen. Wenn es darum ging, erfolgreich Signale von Frauen zu empfangen, hielt er sich gerne für einen der besten Männer, aber in Wahrheit hatte er nicht mehr Ahnung als jeder andere, und das wusste er auch. Trotzdem: Als sie gemeinsam in der Berghütte ihres Vaters in Idaho gewesen waren, war er sicher gewesen, dass sie versucht hatte, mehr als Freunde zu sein.
Lange Zeit war er still. Als er sprach, tat er das mit zusammengebissenen Zähnen. »Otmar Wolff ist so gut wie tot.«
»Falls wir ihn je wiedersehen«, sagte Lea mit einem Seufzen.
»Darauf kannst du dich verlassen«, sagte er. »Ist mir egal, wie lange es dauert. Wolff wird für alles bezahlen.«
Lexi Zhang erschien aus dem Hauptquartier und rief Lea herüber. Jemand wollte sie am Telefon sprechen. Nachdem sie aufgestanden war, küsste sie Hawke auf die Wange, bevor sie wegging.
Er sah zu, wie sie in den Schatten des zerstörten Gebäudes trat, und versuchte, die Stille zu nutzen, um eine Perspektive zu finden, aber dann kam Scarlet über den Strand auf ihn zu. Ihr Haar war vom Ozean glatt zurückgestrichen, und das Salzwasser lief an ihrem Surfanzug herunter. Hawke anlächelnd lief sie über den heißen Sand.
»Bist du sicher, dass du kein Gewicht zulegst?«, fragte sie, aber an ihrem Ton erkannte er, dass es ein halbherziger Versuch war, die Stimmung zu heben. »Sieht da unten einfach ein bisschen teigig aus.«
»Ich denke einfach ständig über all die Möglichkeiten nach, wie ich Dinge hätte anders machen können. Dann wären sie noch am Leben und vielleicht würde es sogar Rich gutgehen.«
»Dir die Schuld für Ryan und Maria zu geben ist dumm«, sagte sie ruhig. »Aber dir die Schuld für den Angriff auf die Insel zu geben ist ausgesprochen idiotisch. Was zum Teufel hättest du anders tun können, um ihn zu unterbinden? Wir wissen ja nicht mal, wer ihn ausgeführt hat.«
»Wir wissen, dass es Amerikaner waren.«
»Alex glaubt, dass es Amerikaner gewesen sein könnten, Joe. Ein großer Unterschied.«
»Es ist ein Anhaltspunkt.«
»Wenn du meinst.«
Er zögerte einen Moment, beobachtete, wie sich die Brandung am Strand brach. »Wie geht‘s Camacho momentan so?«
»Wenn du es unbedingt wissen musst, wir verstehen uns ganz gut.«
»Legt sich die große Cairo Sloane endlich fest?«
»So weit würde ich nicht gehen, Schätzchen. Sagen wir einfach, ich kann eine Zukunft für mich sehen, die ohne …«
»Saufen, rauchen und kämpfen auskommt?«
»Ich wollte ohne Einsamkeit sagen, wenn du es unbedingt wissen musst.«
»Ich freue mich für dich, Cairo. Das weißt du.«
»Und was ist mit dem großen Josiah Hawke?«, fragte sie schelmisch.
»Was meinst du?«
»Ziehen wir eines Tages eine Mrs. Lea Hawke in Betracht?«
Ihre Worte ließen ihn kurz innehalten. So hatte er Lea noch nie beschrieben gehört … mit seinem eigenen Namen. Er hatte die Namen noch nie gedanklich zusammengebracht, und es klang merkwürdig. Es brachte Erinnerungen an seine erste Frau und ihren Hochzeitstag zurück.
»Also, wenn du es unbedingt wissen musst, ich …«
Er unterbrach sich, als die Sonne auf der Tür aufblitzte und Lea und Lexi aus dem ruinierten Komplex auftauchten. Reaper war einen Schritt hinter ihnen. Hawke und Scarlet sahen zu, wie sie herauskamen und zum Garten gingen.
Scarlet zündete sich eine Zigarette an. »Du kannst es mir später erzählen, Schätzchen.«
»Das war seltsam«, sagte Lea, als sie sich wieder neben Hawke setzte.
»Was war seltsam?«, fragte Scarlet und blies eine Rauchwolke auf einen Moskito, die ihn zu einer raschen Kehrtwende veranlasste.
»Das Telefonat, das ich gerade hatte. Es war jemand namens Magnus Lund.«
»Scheiße«, sagte Scarlet. »Das ist seltsam.«
Lea verdrehte die Augen und seufzte. »Wenn du mich mal ausreden lässt, dann kann ich die Seltsamkeit vernünftig erklären. Mr. Lund hat mich von einem Jet über dem Atlantik aus angerufen.«
»Nicht mal ansatzweise seltsam«, sagte Scarlet, zog an ihrer Zigarette und schob sich den Hut ins Gesicht, um die Sonne zu blockieren.
»Er ist an Bord eines Fluges von Kopenhagen nach Miami, wo er sich mit uns wegen etwas, das er als dringlich bezeichnet hat, treffen will.«
»Wissen wir überhaupt, wer dieser Kerl ist?«, sagte Hawke.
»Tun wir«, antwortete Lea mit einem breiten Grinsen, »weil er es mir gerade gesagt hat. Nachdem Rich jetzt im Krankenhaus ist, ist Magnus Lund anscheinend der Leiter des Konsortiums, dem diese Insel gehört.«
Kapitel 3
Miami
»Ich dachte, dieser Ort ist sonnig?«, sagte Hawke, als er den Regenschirm öffnete, den er am Flughafen gekauft hatte. Ringsherum wimmelte es von Menschen, während sie der Brickell Avenue folgten, bis sie die Adresse erreichten, die Lund ihnen gegeben hatte.
Sie durchquerten die Eingangshalle und nahmen den Fahrstuhl zur obersten Etage. Als die Türen leise aufglitten, enthüllten sie einen aller Dekoration beraubten Hartholzkorridor. Sie verließen den Fahrstuhl und gingen auf die einzige Tür zu. Lea klopfte sachte an die Holzpaneele.
»Herein.«
Sie betraten einen großen, lichterfüllten Raum und ließen die Opulenz auf sich wirken. Er war von postmodernem Stil und teuer dekoriert, mit abstrakter Kunst und Skulpturen, und auf dem Boden lag ein gewaltiger Oushak-Teppich. Hinter dem Schreibtisch schloss ein Mann in einem schlichten Anzug ohne Krawatte den Deckel seines Laptops und sah zu ihnen auf. Sein Gesicht war schlank, und er trug eine randlose Brille.
»Guten Tag. Bitte setzen Sie sich.«
Sie tauschten einen Blick und taten wie gebeten; jeder setzte sich in einen komfortablen Ledersessel vor dem großen Schreibtisch.
»Ich bin Magnus Lund. Möchten Sie einen Kaffee?«, fragte er.
»Nicht für mich«, sagte Scarlet und suchte verhalten nach einem Barschrank.
»Von mir aus gerne«, sagte Hawke, der versuchte, den Mann einzuschätzen.
Lea lächelte ihn an. »Ich nehme gerne einen, danke.«
Lund sprach auf Dänisch in die Gegensprechanlage auf seinem Schreibtisch, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf die fünf ECHO-Mitglieder, die ihm gegenübersaßen.
»Dann mal raus damit«, sagte Hawke.
Lund fixierte ihn ausdruckslos. »Raus womit?«
»Wer sind Sie?«, sagte Lea.
»Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass mein Name Lund ist.«
»Ja, den Teil haben wir verstanden«, sagte Hawke. »Ich meinte, wer ist das Eden-Konsortium?«
»Natürlich meinten Sie das«, sagte Lund lächelnd. »Das Eden-Konsortium wurde von Sir Richard gegründet, um die nötigen Gelder zu besorgen, um Spiel und Spaß zu betreiben, die Sie drüben in der Karibik haben.«
»Spiel und Spaß?«, sagte Hawke. »Wir haben gute Menschen verloren.«
»Ich bitte um Entschuldigung. Eine schlechte Wortwahl meinerseits. Ich wollte nur ausdrücken, dass wir eine kleine Gruppe internationaler Unterstützer mit ähnlicher Weltauffassung sind. Nach dem Angriff auf die Insel und der Klinikeinweisung Sir Richards versammelten wir uns unverzüglich, und ich habe Sie hergebeten, um Ihnen unser Beileid auszusprechen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte Hawke sarkastisch. »Aber was ist der wahre Grund dafür, dass wir hier sind?«
Lund schenkte Hawke einen nachdenklichen Blick und beugte sich näher an den Schreibtisch. Er stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und legte die nach oben gerichteten Fingerspitzen aneinander. »Wie ich sehe, sind Sie ein scharfsinniger Beobachter der menschlichen Natur, also lassen Sie mich direkt zur Sache kommen. Sir Richard liegt im Koma, aber das heißt nicht, dass wir frei haben. Vor einigen Stunden wurde ein Museum in Kolumbien von drei maskierten Männern ausgeraubt.«
»Klingt nach einem Problem«, sagte Scarlet und zündete sich, noch bevor der Satz über ihre Lippen gekommen war, eine Zigarette an.
»Ja, aber welche Art von Problem?«, fragte Reaper.
Lund lehnte sich in seinem Sessel zurück. Sein Gesicht verlor das bisschen Farbe, das es gehabt hatte. »Vielleicht erinnern Sie sich an eine Galeone, die die Kolumbianer letztes Jahr vor ihrer Küste entdeckt haben?«
Hawke nickte. »Die San José?«
Auch Lund nickte.
»Ich erinnere mich«, sagte Scarlet. »Die haben gerade eine Riesenmenge Schätze rausgeholt und in ein Museum in Cartagena gekarrt.«
»Spanende Sache«, sagte Hawke.
»Aber wo liegt das Problem?«, fragte Lea.
»Wie gesagt, das Museum wurde gerade von einer Gruppe äußerster Profis ausgeraubt.«
Hawke richtete sich in seinem Sessel auf und sah ihn scharf an. »Schatzjäger?«
»Nach Eiscreme haben sie nicht gesucht, Joe«, sagte Scarlet mit einem Seufzen.
»Wir haben keine Ahnung, wer sie sind«, sagte Lund kühl.
»Wissen Sie, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dazu durchringen kann, einen Dreck um all das zu geben«, antwortete Lea. »Nicht mehr.«
Lund sah sie eindringlich an, aber Hawke war derjenige, der antwortete. »Wir schulden es Maria, Ryan und Rich was darauf zu geben«, sagte er nachdrücklich. »Und genau das werden wir auch tun. Was ich jetzt wissen will, ist, wer hat das Museum überfallen, und warum?«
Reaper bewegte sich in seinem Sessel und grunzte unzufrieden. »Und was haben sie geklaut?«
»Das ist leicht«, sagte Lund. »Es ist nicht öffentlich bekannt, aber ich habe Kontakte. Sie haben nur einen einzigen Gegenstand gestohlen.«
Das fesselte die Aufmerksamkeit aller, selbst von Scarlet, und alle richteten den Blick auf den ernsten Dänen.
»Nur einen Gegenstand?«, sagte Hawke.
»Was für einen?«, fragte Lexi.
»Etwas, das zwischen den Schätzen des Wracks der San José gefunden wurde … eine kleine, goldene Maske.«
»Verquerer und verquerer«, sagte Lea.
»Genau meine Meinung«, stimmte Lexi zu.
Hawke stand auf. »Gibt es mehr Details über diese Maske?«