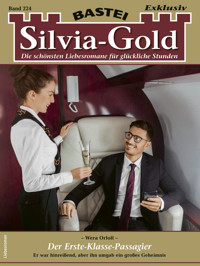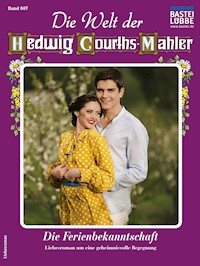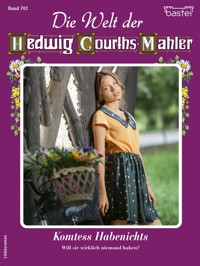
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Welt der Hedwig Courths-Mahler
- Sprache: Deutsch
Es ist nicht nur die Trauer um die verstorbene Mutter, die sie quält. Die Geschwister Lucian und Stefanie von Moosburg befürchten, dass mit dem letzten Atemzug ihrer Mutter auch jeder Hauch von Liebenswürdigkeit aus dem Haus verschwunden ist.
Und sie sollen recht behalten. Ihr Vater kümmert sich weder um das Gut noch um die Familie - das Einzige, was ihn interessiert, sind regelmäßige Trinkgelage mit seinen Freunden. Das macht ihn zum perfekten Opfer für die hinterhältige Hauswirtschafterin, die von nun an das Regiment auf Gut Moosburg übernimmt.
Als dann auch noch der Graf selbst stirbt, müssen die Komtess und ihr Bruder den traurigen Tatsachen ins Auge blicken: Gut Moosburg ist ruiniert - und die Hauswirtschafterin mit dem letzten Rest des Vermögens über alle Berge!
Der Schock sitzt tief. Die Geschwister sind obdachlos. Lucian könnte zu seiner Braut ziehen, aber seine über alles geliebte Schwester alleine zu lassen, kommt für ihn niemals infrage. Allerdings: Wo soll Stefanie jemals einen passenden Mann finden, jetzt, wo sie nur noch eine Komtess Habenichts ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Komtess Habenichts
Vorschau
Impressum
Komtess Habenichts
Will sie wirklich niemand haben?
Es ist nicht nur die Trauer um die verstorbene Mutter, die sie quält. Die Geschwister Lucian und Stefanie von Moosburg befürchten, dass mit dem letzten Atemzug ihrer Mutter auch jeder Hauch von Liebenswürdigkeit aus dem Haus verschwunden ist.
Und sie sollen recht behalten. Ihr Vater kümmert sich weder um das Gut noch um die Familie – das Einzige, was ihn interessiert, sind regelmäßige Trinkgelage mit seinen Freunden. Das macht ihn zum perfekten Opfer für die hinterhältige Hauswirtschafterin, die von nun an das Regiment auf Gut Moosburg übernimmt.
Als dann auch noch der Graf selbst stirbt, müssen die Komtess und ihr Bruder den traurigen Tatsachen ins Auge blicken: Gut Moosburg ist ruiniert – und die Hauswirtschafterin mit dem letzten Rest des Vermögens über alle Berge!
Der Schock sitzt tief. Die Geschwister sind obdachlos. Lucian könnte zu seiner Braut ziehen, aber seine über alles geliebte Schwester alleine zu lassen, kommt für ihn niemals infrage. Allerdings: Wo soll Stefanie jemals einen passenden Mann finden, jetzt, wo sie nur noch eine Komtess Habenichts ist?
»Friedrich! Wo steckt dieser Mensch bloß wieder?«
Die jammernde Stimme der alten Apollonia hallte in den hohen Korridoren des Gutshauses von Moosburg wider.
»Himmel, haben Sie mich erschreckt, Apollonia!«, flüsterte der Diener Friedrich, der soeben das Schlafzimmer des Gutsherrn für die Nacht hergerichtet hatte und jetzt auf den Flur heraustrat. »Wir sprechen seit Wochen wegen der schweren Krankheit der gnädigen Frau nur noch im Flüsterton, und jetzt machen Sie ein solches Gezeter!«
»Wo bleiben Sie denn? Sie müssen sofort ins Dorf laufen! Die Fernsprechleitung ist anscheinend durch den Sturm gestört.« Die Hände der alten Dienerin zitterten.
»Geht es der Gnädigen schlechter?«
»Ach, sehr schlecht! Sie verlangte nach dem Pfarrer. Jetzt ist sie bewusstlos. Es eilt, Friedrich, es eilt sehr!«
Das ausdruckslose Gesicht des Dieners wurde einen Schein blasser. »Es geht doch nicht etwa zu Ende, Apollonia? Was soll dann aus uns allen werden?«
»Reden Sie nicht, Friedrich! Gehen Sie lieber!«, verlangte Apollonia energisch.
Friedrich neigte stumm den Kopf und verschwand mit eiligen Schritten um die Biegung des Flurs.
Langsam stieg die Dienerin die Treppe zum ersten Stockwerk empor, wo sich die Zimmer der Gutsherrin und ihrer Tochter befanden. Dabei liefen der treuen alten Seele die Tränen über das Gesicht.
Apollonia öffnete oben die erste Tür. Sie trat ins Vorzimmer zum Schlafgemach der Hausherrin. Hier hielt sich die Pflegerin auf, wenn sie nicht am Bett der Kranken weilte. Sie kochte gerade eine Spritze aus. Die Tür zum Schlafzimmer stand halb offen.
»Hat sich die gnädige Frau beruhigt?«, fragte Apollonia leise.
»Ein wenig«, flüsterte die Schwester. »Sie ist sie wieder bei Bewusstsein, atmet aber sehr unregelmäßig. Vielleicht sagen Sie ihr, dass der Pfarrer unterwegs ist!«
Apollonia schlich auf Zehenspitzen in das nur von einer kleinen Nachtlampe erhellte Schlafzimmer. Ein abgezehrtes, bleiches Gesicht sah ihr mit glänzenden Augen entgegen.
»Hast du – ihn rufen lassen, Apollonia? Wann – wann wird er kommen?«
Das Sprechen fiel der Kranken sichtlich schwer. Man brauchte kein Arzt zu sein, um zu erkennen, dass hier der Tod zu Gast war.
»Der Pfarrer wird bald hier sein, gnädige Frau!«, log Apollonia.
Der Arzt, der seit Jahrzehnten der Hausarzt der gräflichen Familie war, saß zur Rechten des Bettes und hielt das magere Handgelenk der Kranken zwischen den Fingern. Schwach und unregelmäßig war der Puls.
Die Schwester erschien mit der Spritze. Der Arzt legte die magere Hand der Kranken behutsam auf die Bettdecke.
»Diese Injektion wird Ihnen guttun!«, sagte er. »Danach habe ich nichts mehr gegen einen Besuch Ihrer Kinder einzuwenden.«
»Geben Sie sich keine Mühe, mich zu täuschen, Doktor!«, murmelte die Kranke. »Ich – ich weiß, dass meine Zeit um ist. Nur – nur eine Stunde brauche ich. Es – es ist sehr wichtig.«
»So dürfen Sie nicht sprechen! Sie werden gesund werden und noch viel Zeit haben!«, widersprach der Arzt.
Doch alle wussten, dass er nicht die Wahrheit sagte, und die Kranke wusste es am besten.
Als sich eine leichte Röte in dem wachsbleichen Gesicht der Frau zeigte, sagte er: »Ich glaube, jetzt können wir es wagen. Holen Sie die jungen Leute, Apollonia!«
Die alte Dienerin hatte schon fast die Tür erreicht, da rief die Kranke leise: »Der Pfarrer – wo bleibt er denn? Ich muss mit ihm sprechen. Es könnte – sonst zu spät sein!«
Apollonia nickte. »Er muss gleich eintreffen.« Dann hastete sie hinaus.
Während sie draußen den Korridor entlangging, rang sie wie in geheimer Qual die Hände. Nur zu gut wusste sie, was Gräfin Theresia von Moosburg dem Pfarrer sagen wollte. Niemand außer ihr kannte das Geheimnis, von dem die Sterbende sprechen wollte.
Aber war es nicht besser, die dunklen Dinge der Vergangenheit totzuschweigen? Wem war damit gedient, wenn sie jetzt ans Tageslicht kamen? Doch einer Sterbenden soll man nicht widersprechen. Es drängte die Gutsherrin bestimmt, ihr Gewissen zu erleichtern.
Um die Ecken des großen Schlosses heulte der Wind eine schauerliche Melodie. Das ist die richtige Nacht zum Sterben, dachte Apollonia und klopfte an die Tür des Wohnzimmers im ersten Stock.
Die Gräfin ringt mit dem Tod, und der Graf befindet sich irgendwo in schlechter Gesellschaft! Was sind das für Verhältnisse!
Ähnliche Gedanken bewegten auch die beiden jungen Menschen, die sich an diesem Abend wie Schutz suchend im Wohnzimmer zusammengefunden hatten.
Der Erbe des Gutes, Lucian von Moosburg, und seine Schwester Stefanie saßen dicht beisammen. Im Kamin brannte ein Feuer.
»Glaubst du, Lucian, dass es nur wieder einer von Mutters Herzanfällen ist?«, fragte Stefanie angstvoll.
»Nein«, erwiderte Lucian fast schroff. »Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Nur ein Wunder könnte Mutter noch retten.«
Stefanies verträumte blaue Augen füllten sich mit Tränen. »Ach Gott«, flüsterte sie und presste die Hände an die Augen.
Lucian liebte seine Mutter innig. Aber er wusste, dass sie unheilbar krank war und dass jede Verlängerung ihres Lebens nur eine Fortsetzung der ständigen Schmerzen bedeutete.
»Wir können Mama nicht helfen, und ich glaube, sie sehnt selbst den Tod herbei!«, sagte er langsam. »Sie hat keine Kraft mehr zum Leben. Sie hat alle Hoffnung und allen Mut verloren.«
»Ach, Lucian, genau dasselbe habe ich auch gefühlt!«, rief Steffi.
Eine steile Falte zeigte sich auf Lucians Stirn. Er dachte an seinen Vater, der bestimmt nicht schuldlos an dem frühen Tod der Mutter war. Seine ständige Rücksichtslosigkeit und der Kummer, den ihr sein zügelloses Leben bereitete, hatten das Herz der Mutter krank werden lassen.
Stefanie ließ die Hände sinken und sah ihren Bruder an. Sie schien seine Gedanken zu lesen, denn sie schüttelte den Kopf.
»Sei nicht bitter, Lucian! Es ist doch unser Vater, nicht wahr? Es steht uns nicht zu, über ihn zu urteilen!«
»Dass man aber tatenlos zusehen muss, wie das Liebste, was man hat, zugrunde gerichtet wird, ist sehr bitter, Steffi!«, rief er zornig und ballte die Fäuste. »Ich glaube, ich hasse ihn!«
»Aber Mama wäre die letzte, die wünschen würde, dass der Sohn sich ihretwegen gegen den Vater wendet!«, flüsterte die Komtess.
Graf Lucians Zorn sank jäh in sich zusammen. »Du hast recht, Kleine!«, murmelte er. »Spielen wir also die Komödie der fügsamen Kinder weiter.«
»Ich habe Angst vor der Zukunft«, sagte Stefanie. »Was soll werden, wenn Mutter von uns geht? Vater und du – ihr werdet hart aneinandergeraten!«
»Du bist ja auch noch da!«, lächelte er zärtlich. »Deinetwegen werde ich hier aushalten, damit dir kein Härchen gekrümmt wird.«
»Niemand wird mir etwas Böses zufügen!«, beruhigte sie ihn. »Vater wird nur tun, als wäre ich Luft für ihn. Ich bin ihm von jeher gleichgültig und sogar lästig gewesen. Du bist mein einziger Trost, Lucian! Ich glaube, ich könnte ein Alleinsein auf die Dauer nicht ertragen.«
Wieder stiegen Tränen in die blauen Augen. Lucian schwieg und streichelte die Hand der Schwester. Draußen rüttelte der Wind an den Fensterläden. Sie kamen sich beide sehr verlassen vor.
In diesem Augenblick klopfte es. Die alte Apollonia trat ein, und sie sahen ihrem Gesicht an, dass es schlecht um die Mutter stand.
»Was ist?« Sie fuhren beide empor.
»Die Mutter verlangt nach euch«, sagte Apollonia, die einst Lucian und Stefanie auf den Armen getragen hatte. »Der Doktor hat ihr eine Spritze gegeben und erlaubt jetzt euren Besuch. Aber ihr dürft sie nicht aufregen! Wenig sprechen! Nicht weinen! Kommt!«
»Oh«, schluchzte Steffi auf, »es geht also wirklich zu Ende?«
»Nimm dich zusammen!«, befahl Lucian, doch er war selbst ganz blass. »Wir wollen ihr den Abschied leicht machen.«
Gemeinsam mit Apollonia verließen sie das Zimmer. Die Kammerfrau betrachtete die beiden jungen Menschen mit einem eigenartigen Gesichtsausdruck.
Graf Lucian und Komtess Stefanie waren sich keineswegs ähnlich. Während Steffi die unverkennbaren Merkmale der Familie Moosburg trug und so zart wie ihre Mutter war, wirkte Lucian wie ein Athlet. Er besaß weder Ähnlichkeit mit seiner Mutter noch mit seinem Vater.
Als sie das Krankenzimmer erreichten, war der Pfarrer noch immer nicht da. Das Wetter erschwerte ihm wohl den Weg zu der Sterbenden.
Ein mattes Lächeln erhellte die Leidensmiene der Mutter, als sie ihre Kinder eintreten sah. Sie hob mühsam die Hände von der Bettdecke und streckte sie ihnen entgegen.
»Meine lieben, lieben Kinder!«, flüsterte sie angestrengt.
Lucian und Stefanie eilten jeder an eine Seite ihres Bettes und ließen sich auf die Erde nieder.
Die Hände der Mutter legten sich auf ihre Scheitel.
»Ich gehe jetzt von euch«, sagte sie klar und tapfer. »Ihr bleibt in einer Welt voll Unruhe zurück. Ich – sorge mich – um euch ...«
Apollonia versuchte der aufsteigenden Tränen Herr zu werden. Der Arzt hatte sich in einen Winkel des Zimmers zurückgezogen und beobachtete von dort aus unentwegt seine Patientin.
»Mama«, sagte Lucian mit fester Stimme, »du brauchst dich nicht zu sorgen. Ich bin ein Mann und werde mich durchzusetzen wissen. Ich werde auf Stefanie ...«
»Steffi!«, hauchte die Kranke mit besonderer Innigkeit. »Um sie sorge ich mich am meisten.« Sie warf einen hastigen Blick zu der Kammerfrau hinüber. »Kommt der Pfarrer denn immer noch nicht?«
»Er wird gleich hier sein«, stammelte Apollonia hilflos.
»Mama«, versprach Lucian, »ich werde Stefanie immer behüten und alles Böse von ihr abwenden!«
Fast schien es, als ob ein Lächeln über das Gesicht der Mutter huschte.
»Immer?«, wiederholte Gräfin Theresia zweifelnd. »Das – das kannst du nicht, Lucian! Aber versprich – versprich mir, dass du so lange deine Schwester wie ein Kleinod hüten wirst, bis du sie einem würdigen Beschützer für ihr ferneres Leben anvertrauen kannst!«
Das Sprechen fiel ihr sichtlich schwer. Steffi hatte den Kopf auf die Bettdecke gelegt, und die Hand der Mutter ruhte auf ihrem Haar.
Graf Lucian richtete sich auf. »Ich verspreche es dir, Mutter!«
Die Mutter nahm seine Hand und drückte sie leicht. »Ich – ich danke dir, mein Sohn! Meine Kinder, vergesst nie, wer – ihr seid! Werdet Menschen, die anderen – ein Vorbild sein können!«
»Wir versprechen es!«
Die beiden jungen Menschen fühlten die Heiligkeit dieses Versprechens am Totenbett der Mutter.
Dann irrten die Blicke der Gräfin wieder zur Tür. »Ist – ist er denn – noch nicht da?«, rang es sich stoßweise von ihren Lippen.
»Sie dürfen nicht mehr sprechen!«, sagte der Arzt. »Es ist zu viel für Sie.«
»Der Pfarrer – ich muss noch – ich darf nicht ...« Ihr Atem ging schwerer und schwerer. »Er – muss alles wissen. Nein, ich kann so – nicht ...«
Die beiden jungen Leute hatten sich aus der knienden Stellung erhoben. Sie starrten angstvoll auf die Mutter. Kam jetzt das Ende?
Die alte Apollonia fühlte großes Mitleid mit der Sterbenden und wünschte dennoch heimlich, der Geistliche möge zu spät kommen. Es war gewiss besser, wenn über jene Dinge, welche die Gutsherrin in letzter Minute offenbaren wollte, nie gesprochen wurde.
»Lebt wohl!«, keuchte Gräfin Theresia unter unsäglicher Anstrengung. »Ich – werde euch – immer nahe – sein ...«
Dann wand sich ihr abgezehrter Körper unter der furchtbaren Gewalt eines neuen Herzkrampfes, und in den Armen des Arztes hauchte sie ihr Leben aus.
Sanft drückte der Arzt der Verstorbenen die Augen zu und ließ sie in die Kissen gleiten. Sohn und Tochter standen umschlungen am Fußende des Bettes und ließen ihren Tränen freien Lauf.
Die Kammerfrau hielt die Uhr an und verhängte den Toilettenspiegel. Die Pflegerin öffnete weit die Fenster.
Wenige Minuten später stand der Pfarrer im Sterbezimmer. Das Haar klebte ihm schweißnass an der Stirn. Er war zu spät gekommen und konnte nur noch beten und die Hinterbliebenen trösten.
Apollonia aber dachte: Es ist gut, dass sie ihr Geheimnis mit ins Grab genommen hat. Nun weiß niemand etwas davon, außer mir, und meine Lippen werden ewig schweigen.
♥♥♥
Wenn Graf Ludwig nicht in Monte Carlo am Roulette spielte – und verlor, wenn er nicht in Paris mit leichten Damen ausging, dann saß er todsicher in der Schenke »Zur Teufelsklamm« und trank.
Das Wort Arbeit war ihm unbekannt, und um die Bewirtschaftung seines Gutes hatte er sich noch nie gekümmert. Als die Sitzung in der Schenke beendet war, lud der Graf alle Anwesenden mit einer großartigen Handbewegung ein, in seinen Wagen zu steigen und mit ihm nach Hause zu kommen.
»Im Weinkeller meines Schlosses ist auch noch was!«, schrie er.
So fuhr die bunt zusammengewürfelte Gesellschaft grölend durchs Dorf zum Gutshaus, in dem vor kurzem die arme Gräfin ihren letzten Atemzug getan hatte.
Als der Wagen vor dem Haus hielt, kletterten sie alle heraus und hielten lärmend Einzug. Mit steinernem Gesicht hielt der Diener Friedrich die Tür auf.
Auf den untersten Stufen der Treppe zum ersten Stock aber standen zwei dunkel gekleidete Gestalten und empfingen den heimkehrenden Hausherrn. Graf Ludwig brauchte eine Weile, bis er den Arzt und den Pfarrer erkannte.
»'n Abend, die Herren!«, rief er jovial und strebte mit seinem betrunkenen Gefolge zum Rauchzimmer.
»Auf ein Wort, Herr Graf!«, rief der Arzt und trat einen Schritt vor.
Die ganze Gesellschaft blieb stehen. »Muss das sein?«, nörgelte Graf Ludwig. »Sie – Sie sehen doch, da-dass ich Gäste ha-habe!«
»Wir haben die traurige Pflicht«, begann der Pfarrer, »Sie von dem Ableben Ihrer Gattin in Kenntnis zu setzen.«
»Wie? Was?«, stotterte der Graf und strich sich das wirre Haar aus der Stirn.
»Ihre Gattin ist vor einer Stunde verschieden«, wiederholte der Arzt.
»Donnerwetter!«, entfuhr es dem betrunkenen Mann.
»Die Verstorbene liegt in ihrem Schlafzimmer«, fuhr der Pfarrer beherrscht fort. »Wenn Sie sie sehen möchten, werde ich Sie hinaufbegleiten, Herr Graf!«
Endlich schien der Gutsherr begriffen zu haben.
»Nicht – nicht jetzt!«, wehrte er unangenehm berührt ab. »Da-das hat wohl noch Zeit!« Dann drehte er sich zu seinen Gästen um und lallte: »Unter den gegebenen Umständen, meine Herren, äh, äh, ist es mir lei-leider nicht möglich, meine – meine Einla-ladung aufrechtzuerhalten! Friedrich, la-lass die Herrschaften nach Hause bringen!«
»Jawohl!«, sagte Friedrich mit steinernem Gesicht und öffnete die Tür. Dann schlich die Gesellschaft betreten hinaus.
Graf Ludwig jedoch verschwand ohne ein weiteres Wort in seinem Rauchzimmer und schloss sich ein. Er ließ sich auf den Diwan fallen und war gleich darauf eingeschlafen.
Der Arzt und der Pfarrer standen ratlos in der Halle.
»Bis morgen früh, Herr Pfarrer!«, sagte der Arzt schließlich. »Eher ist er nicht vernehmungsfähig.«
Der Geistliche nickte betrübt. »Und auch dann wird er alle Bestattungsangelegenheiten seinen Kindern und dem Personal überlassen.«
Sie verabschiedeten sich voneinander und gingen.
In seinem Zimmer über der Halle stand der junge Graf Lucian am Fenster und hatte die Fäuste in ohnmächtigem Zorn geballt. Wenige Zimmer von ihm entfernt lag die tote Mutter, und unten grölten die Kumpane seines Vaters. Am liebsten wäre er mit eisernem Besen dazwischengefahren, aber ihm waren die Hände gebunden.
Müde wandte er sich ab und ging zu Bett. Sein Gesicht sah um Jahre älter aus, und er zählte doch erst vierundzwanzig. Wie würde das Leben auf Gut Moosburg nun für ihn aussehen?
Einige Fenster weiter war noch Licht. Da schmiegte sich ein schluchzendes Mädchen an die Schulter der alten Apollonia.
»Mutter hat so viel gelitten!«, flüsterte Stefanie. »Der Gedanke, dass sie jetzt für immer erlöst ist, tröstet mich ein wenig.«
Apollonia führte die Komtess zu ihrem Bett. »Die nächsten Tage werden allerhand von dir verlangen, mein Kind! Geh schlafen! Du musst tapfer sein!«
Sie half der Zweiundzwanzigjährigen beim Auskleiden. Dann löschte sie das Licht und huschte leise hinaus.
Stefanie schluchzte in die Kissen, bis der Schlaf das verwaiste Mädchen in seine tröstenden Arme nahm.
Die alte Apollonia hielt Totenwache am Bett der Verstorbenen, und Ludwig Graf von Moosburg schlief im Rauchzimmer laut schnarchend auf dem Diwan, und von seinen beschmutzten Schuhen tropfte es auf den Teppich und bildete eine trübe Lache.
♥♥♥
Die gleiche sorgenvolle Unruhe, die Lucian und Stefanie erfüllte, quälte auch die Menschen in der Gesindestube.
Knechte und Mägde, Diener und Stubenmädchen, Zofe, Gärtner und Bursche – sie alle waren zu dieser Abendstunde noch versammelt und versuchten, die Nachricht vom Tod der Gräfin zu verarbeiten.
»Jetzt wird sich Verschiedenes ändern«, sagte Friedrich, der Diener. »Da der Einfluss der gnädigen Frau fehlt, werde ich nicht mehr lange bleiben!«
»Und warum nicht?«, fragte die Köchin, die heimlich für Friedrich schwärmte.
»Solche Entgleisungen wie heute Abend dürften jetzt wohl bald an der Tagesordnung sein«, prophezeite Friedrich. »Und dann kann ein Mensch, der auf sich hält, nicht hierbleiben.«
»Das verstehe ich«, nickte die Köchin traurig.
Der Inspektor, der sonst nicht viel sprach, nahm umständlich seine Pfeife aus dem Mund.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: