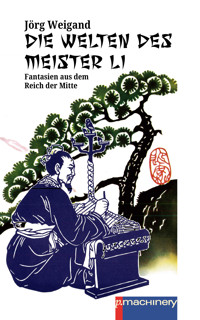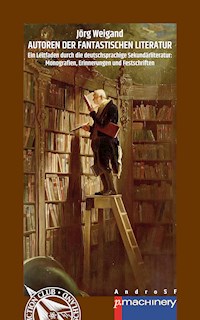8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jörg Weigand (* 1940) ist promovierter Sinologe, Journalist und Autor. Er produzierte nicht nur eine fast unübersehbare Anzahl sekundärwissenschaftlicher Artikel, diverse Fachbücher – darunter das legendäre Pseudonym-Lexikon – und gab Dutzende von Anthologien heraus, sondern schrieb auch eine dreistellige Anzahl von Kurzgeschichten. In diesen reflektiert Weigand oft den jeweiligen Zeitgeist und greift brisante politische und gesellschaftliche Themen auf. Sehr nützlich waren ihm hier seine eigenen Erfahrungen als langjähriger Politjournalist und Reporter, aber auch als Reserveoffizier. Aus einer Idee kocht er die Essenz heraus, um diese dann oft auktorial, teils dokumentarisch beschreibend, niederzulegen; bisweilen geschieht das in einer beiläufigen Brutalität, die den Leser erst im Nachhinein oder beim nochmaligen Lesen schockiert. In diesem Band werden seine besten phantastischen Geschichten zusammengefasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Frank G. Gerigk (Hrsg.)
Die Welten des Jörg Weigand
Die Welten der SF 2
Frank G. Gerigk (Hrsg.)
DIE WELTEN DES JÖRG WEIGAND
Die Welten der SF 2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Dezember 2020
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Rainer Schorm
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: Schaltungsdienst Lange oHG, Berlin
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 222 5
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 874 6
Frank G. Gerigk: Vorwort
Bestürzt holte ich Atem! Was war geschehen? – Eine kleine Blume, aus Versehen auf einen frischen Kolonialplaneten geschmuggelt, bedeutete dessen Untergang! Ein zarter Blumenstrauß, vor Wut in den Boden getrampelt, war das beinahe intime Zeichen für eine weltumspannende, kaum zu überschätzende Tragödie, die sich da abzeichnete. Diese war dort, wo andere Autoren endlos fabuliert hätten, in nur sechs Seiten komprimiert dargestellt in einer Kurzgeschichte von Jörg Weigand.
Das las ich erstmals in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts; tief hat sich diese Geschichte in mein Gedächtnis eingegraben. Und immer wieder stieß ich seither auf solche Geschichten, und immer wieder waren sie von Jörg Weigand.
Seine Protagonisten sind nie die typischen Helden, sondern hadern mit ihrem Schicksal – überwiegend in Form von eindringlichen, oftmals fantastischen, vielfach schicksalshaften Begegnungen. So fällt es auch leicht, Weigand in die Fantastik einzuordnen. Er ist also kein typischer Autor der Science-Fiction; im Gegenteil gründen seine Geschichten in europäischen Genres, die um Jahrhunderte älter sind. Zusätzlich bedient er sich gerne aus dem Fundus der Fabeln und der fernöstlichen Mystik. Diese entkernt und renoviert er und versieht sie mit einem neuzeitlichen Gewand.
Weigand schreibt zeit- und genreüblich meist für männliche Leser: Die Protagonisten sind fast ausschließlich männlich, ebenso die Vorgesetzten und Kollegen. Frauen spielen entweder Nebenrollen oder sind mit den klassischen Figurenvarianten der Verführerin, der Hexe, der Stichwortgeberin usw. besetzt.
Weigands Geschichten sind meist umso kürzer, je älter sie sind – sieht man von den Kürzestgeschichten für die »Phantastischen Miniaturen« ab, die von Thomas Le Blanc für die Phantastische Bibliothek Wetzlar herausgegeben werden. Aus einer Idee kocht er die Essenz heraus, um diese dann oft auktorial, überwiegend nüchtern, teils dokumentarisch beschreibend, niederzulegen; bisweilen geschieht das in einer beiläufigen Brutalität, die den Leser erst im Nachhinein oder beim nochmaligen Lesen schockiert. Dies markiert Weigand auch als Autor des Realismus’ – scheinbar im Gegensatz zu seinen gewählten Genres, in denen es doch oft um genau den Bruch mit der Realität geht. In seinen späteren Geschichten mehren sich jene Elemente, die die einst eher beispielhaften Protagonisten individueller verorten, und charakterisieren bis hin zu schmückenden Erläuterungen, vor allem, wenn er für andere Herausgeberschaften schreibt als seine eigenen. Erst in seinem Spätwerk geht er zu Romanen über, in dem auch Frauen die Hauptrollen spielen – doch das ist ein Thema für außerhalb dieses Buches.
Die Plots entwickeln sich stringent, unverwickelt und geradlinig auf einen einzigen Höhepunkt zu.
Mehrfach reflektiert Weigand den jeweiligen Zeitgeist und greift brisante politische und gesellschaftliche Themen auf: Terrorismus, das Gefälle von Arm und Reich in den Entwicklungsländern, die Angst vor der Atombombe während des Kalten Kriegs, Militarismus, Bürokratismus, die Unterdrückung der Freiheit, Absolutismus in Diktaturen u. a. Sehr nützlich waren ihm hier seine eigenen Erfahrungen als langjähriger Politjournalist und Reporter, aber auch als Reserveoffizier.
Die Geschichten sind hauptsächlich in der Jetztzeit oder der nahen Zukunft angesiedelt, die für uns Leser inzwischen teilweise schon zur Vergangenheit geworden ist. Sie wurden absichtlich nicht dem heutigen Datum angepasst, sondern als Zeitdokumente im Original belassen. Zur besseren Einordnung der Werke wurden diese nicht nur in chronologischer Reihenfolge geordnet, sondern jedem sein Entstehungsjahr vorangesetzt. Lediglich die Schreibweisen nach der Rechtschreibreform wurden angepasst.
In dieser Reihe wollen der Verleger und ich herausragende deutschsprachige Autoren der Fantastik vorstellen und dabei Erzählungen präsentieren, die es wert sind, immer noch einmal gelesen zu werden.
Dass Jörg Weigand sehr früh hier vorgestellt wird, ist insofern geradezu zwingend. Wir freuen uns, dass er für dieses Buch zugesagt hat.
Schwierig war es, aus seinem breiten Fundus die besten und beispielhaftesten Geschichten herauszusuchen. Die Auswahl seitens des Herausgebers erfolgte unzweifelhaft etwas subjektiv; der Weigand-kundige Leser möge dies mit Nachsicht betrachten.
Das Geheimnis der Hakka (1973)
Bericht des Missionars Jens Lindgreen:
»Es ist uns aber zu Ohren gekommen, dass in den Hakka-Bergen ein recht kurioses Volk lebt. Dem Vernehmen nach kennen diese in Abgeschlossenheit lebenden Menschen ein Mittel zur Erlangung längeren Lebens. Sie züchten eine besondere Art von Affen, deren Hirn sie in mystischen Zeremonien bei lebendem Zustand der Tiere verzehren. Es wird dazu ein Trank gereicht, der besondere Kräfte wecken soll. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfuhren, sollen in jenen Bergen überaus zahlreiche Hundertjährige und Ältere leben.«
(Aus: Annalen des Museums für Völkerkunde, Stockholm 1898)
Mehrere Tage waren sie nun schon unterwegs. Pieter van Delden fühlte sich ausgelaugt und erschöpft. Zuerst das risikoreiche, nächtliche Überschreiten der Grenze zur Volksrepublik China und dann dieses mühsame Sichvorwärtsquälen durch fast unwegsames Gelände.
Der Holländer war Fußmärsche einfach nicht gewöhnt. Huang Pao-li dagegen, seinem chinesischen Begleiter und Führer, war noch keinerlei Müdigkeit anzumerken; im Gegenteil, je mehr sie vordrangen, desto beschwingter schien er vorwärtszustreben. Sein Schritt blieb gleichmäßig federnd und seine Stimmung ungebrochen gut. Van Delden beneidete ihn um diese Kondition. Keuchend zog er ein bereits feuchtes Tuch aus der Tasche und wischte sich die schweißüberströmte Stirn. Wenn nur die Sonne nicht so heiß brennen würde!
Angefangen hatte das Abenteuer in Hongkong. In diesem brodelnden Schmelztopf Südostasiens ist kein Verbrechen unbekannt, kann der Europäer sicher sein, für jedes seiner Laster Befriedigung und für alle ausgefallenen Ideen Verständnis zu finden. Daher hatte sich auch Pieter van Delden eines Tages hier eingefunden, voll Hoffnung auf die Erfüllung seines großen Traumes, dem er bereits sein halbes Leben lang nachjagte.
In einer relativ neuen, nichtsdestoweniger aber bereits arg verräucherten Kneipe, ganz in der Nähe des Dschunkenhafens, war er auf Huang Pao-li gestoßen. Reiner Zufall, dass sie am Tresen zusammenfanden. Huang verströmte Zuverlässigkeit, seine braunen Augen schufen Vertrauen und seine gedrungene Gestalt verhieß Sicherheit.
Der bereits stark angesäuselte van Delden war rasch mit dem Chinesen ins Gespräch gekommen und hatte sich innerhalb einer Stunde dem ihm bis dahin völlig Unbekannten in einem Anfall von Schutzbedürfnis anvertraut.
Er sprach von seinem verpfuschten Leben, den vielen Berufen, in denen er sich bereits vergeblich versucht hatte, seiner gescheiterten Ehe. Und er erzählte von seiner Angst vor dem Tode oder vielmehr vor dem Sterben und von seiner Suche nach einer Möglichkeit, dieser hässlichen Aussicht wenigstens zeitweise durch eine Verlängerung des Lebens zu entgehen.
Huang hatte für alles Verständnis gezeigt, ihm schienen solche Ängste nicht fremd zu sein. In fast akzentfreiem Englisch hatte er hin und wieder kurze Zwischenfragen eingeworfen und ihm schließlich – der neue Tag begann außerhalb der Kneipe bereits zu grauen – angedeutet, dass er vielleicht eine solche Möglichkeit wüsste, nach der Pieter van Delden so leidenschaftlich, so verzweifelt suchte.
»Wir werden eine Rast einlegen«, unterbrach der chinesische Führer seinen Begleiter in dessen stillen Überlegungen. »Wir haben es nun nicht mehr weit. Morgen, so gegen Abend, werden wir in dem Dorf T’ai-po, dem Ort der Erhabenen Weiße, eintreffen. Dort wartet bereits das Festmahl auf uns, und die Dorfbewohner stehen zu unserem Empfang bereit.«
Dankbar über die Marschpause ließ sich der Holländer ins spärliche Gras sinken. Er hatte Durst, und seine Füße schmerzten. Sie marschierten durch eine felsige Bergwelt ohne viel Wald, die hin und wieder von tiefen Schluchten durchzogen wurde. Schroffe Abgründe hatten mehr als einmal ihr Vordringen gestoppt und sie zu Umwegen veranlasst.
Der Pflanzenwuchs in der Region war spärlich. Harte, schilfige Gräser und verholzte Stauden bildeten fast den einzigen Niederwuchs; Flechten überzogen die freiliegenden Felsen. Selten, dass irgendwo eine Blüte zu sehen war.
Van Delden verkroch sich in den schmalen Schatten einer Zirbelkiefer und zog sich die Schuhe von den Füßen. Wohlig bewegte er die befreiten Zehen und nahm gleichzeitig einen tiefen Schluck aus der Feldflasche, die ihm Huang Pao-li reichte. Darin befand sich dünner grüner Tee. Der Europäer trank mit Genuss, auch wenn sein Körper nach Alkohol gierte.
»Erzähl mir bitte noch ein wenig von der Zeremonie, wie du es nennst«, bat er den Chinesen. »Mir sind noch nicht alle Einzelheiten klar geworden.«
Huang Pao-li hockte sich nieder und begann noch einmal geduldig mit seinen Erklärungen.
»Die Hakka kennen das Geheimnis des langen Lebens schon seit urdenklichen Zeiten; irgendwann in grauer Vorzeit haben ihre Urväter dieses Wissen erlangt. Das besagt, dass man das eigene Leben verlängern kann, wenn man die Lebenskraft eines anderen Lebewesens in sich aufnimmt. Diese Kraft, so sagen die Hakka, befindet sich im Gehirn. Und je höher entwickelt ein Geschöpf ist, desto größer ist auch die ihm innewohnende Lebenskraft, das ist klar.«
»Aber dann müsste man doch folgerichtig das Hirn eines Menschen zu sich nehmen, denn er ist das höchste aller Geschöpfe«, zog van Delden den Schluss aus der Erzählung des anderen, wobei es ihn innerlich schon beim bloßen Gedanken daran grauste.
»Stimmt!«, bestätigte Huang Pao-li und trank seinerseits einen kräftigen Schluck. »Doch darüber brauchen sich die Hakka nicht den Kopf zu zerbrechen, da in ihren Bergen eine besondere Art von Affen vorkommt, die ein außergewöhnlich großes Gehirn besitzt. Diese Affen werden von den Hakka-Leuten in Bambuskäfigen gehalten, die sie nur verlassen dürfen, um bei der heiligen Zeremonie ihre Lebenskraft weiterzugeben.«
»Du hast mir etwas erzählt von einem Getränk, das dabei gereicht wird. Weißt du, woraus es besteht?«
Pao-li schüttelte den Kopf.
»Das weiß niemand außer dem Dorfzauberer. Die Formel, nach der die Zutaten gemischt werden, wird vom Eingeweihten immer nur an seinen Nachfolger weitergegeben. Verständlich, wenn man daran denkt, dass der Trank magische Kräfte besitzen soll. Man erzählt auch, dass nur derjenige das Geheimnis der Hakka erfährt, der auch von dem Gebräu getrunken hat. Mir ist wenigstens bekannt, dass immer nur wenige Auserwählte während einer Zeremonie davon kosten dürfen.«
»Warum kannst du mir nicht mehr darüber erzählen?«, fragte der Holländer etwas unwillig, denn die vagen Andeutungen hatten ihn neugierig gemacht.
Der Chinese wurde verlegen und druckste herum, als sei es ihm unangenehm, auf diese Frage zu antworten.
»Weil nicht jeder auch nur an der einfachen Zeremonie teilnehmen darf«, gestand er schließlich, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern, obwohl van Delden in ihn drang.
Doch der Europäer wollte noch mehr wissen. »Wie ist es eigentlich möglich«, fragte er, da er bemerkte, dass er über das andere Thema aus seinem Führer nichts herausbekommen würde. »Wie kommt es, dass die Hakka ihre alten Sitten und Gebräuche so total unbehelligt von der politischen Führung in Peking pflegen können?«
Diese Frage schien Huang Pao-li wieder genehm zu sein, denn seine Antwort darauf kam wie aus der Pistole geschossen.
»Peking liegt weit weg im rauen Norden, was wissen die dort oben schon von den Bräuchen des Südens! Die Hakka waren schon immer ein sehr eigenständiges Volk. Sie haben sich über zweitausend Jahre chinesischen Kaisertums ihre Unabhängigkeit bewahren können und auch die Fremdherrschaft der Mandschus überstanden, ohne in ihrem Eigenleben gestört zu werden. Und als 1911 das Kaiserhaus gestürzt wurde, lebten sie im Grunde immer noch so wie ihre Ahnen vor vielen hundert Jahren. Während des Bürgerkrieges bis zum Jahre 1949 zogen sie sich noch weiter in die unwegsame Wildnis ihrer Berge zurück, wohin ihnen niemand folgen mochte, denn wer sich zu weit vorwagte, der kehrte nicht mehr zurück. Und die neuen Machthaber in Peking haben zwar wiederholt versucht, den Widerstand der Hakka zu brechen, aber bis heute ohne Erfolg. Daran haben auch die Wirren während der Großen Proletarischen Kulturrevolution nichts ändern können.«
Pao-li schien gerne über die Hakka zu reden, denn seine Augen funkelten, wenn er immer wieder ihre Unabhängigkeit von den Mächtigen im Norden betonte. Doch dann schien er wie aus einem schönen Traum zu erwachen.
Er erhob sich.
»Wir sollten uns wieder auf den Weg machen, damit wir noch ein gehöriges Stück Wegs zurücklegen, ehe die Nacht anbricht.«
Und van Delden musste sich sputen, um ihm auf den Fersen zu bleiben.
Die mächtigen Bäume rund um den Talkessel warfen schon lange Schatten, als die beiden Wanderer am nächsten Tag endlich in T’ai-po eintrafen. Die Hütten des Dorfes schmiegten sich eng an den Hang. Auf dem Dorfplatz herrschte ein reges Treiben. Als sie näher kamen, erkannte van Delden, dass die Eingeborenen dabei waren, einen schweren hölzernen Tisch im Rund zwischen den Hütten aufzustellen.
Am Eingang des Dorfes kamen ihnen Kinder und Hunde in bunter Mischung entgegengerannt. Während die Dorfköter die beiden Ankömmlinge mit wildem Kläffen begrüßten, starrten die Kinder die zwei nur stumm aus großen Augen an. Huang Pao-li vertrieb die Hunde mit einigen Fußtritten und Steinwürfen und verscheuchte die Kinder durch wenige, rasch hingeworfene, zornige Worte, die der Holländer nicht verstehen konnte.
Sie kamen auf den Dorfplatz.
Van Delden fiel sofort die unverhältnismäßig große Zahl an uralten Männern auf, deren weiße strähnige Bärte fast bis zu den Knien reichten. Doch trotz des hohen Alters schauten ihre Augen noch wachen Sinns in die Welt. Er machte Pao-li darauf aufmerksam.
Dieser lachte selbstgefällig.
»Es gibt mindestens noch ebenso viele alte, ja steinalte Frauen im Dorf«, erklärte er. »Aber sie stecken in den Hütten und kommen erst am Abend, nach Sonnenuntergang heraus.«
Ehe sie sich versahen, war die Sonnenscheibe hinter den Berggipfeln verschwunden. Die Dämmerung wich rasch einer sternklaren Nacht; im Talkessel herrschte Dunkelheit, die von einem kleinen Holzfeuer auf dem Dorfplatz nur ungenügend erhellt wurde.
Alle Erwachsenen des Dorfes hatten sich inzwischen auf dem Platz versammelt. Der Holländer erblickte viele von den alten Frauen, die Pao-li erwähnt hatte; es schien ihm sogar, als gebe es mehr alte als junge Menschen hier versammelt. Alle umlagerten den mächtigen Tisch.
Huang Pao-li verabschiedete sich von seinem europäischen Gefährten mit dem Hinweis, dass er selbst auch diesmal nicht an dem magischen Zeremoniell teilnehmen könne. Pieter van Delden suchte sich daher einen Platz direkt neben dem Tisch, die Dorfbewohner wichen fast scheu vor ihm zurück. Nun, da er der Verwirklichung seines Traumes so nah war, wollte er aber auch keine Einzelheit versäumen!
Unter einem knorrigen Maulbeerbaum am Kopfende des Tisches hatte ein Trommler Platz genommen. Er begann nun sein Instrument zu bearbeiten; die Schläge mit der flachen Hand auf das gespannte Fell mündeten in einen Rhythmus, der van Delden langsam und schnell zugleich schien. Ein leises Raunen ging durch die versammelte Menge, die Menschen wandten ihren Kopf alle in die gleiche Richtung.
Der Zauberer war da!
Sein Gesicht steckte hinter einer hölzernen geschnitzten Drachenmaske, über die der spärliche Lichtschein des Feuers hin und her huschte und bizarre Schatten malte. Der Zauberer trug ein kleines irdenes Gefäß in der Rechten, aus dem ein betäubender Duft aufstieg, der sich in Windeseile über den ganzen Platz verteilte. Myrrhe und Zinnober, eine seltsame Mischung!
Hinter dem Dorfzauberer zerrten zwei Gehilfen einen riesigen Affen auf den Platz. Van Delden hatte den starken Eindruck, dass sich das Tier heftig sträubte, als wisse es, was auf es wartete. Einmal gelang es dem Affen fast, sich loszureißen. Der Holländer erkannte nun, dass das Tier praktisch die Größe eines ausgewachsenen Menschen erreichte.
In dem Bemühen, sich von den Fesseln und aus den Händen seiner Peiniger zu befreien, fiel der Blick des Affen auf den wie gebannt zuschauenden Europäer. Der tiefe Schmerz, der ihn aus den Tieraugen traf, was für van Delden wie ein Schlag. Der Affe schürzte die Lippen, bewegte den Mund, als wollte er dem ausländischen Gast im Dorf eine Botschaft mitteilen. Doch obgleich er sich verzweifelt wehrte, war sein Widerstand schnell gebrochen; die Gehilfen des Zauberers schleppten das Tier unter den Tisch.
Der Tisch besaß in der Mitte ein kreisrundes Loch, groß genug, dass der Kopf des Affen hindurchpasste. Das Tier wurde mit allen vier Gliedmaßen so unter der Tischplatte festgebunden, dass lediglich der obere Teil des Schädels – etwa bis zu den Augenbrauen – aus dem Loch hervorsah.
Unterdessen hatte der Trommler die Szene im Halbdunkel ununterbrochen leise begleitet. Nun ließ er ein heftiges, aufpeitschendes Stakkato folgen. Der Zauberer trat näher und ließ sich von einem seiner Gehilfen eine Säge mit feinem Blatt reichen. Er beugte sich über den Tisch, während die Umstehenden zum Trommelwirbel verschiedene magische Formeln rezitierten; van Delden verstand davon natürlich keine Silbe, doch der beschwörende Inhalt wurde auch so deutlich genug.
Mit geübten Bewegungen sägte der Zauberer die Hirnschale des Affen auf. Vorsichtig nahm er den abgesägten Knochenteil beiseite. Unter dem entfernten Knochendach konnte van Delden das pulsierende Gehirn erkennen.
Da also war sie, die Verheißung eines langen Lebens! Gier erfasste ihn. Er wollte auch daran teilhaben! Er wollte auch länger leben! Er wollte auch davon essen!
Der Magier hatte einen kleinen Holzlöffel mit langem Stiel ergriffen, durchstach damit die das Hirn umhüllende Haut und fuhr in die pulsierende Masse. Erst nachdem er so den Anfang gemacht hatte, folgten die Dorfbewohner mit ihren Löffeln, die sie griffbereit in den Händen hielten.
Pieter van Delden sah mit einem Mal den Dorfzauberer vor sich. Er hielt ihm den langstieligen Löffel hin.
»Der erste Bissen!«, sagte dieser mit dumpfer Stimme, die durch die schwere Holzmaske bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wurde. »Der erste Bissen gebührt wie immer unserem Gast. Möge es dir das verleihen, was du dir und was wir uns wünschen.«
Hastig griff der Holländer nach dem Löffel und verschlang das Stückchen Hirn.
»Und nun noch der rituelle Schluck, der dir die Erkenntnis unserer Zeremonie vermitteln wird«, sagte der Zauberer drängend und hielt ihm eine Flasche entgegen.
Dieses aufdringliche Gehabe schreckte van Delden ab, doch war seine Gier größer als die angeborene und anerzogene Vernunft. Er fasste gehorsam die irdene Flasche und nahm einen tiefen Schluck daraus.
Es war wie ein Schock, ein Blitzschlag in seinem Magen. Das fremde Gebräu schien in ihm zu explodieren, Eiseskälte und Gluthitze wechselten sich in schneller Folge ab. Tränen schossen ihm in die Augen, er japste nach Luft, sein Gehirn schien sich zusammenzukrampfen. Mit verzweifelter Anstrengung riss er seine Augen wieder auf.
Der Zauberer stand vor ihm, er hatte sich die Drachenmaske vom Gesicht genommen. Dem Holländer verschwamm alles vor den Augen. Irritiert fragte er sich, wie der Zauberer auf einmal wie Huang Pao-li aussehen konnte, wie ein Huang Pao-li, der mit einem triumphierenden Grinsen vor ihm stand.
Dann versank seine Umgebung in einem dichten Nebel. Pieter van Delden versank in tiefem Schlaf.
Das Erwachen geschah in Etappen, lichte Momente wechselten mit Augenblicken ohnmächtigen Schlafs. Schließlich aber riss der Nebel vor seinem Gesicht auf. Er kam zu sich.
Er setzte sich auf. Verständnislos blickte er um sich.
Er befand sich in einem Käfig. Dicke Bambusstangen rings um ihn bildeten eine undurchdringliche Barriere zur Außenwelt. Er war gefangen, steckte hinter Gittern.
Verhaltenes Gemurmel ließ ihn aufmerksam werden. Er beugte sich vor, richtete sich noch mehr auf, starrte durch die Bambusbarriere hindurch. Links, etwas im Hintergrund, stand eine kleine Gruppe Menschen, Hakka, die sich dem Käfig nun gemächlich näherte. Huang Pao-li befand sich unter ihnen. Er trat als Einziger bis an die Bambusstäbe heran.
»Bist du nun zufrieden, Holländer?«, fragte er höhnisch. »Habe ich nicht als Zauberer des Dorfes gehalten, was ich dir als Fremdenführer in Hongkong versprochen habe?«
Wut wallte in van Delden hoch, dass er daran zu ersticken drohte. »Du Betrüger, du Lump!«, wollte er schreien, doch es kam nur ein dumpfes Heulen aus seiner Kehle.
»Sei nicht so undankbar«, lachte Huang erneut, als habe er verstanden, was der Europäer ihm entgegenbrüllen wollte. »Wolltest du nicht an der Zeremonie teilnehmen und erkennen, worin ihr Geheimnis besteht? Nun, die Gelegenheit hast du gehabt und hast sie genutzt. Und bald, sehr bald wirst du auch das lange Leben, ja die Unsterblichkeit erlangt haben – durch uns.«
Er lachte spöttisch auf und wandte sich ab. Für ihn war die Angelegenheit erledigt.
In ohnmächtiger Wut sprang der Gefangene auf und packte die Bambusstäbe, die seinen Käfig bildeten. Doch so sehr er auch daran rüttelte, sie gaben nicht nach. Ein Entrinnen war unmöglich. Sie hatten ihn in ihrer Gewalt.
Das Denken fiel ihm schwer. Was hatte Huang mit seinen Worten sagen wollen?
Sein Blick fiel auf seine Hände, die immer noch das Gitter gepackt hielten. Er erschrak.
Feiner Flaum, einem Pelz gleich, spross auf beiden Handrücken. Er sah an sich hinab. Außer einigen zerlumpten Fetzen trug er nichts mehr. Der Flaum war überall, am ganzen Körper.
Der Trank!
Es musste das scharfe Gebräu gewesen sein, das er zuletzt getrunken hatte. Machte es etwa auf eine ganz geheimnisvolle Weise aus Menschen …
Er ließ sich, wo er war, zu Boden fallen. Resignation überschwemmte ihn.
Jetzt verstand er auch, was ihm der sich verzweifelt wehrende Affe hatte mitteilen wollen.
Mandragora (1975)
Die Suche nach der magischen Untermauerung menschlichen Seins ist so alt wie die Menschheit selbst. Eine lange Tradition also. Doch wer diesem Drang nachgibt …
Zum wiederholten Mal hatte ich mir das rechte Knie an einem vorstehenden Felsbrocken blutig gestoßen, und mein Anzug war sicherlich auch bereits von oben bis unten voller Dreck. Da kroch ich in einer stockfinsteren Nacht auf allen vieren auf dem Erdboden herum und versuchte, diese verdammte Wurzel zu finden, die ich so dringend brauchte.
Mandragora nennt sie der Lateiner; im Volksmund kennt man sie eher unter dem Namen Alraune, ein geheimnisvolles, sehr seltenes Gewächs, das gewiss in absehbarer Zeit ausgerottet sein wird. Denn wo werden heute noch zum Tode Verurteilte gehenkt? Zwar ist noch nicht überall die Todesstrafe abgeschafft, doch dort, wo sie weiter ausgeführt wird, greift man eher zur Giftspritze oder jagt Stromstöße durch den Körper des Verurteilten; in Militärdiktaturen bevorzugen die Machthaber nach wie vor das Erschießungskommando.
Aber Hängen? Der Galgen mit seiner eindrucksvollen Silhouette gegen den grauen Morgenhimmel ist eine aussterbende Errungenschaft der menschlichen Kultur. Und mit ihr wird die Alraune aussterben; sie hat keine Überlebenschance mehr.
Denn nur an solchen Richtstätten, direkt unter dem Galgen, wächst das rare Kraut. Es heißt, die Alraune benötige kein Wasser und keinen Sonnenschein; lediglich ein wenig Sperma, das dem Gehenkten bei seinen letzten Todeszuckungen aus den Lenden tropft. Wo der Tropfen im Boden versickert, entwickelt sich noch in der gleichen Nacht die Mandragora, jene Pflanzenwurzel in Menschengestalt, die den magischen Künsten so heilig ist und für alle Alchimistenküchen des Mittelalters fast noch wichtiger war als der »Stein der Weisen«.
Es hatte sich als sehr schwierig erwiesen, in Europa einen Richtplatz zu finden, der noch genutzt wurde. Schließlich hatte mich die erfreuliche Nachricht aus dem serbischen Hochland erreicht. Dort nämlich, fernab jeder Zivilisation, hat sich der Brauch erhalten, unliebsames Gesindel nach einigen Tagen Haft ohne weitere Umstände aufzuhängen. Nach Eintreffen der Neuigkeit hatte ich mich sofort auf die Reise begeben und war auch wirklich zur rechten Zeit angelangt.
Nun kroch ich also in dieser Neumondnacht in einer mir unbekannten Gegend auf dem Boden herum und versuchte herauszubekommen, an welcher Stelle genau die Alraune aus dem Urgrund der Mutter Erde hervorschießen würde. Da Gehenkte oftmals noch ein wenig hin und her pendeln, war ein großer Radius abzusuchen.
Vom geduckten Kriechen schmerzte der Rücken, ich richtete mich auf, stieß aber sofort an die leicht schaukelnden Beine des unbekleideten Leichnams. Die alte Eiche, die zu seinem Galgen bestimmt worden war, hatte sehr niedrige Äste, sodass der Gehängte mit den Füßen fast den Erdboden berührte.
Seufzend bückte ich mich wieder, um meine beschwerliche Suche fortzusetzen. Gewisse Rituale sind nun einmal einzuhalten, will man die Zauberwurzel aufspüren; dazu gehört, dass Neumond herrschen muss und dass keinerlei künstliche Lichtquellen benutzt werden dürfen.
Ich wollte das blinde Herumtasten schon fast aufgeben, als ich mit den ausgestreckten Fingerspitzen der linken Hand an ein Büschel Blätter stieß, das mir in der Berührung irgendwie eigenartig vorkam. Vorsichtig tastete ich Blatt für Blatt ab. Richtig: Auf ihnen lagen kleine Erdkrümel. Sie waren darauf haften geblieben, als die Pflanze sich aus der feuchten Erde gebohrt hatte.
Das war sie. Mandragora!
Jetzt bedurfte es nur noch einer geringen Anstrengung, die kostbare Wurzel mit aller gebotenen Sorgfalt auszugraben. Keine der verästelten Nebenwurzeln durfte nennenswert beschädigt werden, wollte ich der Wurzel nicht einen erheblichen Teil ihrer magischen Kräfte rauben.
Der Rückweg in die bescheidene Landgaststätte, in der ich ein einfaches Zimmer bezogen hatte, war für mich eine Strecke des stillen Triumphes. Jetzt konnte ich, endlich, meine Experimente fortsetzen und, wenn alles gut ging, zu einem erfolgreichen Ende bringen.
»Jetzt bist du ein gemachter Mann«, sagte ich zu mir, denn der Fund beschäftigte mich sehr, und ich musste einfach einige Gedanken loswerden. »Du wirst in die Geschichte der Menschheit eingehen als einer der größten und mächtigsten Männer aller Völker und Zeiten. Die heutige Moderne mit all ihrer sogenannten Aufgeklärtheit – was wird sie staunen, wenn ihre Urängste, die lange verdrängten, wiederauferstehen! Denn in jedem Menschen steckt ein magischer Kern. Du kannst es ihnen zeigen, dass die Magie lebt und dass die Angst davor nicht unbegründet ist.«
So sprach ich mit mir, bis ich mit meiner Beute in meinem Zimmer war. Dort wickelte ich die Wurzel vorsichtig aus dem feuchten Tuch, in dem ich sie transportiert hatte, damit sie nicht austrocknete, und legte sie vor mich auf den Tisch. Liebevoll, ja fast zärtlich, säuberte ich sie von den letzten Erdkrumen, die ihr noch anhafteten.
Ich betrachtete sie aufmerksam, drehte und wendete sie nach allen Seiten.
Die Mandragora hatte tatsächlich große Ähnlichkeit mit einem winzigen, ungefähr acht Zentimeter großen Menschlein. Oben trug die Wurzel eine Verdickung, einem Kopf gleich; ich glaubte sogar, Augen und Mund erkennen zu können. Zwei stärkere Nebenwurzeln an den Seiten bildeten die Arme. Unten spaltete sich die Alraune, sodass auch für die Beine gesorgt war.
Total erschöpft, aber glücklich, legte ich mich schließlich aufs Bett und schlief wie ein Toter.
Am nächsten Morgen fühlte ich mich sehr schwach. Die Anstrengungen der vergangenen Nacht waren wohl etwas zu viel gewesen. Auch schien das Herumkriechen auf dem feuchten Boden meiner Gesundheit nicht gerade zuträglich gewesen zu sein; ich hatte eine heißen, fiebrigen Kopf und einen rauen Hals.
Heute, in der selbstkritischen Rückschau, ist mir klar geworden, dass ich bereits damals unter dem Einfluss der Unheilwurzel stand, aber an jenem Morgen führte ich alles lediglich auf eine Erkältung zurück. Also beschloss ich, einige Tage länger in jenem Gasthof zu bleiben und mich auszukurieren. Ein Entschluss, der sich als verhängnisvoller Irrtum herausstellen sollte.
Die Tage vergingen, und es wollte mir noch immer nicht besser gehen. Mein Zimmer verließ ich praktisch überhaupt nicht mehr, kaum dass ich mich einmal zum Fenster schleppte und aus trüben Augen in die Ferne starrte – ohne etwas zu erkennen. Das Essen und was ich sonst noch benötigte, ließ ich mir jeden Tag von den Wirtleuten oder vom Hausknecht heraufbringen.
Schließlich muss mein Verhalten den guten Leuten, die sich im Laufe der Zeit offensichtlich Sorgen zu machen begannen, seltsam vorgekommen sein, denn eines Tages wartete man gar nicht mehr ab, bis ich die Tür geöffnet hatte. Als ich heraustrat, stand das Bestellte bereits vor mir auf der Fußmatte.
Aber auch das war mir inzwischen gleichgültig geworden. Ich versank immer mehr in einer die Glieder und das Denkvermögen beschwerenden Lethargie. Mein Sorgen und Hoffen galt einzig und allein der Mandragora, die ich täglich über Stunden hinweg betrachtete. Bis – ja, bis ich eines Morgens schweißgebadet erwachte.
Ein mehrfach wiederkehrender Albtraum hatte mich gequält, in dem die Alraunwurzel zum Leben erwacht war. In einer dieser Sequenzen hatte sie sich vor mir aufgebaut und gesagt:
»Du bist mein Meister, denn du hast mich aus dem Gefängnis der Erde befreit. Ich will getreulich meine Aufgabe erfüllen, die mir gestellt ist.« Und später, als ich immer wieder ungläubig und nicht verstehend den Kopf geschüttelt hatte, war sie in ihrer Rede fortgefahren.
»Es ist schon lange in Vergessenheit geraten, dass wir Wurzelwesen den Geist dessen übernehmen, aus dessen Todesschweiß wir entstanden sind. Der Gehenkte an der Eiche, unter der du mich nächtens ausgegraben hast, war ein Mörder. Und eben das wird meine Aufgabe sein: Ich muss dich töten, so wie jener getötet hat. Denn du bist zwar mein Meister, weil du mich der Erde entrissen hast, doch Macht über mich besitzt du nicht.« Und damit war die Wurzel an mir hochgesprungen und hatte versucht, mir in den Hals zu beißen.
Ich war aus dem Traum hochgeschreckt und hatte nach dem Licht getastet. Unter dem hellen Kegel der Lampe konnte ich mich sicher fühlen. Was für ein Unsinn auch, dieser Traum! Die Mandragora lag auf dem Tisch, wo sie hinge …
Halt doch! Wo war sie? Ich sprang aus dem Bett, die Wurzel war verschwunden. Nur das leere Tuch, in das ich sie immer gewickelt hatte, war noch vorhanden. Ein stechender Schmerz am Hals ließ mich zusammenzucken. Es war ein Schmerz, der vom Hals ausgehend bis in mein Herz stach und mich in Todesangst versetzte.
Ich fasste an den Hals – und griff auf Holz. Die Alraunwurzel! Mit einer wilden Bewegung wischte ich sie von der Haut. Und starrte entsetzt auf meine Hand, die voll Blut war. Voll von meinem Blut!
Das war kein Traum, das war die Wirklichkeit! Die schreckliche Wurzel war zum Leben erwacht und wollte mich töten. Auf meiner Stirn stand kalter Schweiß, der Mund war trocken. Ich spürte Ratlosigkeit, ja Verzweiflung.
Ich blickte an mir hinunter. Mein Pyjama war über und über blutbefleckt. Dann erstarrte ich, denn die Alraune versuchte es aufs Neue. Diesmal nagte sie an meinem freien, unbedeckten Knöchel. Ich schlug nach ihr, doch sie wich aus und sprang zur Seite. Nur um mich sogleich aus einer anderen Richtung wieder anzufallen.
Das ging die ganze lange Nacht hindurch so weiter. Kaum war es mir gelungen, die mörderische Wurzel abzuwehren, da musste ich schon wieder auf der Hut sein, wo sie es wohl diesmal versuchen würde.
Inzwischen bin ich am ganzen Körper von Bissen und blutenden Rissen übersät. Ich merke, wie ich zunehmend schwächer werde. Die Wunden schmerzen und das austretende Blut gerinnt nur noch sehr langsam. Von Zeit zu Zeit überkommt mich Resignation, aus der ich durch den nächsten Biss wieder aufgeschreckt werde.
Ich habe mehrfach versucht wegzulaufen, doch die Alraune ist gewandter und schneller als ich. Der Blutverlust macht mir zu schaffen. Ich habe mich zur Tür geschleppt und versuche sie zu öffnen. Aber die Wurzel sitzt auf dem Riegel und belauert mich; ich kann die Sperre nicht zurückschieben, ohne mich der Gefahr auszusetzen, dass meine Adern am Handgelenk aufgerissen werden. Ich habe Angst, nicht vor dem Tod, der unausweichlich scheint, sondern vor diesem Wurzelwesen.
Jetzt sitze ich am Tisch und schreibe mein Erlebnis auf, zur Warnung für alle, die nach Ähnlichem streben. Jeder soll wissen, wie gefährlich es ist, nach der magischen Basis des Seins zu forschen. Und welches unvermeidbare Risiko jeder eingeht, der sich im Eigeninteresse der Unnatur bedienen will.
Der Geist, den ich gerufen habe, lässt mich nicht mehr los. An meiner Brust hängt die Mandragora und beißt und zerrt an mir. Und ich habe nicht mehr die Kraft, sie abzuwehren. Bald wird sie sich bis zu meinem Herzen durchgefressen haben.
Dann werde ich endlich erlöst sein.
Sonnensegel (1978)
Der Überraum hatte sie ausgespuckt. Wie einen abgelutschten Pflaumenstein. Nun hingen sie da mit ihrem Schiff in der Leere zwischen den Galaxien. Drifteten zwischen den Welteninseln ab und mühten sich, das Leck zu finden, dass irgendein Stück kosmischen Drecks in die Schiffshülle geschlagen hatte.
Auch den Konverter hatte es getroffen. Mitten hinein ins empfindliche Aggregat. Die Maschine hatte daraufhin die überlichtschnelle Fahrt nicht mehr halten können. Sie waren in den Normalraum zurückgefallen.
Ausgespuckt. Wie ein Pflaumenstein.
Charles DuBonneau zwängte sich an einer der scharfen Spitzen vorbei, die das Leck säumten. Wenn nur der Schutzanzug nicht undicht wurde! Weiß der Himmel, wie viele Tage die Reparatur, das Auswechseln des beschädigten Teils dauern mochte.
Etwas hielt seinen Blick fest. Unbewusst noch. Dort in der schwarzen Leere. Rechts sah er die silberne Spirale der heimatlichen Milchstraße; links funkelten Sternhaufen, deren Namen wohl in der Kladde verzeichnet waren. Er selbst kannte sie auf Anhieb nicht.
Dazwischen Schwärze … Leere …
Nicht doch, da war etwas! Ein verwaschener Fleck. Genau in Fahrtrichtung.
»Piet«, sagte er ins Mikro. »Kannst du mal kommen? Da ist was.«
Nichts weiter sagte er. Doch Piet van Heelen, sein Partner auf dem Trip, kam. Denn wenn da was ist in der Leere, kann es Aufmerksamkeit verlangen. Das war ein ungeschriebenes Gesetz.
Dann standen sie da und starrten hinaus. Auf das schwach sich abzeichnende Objekt, das sie nicht identifizieren konnten. Sie standen und vergaßen die Reparatur, von der doch ihr Überleben abhing. Lange Zeit standen sie so.
Dann sagte Charles: »Los, an die Arbeit! Das Ding scheint uns entgegenzukommen. Morgen wissen wir mehr.«
Piet nickte. Und werkelte weiter an dem zerstörten Teil.
Am dritten Tag schließlich hielten sie es nicht mehr aus. Sie mussten wissen, was es war – das Ding da draußen. Sie zwängten sich in die Pinasse, die auf kurze Strecken immerhin was taugte. Und flogen dem rätselhaften Objekt entgegen.
Je näher sie kamen, desto andächtiger staunten sie. Staunten über die Meisterschaft einer unbekannten Rasse, die ein solches Wunderwerk hatte bauen können.
Sie sahen ein Segel aus feinstem Gespinst, wohl mehrere Quadratkilometer an Fläche. So fein waren die einzelnen Fäden, dass nur die angehäufte Vielzahl sie sichtbar machte. Wie feiner Nebel spannte sich das Segel über einer Plattform, die darunter hing; gehalten von gedrehten Klammern.
Ihr Boot stieß an die Plattform, federnd, sanft, wie auf Daunen auflaufend. Es gab Behausungen. Alle verlassen. Von den Bewohnern keine Spur.
»Wie lange es schon so treibt?«, flüsterte Piet. Die Andacht verschlug ihm fast die Sprache.
»Schau her«, antwortete Charles ebenso leise, denn ihm ging es ähnlich. Er rieb mit dem Handschuh über den Boden und streckte ihn dem Freund hin.
Millimeter dicker Staub.
»Wie lange braucht es wohl, bis kosmischer Staub sich in solcher Schicht absetzt?«
Nichts weiter musste gesagt werden. Das Sonnensegel mit der Lebensplattform war uralt. Wohl viel älter als die Menschheit.
Und keine Spuren, wie sie ausgesehen haben mochten, die Erbauer dieses technischen Wunders.
»Es wird getrieben durch kosmische Winde.« Charles DuBonneau sprach zu sich selbst. »Sonnenkorpuskel spenden die Energie. Hörst du das Singen, Piet?«
Und während er das sagte, wurde es ihm erst richtig bewusst – dieses Singen. Es war, als finge sich der Wind im feinen Geflecht der Fäden.
Fast unhörbar war dieses Klingen, am Rande des Vernehmbaren. Doch es fraß sich fest in ihrem Kopf. Wollte nicht mehr weichen. Ließ sie alles vergessen.
Sie saßen und lauschten. Und vergaßen ihr eigenes Sein. Waren eins mit dem Singen, waren eins mit dem Kosmos.
Und träumten.
Was sie weckte?
Vielleicht eine Bewegung ihrer Glieder. Oder ein fast unmerklicher Wechsel in der Geschwindigkeit, mit der das Sonnensegel die Plattform durchs All zog.
Sie erhoben sich wie in Trance. Kamen allmählich zu sich. Sie waren weit abgetrieben worden von ihrem havarierten Schiff.
Sie rissen sich mit Mühe los. Beide. Das kosmische Singen des Sonnensegels hielt sie in Bann. Immer noch. Charles war der Stärkere. Er packte Piet. Stieß ihn in die Pinasse.
Als das riesige Segel immer kleiner wurde, wieder zu jenem nebelhaften Fleck zu werden drohte, kamen sie zu sich.
Charles kauerte vor dem Schirm. Er starrte mit brennenden Augen hinaus. Neben ihm Piet, reglos. Gebannt von dem Wunder.
Charles merkte, dass er weinte. Doch er schämte sich der Tränen nicht.
»Wie sie wohl ausgesehen haben?« flüsterte er.
Piet blieb stumm.
Die Welt des Doo (1979)
1
Er kauerte verkrümmt im Schalensitz des Rettungssystems; seine vom Havarieschock verschleierten Augen sahen nichts als wechselnde Grautöne. Seine Lebensimpulse waren auf das absolut Notwendige reduziert. Sein verstörtes Ich suchte Zuflucht in der gekrümmten Wärme seines Körpers.
Das Unglück war unverhofft über den terrestrischen Luxusraumer hereingebrochen. Während eines der zahlreichen Bordfeste, die auf jeder überlichtschnellen Reise für die verwöhnten Passagiere ausgerichtet werden, um die nervtötende Eintönigkeit einer Fahrt zwischen den bewohnten Welten überbrücken zu helfen, hatte ein schwerer Stoß das Schiff erschüttert.
Während im Ballsaal alle über- und durcheinanderpurzelten, fielen nacheinander sämtliche Kontrollen aus. Der leitende Ingenieur war durch die Erschütterung gegen eine Seitenstrebe geschleudert worden und hing mit gebrochenem Genick über der Maschine.
Die Spannung ließ rapide nach. Durch den Energieausfall konnten die beiden QU-Konverter das Schiff nicht mehr im Überraum halten. Der Übertritt von der Dunkelzone in das Normaluniversum erfolgte ohne Vorwarnung. Innerhalb weniger Sekunden gab es im Maschinenraum verheerende Explosionen.
Valentin Fisher, Repräsentant eines multiplanetaren Großkonzerns für Maschinenbau, hatte gerade seinen zehnten Drink dieses Tages vor sich stehen, als die Panik ausbrach. Da er sich nichts aus Tanzen machte, woran ihn auch sein stattlicher Leibesumfang nicht unwesentlich gehindert hätte, war sein Platz bei solchen Bordfesten immer an der Bar.
Der erste Stoß, den das Schiff erhielt, hatte Fisher nicht aus seinem vom Whisky erzeugten Dösen herausreißen können. Doch die zunehmende Unruhe im Saal schreckte ihn schließlich auf. Gezielt steuerte er auf den Ausgang zu. Doch bereits nach wenigen Schritten erhielt er einen Schlag auf den Kopf und spürte danach nichts mehr.
Erst nach geraumer Zeit wurde sich das wimmernde Bündel im Schalensitz des Rettungssystems seiner Umgebung bewusster.
Langsam sickerten in seinen getrübten Geist Einzelheiten der Kabine: das Flackern der Lämpchen; das Graugrün des Bodenbelags; die viereckige Platte der Steuerkonsole; das fahle Rosa der eigenen verkrampften Finger.
Er musste sich übergeben.
Während Valentin Fisher würgte, wurde er sich mit plötzlicher Schärfe der Tatsache bewusst, dass er allein war. Allein in einer Notkapsel des beginnenden 22. Jahrhunderts, deren Funktionen ihm nicht vertraut waren; denn bei der allfälligen Instruktion zu Beginn der Reise hatte er selbstverständlich gefehlt. Die Möglichkeiten zu seiner Rettung waren ihm nicht einmal andeutungsweise bekannt.
Er würgte erneut. Und während er nichts als Schleim erbrach, wurde er wieder bewusstlos.
2
Als sie ihn fanden, war er nichts weiter als ein hilfloses Tier, bis auf die Knochen abgemagert, stammelnd wie ein Idiot.
Sie waren sanft, mit weichem, flaumigem Pelz und tiefbraunen, lidlosen Augen. Ihm zu helfen, war eine Selbstverständlichkeit, die ihnen von Geburt an durch ihren Glauben mitgegeben war. Sie schafften ihn in ihre Welt und linderten seinen Hunger, seinen Durst, seine Ängste. Schmale, vielgliedrige Finger wuschen ihn, salbten ihn und streichelten ihn, bis er sich, ruhig geworden, lang ausstreckte.
Als er schließlich aus seiner mehrtägigen Bewusstlosigkeit erwachte und seine Betreuer betrachten konnte, fasste er sofort Vertrauen zu ihnen. Diese freundlichen Wesen wollten nur das Beste, dessen war er mit einem Mal sicher.
Danach machte der Heilungsprozess rasche Fortschritte.
Als er wieder soweit hergestellt war, dass ihm das Aufstehen kaum noch Mühe bereitete, da begannen sie auch, mit ihm zu sprechen. Denn bis dahin hatten sie sich nur durch Gesten verständlich gemacht.
»Wir sind das Volk«, sagte unverhofft sein ständiger Pfleger, den er leicht an einer angegrauten Stelle des Pelzes unter dem rechten Auge erkannte. »Wir haben dich als unseren Gast aufgenommen. Wenn du aufstehen und dich umsehen willst, dann ist dir das gestattet.«
Valentin Fisher war durch die plötzliche Anrede so überrascht, dass es ihm zuerst an Worten fehlte. Als er stammelnd zu einer Antwort ansetzte, wurde er sanft unterbrochen:
»Wir wollten dir Zeit lassen, dich auch innerlich wieder zu fangen. Außerdem waren wir uns nicht ganz sicher, ob du in den Kreis des Doo gehörst wie wir alle. Offen gestanden sind wir uns immer noch nicht im Klaren darüber, doch die Zeit wird uns das wissen lassen.«
»Wo bin ich?«, war Fishers erste Frage.
»Unsere Heimat schwebt zwischen den Welten, in der Leere, die das Doo gebiert. Vor langen Jahren schon hat sich das Volk losgesagt von allem Verhaftetsein mit den Systemen des Universums. Wir haben uns eine eigene Welt geschaffen, die schweigend dahinzieht; hier leben und sterben wir.«
Während der Pelzige das erklärte, hatte der Mensch sich von seiner Lagerstatt erhoben. Das Fremdwesen ging ihm knapp bis an die Schulter, wie er mit Überraschung feststellte. Denn aus der Perspektive des Liegenden war ihm der andere viel größer vorgekommen.
Valentin Fisher fühlte sich leicht, fast unbeschwert, wie schon lange nicht mehr in seinem Leben, das ihn auf viele bewohnte Welten geführt hatte. Er merkte, dass diese Empfindung offensichtlich auch mit der Tatsache zusammenhing, dass hier eine geringere Schwerkraft als auf der Erde oder in den irdischen Raumschiffen herrschte.
»Wie soll ich dich nennen?«, erkundigte er sich bei seinem Gegenüber.
»Man nennt mich Lilisan.« Sein Pelz hatte, von oben gesehen, einen seidigen Schimmer. »Du als unser Gast darfst mich auch so anreden.«
Nach allem, was Lilisan bisher erzählt hatte, befanden sie sich in einer Art Raumstation, die zwischen den Galaxien schwebte und völlig autark war. Valentin Fisher schienen die Angehörigen des Volkes, wie sie sich nannten, etwas seltsam zu sein. Aber solange sie sich um ihn kümmerten und ihm halfen, wieder nach Hause zurückzukehren, sollte ihm das egal sein.
»Wir wollen einen Rundgang machen«, schlug Lilisan vor und wandte sich zur Tür. »So bekommst du am besten einen Eindruck von uns und von unserer Welt.
3
Die Welt des Doo, so nannten die Pelzigen ihre Heimat untereinander, war auch für irdische Begriffe riesenhaft, doch sie besaß nur einige tausend Bewohner. Ausgeklügelte Selbstversorgungsanlagen verhinderten, dass irgendjemand Not leiden musste. Auf mehreren Decks übereinander befanden sich Plantagen, in denen die verschiedensten Gewächse kultiviert wurden. Tiere sah Valentin Fisher keine. Und Fleischgenuss galt, das ergab eine vorsichtige Frage, als heiliges Tabu.
Im Verlauf langer Gespräche kam Fisher dahinter, dass das Volk weniger eine soziale als eine religiöse Ordnung kannte. Es gab keine Vorgesetzten und keine Bestrebungen Einzelner, sich gegenüber den anderen hervorzutun. Wo etwas zu entscheiden war, geschah dies einvernehmlich – oft ohne sichtbare Abstimmung. Dem Menschen schien es manchmal, als sei hier eine Gemeinschaft so ineinander verwachsen, dass das verbale Einholen der Zustimmung Einzelner gar nicht mehr vonnöten war.
Alles bestimmte das Doo, ein Begriff, unter dem sich Fisher lange Zeit überhaupt nichts vorstellen konnte. Manchmal erschien es ihm als abstrakter Begriff, doch fast ebenso oft wiederum hatte er den Eindruck einer Personifizierung. So, wenn Lilisan etwa in einer Diskussion einwarf: »Das Doo sagt, dass …« Meist folgten dann Äußerungen, die auf Geduld und Verständnis anderen gegenüber abzielten.
Erst allmählich merkte Valentin Fisher, dass jedes Gespräch, das er mit einem Vertreter des Volkes führte, gleichzeitig ein Test war.
Seine Gesprächspartner wechselten rasch, als wollte man ihn durch verschiedene Spezialisten prüfen lassen. Ihm freilich kam es so vor, als ginge es immer nur um das gleiche Thema: die meditierende Haltung des Einzelnen gegenüber dem Universum und die Einpassung des Individuums in die religiöse Gemeinschaft des Doo.
Zu Anfang hielt er sich bei den ausgedehnten Diskussionen zurück. War es zuerst mehr Unsicherheit darüber, worum es eigentlich ging, so merkte er rasch, dass es da Dinge gab, auf die das Volk großen Wert legte, die ihm jedoch ziemlich fremd waren. Doch merkte er mit Fortschreiten der Zeit, dass ihn eine geheime Ungeduld befiel, die anwuchs und durch nichts zu stoppen war.
Zum ersten Mal ging Fisher aus sich heraus, als sein neuer Gesprächspartner ihm eine Vorlesung zu halten begann über die Tugenden des Doo:
»Wer im Doo lebt, weiß, ohne zu wissen. Er ist ehrlich und weiß doch nicht, was Wahrheit ist. Er hilft aus eigenem Antrieb anderen, ohne Hilfe zu kennen. Er liebt das Volk über alles, und doch ist ihm Liebe unbekannt. Er tut seine Arbeit, doch was ist für ihn Pflicht? Er praktiziert Treue zum Doo und …«
Da riss der Geduldsfaden.
»Was soll das eigentlich?«, unterbrach er in scharfem Ton den vortragenden Tansetung.
»Was soll dieses Salbadern? Warum muss ich mir das immer wieder anhören? Einmal ist genug!«
Tansetung, aus seinem meditierenden Sprechen brutal in die Gegenwart gerissen, schaute ihn aus schreckgeweiteten Augen an. Fisher ließ sich nicht beirren:
»Wie lange muss ich eigentlich noch warten, ehe man mehr auf das eingeht, was ich will? Wann kann ich endlich nach Hause? Habe ich es hier nur mit lauter Verrückten zu tun?«
Er hatte sich bei diesem Gefühlsausbruch erhoben und schaute Tansetung wütend an. Doch nicht lange – dann war der Pelzige geflohen.
4
Zwar bereute Valentin Fisher im Nachhinein, dass er sich so hatte gehen lassen, doch beruhigte er sich schnell wieder bei der Überlegung, dass es eben einmal hätte sein müssen. Er hatte es doch gar nicht nötig, sich auf diese Weise schikanieren zu lassen! In seinem irdischen Beruf als Repräsentant von Großmaschinen galt auch nur das forsche Drauflosgehen; Rücksichten konnte sich bei dem Job keiner erlauben.
Im Übrigen ließ das Volk ihn nun in Ruhe. Er seinerseits hatte auch keine große Lust, auf die Pelzigen zu treffen; daher verließ er kaum noch sein Zimmer. Ein verschüchtertes Jüngelchen brachte ihm jeden Tag seine Mahlzeiten, ein nicht minder verängstigtes Mädchen machte seinen Schlafraum sauber und sorgte auch sonst für Ordnung. Er, Valentin Fisher, hatte endlich Ruhe vor diesem Geschwätz, das nur den Nerv tötete und zu nichts gut war.
Nun allerdings, den ganzen Tag auf sich allein gestellt, begann er den Whisky schmerzlich zu vermissen. Nicht, dass er in seinem normalen Leben unter die Säufer zu rechnen gewesen wäre. Wenn er auch keinen Tag ohne ein gutes Dutzend Schnäpse hatte verstreichen lassen, so hielt sich Fisher doch nicht für einen Trinker. Dass er freilich bis jetzt ohne Alkohol ausgekommen war, schien ihm nicht ganz begreiflich.
Dazu kam noch, dass ihm allmählich das Essen über wurde. Jeden Tag, morgens – mittags – abends, gab es Pflanzenkost. Zwar wurden die verschiedensten Gewächse meist sehr schmackhaft zubereitet, doch Fisher bekam immer mehr einen Heißhunger auf Fleisch. Die Gier nach tierischem Eiweiß wühlte in seinen Eingeweiden und konnte auch durch die köstlichen Salate und Gemüse nicht gestillt werden.
Eines Tages stand unverhofft Lilisan in der Tür. Fisher, der sich gerade einem Tagtraum hingab, in dem ein riesiges Steak auf einem Teller dampfte, schrak zusammen.
»Darf ich mich setzen?«, fragte Lilisan mit der allen Pelzigen eigenen sanften Stimme.
»Aber sicher, nimm nur Platz. Es ist schließlich eure eigene Welt, auf der ich mich befinde!«
Lilisan beachtete die Spitze nicht, die in den Worten des Menschen zu spüren war.
»Wir sind über dich zurate gegangen«, sagte er und richtete seine dunkelbraunen Augen auf Fisher, »und sind zu dem Schluss gekommen, dir noch eine Chance zu geben, ehe wir endgültig entscheiden.«
Valentin Fisher fühlte die Wut in sich aufsteigen. Sollte er sich etwa wieder dieses dumme Geschwätz anhören?
»Muss das denn ewig so weitergehen?«, fragte er böse. »Warum habt ihr nicht Interessen wie andere auch, zum Beispiel: Wann gibt es endlich etwas Richtiges zu essen? Fleisch beispielsweise.«
Lilisan erstarrte.
»Ich bitte dich, einen solchen Frevel nicht mehr auszusprechen!«, stieß er hervor, sichtlich aufgebracht.
»So ist das also! Hier darf man nicht einmal sagen, was man denkt.« Fisher dachte nicht mehr über seine Worte nach. Sie sprudelten über seine Lippen wie eigenständige Wesen.
»Hast du mich verstanden: Ich habe Hunger auf Fleisch!« Lilisan wich vor dem wütenden Menschen bis an die Tür zurück.
»Dann fürchte ich, dass hiermit das Urteil gefällt ist«, sagte er mit trauriger Stimme.
Fisher beachtete die Worte Lilisans überhaupt nicht. Er gab sich ganz seinem Zorn hin.
»Euer betuliches Geschwätz könnt ihr euch sparen. Damit werdet ihr auch nichts erreichen, wenn es einmal hart auf hart geht. Auf der Erde ist noch nie eine Auseinandersetzung oder ein Krieg entschieden worden, weil jemand klug dahergeredet hat!«
»Krieg!«
Man sah förmlich, wie der Pelzige sich versteifte. Er warf Fisher noch einen entsetzten – ja verstörten – Blick zu und stürzte dann hinaus.
Als die Tür hinter ihm zufiel, hörte Fisher zum ersten Mal ein Klicken, als ob ein Riegel einrastete. Er stürzte nach vorn, rüttelte an der Tür. Sie war fest verschlossen.
Er war eingesperrt.
Wie ein wildes Tier.
5
Er kauerte im Schalensitz vor der Steuerkonsole und kam langsam wieder zu Bewusstsein. Es war ihm, als rüttelte er immer noch an der verschlossenen Tür.
Ja, er erinnerte sich. Dann war es auf einmal dunkel um ihn geworden.
Und jetzt … Wo war er?
Sein Blick fiel auf den Sichtschirm. Dort war schwarze Leere. Ein verwaschener Fleck deutete eine Galaxis an, Millionen von Lichtjahren entfernt. Und von rechts schob sich nun ein riesenhaftes, eiförmiges Gebilde gegen die Bildmitte vor.
»Die Welt des Doo.« Nun sah er sie auch einmal von außen.
Da! Es kam ihm voll zu Bewusstsein, dass er ausgesetzt war. Das Volk hatte ihn wieder dorthin zurückgebracht, wo sie ihn aufgelesen hatten.
Und wie damals war seine Lage hoffnungslos. Ohne Aussicht auf Hilfe trieb er zwischen den Milchstraßensystemen in der drohenden, lebensfeindlichen Leere. Und konnte nur warten. Und draufgehen.
Aus dem Lautsprecher kam ein Kratzen. Fisher fuhr zusammen.
»Hörst du mich, Mensch?«
Das war Lilisans Stimme.
»Ja, verdammt. Warum habt ihr mich wieder in diesen Kasten gesetzt?«
»Es musste sein.« Aus der Stimme des Pelzigen sprach kein Mitleid.
»Aber ich werde sterben müssen. Hier hilft mir doch keiner!«
»Das ist richtig. Dir soll auch keiner helfen können. Denn du bist eine Gefahr für alle.«
»Ihr könnt mich doch nicht einfach zum Tode verurteilen!«
Fisher merkte, wie die Wut ihn übermannte.
»Ihr verdammten Heuchler!«, schrie er mit überschnappender Stimme. »Ihr redet von Liebe und Demut und lasst doch andere jämmerlich krepieren.«
»Wir wissen, dass du uns nicht verstehst«, sagte Lilisan, und: diesmal klang Mitgefühl aus seinen Worten. »Und du tust uns leid. Doch auch wir müssen uns treu bleiben. Wir helfen allen Lebewesen im Universum am meisten dadurch, dass wir dich dir selbst überlassen.«
Fisher schlug in ohnmächtigem Zorn um sich, fegte den Lautsprecher von der Wand, trampelte auf ihm herum. Ehe das Gerät zerbrach, hörte der Mensch noch die letzten Worte des Pelzigen:
»Wer im Doo lebt, hat die anderen vor Übel zu bewahren. Und du, du bist das schlimmste Übel, das wir kennen!«
Auf dem Bildschirm zog die Welt des Doo vorüber und entfernte sich in das schwarze Niemandsland zwischen den Galaxien.
Valentin Fisher war allein mit sich selbst.
Eigentor (1979)
An: Ministerium für Kultus und Erziehungswesen
Referat IX b —
Terra-City
Verbund Besiedelter Welten
Von: Kommission für die Reform des Erziehungswesens
Der Sekretär für historische Studien –
Betr.: Vorschlag zur Textgestaltung des programmierten »Lehrbuchs zur Historie der Menschheit«.
Terra-City,
12. Tag im 9. Monat d. J. 1075
(neue Datierung)
In Ergänzung unseres Projektentwurfs zur Textgestaltung des programmierten »Lehrbuchs zur Historie der Menschheit« schlagen wir vor, den in Anlage als Kopie beigefügten Textauszug aus dem Tagebuch des cygnianischen Geschichtsschreibers Bythamele Ty Mnomeno in das o. a. Lehrbuch aufzunehmen.
Begründung:
Der vor ca. 200 Jahren verstorbene Cygnianer Mnomeno war der bislang bedeutendste Historiker seines Planeten. Sein Tagebuch galt lange Zeit als verschollen. Ein glücklicher Umstand ließ das auf einer Autografenauktion angebotene Dokument in den Besitz der »Kommission für die Reform des Erziehungswesens, Abteilung Historische Studien« gelangen.
Mnomenos Tagebuchauszug, der hiermit zur Aufnahme in das o. a. Lehrbuch vorgeschlagen wird, ist ein Dokument aus erster Hand und für einen gewissen Zeitraum unserer Geschichte von nicht unerheblicher Bedeutung. Der Text belegt das Schicksal unserer Expedition, die im Jahre 851 (neue Datierung) Cygni II befrieden und für menschliche Besiedlung öffnen sollte. Da damals die Gefahr bestand, dass das Capella-Reich ebenfalls Interesse an einer Kolonisierung des durch von Echsen abstammenden Intelligenzen nur spärlich besiedelten Planeten haben könnte, erfolgte das Unternehmen ohne große vorherige Erkundungsaktion. Man hielt die (recht spärlichen) Daten einer automatischen, unbemannten Sonde, die Cygni II mehrmals umkreist hatte, für ausreichend.
Die Expedition kehrte nie zurück. Spätere Untersuchungen (erst vor 100 Jahren gelang es, eine weitere Sonde auf dem Planeten zu landen und Messungen durchzuführen) ergaben einen erhöhten radioaktiven Strahlenbefall des ganzen Planeten. Man führte dies auf den Beschuss durch unsere Expeditionsflotte zurück. Die Wirren, die in den Jahren 859 bis 866 (nD) den Verbund Besiedelter Welten erschütterten und schließlich zur Eroberung des Capella-Reiches führten, ließen das Geschehen um Cygni II in Vergessenheit geraten. Neuerdings scheint der Planet wegen der erhöhten Strahlung sowieso nicht mehr zur Besiedlung geeignet zu sein.
Mnomenos Tagebuch erhellt das Schicksal jener Expedition. Wir halten den vorgelegten Auszug für geradezu beispielhaft und überaus geeignet, das historische Denken unserer Kinder zu formen, und bitten daher um Aufnahme in das o. a. Lehrbuch.
Dieser Antrag wurde von den Kommissionsmitgliedern gemeinsam formuliert und einstimmig gebilligt.
Kommission für die Reform des Erziehungswesens
Der Sekretär für historische Studien –
gez. S. R. Hoggins
(o. ö. Professor der Historie)
Erste Terranische Zentraluniversität
Anlage: Auszug aus dem Tagebuch des cygnianischen Historikers B. Ty Mnomeno.
ÜBERTRAGUNG DER HANDSCHRIFTLICHEN TAGEBUCHEINTRAGUNGEN VON BYTHAMELE TY MNOMENO (KOPIE DES COMPUTERS):
»Ganz plötzlich waren sie da.
Wenn auch mein Erinnerungsvermögen im Verlauf vieler Jahre nachgelassen hat, dieser Tag wird mir immer gegenwärtig bleiben. Es war strahlend schönes Wetter; die Zeit der Ernte stand vor der Tür. Wie gewöhnlich um diese Tageszeit – das Licht der Zweiten Periode begann am Horizont zu glühen – ging ich am nahegelegenen See spazieren. Ich begegnete niemandem, denn auch damals – wie heute – waren wir ein dünn besiedelter Planet, der dem Einzelnen genügend Raum zur persönlichen Entfaltung gewährt. Durch ein ungewöhnlich durchdringendes Aufblitzen im Gegenlicht wurde ich auf das Geschehen aufmerksam. SIE kamen. Nach einem Augenblick des Wartens sah ich eine ganze Flotte silberner Schiffe am Himmel über mir. Über der nahen Hauptstadt, in der ich damals noch meine Pflichtarbeitsstunden pro Dekade ableisten musste, verhielten die Schiffe – unbeweglich, drohend. Dann ging es los.
Tausende glitzernder Punkte lösten sich aus den Schiffsleibern und taumelten herab. Unübersehbare Mengen atomarer Sprengkörper, dazu bestimmt, unseren schönen Planeten zu versengen. In immer neuen Trauben sank die Vernichtung vom Himmel. Schon zischten die ersten Bomben in den See und ließen heiße, helle Dampfschwaden aufsteigen. Ich stand wie gelähmt. Das Unheil um mich her hatte mich handlungsunfähig gemacht. Ich beobachtete. An meinen eigenen Schutz dachte ich nicht. Durch eine glückliche Fügung kam ich unbeschadet davon – so kann ich als Chronist meiner Pflicht genügen.
Dann schaltete sich unsere Abwehr ein.
Die weitreichenden Geschütze und Energiebatterien holten sogleich Dutzende der silbernen Schiffe herunter. Die Formation geriet in Unordnung. Im Bestreben, dem konzentrierten Beschuss auszuweichen, wurden die Manöver der feindlichen Armada immer unkontrollierter. Schiffe stießen zusammen und stürzten trudelnd in dichten Knäueln ab. Schließlich wandte sich der Rest zur Flucht. Doch kein Schiff entkam. Unsere Abwehr leistete ganze Arbeit.
Aus den Trümmern der abgestürzten Maschinen aber, die zum Teil in unwegsamem Gelände niedergegangen waren, krochen die Überlebenden und flüchteten sich in die Wälder. Und wurden ihre eigenen Opfer.
Denn uns macht radioaktive Strahlung nichts aus. Im Gegenteil: Im Verlauf unserer sieben Entwicklungsphasen sind wir dringend auf sie angewiesen. So dringend, dass unsere Wissenschaftler bereits vor langen Jahren einen Schutzschirm errichtet haben, der das Entweichen der Strahlung in den Weltraum verhindert. Dieser Schutzschirm liegt weit heruntergezogen in der Atmosphäre, um eine Mindestkonzentration der Strahlung zu gewährleisten. Schade eigentlich, dass die feindlichen Schiffe nur Sprengkörper mit extrem kurzer Zerfallszeit einsetzten. Nun müssen wir wieder Mangel leiden.
Für die Angreifer aber wurde die Strahlung zum Verhängnis. Ihre Körper deformierten sich. Ihre Nachkommen glichen kaum noch den Eltern. Sie wurden zu Tieren. Heute noch ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen unserer Jugend in der zweiten Entwicklungsphase die Jagd auf die wilden Bestien, die sich einst ›Menschen‹ nannten.«
Kommission für die Reform des Erziehungswesens
An: Kommission für die Reform des Erziehungswesens
Der Sekretär für historische Studien –
Terra-City/BW
Von: Ministerium für Kultur und Erziehungswesen
Referat IX c –
Betr.: Vorschlag zur Textgestaltung des programmierten »Lehrbuchs zur Historie der Menschheit«
Ihr Schreiben vom 12. Tag im 9. Monat d. J. 1075 (nD)
Terra-City,
3. Tag im 11. Monat d. J. 1075 (nD)
Zuständigkeitshalber wurde uns das o. a. Schreiben von Referat IX b im Hause übergeben. Wir bitten, in Zukunft die Zuständigkeiten der Fachressorts besser zu beachten.
Der Antrag auf Aufnahme des Tagebuchauszugs des Cygnianers Mnomeno in das o. a. Lehrbuch für die Schulen im Bereich des VBW wird abgelehnt.
Begründung:
Nach sorgfältiger Prüfung des übersandten Tagebuchteils erscheint ein wünschenswerter Einfluss auf das Denken unserer Schulkinder nicht möglich. Unsere historische Wissenschaft hat als wichtigste Aufgabe und oberstes Ziel, eine positive Einstellung der Bevölkerung zur Geschichte der Menschheit und ihrer verschiedenen Entwicklungsphasen zu erreichen. Der vorgelegte Tagebuchauszug enthält jedoch eine Schilderung, die diesem Ziel entgegensteht. Unwesentliche Fehler politischer und militärischer Führung der VBW sind nicht geeignet, dadurch aufgebauscht zu werden, dass sie in Schulbüchern behandelt werden. Falls notwendig, erscheint eine Darstellung durch einen kompetenten Fachhistoriker möglich, der das Ereignis der Aufnahmefähigkeit der Schüler entsprechend aufarbeitet.Keinesfalls aber kann das Abhandeln solcher Ereignisse durch wörtliche Zitate aus – vermutlich verzerrten – Darstellungen Fremdrassiger erfolgen.
Gemäß § 135, Abs. 3, Unterzeile c, der »Verordnung zur Erneuerung des Gedankenguts an Schulen« wird der Antrag daher als unzumutbar zurückgewiesen und gleichzeitig der Kommission für die Reform des Erziehungswesens ein förmlicher Tadel ausgesprochen. Wir bitten, weitere dergl. Anträge zuvor genauer auf Eignung zu überprüfen.
Weiterhin wird gemäß § 18, Ziffer 7, Abs. 5, »Gesetz zum Schutz der Bürger im VBW« das diskriminierende Dokument beschlagnahmt. Das Tagebuch des Cygnianers Mnomeno ist unverzüglich der im Wohnbezirk zuständigen Unterstelle des Sicherheitsdienstes auszuliefern. Gemäß § 18, Ziffer 8, Abs. 3, steht auf Zuwiderhandeln die Todesstrafe.
Ministerium für Kultus und Erziehungswesen
Referat IX c –
gez. Smitt
(Oberverwaltungssekretär)
Durchschlag an: SD, Wohnbezirk E. T. Zentraluniversität.
Der Vogel (1980)
Der kleine Vogel hüpfte immer um den Pfeiler der Turbobahn herum und pickte im Staub. Das Getöse der Bahn über ihm wie auch die vielfältigen Straßengeräusche schienen ihn nicht zu stören. An dem graubraunen Gefieder erkannte der alte Mann auf der anderen Straßenseite, dass es sich um einen Spatz handelte. Nun war er zweiundneunzig Jahre alt, der Greis, und hatte seit Jahren keinen Spatzen mehr gesehen. Er hatte sich freilich noch nie viele Gedanken darüber gemacht, weswegen es immer weniger Vögel gab. Seit einigen Jahren ging er nicht mehr oft auf die Straße; der Lärm und das Gequirle der Menschenmassen stießen ihn ab. Nur manchmal, wenn er es in seinem Zimmerchen gar nicht mehr aushielt, traute er sich für einige Minuten außer Haus – um danach schleunigst wieder in die Geborgenheit seiner vier Wände zu fliehen.
Heute hatte er gerade die Hektik der Durchgangsstraße verlassen wollen, um auf seinem Zimmer die Nachmittagsnachrichten anzusehen, da erblickte er den Vogel.
Der Spatz schien im Straßendreck eine Menge Pickenswertes zu entdecken; denn er kam gar nicht zur Ruhe. Das Köpfchen ging auf und ab, stocherte den Schnabel in den Untergrund; dann ein Hüpfen seitwärts oder nach vorn, und wieder geriet das Köpfchen in Bewegung.
Diese stete Bewegung war es wohl auch, die einige Jugendliche auf den Vogel aufmerksam machte. Die etwa Vierzehnjährigen schlenderten langsam näher und hielten sich dabei im Sichtschatten des mächtigen Pfeilers der Turbobahn. Dabei sprachen sie miteinander, doch das Brausen des Straßenverkehrs war so intensiv, dass der alte Mann auf der anderen Seite der Straße nichts verstehen konnte. Plötzlich bückte sich der eine Jugendliche, für sein Alter hochgewachsen und von Mutter Natur mit einem wirren schwarzen Haarschopf bedacht, griff in den Staub und warf – eine Bewegung ging in die andere über – einen Steinbrocken auf den Vogel, der arglos herumpickte. Die vier Kumpane des Schwarzhaarigen taten es ihm nach, und im Nu prasselte ein Steinhagel auf das kleine Tier nieder.
Der erste Brocken musste bereits getroffen haben, denn als der alte Mann, von den vorbeifahrenden Wagen immer wieder irritiert, genauer hinschaute, lag der Spatz bewegungslos am Boden. Der Alte erkannte in der jugendlichen Gruppe nun auch ein Mädchen, das sich bückte und den Vogel aufhob. Unter der Berührung der menschlichen Hand bewegte der Spatz schwach seine Flügel.
»Lasst den Vogel in Ruhe!«, schrie der Greis mit zitternder, vor Erregung heiserer Stimme, konnte aber den Straßenlärm nicht übertönen. Doch drüben, unter der Turbobahn, bemerkte einer aus dem Augenwinkel das Gestikulieren des alten Mannes und machte die anderen darauf aufmerksam. Ein fast verachtungsvoller Blick herüber, dann wandten die fünf ihre Aufmerksamkeit wieder dem Tier in der Mädchenhand zu.
Ehe sich der Alte versah, befand er sich mitten auf der Fahrbahn des in dieser Fahrtrichtung dreispurigen Boulevards, getrieben von einer jäh aufschießenden Erregung. Er verursachte Notbremsungen und musste Verwünschungen anhören, doch er kam unbeschadet auf den Mittelstreifen unter der Turbobahn.
Die Jugendlichen gingen ihm nun langsam entgegen, das Mädchen hielt immer noch den Vogel.
»Na, Opa, was ist denn los?«, fragte der Schwarzhaarige grinsend.