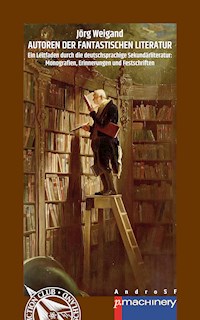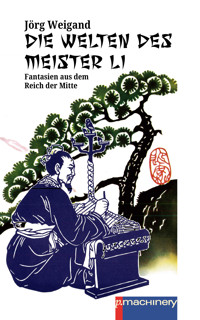
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Meister Li erblickte im Jahr 2012 das Licht der literarischen Welt, als ich eine Geschichte für die von Thomas Le Blanc herausgegebenen Anthologie »Die böse Seite des Mondes« zu schreiben hatte und mich auf mein sinologisches Studium besann. Seitdem hat diese fiktive Gestalt eines Dichter-Gelehrten ein erstaunliches Eigenleben entwickelt, hat offenkundig in verschiedenen Jahrhunderten gelebt und ist sogar in die Zukunft gereist. Damit kein Irrtum entsteht: Es gab den chinesischen Dichter Li T'ai-p'o wirklich; er lebte im 8. Jahrhundert nach Christus, genauer 699–762, und besang in seinen Gedichten – oft weinselig – den Mond, der sich im Tung-t'ing-See spiegelte. Er wird seit damals zu den wichtigsten Dichtern des Reichs der Mitte gezählt, wenn er nicht sogar der bedeutendste ist. Soweit die Tatsachen. Alles in allem führt(e) mein (fiktiver) Li T'ai-p'o ein sehr abwechslungsreiches Leben, wenngleich es sich hauptsächlich in dem sehr engen geografischen Rahmen um den T'ung-t'ing-See abspielt(e). Angesichts dieser Vielfalt kann man durchaus von den »Welten des Meister Li« sprechen. Immerhin waren und sind Ausflüge in die weitere Umgebung und sogar in die Zukunft möglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Weigand
Die Welten des Meister Li
Fantasien aus dem Reich der Mitte
Außer der Reihe 98
Jörg Weigand
DIE WELTEN DES MEISTER LI
Fantasien aus dem Reich der Mitte
Außer der Reihe 98
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Dezember 2024
p.machinery Michael Haitel
Titelbild & Illustrationen: Jörg Weigand, aus seiner Scherenschnitt-Sammlung »Fensterblumen«
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN des Printbuchs: 978 3 95765 436 6
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 707 7
Das Lied des Wassers
Zu Meister Lis Eigenheiten gehörte es, sich während der Sommerzeit an einigen bestimmten Tagen jeden Monats bereits vor Sonnenaufgang an die Ufer des T’ung-t’ing-Sees zu begeben. Dort verharrte er meist reglos in Erwartung des Sonnenballs, dessen Spiegelungen im Wasser er bereits mehrfach in seinen Poemen besungen hatte. Diese morgendliche Stunde war dem Meister heilig, niemand durfte ihn stören.
Was seine Schüler nicht wussten: Hätte sich einer von ihnen heimlich angeschlichen, was sie aus übergroßem Respekt vor ihrem Meister nicht wagten, hätten sie so manches Mal Li T’ai-p’o in fast theatralischer Pose vorgefunden – er deklamierte mit leiser, aber akzentuierter Stimme Gedichte über den See.
Für Meister Li war das ein geradezu heiliges Ritual, über das er mit niemandem sprach; denn über Privates zu reden, das lag ihm nicht.
In seiner Jugend war er voller Eifer gewesen, hatte die großen Klassiker Konfuzius, Mencius oder Han Fei-tzu gelesen und sich, so der Wille seines als Fischer ein bescheidenes Leben führenden Vaters, auf das Mandarinsexamen vorbereitet, das ihm den Einstieg in die begehrte Beamtenkarriere ermöglichen sollte. Er war ein gehorsamer Sohn, wie das die Tradition verlangte, doch hatte er sich damit schwergetan, die konfuzianischen Vorschriften und Anschauungen zu verinnerlichen; viel lieber hielt er sich – statt in der Studierstube – im Freien auf, lauschte den Vögeln und bewunderte das filigrane Netz einer Spinne am Wegesrand.
Innerlich zerrissen zwischen dem Pflichtgefühl seinen Eltern gegenüber und seinem eigenen Sehnen nach einem harmonischen Einswerden mit Natur und Elementen, war es mit seinem Schlaf nicht weit her. Dies wiederum beflügelte ihn nicht unbedingt bei seinen klassischen Studien, vielmehr fiel er leicht in Träumereien.
Als er wieder einmal nächtens vor Verzweiflung wach lag, da hielt es ihn nicht länger in der Hütte seiner Eltern. Er schlich sich hinaus an das Ufer des T’ung-t’ing-Sees. Und als die ersten Sonnenstrahlen den Morgen kündeten und sich im Wasser spiegelten, da übermannte ihn die Trauer, und er brach in Tränen aus.
»Was weinst du?«, fragte da eine Stimme vom Wasser her, sodass er zusammenzuckte. »Woran gebricht es dir?«
Man hatte ihn während der konfuzianischen Studien eindringlich vor eben solchen Zwischenfällen gewarnt. Alchimisten, Taoisten, Mystiker – sie alle sprachen davon, dass es Dinge gebe, die der geradlinigen Weltanschauung des Konfuzius nicht nur nicht entsprachen, sondern sie geradezu ad absurdum führten.
Ein sprechender Fisch!
»Es kann dich nicht geben«, sagte T’ai-p’o. »So etwas wie du ist unmöglich!«
»Und doch spreche ich zu dir«, sprach der Fisch weiter. »Auch so etwas wie die Brechung des Sonnenlichts im Wasser kannst du nicht fassen. Ist es also nicht existent?«
»Doch, und es gefällt mir«, bestätigte Li.
»Ich bin Ton-ka, so wie du T’ai-p’o bist«, sagte der Fisch.
»Ich kenne dich nicht!« Damit wollte sich der junge Li T’ai-p’o abwenden, wie es einem konfuzianischen Eleven gebührte, doch etwas hielt ihn zurück. Er zögerte und bekam zu hören:
»Du bist zu Höherem geboren. Die Beamtenstube eines Konfuzianers ist nichts für dich. Warum sprichst du nicht aus, was du bewunderst? Du musst in Worte fassen, was dir am Herzen liegt.«
»Ton-ka, wer bist du wirklich?«, fragte der Junge, denn er fühlte etwas Entscheidendes geschehen.
»Nun, ich sage es dir, wenn du sofort das besingst, was du hier siehst.«
Und schon brach es aus Li heraus:
»Die Strahlen der Morgensonne
Brechen das Blaugrau der Wellen,
Wie Schmetterlinge
Tanzt das Licht und
Singt das Lied des Wassers.«
»Ich bin ein Geist der Poesie, wie er in jedem See und in jedem tieferen Gewässer lebt. Dass du mich siehst, ist wie ein Traum, denn eigentlich bin ich unsichtbar. Und meine Aufgabe ist es, Talente wie dich zu bewegen, ihre Gefühle und Beobachtungen zum Ausdruck zu bringen.«
Damit wollte der Fisch untertauchen, doch Li T’ai-p’o rief:
»Bleib bei mir, ich brauche deine Hilfe!«
»Nein«, hörte er Ton-ka sagen. »Ich habe getan, was ich konnte. Und du hast gezeigt, was du kannst. Jetzt ist es an dir, diese Kunst zu vollenden. Aber wenn du magst, kannst du mir jederzeit deine Gedichte vortragen. Ich werde sie sehr aufmerksam anhören.«
Damit war Ton-ka verschwunden.
Und Meister Li geboren.
Der Baum der Erkenntnis
Unweit von Meister Lis Behausung lag der Pai-schu-Hain.
Darin gab es den »Baum der Erkenntnis«, zu dem Li T’ai-p’o zuweilen einen Ratsuchenden schickte.
So auch den reichen, aber geizigen Bo Li-ma, der sich von dem Philosophen die Bestätigung erhofft hatte, er sei ein besonders wertvoller Mensch.
Nach wenigen Stunden stand Bo wieder vor Meister Li, offensichtlich ratlos und irgendwie enttäuscht.
»Hast du auf jenes borkenfreie und glatte Stück des Stammes am Baum der Erkenntnis geschaut, wie ich es dir geraten hatte?«, fragte Li T’ai-p’o. »Und hast du gemerkt, dass du durch deine Blicke hineingezogen worden bist in jenen Baum? Weißt du nun, wer du bist?«
»Ich weiß nicht, was ich denken soll«, war die Erwiderung. »Mein Blick drang in den Baum und zog mich hinein. Ich hatte erwartet, meine ganze Gestalt zu erkennen, doch ich sah immer nur meine Vorderseite, sah weder meine linke noch meine rechte Seite, und schon gar nicht meinen Rücken. Was soll ich davon halten? Ist das die Erkenntnis meinerseits, dass ich nur aus einer Vorderseite bestehe?«
»Nun«, sagte Meister Li. »Du hast gesehen, was du sehen wolltest: dich selbst. Du denkst nicht an deine Mitmenschen, sondern nur an dich und dein Geld, als gäbe es sonst nichts links und rechts von dir oder gar hinter deinem Rücken. Genauso sehen dich die anderen rings um dich herum: ein knausriger Geizhals, der nur sich selbst kennt. Gibt es etwas, was einseitiger sein könnte?«
Dummheit
Meister Li hatte einst mit zwei Schülern angefangen; inzwischen war daraus eine ganze Schar geworden: Mal waren es zehn, mal zwölf Personen, die seinen Worten lauschten. Und es waren in der Regel jüngere Männer, die sich im Halbkreis um ihn setzten und aufmerksam zuhörten; dass ein Mann über vierzig sich zu ihnen gesellt, war eher selten, doch gerade das war tags zuvor geschehen.
Su Ma-ch’o war offensichtlich seit Langem auf Wanderschaft, seine Kleidung war zerschlissen und seine Schuhe bestanden aus geflochtenem Stroh. Doch Li T’ai-p’o scherte das wenig, legte er doch selbst denkbar wenig Wert auf sein Aussehen. Nur sauber musste alles sein. Und das war bei dem neuen Schüler der Fall. Also war er willkommen.
Su Ma-cho erwies sich rasch als wissbegierig; er war zwar wenig gebildet, aber von einer natürlichen Intelligenz, die ihn auch zu Fragen verleitete, die manch anderer wohl nicht so gestellt hätte. Als Meister Li nach einer Unterrichtsstunde noch eine Weile mit seinen Schülern zusammensaß, war Gelegenheit zu einer solchen Frage:
»Könnt Ihr mir erklären, verehrter Meister, was das ist – Dummheit?«, Su schien an einer Antwort sehr interessiert zu sein und auch die anderen Schüler nickten beifällig. Dummheit, ja – darüber wollten auch sie mehr erfahren.
Li T’ai-p’o musste kurz überlegen, ehe er entgegnete:
»Dazu will ich dir eine Geschichte erzählen, die sich nach dem, was ich gehört habe, wirklich ereignet hat:
Südlich der Hauptstadt lebte einmal ein reicher Bauer, der auf seinem Land nicht nur Reis und Gemüse, sondern auch vielerlei Früchte und Gewürze anbaute. Nennen wir ihn Li, denn das ist bei uns ein Allerweltsname. Der Bauer war nicht nur reich, er war auch sehr knauserig, um nicht zu sagen, geizig.
Dieser Bauer Li musste bei der Inspektion seines Besitzes feststellen, dass der starke Sturm in der vergangenen Nacht einen Baum geknickt und quer über einen seiner Äcker geworfen hatte. Während er noch überlegte, wie das Hindernis ohne große Probleme oder gar Kosten entfernt werden könnte, gewahrte er einen Hasen, der wohl in einem Versteck geruht hatte und vom Eigentümer des Feldes aufgeschreckt worden war. In seiner Panik rannte das Tier gegen den umgestürzten Stamm und blieb mit gebrochenem Genick liegen.
Bauer Li war hocherfreut und beeilte sich, den Hasen in seinen Besitz zu bringen. Ein Braten, der nichts kostete, war ihm jederzeit willkommen. Also ging er rasch nach Hause, um sich von seiner Frau ein Essen zubereiten zu lassen. Den umgestürzten Baum hatte er darob einfach vergessen.
Anderntags fiel ihm der Stamm freilich wieder ein, als er an das köstliche Mahl dachte, das er am vergangenen Tag zu sich genommen hatte. Was meinst du, was waren seine Gedanken?«
Während Su Ma-cho noch seine Antwort überlegte, denn er war ein Mann von bedächtigem Wesen, meldete sich einer der langjährigen Schüler zu Wort, Na-ya war sein Name:
»Ich glaube, er hätte gerne noch so einen kostenlosen Braten in der Pfanne gehabt.«
Und ein anderer ergänzte: »Wer will das nicht?«
»Ganz richtig!«, sagte Meister Li. »Wer will das nicht? Doch wie sich der Bauer Li angestellt hat …«
»Wie denn, Meister?«, fragte Su Ma-cho. »Und was hat der Hase mit Dummheit zu tun?«
Li T’ai-p’o hatte es sich zeitlebens zur Devise gemacht, stets die Wahrheit auszusprechen, mochte sie noch so unangenehm sein. Und jemanden direkt der Dummheit zu zeihen, war eigentlich ein grober Verstoß gegen die allgemeinen Sitten – auch wenn es sich nur um eine Erzählung handelte. Er sprach aus, was er dachte:
»Es war blanke Dummheit, die ihn alles verlieren ließ, was er besaß – Haus und Hof und letztendlich auch seine Frau. Denn er ließ sich leiten von seiner Gier, von seiner Habsucht und seinem Geiz. Tagelang, wochenlang, ja über lange Monate hinweg harrte er, sobald es hell wurde, in Sichtweite des vom Sturm gefällten Baumes aus, in der Hoffnung, dass wieder ein Hase an dieser Stelle das Leben verlieren würde.
Über diesem Warten vergaß er die Fütterung des Viehs, die Bearbeitung und Bestellung der Felder, das Einbringen der Ernte. Der Reis verfaulte in seinem Wasserbeet, das Obst fiel überreif von den Bäumen und verrottete.
Er merkte davon nichts, kam nur des Nachts zum Schlafen und verließ am Morgen das Haus, um den Baumstamm zu bewachen. Schließlich verließ ihn seine Frau und zog zu ihren alten Eltern.
Er verlor alles und wurde dessen nicht gewahr.
Er wartete auf den Gratishasen – und verlor alles,
Das, meine Schüler, nenne ich Dummheit.«
Und keiner der um ihn Herumsitzenden widersprach.
Eine Rache besonderer Art
Zu Meister Lis langjährigen Freunden am T’ung-t’ing-See gehörte der Fischer Liu Hao-po. So erfolgreich dieser in seinem Beruf war, so gerne holte er sich bei dem Dichterphilosophen immer wieder Rat, sobald er vor einem anscheinend unlösbaren Problem stand.
Als er an jenem frühen Morgen an die Türe von Meister Lis beschiedener Hütte klopfte, trug er noch seine Fischermontur, sodass klar war, dass er vom See direkt hierhergekommen war. Liu zitterte am ganzen Körper, doch nicht wegen der morgendlichen Frische, die ihm gemeinhin nichts ausmachte. Er kam gleich zur Sache:
»Meister, nun ist Mu Pu-hao zu weit gegangen. Wirklich: zu weit!« Der erwähnte Mu war Liu Hao-pos stärkster Konkurrent von all den Fischern, die auf dem T’ung-t’ing-See ihren Lebensunterhalt verdienten. Schon mehrfach hatte er Lius Boot gerammt oder auf dem einige Meilen entfernten Wochenmarkt dessen Fang vor versammeltem Publikum als minderwertig bezeichnet. Und Liu hatte dies, wie ihm Meister Li angeraten hatte, stillschweigend über sich ergehen lassen.
»Die Qualität deiner Ware wird alle überzeugen, es ist nur eine Frage der Zeit«, hatte ihn Li T’ai-p’o damals beruhigt. Nun aber schien sich die Situation geändert zu haben.
»Was ist geschehen?«
»Meister, wie Ihr wisst, habe ich zwei Boote. Damit mir immer eines zur Verfügung steht. Nun gab es gestern diesen Sturm und dabei ist Boot Nummer eins beschädigt worden. Ich wollte heute das andere flott machen. Doch es ist nicht einsatzfähig. Dieser Mu hat das Steuer zerbrochen und daneben auf den Schiffsrumpf die Zeichen geschrieben: »Das Schicksal will es so!«
Li T’ai-p’o glaubte, nicht recht zu hören: »Das hat er wirklich geschrieben?«
»Ja, ich kenne seine Art, die Schriftzeichen zu verkürzen. Er war es. Was soll ich nun tun? Meine Frau macht mir das Leben zur Hölle, wenn ich mich nicht wehre. Sie sagt, ich soll mich für diese Tat rächen. Aber wie?«
Meister Li schmunzelte; ihm war eine Idee gekommen: »Hat sie nicht immer wieder gefordert, du sollst weniger auf den See hinausfahren und dich vielmehr intensiver deiner Familie widmen? Deinen drei Kindern und natürlich ihr ebenfalls …«
Liu Hao-po sah den Meister verständnislos an: »Ja, aber was …«
»Nun, du machst Folgendes.«
Die Instruktion erforderte nur wenige Minuten. Dann wusste der genervte Fischer, was er zu tun hatte.
Zur Überraschung aller an den Ufern des Sees, lief Mu Pu-hao am nächsten Tag mit einem von absoluter Verwirrung gezeichneten Gesicht herum und hielt sich danach mit seinen Attacken zurück. Von einigen Nachbarn darauf abgesprochen, gab er keine Antwort. Er fürchtete, verspottet zu werden.
Denn Liu, der verhasste Konkurrent, hatte ihn mit vor Freude strahlendem Gesichtsausdruck aufgesucht, hatte ihm die Hand geschüttelt und gesagt: »Ich bin dir einen großen Dank schuldig; sag mir bitte, wenn ich etwas für dich tun kann.«
Und als ihn Mu verdutzt angestarrt hatte, hatte Liu erklärt: »Meine Frau wollte schon lange, dass ich weniger auf den See fahre und mich mehr um sie kümmere. Sie hat mir sogar das Bett verweigert. Nun habe ich die ideale Gelegenheit dazu. Mein restliches Boot wird in wenigen Tagen wieder einsatzbereit sein. Aber ich werde es ab sofort weniger nutzen. Ich habe in der Vergangenheit Ersparnisse anlegen können, nun werde ich langsamer machen und das Leben genießen.«
Liu hatte Mu noch einmal die Hand geschüttelt und zum Abschied gesagt: »Du hast meine Ehe gerettet. Ich bin dir etwas schuldig.«
Meister Li und das einfache Denken
Meister Li liebte es, seine Schüler um sich versammelt zu sehen, denn die ihm geschenkte Aufmerksamkeit spornte ihn immer wieder zu weiteren Denkabenteuern an. Und das wiederum wussten seine Schüler zu schätzen – zumeist Bildungsbeflissene aus den gehobenen Bevölkerungsschichten.
Umso befremdlicher war allerdings für diese Meister Lis Gewohnheit, sich von Zeit zu Zeit in die umliegenden Dörfer zu begeben und mit den dortigen Bauern und Fischern einen ganzen Tag zu verbringen: Mit Gesprächen, über deren Inhalt niemand sonst etwas wissen konnte, da Li T’ai-p’o diese Ausflüge allein zu unternehmen pflegte.
Es war Wu Tse-neng, der Sohn eines hohen Mandarins in der Hauptstadt, den seine Wanderlust und seine Wissbegierde an den T’ung-t’ing-See verschlagen hatten, der eines Tages aus der Gruppe der Schüler heraus die Frage aussprach, die alle um ihn herum bewegte:
»Ihr seid gewiss einer der klügsten und einfallsreichsten Menschen dieser Zeit, Meister. Meint Ihr wirklich, dass diese ungebildeten, grobschlächtigen Bauern und Fischerleute Euch verstehen können? Meint Ihr wirklich, diese einfachen Gehirne können Euren hoch fliegenden Gedanken folgen?«
Meister Li lächelte bei dieser Frage, nicht weil er sie für ungehörig hielt, sondern weil er wusste, dass es nicht wenigen seiner Schüler ähnlich ging wie Tse-neng.
»Da es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten, will ich versuchen, mich dir verständlich zu machen.«
Zustimmendes Gemurmel erklang: Ja, auf diese Antwort waren alle gespannt.
»Der Irrtum, auf dem deine Frage beruht, liegt darin, dass du annimmst, ich wollte meine Gedanken und Überlegungen an diese Dorfbewohner weitergeben. Diese Annahme ist falsch. Wenn diese Menschen solches von mir wissen wollten, würden sie sich um mich versammeln, so wie ihr alle hier mir zuhört. Nein, in Wahrheit bin ich derjenige, der hören will, was sie zu sagen haben.«
»Wie soll ich das glauben können, Meister?«, wagte Tse-neng zu widersprechen. »Was können diese Menschen wissen und verstehen, was Ihr nicht schon längst verinnerlicht habt? Ihr Denken ist doch viel zu einfach.«
»Eigentlich solltest du dir selbst diese Frage beantworten können«, sagte Meister Li. »Wenn du meinst, dass sie meinen Gedanken nicht folgen können, dann muss ich dir mitteilen, dass ich oft genug Mühe habe, ihre einfachen, ja vielleicht sogar zu einfachen Überlegungen zu begreifen. Gerade weil sie so einfach sind. Und ich höre aufmerksam zu und versuche zu verstehen, weil in ihnen oft eine praktische Weisheit steckt, zu der ich im Allgemeinen keinen Zugang hab. Wenn es mir aber gelingt, ihrem Denken zu folgen, eröffnen sich oft für mich Möglichkeiten zusätzlicher Erkenntnisse, über die ich sonst nicht verfügen würde.«
Über Meister Lis Gesicht huschte ein Lächeln. Er wusste, dass er seine Schüler mit dem Folgenden womöglich noch mehr verblüffen würde:
»Dazu kommt, dass einfache Menschen mit ihrer Art zu denken oft leichteren Zugang zum Reich der Geister und Feen, ja sogar der Dämonen haben.«
Tse-neng, der seinem Meister aufmerksam zugehört hatte, schwieg nach diesen Worten. Dann wagte er, mit zaghafter Stimme, die Frage:
»Ihr meint, dass sich das Eine und das Andere ergänzen?«
»Ja!«, bestätigte Meister Li. »Und ohne das Eine kann es das Andere nicht geben.«
Klappertopf
Bereits als junger Mann liebte Li T’ai-p’o die beschauliche Ruhe, die es ihm ermöglichte, seinen Gedanken zu folgen, die in ihm aufkeimten. Kaum hatte er sein Elternhaus verlassen und war an den T’ung-t’ing-See gezogen, lernte er ein wunderhübsches Mädchen kennen, für das sein Herz im Nu entflammte. Hao-mei, bezaubernde Pflaumenblüte, war ihr Name und alle beneideten T’ai-p’o wegen dieser Beziehung. Sehr rasch zog sie zu ihm, was verständlicherweise zu Gerede führte. Doch T’ai-p’o begegnete ihm mit dem Hinweis, dass er sie in kürzester Zeit zur Frau nehmen wolle.
Der junge Scholar hing sehr an Hao-mei, doch sehr schnell kam die Ernüchterung. Die junge Frau war eine hervorragende Köchin und T’ai-p’o sprach dem guten Essen mehr zu, als ihm guttat. Das Resultat war: Er nahm unverhältnismäßig schnell an Gewicht zu und begann geradezu unförmig zu werden. Das machte ihn körperlich wie mental unbeweglicher, sodass er darüber nachgrübelte, wie dies zu ändern sei. Die Lösung des Problems kam von unerwarteter Seite.
Hao-mei hatte rasch bemerkt, dass ihr neuer Gefährte ihrem Essen mehr als nur gerne zusprach, daher verdoppelte sie ihre Bemühungen in der Küche, zeitlich wie mengenmäßig. Diese Zubereitung der täglichen Mahlzeiten war zunehmend verbunden mit unverhältnismäßig starkem Lärm: Es klirrten Gläser, klapperten Töpfe, fielen diverse Dinge zu Boden und gingen eventuell sogar zu Bruch. Kurzum: T’ai-p’os Bedürfnis nach absoluter Ruhe, um seinen Gedanken freien Lauf lassen zu können, blieb ein dringendes Bedürfnis. Hao-mei war nicht zu bewegen, in der Küche – in der Hütte nahm sie einen wesentlichen Platz ein, sodass Li T’ai-p’o kaum Ausweichmöglichkeiten hatte, es sei denn, er ging ins Freie – weniger laut zu hantieren. Bis in den Schlaf hinein verfolgten ihn diese Geräusche und verursachten Albträume.
Eines Nachts, als der Scholar nach einem solch lärmbetonten Tag neben Hao-mei eingeschlafen war, bescherte ihm ein Traum einen Ausweg. Es erschien ihm ein Mann in der Kleidung eines adeligen Herrschers, den er nicht kannte.
»Ich bin der Herzog von Chou. Es ist dir wohl bislang entgangen, dass ich ein berühmtes Werk über Träume, deren Bedeutung und ihre Wechselbeziehung mit dem wirklichen Leben geschrieben habe. Deine aktuellen Träume sind schlimm. Sie belasten dich ebenso wie das tägliche Leben. Sie sind bis zu mir gedrungen und sind mir Grund genug, dir meine Erkenntnisse zu offenbaren. Da du meine Schrift nicht kennst, will ich dir einen Rat geben.«
Li T’ai-p’o merkte im Traum, wie sich sein Körper im Schlaf versteifte. Er brauchte keine Traumdeuter, er benötigte Hilfe im realen Leben. Sein Gast schien Gedanken lesen zu können, denn er reagierte sofort auf diesen Einwand:
»Ich verstehe, dass du glaubst, ich könnte dir nicht helfen. Das ist ein Irrtum, denn du stehst vor dem Dilemma, dass du dieses Mädchen verlierst, wenn du ihr die Lieblingsbeschäftigung nimmst. Sie klappert nun einmal gerne mit allen Töpfen, denn das ist ihr die akustische Bestätigung, dass sie etwas leistet und dir etwas Gutes tut. Es ist im besten Sinne für sie eine Bestätigung ihrer selbst.«
Hätte sich T’ai-p’o beim Schlafen selbst beobachten können, hätte er in diesem Moment bemerkt, dass er zustimmend nickte. Und er wusste sogleich, dass es keinen Ausweg gab. Hao-mei war eben doch keine Pflaumenblüte, sondern ein Klappertopf – für ihn schier unerträglich.
»Doch den gibt es!«, beteuerte sein Traumgast, als habe er auch diesmal seine Gedanken gelesen. »Ich kann dafür sorgen, dass alles gut wird. Du selbst hast den Hinweis gegeben, wie dies geschehen soll. Morgen, wenn du aufwachst, wirst du den Klappertopf – deine eigenen Worte! – neben dir finden. Dann gehe damit in den Garten hinter deiner Hütte; du wirst erkennen, was zu tun ist.«
Damit verschwand der Herzog von Chou und Li T’ai-p’o genoss einen langen, ruhigen Schlaf. Als er erwachte, suchte er vergebens nach Hao-mei, er fand sie nirgends. Doch als er neben dem Bett nachsah, erblickte er eine gelbblühende Pflanze, die sich in den Fußbodenritzen verwurzelt hatte. Als er sie anfasste, glaubte er ein leises Geräusch, ein Klappern wie beim Topfschlagen aus den Blüten zu vernehmen.
Da erinnerte er sich an seinen Traum und wusste mit einem Mal, was zu tun war.
Seitdem wächst der Klappertopf hinter Meister Lis Hütte. Viele seiner Schüler wollten ihn schon herausreißen, da er als Giftpflanze galt. Doch stets wurden sie vom Meister daran gehindert. In seiner Erinnerung war Hao-mei immer präsent. Wenn er den Klappertopf anschaute, sah er sie vor sich in der Küche hantieren.
Aber eben nur in seiner Fantasie.
Das Indiz
In einer Ecke seiner bescheidenen Behausung hatte Meister Li seine Bücher untergebracht. Eine auch inhaltlich beschränkte Bibliothek war das, in der Mehrzahl die unterschiedlichsten Ausgaben des I-Ching, jenes Orakel-Klassikers, mit dessen Hilfe gemeinhin die Zukunft vorher gesagt wurde. Meister Li freilich hatte dafür noch eine andere Verwendung.