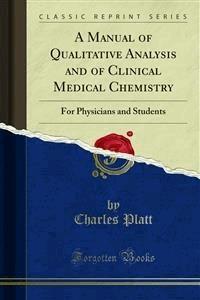8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Weltenschöpfer
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der drei Bände umfassenden Reihe präsentiert zwanzig der fast sechzig Essays, die auf Charles Platts Gesprächen mit bedeutenden SF-Persönlichkeiten basieren. Die Texte entstanden zwischen 1978 und 1982 und werden nun erstmals vollständig auf Deutsch vorgelegt. In zahlreichen zusätzlichen Texten und Ergänzungen, die Charles Platt jetzt, vier Jahrzehnte später, exklusiv für diese deutsche Ausgabe verfasst hat, erzählt er weitere Anekdoten und persönliche Erinnerungen an seine Gesprächspartner. In Band 2: Gespräche mit Ray Bradbury, Frank Herbert, Kate Wilhelm & Damon Knight, Michael Moorcock, J. G. Ballard, E. C. Tubb, Ian Watson, John Brunner, Gregory Benford, Robert Silverberg, Brian W. Aldiss, Jerry Pournelle, Larry Niven, Christopher Priest, William S. Burroughs, Arthur C. Clarke, Alvin Toffler, John T. Sladek, D. M. Thomas und Keith Roberts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Charles Platt
DIE
WELTEN
SCHÖPFER
Kommentierte Gespräche
mit Science-Fiction-Autorinnen
und -Autoren
Band 2
übersetzt von:
Frank Böhmert, Maike Hallmann, Horst Illmer,
Bernhard Kempen, Michael Plogmann,
Jakob Schmidt, Erik Simon, Dirk van den Boom,
Robert Wohlleben und Melanie Wylutzki
Impressum
Die Weltenschöpfer erschienen im Original erstmals 1980 und 1983 in zwei Bänden unter dem Titel Dream Makers, Band 1 deutsch 1982 als Gestalter der Zukunft. In der vorliegenden Neuausgabe ist der ursprüngliche Text vom Autor überarbeitet worden – geändert, umformuliert, erweitert, stellenweise auch gekürzt. Wo es sachlich möglich war, wurden Passagen aus Ronald M. Hahns Übersetzung der älteren deutschen Fassung übernommen.
Weitere Informationen zu den Originalausgaben finden Sie am Ende dieses Bandes.
Charles Platt
Die Weltenschöpfer – Band 2
© 2022 by Charles Platt
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
© der deutschen Ausgabe 2022 by Memoranda Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Hardy Kettlitz
Lektorat und Korrektur: Christian Winkelmann & Melanie Wylutzki
Gestaltung: s.BENeš [http://benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
Kontakt: [email protected]
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-66-3 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-67-0 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Inhalt
Ray Bradbury
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Frank Herbert
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Kate Wilhelm & Damon Knight
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Michael Moorcock
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
J. G. Ballard
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
E. C. Tubb
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Ian Watson
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
John Brunner
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Gregory Benford
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Robert Silverberg
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Brian W. Aldiss
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Jerry Pournelle
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Larry Niven
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Christopher Priest
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
William S. Burroughs
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Arthur C. Clarke
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Alvin Toffler
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
John T. Sladek
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
D. M. Thomas
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Keith Roberts
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Quellen und Originalausgaben der Porträts
Publikationsgeschichte und Copyrights
Bücher bei MEMORANDA
Ray Bradbury
Ray Bradburys Geschichten sprechen mit einer einzigartigen Stimme. Sie sind mit den Werken keines anderen Autors zu verwechseln. Und Bradbury selbst ist genauso unverwechselbar: ein charismatischer Individualist von eindringlichem, überschwänglichem Wesen und einer Art weit gefasster, epischer Hingabe an die Kräfte des Schöpfertums, des Lebens und der Kunst.
Er hat nichts übrig für kommerzielles Schreiben, das seelenlos für den Massenmarkt produziert wird:
»Das ist alles Dreck, alles Dreck, und ich predige da keine Tugend: Ich reagiere darauf, wie es mir meine Emotionen und Bedürfnisse vorschreiben; denn wenn man sich von dem abgewendet hat, was man eigentlich ist, wird es einen irgendwann krank machen. Wenn man nur für den Markt schreibt, wird man eines Tages aufwachen und es bedauern. Ich kenne eine Menge Drehbuchautoren; die machen immer nur Sachen für andere Leute, für Geld, weil es ihr Job ist. Anstatt zu sagen ›He, das sollte ich wirklich nicht tun‹, greifen sie zu, weil es ein schneller Job ist und weil sie im Abspann genannt werden. Aber keiner erinnert sich später daran. Fragen Sie mal irgendwelche etablierten Autoren in Los Angeles ›Wer hat das Drehbuch für Vom Winde verweht geschrieben?‹, und sie können es Ihnen nicht sagen. Oder das Drehbuch für Der unsichtbare Dritte? Oder das Drehbuch für Psycho – selbst ich könnte Ihnen das nicht sagen, und ich habe den Film achtmal gesehen. Diese Leute sind die Laufburschen des Marktes; sie werden alt und einsam und neidisch, und sie werden nicht geliebt, weil sich keiner an sie erinnert.
Mit Romanen und Kurzgeschichten, Essays und Gedichten haben Sie zwar unvermeidlich kein solch großes Publikum, aber mit etwas Glück haben Sie eine ständige Gruppe von Anhängern, die Sie lieben, Leute, die gelegentlich in Ihr Leben treten und Sie mit so strahlendem Gesicht und so strahlenden Augen anschauen, dass man diese Liebe gar nicht infrage stellen kann, sie ist da, man kann sie nicht vortäuschen. Wenn man über die Straße geht und jemanden trifft, den man seit Jahren nicht mehr gesehen hat – dieser Blick! Man sieht einen, und dieses Licht, es ist plötzlich da und sagt: Mein Gott, da bist du ja, Herr im Himmel, es ist fünf Jahre her, komm, ich gebe dir einen aus. Und man geht in eine Bar, und … und diese wunderschöne Sache, die die Freundschaft einem gibt, das ist es doch, was wir wollen. Und der ganze Rest ist Dreck. Wirklich. Das ist es, was wir vom Leben haben wollen …« Er schlägt mit der Faust auf die Glasplatte seines großen, runden Couchtisches. »Wir wollen Freunde!
Im ganzen Leben haben die meisten Leute nur einen oder zwei anständige Freunde, Freunde von Dauer. Ich habe fünf, vielleicht sogar sechs. Und eine anständige Ehe und Kinder und die Arbeit, die wirklich Spaß macht, und die Fans, die sich um diese Arbeit scharen – mein Gott, das ist das ganze Leben, nicht wahr? Aber die Drehbuchautoren haben dies nie, und das ist fürchterlich traurig.
Oder die Harold Robbinse der Welt – ich meine, wahrscheinlich ist er ja ein ganz netter Kerl. Aber das kümmert keinen, keinen kümmert es, dass er diese Bücher geschrieben hat, weil es kommerzielle Bücher sind, und es liegt kein Moment der Wahrheit in ihnen, der ans Herz geht. Es fehlen die Erhabenheit und die Erheiterung gewisser Tage … dieser großartigen Tage, an denen man hinausgeht und es ist genug, einfach zu leben, das Sonnenlicht fährt einem in die Nase und kommt einem aus den Ohren wieder heraus, nicht wahr? Darauf kommt es an. Und der Rest? An dem Konzept basteln, wie man einen Bestseller schreibt – wie langweilig!
Mein Gott, ich würde mich umbringen, wirklich, ich könnte so nicht leben. Und ich moralisiere nicht. Ich spreche aus den geheimen Springquellen des Nervensystems heraus. Ich kann so etwas nicht machen, und nicht etwa weil es moralisch falsch und nicht tugendhaft ist, sondern weil ich es nicht verkraften könnte, letzten Endes dem Geschenk des Lebens zuwiderzuhandeln. Wenn man sich von den natürlichen Werten abwendet, die Gott einem gegeben hat oder die das Universum einem gegeben hat, wie immer man sich ausdrücken will, dann wird man zu schnell alt. Man wird verbittert, man wird zynisch, ein raffinierter Zyniker, weil man getan hat, was man getan hat. Man wird tot sein, noch ehe man stirbt. Das ist keine Art zu leben.«
Er spricht mit voller, kräftiger Stimme, als er diese begeisterte Predigt hält – wahrlich mit der Stimme eines feurigen Predigers. Für dieses Interview mag er sich eines leicht schärferen Tonfalls befleißigen und etwas übertreiben, um seinen Ansichten Nachdruck zu verleihen, aber ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. Diese Abschnitte von ekstatischer Prosa in seiner Literatur, die den kräftigen Bildern der Kindheit Tribut zollen, dem grandiosen Wüten Flammen ausstoßender Raketen, dem erlesenen Geheimnis des Mars, überhaupt der allumfassenden wunderbaren Beschaffenheit des Universums – er scheint das Leben wirklich in diesen Begriffen zu erfahren.
Zwar haben auch intellektuelle Kontrolle und kalte, harte Vernunft ihren Platz, erklärt er, doch beim Schöpfungsprozess müssen sie dem Gefühl weichen:
»Es dauert einen Tag, um eine Kurzgeschichte zu schreiben. Am Ende des Tages sagt man sich: Dieses scheint zu funktionieren, was nicht? Nun, da ist eine Szene, die stimmt einfach nicht, was fehlt? Gut, der Intellekt kann einem da helfen. Und am nächsten Tag kehrt man zu der Geschichte zurück und explodiert erneut, ausgehend von dem, was man abends zuvor durch seinen Intellekt erfahren hat. Aber es muss eine wahre Explosion sein, die in ein paar Stunden vorüber ist, wenn sie ehrlich sein soll.
Nur auf den Intellekt zu vertrauen ist sehr gefährlich. Er kann einem völlig den Weg verbauen. Der Intellekt soll uns davor schützen, uns selbst Schaden zuzufügen – vor einem Sturz von einem Abhang oder vor einer schlechten Beziehung, vor Liebesaffären, vor denen uns nur unser Verstand bewahrt. Dafür ist der Intellekt da. Aber er sollte nicht zum Mittelpunkt aller Dinge werden. Wenn man versucht, den Intellekt zum Mittelpunkt des Lebens zu machen, verdirbt man sich doch den ganzen Spaß, nicht wahr? Man steigt aus dem Bett von Leuten, bevor man überhaupt zu ihnen ins Bett gestiegen ist! Wenn es so weit kommt … Die ganze Welt würde sterben, wir hätten überhaupt keine Kinder mehr!« Er lacht. »Man würde überhaupt keine Beziehung mehr eingehen, man würde sich vor jeder Freundschaft fürchten und paranoid werden. Wenn man nicht aufpasst, kann der Intellekt einen gegenüber allem paranoid werden lassen, auch gegenüber der Kreativität. Warum also warten wir nicht mit dem Denken, bis es geschehen ist? Das tut kein bisschen weh.«
Ich habe den Eindruck, dass Bradburys Weltsicht und seine Geschichten schamlos romantisch sind. Doch mit diesem Begriff scheint er ganz und gar nicht einverstanden zu sein.
»Ich bin nicht ganz sicher, ob ich weiß, was er bedeutet. Was kann man dafür, wenn einen gewisse Dinge lachen oder weinen lassen? Sie beschreiben damit nur einen Prozess. Vor drei Jahren bin ich zum ersten Mal nach Cape Canaveral gefahren, und ja, ich dachte, das ist meine Heimatstadt! Hier komme ich her, und das ist alles in den letzten zwanzig Jahren hinter meinem Rücken gebaut worden. Ich gehe in die Montagehalle der Raumfahrzeuge, die 400 Fuß hoch ist[1], und fahre mit dem Fahrstuhl hinauf und blicke hinab – und die Tränen schießen mir aus den Augen. Sie schießen mir wirklich aus den Augen! Ich verspüre die gleiche Ehrfurcht wie in Chartres oder beim Betreten von Notre Dame oder des Petersdoms. Die Größe dieser Kathedrale, wo die Raketen zum Mond starten, ist so wunderbar, dass ich nicht weiß, wie ich sie beschreiben soll. Als ich hinausgehe, mit Tränen in den Augen, drehe ich mich zu meinem Fahrer um und sage: ›Wie zum Teufel soll ich das niederschreiben? Es war, als wäre ich in Shakespeares Kopf herumspaziert.‹ Und sobald ich das gesagt hatte, wusste ich, dass ich meine Metapher gefunden hatte. An diesem Abend setzte ich mich im Zug an meine Schreibmaschine und schrieb ein siebenseitiges Gedicht, das in meinem letzten Gedichtband erschienen ist, über meine Erfahrung, wie ich auf Cape Canaveral in Shakespeares Kopf herumgegangen bin.
Wenn das romantisch ist, dann wurde ich eben mit romantischen Genen geboren. Ich weine wohl mehr … Mir kommen die Tränen schnell, aber ich lache auch schnell, ich versuche, damit zu leben und es nicht zu unterdrücken. Wenn das also romantisch ist, dann bin ich wohl ein Romantiker, aber ich weiß wirklich nicht, was dieser Begriff bedeutet. Ich habe gehört, dass er auf Leute wie Byron angewendet wurde, und der war in vielerlei Hinsicht ein schrecklicher Narr, besonders mit der Art, wie er schließlich sein Leben verspielte. Ich hasse es, wenn ich sehe, dass jemand sinnloserweise der Welt verloren geht. Wir hätten ihn noch fünf Jahre haben sollen … oder wie wäre es mit zwanzig? Ich glaube schon, dass er ein törichter Romantiker war, aber so genau kenne ich sein Leben auch wieder nicht. Ich bin ein bisschen von allem; ich halte George Bernard Shaw für keinen besonders großen Romantiker, und doch bin ich ein großer Anhänger von ihm. Er hat mich tief beeinflusst, zusammen mit Leuten wie Shakespeare oder Melville. Ich bin ganz verrückt nach Shaw; ich trage ihn überall bei mir. Ich lese seine Vorworte immer wieder.«
Ganz abgesehen von der romantischen Weltsicht, die ich bei Bradbury wahrnehme, ist Bradbury entschieden ein Autor, dessen Werk immer wieder ein Gefühl von Nostalgie vermittelt. Viele Geschichten blicken auf vergangene Zeiten zurück, in denen alles einfacher war und die Technik noch nicht die Grundlagen des Kleinstadtlebens untergraben hatte. Ich frage ihn, ob er weiß, woher seine Zuneigung zum Einfachen stammt.
»Ich bin in Waukegan, Illinois, aufgewachsen, einer Stadt mit rund 32.000 Einwohnern, und in so einer Stadt geht man als Kind überallhin. Bis zu meinem zwölften Lebensjahr hatten wir keinen Wagen. Ich bin daher nicht viel in Autos gefahren, bis ich mit vierzehn westwärts nach Los Angeles zog. Wir hatten kein Telefon in unserer Familie, bis ich etwa fünfzehn und auf der Highschool war. Wir hatten eine ganze Menge nicht; wir waren eine sehr arme Familie. Also fängt man mit den einfachen Dingen an, und man respektiert sie. Man respektiert es, zu Fuß zu gehen, man hat Achtung vor einer Kleinstadt und vor der Bibliothek, in der man sich seine Bildung zulegt – womit ich begann, als ich neun oder zehn war. Ich war schon immer ein guter Schwimmer und gut zu Fuß und gut mit dem Fahrrad. Ich habe festgestellt, dass mir jedes Mal, wenn ich niedergeschlagen oder aus irgendeinem Grund besorgt war, das Schwimmen oder Wandern oder Radfahren darüber hinweggeholfen hat. Es säubert das Blut und klärt den Verstand, und danach ist man bereit, wieder an seine Arbeit zu gehen.«
Er erzählt von seinen früheren Ambitionen:
»Ich hatte verschiedene Interessen. Ich wollte immer Zeichner werden und meinen eigenen Comicstrip haben. Und ich wollte Filme machen und auf der Bühne stehen und ein Architekt sein … Ich war schrecklich in die Architektur der Zukunft verschossen, die ich auf den Fotos von den vielen Weltausstellungen sah, die meiner Geburt vorausgegangen waren. Und als ich dann mit zehn oder elf Edgar Rice Burroughs las, wollte ich Marsgeschichten schreiben. Als ich dann mit zwölf zu schreiben begann, war das das Erste. Ich habe eine Fortsetzung zu einem Buch von Edgar Rice Burroughs geschrieben.
Mit siebzehn habe ich in Los Angeles immer die Science-Fantasy-Treffen in der Innenstadt besucht. Wir gingen in Clifton’s Cafeteria; Forrest Ackerman und seine Freunde holten die Gruppe dort jeden Donnerstagabend zusammen, und man konnte hingehen und Henry Kuttner begegnen und C. L. Moore und Jack Williamson und Edmond Hamilton und Leigh Brackett … Mein Gott, war das schön, ich war siebzehn, ich wollte Helden haben, und sie behandelten mich wunderbar. Sie akzeptierten mich. Ich kenne noch immer praktisch jeden im Genre, zumindest von den alten Zeiten her. Ich liebe sie alle. Als ich neunzehn war, war Robert Heinlein mein Lehrer.
Aber man kann nicht ewig dabeibleiben, eine Familie muss wachsen. Wenn man seine Kinder in die Welt entlässt – ich habe vier Töchter –, sagt man auch nicht: ›Hier ist die Grenze, du kannst nicht dort hinausgehen.‹ Also fing ich mit neunzehn an, erwachsen zu werden. Mit zwanzig gesellte ich mich zu kleinen Theatergruppen und begann mit anderen Literaturformen zu experimentieren. Ich hielt meine Kontakte zu den Science-Fiction-Gruppen noch, aber ich durfte es nicht einfach dabei bewenden lassen.
Ungefähr mit vierundzwanzig versuchte ich Geschichten an COLLIER’S und HARPER’S und THE ATLANTIC zu verkaufen, und ich wollte in THE BEST AMERICAN SHORT STORIES erscheinen. Aber das gelang mir nicht. Ich hatte einen Freund, der einen Psychiater kannte. ›Kannst du mir mal deinen Psychiater für einen Nachmittag leihen?‹, fragte ich ihn. Eine Stunde kostete zwanzig Dollar! Ich brauchte meinen vollen Wochenlohn für eine Stunde bei diesem Burschen. Ich ging also hin, und er sagte: ›Mr. Bradbury, was für ein Problem haben Sie?‹ Und ich sagte: ›Na, zum Teufel, es passiert einfach nichts.‹ Und so fragte er: ›Was soll denn passieren?‹ ›Na ja‹, sagte ich, ›ich will der größte Schriftsteller aller Zeiten werden.‹ ›Aber dazu braucht man doch etwas Zeit, oder?‹, meinte er. ›Haben Sie schon einmal in der Enzyklopädie gelesen? Dann gehen Sie mal in die Bibliothek und lesen Sie über das Leben von Balzac und du Maupassant und Dickens und Tolstoi nach und sehen Sie, wie lange die brauchten, um zu dem zu werden, was sie geworden sind.‹
Also ging ich in die Bibliothek und las nach und fand heraus, dass auch sie warten mussten. Und ein Jahr später begann ich an den AMERICAN MERCURY und an COLLIER’S zu verkaufen, und mit sechsundzwanzig erschien ich in THE BEST AMERICAN SHORT STORIES. Ich machte noch immer nicht viel Geld damit, aber ich bekam die Anerkennung, die ich brauchte, die Liebe, die ich von den Leuten haben wollte, zu denen ich emporsah. Die intellektuelle Elite Amerikas meinte jetzt allmählich: ›He, du bist in Ordnung, du wirst es schaffen.‹ Und dann sagte mir meine Freundin Maggie das Gleiche. Und dann war es mir egal, ob die Leute um mich herum über mich spotteten. Ich war bereit zu warten.«
In der Tat hat Bradbury in den späten 50er- und 60er-Jahren wahrscheinlich mehr kritische Würdigungen erhalten als jeder andere Science-Fiction-Autor. In seinem Werk benutzte er sehr wenig technischen Jargon, was es für »Außenstehende« leichter zugänglich machte, und er erwarb sich eine Reputation als Stilist, und sei es auch nur, weil damals so wenige Science-Fiction-Autoren überhaupt auf den Stil achteten.
Auf dem Gebiet der Science Fiction selbst hat Bradbury jedoch nie so viel Zuspruch erhalten, gemessen (zum Beispiel) an Hugo- oder Nebula-Preisen. Ärgert ihn das?
»Das ist ein sehr gefährliches Thema.« Er überlegt. Bis zu diesem Moment hat er bereitwillig und voller Selbstvertrauen gesprochen. Jetzt scheint ihm unbehaglich zu sein. »Ich verließ die Familie, verstehen Sie? Und darin liegt eine Gefahr … für sie. Weil sie das Haus nicht verlassen haben. Es ist so, als würde Ihr älterer Bruder plötzlich aus dem Haus gehen – wie kann er es wagen, mich zu verlassen? Mein Held, von dessen Schutz ich völlig abhängig war. So eine Art Gefühl ist da. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber sobald man aus dem Haus gegangen ist und zurückschaut, und sie drücken die Nasen gegen die Fensterscheiben, dann will man sagen: ›He, kommt schon, es ist gar nicht so schwer, kommt doch auch heraus!‹
Aber ein jeder bringt zu einer gewissen Zeit mehr oder weniger Tollkühnheit auf. Man braucht eine gewisse Menge an … Es ist kein Wagemut, es ist die Bereitschaft, etwas auszuprobieren. Denn im Grunde bin ich ein Feigling. Ich habe Höhenangst, ich fliege nicht, ich fahre nicht Auto. Ich kann also wirklich nicht von mir behaupten, besonders tapfer zu sein. Aber der Teil von mir, der ein Schriftsteller ist, wollte es draußen in der weiten Welt versuchen, und ich konnte mir einfach nicht helfen, ich musste hinausgehen.
Ich wusste, dass ich auf eine bestimmte Art schreiben und etwas riskieren musste. Drei oder vier Jahre lang, von meinem neunzehnten bis zu meinem zweiundzwanzigsten, dreiundzwanzigsten Lebensjahr, verkaufte ich Zeitungen an der Straßenecke. Ich machte damit zehn Dollar die Woche, also gar nichts, und das hieß, dass ich keine Mädchen ausführen und mit ihnen einen halbwegs anständigen Abend verbringen konnte. Ich konnte ihnen eine Malzmilch für zehn Cent ausgeben und sie auf einen der billigen Plätze im Kino einladen und sie dann nach Hause bringen. Den Bus konnten wir nicht nehmen, ich hatte kein Geld mehr. Wie gesagt, ich habe mich nicht aus Tugendhaftigkeit dafür entschieden; es war reiner Instinkt. Ich wusste genau, wie ich meine Schäfchen ins Trockne zu bringen hatte.
Ehe ich Mitte zwanzig war, begann ich für WEIRD TALES zu schreiben, verkaufte meine Kurzgeschichten dorthin, bekam zwanzig oder dreißig Dollar das Stück dafür. Wissen Sie, alle Geschichten aus The Martian Chronicles, bis auf zwei, brachten ursprünglich vierzig, fünfzig Dollar das Stück.
Mit fünfundzwanzig traf ich Maggie. Sie arbeitete in einer Buchhandlung in der Innenstadt von Los Angeles und hatte so ziemlich die gleichen Ansichten wie ich – sie interessierte sich für Bücher, für Sprache, für Literatur … Und sie war nicht daran interessiert, einen reichen Freund zu bekommen; toll, denn ich war alles andere als reich. Wir heirateten zwei Jahre später, und in den 32 Jahren unserer Ehe hatten wir nur ein einziges Mal ein Problem mit dem Geld. Ein einziger Fall im Zusammenhang mit einem Schauspiel. Die restliche Zeit haben wir nie über Geld geredet. Wir wussten, dass wir kein Geld auf der Bank hatten, wozu also über etwas reden, das man nicht hat?
Ein paar Jahre lang wohnten wir in Venice, Kalifornien, in unserer kleinen Wohnung für 30 Dollar den Monat, und unsere ersten Kinder kamen, was uns Angst machte, weil wir kein Geld hatten, und dann begann Gott für uns zu sorgen. Sobald das erste Kind kam, ging mein Einkommen von 50 Dollar die Woche auf 90 Dollar die Woche hoch. Mit 33 verdiente ich 110 Dollar die Woche. Und dann kam John Huston und gab mir Moby Dick [den Film, für den Bradbury das Drehbuch schrieb], und binnen eines Jahres kletterte mein Einkommen steil in die Höhe und fiel dann nächstes Jahr wieder ab, weil ich mich entschlossen hatte, die nächsten drei Jahre keine Drehbücher zu schreiben – eine gleichermaßen bewusste und intuitive Entscheidung, mehr Bücher zu schreiben und mir eine Reputation aufzubauen. Denn, wie ich schon sagte, heute weiß keiner mehr, wer die Filmfassung von Moby Dick geschrieben hat.
Los Angeles hat mir sehr weitergeholfen, weil hier Hollywood – die Filme – mit der Geburt bestimmter Technikentwicklungen zusammenkam. Seit ich drei Jahre alt war, bin ich vom Film begeistert. Ich bin kein reiner Science-Fiction-Autor, im Grunde meines Herzens bin ich ein Filmfanatiker, und mein gesamtes Werk ist davon angesteckt. Viele meiner Kurzgeschichten könnten vom Manuskript weg verfilmt werden. Als ich vor acht oder neun Jahren Sam Packinpah kennenlernte und eine Freundschaft zwischen uns entstand und er Something Wicked This Way Comes verfilmen wollte, sagte ich: ›Wie packst du das an?‹ ›Ich reiße die Seiten aus deinem Buch‹, meinte er, ›und stopfe sie in die Kamera.‹ Er hatte völlig recht. Da ich ein illegitimer Sohn von Erich von Stroheim und Lon Chaney bin – ein Kind des Kinos, ha! –, ist es nur natürlich, dass fast alle meine Arbeiten fotogen sind.«
Ist er mit der Verfilmung seiner Geschichten zufrieden?
»Mit Fahrenheit 451 war ich zufrieden. Ich denke, das ist ein wunderbarer Film mit einem grandiosen Ende. Einem großartigen Ende von Truffaut. Den Illustrated Man habe ich verabscheut; ein schrecklicher Film. Ich habe jetzt die Rechte zurückerhalten, und wir werden ihn irgendwann in den nächsten Jahren neu drehen. Moby Dick – dieser Film bewegt mich ungeheuer. Ich bin sehr glücklich damit. Ich sehe Dinge, die ich jetzt, fünfundzwanzig Jahre später, besser machen könnte, ganz einfach weil ich sie besser verstehe, über Shakespeare und die Bibel, bei denen Melville letztlich gelernt hat. Ohne die Bibel und Shakespeare wäre Moby Dick niemals entstanden. Dennoch, bei allen Schwachpunkten und bei dem Problem, dass Gregory Peck nicht ganz der richtige Mann für den Ahab war – ich hätte jemanden wie Olivier gewollt; mit Olivier wäre der Film ganz phantastisch geworden –, trotz alledem bin ich immer noch sehr zufrieden.«
In den letzten Jahren hat sich Bradbury in immer stärkerem Maße von Kurzgeschichten hin zu Gedichten gewandt, aber nicht alle seine Gedichte wurden gut aufgenommen. Ich frage ihn, ob er unter dieser höchst irritierenden Kritik leidet: dass ihm Leute sagen, seine früheren Werke seien besser gewesen.
»O ja, und sie … sie haben natürlich nicht recht. Steinbeck musste auch damit klarkommen. Ich weiß noch, wie ich ihn das sagen gehört habe. Und es ist Unsinn. Ich schreibe jetzt in meinen Gedichten, was ich vor dreißig Jahren niemals hätte schreiben können. Und ich bin sehr stolz darauf. Einige der Gedichte, die in den letzten beiden Jahren aus meinem Kopf geströmt sind, sind einfach unglaublich. Ich weiß nicht, woher zum Teufel sie kommen, aber … mein Gott, sie sind gut! Ich habe mindestens drei Gedichte geschrieben, die in siebzig, in hundert Jahren noch Bestand haben werden. Nur drei Gedichte, sagen Sie? Aber der Ruf der meisten großen Dichter beruht auf nur einem oder zwei Gedichten. Ich meine, wenn Sie an Yeats denken, dann denken Sie an ›Sailing to Byzantium‹, und dann nennen Sie mir mal, wenn Sie nicht gerade ein Yeats-Fan sind, sechs andere Gedichte von ihm.
Ein Gedicht im Leben schreiben zu können, von dem man fühlt, dass es so gut ist, dass es eine Zeit lang Bestand haben wird … Und mir ist das gelungen, verdammt, mir ist das gelungen – mindestens drei Gedichte … und eine Menge Kurzgeschichten. Vor einem Jahr habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben, ›Gotcha‹, Mann, verdammt, die ist dermaßen gut, einfach toll! Und noch eine, ›The Burning Man‹, die ich vor zwei Jahren geschrieben habe … und dann manche von meinen neuen Theaterstücken, das neue Fahrenheit 451, ein völlig neues Schauspiel, das auf dem beruht, was meine Figuren mir an der Schreibmaschine geben. Ich habe keine Kontrolle über sie. Sie leben ihr Leben wieder von Neuem, neunundzwanzig Jahre später, und sie sprechen gute Dialoge. Solange ich die Kanäle zwischen meinem Unterbewusstsein und meinem äußeren Selbst offen halten kann, wird es gut bleiben.
Ich weiß nicht, wie ich das mache, wenn ich Gedichte schreibe. Es geschieht instinktiv, von den Jahren und Jahren und Jahren, in denen ich Shakespeare gelesen habe und Pope – ich bewundere Pope sehr – und Dylan Thomas, oft weiß ich nicht, was zum Teufel er da sagt, aber bei Gott, es klingt gut, Jesus, das tönt, nicht wahr? Das ist so klar wie Kristall. Und dann schaut man näher hin und sagt, es ist Kristall – aber ich habe keine Ahnung, wie er geschliffen ist. Aber das kümmert einen nicht! Wie gesagt, für mich ist das unbewusst. Die Leute kommen und sagen, oh, Sie haben hier ein Couplet in Alexandrinern geschrieben. Ja, sag ich, wirklich? Ich war so dumm, ich dachte, ein Alexandriner hätte etwas mit Alexander Pope zu tun!
Aber wenn man jeden Tag im Leben Lyrik gelesen hat, dann greift man Rhythmen auf, dann greift man den Takt auf, dann greift man Binnenreime auf. Und dann, an irgendeinem Tag in seinem fünfundvierzigsten Jahr, bereitet einem sein Unterbewusstsein eine Überraschung. Man bringt endlich etwas Anständiges zustande. Aber ich musste dreißig, fünfunddreißig Jahre lang schreiben, bevor ich auch nur ein Gedicht schrieb, das mir gefiel.«
Man kann diesem Mann seine Energie und seinen Enthusiasmus nicht absprechen. Er drückt ihn so direkt und ohne Berechnung aus, dass man ihn einfach mögen muss, ob man nun seine Ansichten und Meinungen teilt oder nicht. Er strahlt eine Mischung von Unschuld und Aufrichtigkeit aus; beim Sprechen sieht er einen direkt an, als will er einen auf seine Seite ziehen und veranlassen, seinen Enthusiasmus mit ihm zu teilen. Er ist ein sonnengebräunter, stattlicher Mann mit weißem Haar und oft weißer oder heller Kleidung. Als ich ihm zum ersten Mal auf irgendeinem Science-Fiction-Con begegnete, wirkte er fast königlich in seinem weißen Anzug, umgeben von einem Schwarm kaum halbwüchsiger schlampiger Fans in unansehnlichen T-Shirts und Jeans. Und doch schien er auf einer Wellenlänge mit ihnen zu sein. Trotz seines gesunden Selbstbewusstseins blickt er nicht auf seine jüngeren Bewunderer herab, vielleicht weil er selbst sich im Herzen immer noch so jung fühlt (und auch so aussieht). Wie ein Kind hat er ein Gefühl für das Wunderbare und einen naiven, idealistischen Geist, und er geht staunend durch die Welt.
Er ist der Science Fiction nicht überdrüssig und nicht von ihr desillusioniert, ebenso wenig von ihrem Kernthema, der Weltraumfahrt.
»Es ist schon erstaunlich, wie die Kinder der Welt in den letzten zehn Jahren begonnen haben, ihre Lehrer zu bilden, indem sie sagten: ›Hier haben Sie Science Fiction; lesen Sie das mal!‹ Und die Lehrer haben es gelesen und gesagt: ›He, das ist nicht schlecht!‹, und haben begonnen, SF zu unterrichten. Erst in den letzten sieben oder acht Jahren hat die Science Fiction Anerkennung gefunden.
Orwells Neunzehnhundertvierundachtzig erschien diesen Sommer vor dreißig Jahren. Keine Erwähnung der Raumfahrt darin, als eine Alternative zum Großen Bruder, als Möglichkeit, ihm zu entkommen. Das beweist, wie kurzsichtig die Intellektuellen der 30er- oder 40er-Jahre über die Zukunft dachten. Sie wollten etwas so Aufregendes und Seelenöffnendes und Offenbarendes wie die Raumfahrt einfach nicht sehen. Weil wir entkommen können, und ein Entkommen ist für den menschlichen Geist sehr wichtig, sehr anregend. Vor 400 Jahren sind wir aus Europa entkommen, und alles war zum Besten, und mit dem, was wir aus dieser Flucht gelernt hatten, konnten wir zurückkehren und sagen ›He, jetzt werden wir euch erneuern, wir haben unsere Revolution gehabt, und vielleicht können wir uns jetzt zusammen gegen gewisse Dinge auflehnen‹. Ich will darauf hinaus, dass sich der intellektuelle Snobismus überall verbreitet hat, alle Romane eingeschlossen, außer in der Science Fiction. Erst in den letzten zehn Jahren können wir zurückschauen und sagen: ›O mein Gott, diese Leute haben uns wirklich die ganze Zeit am Haken gehabt, und es ist ein Wunder, dass wir überlebt haben.‹«
Aber, gebe ich zu bedenken, die mythische Beschaffenheit der Raumfahrt ist doch jetzt, da die NASA sie zu einer alltäglichen Realität gemacht hat, größtenteils verloren gegangen.
»Ich glaube, dass jede große Tat irgendwann einmal eine Menge Leute langweilt«, erwidert er, »und dann ist es an uns ›Romantikern‹, hm, das Unternehmen fortzusetzen. Denn mein Enthusiasmus bleibt unverändert. Seit damals, als ich meine ersten Weltraumbilder auf den Umschlägen von SCIENCE AND INVENTION oder WONDER STORIES sah – ich war acht oder neun –, steckt dieses Zeug in mir. Carl Sagan, ein Freund von mir, er ist ein ›Romantiker‹, er liebt Edgar Rice Burroughs – ich weiß es, er hat es mir gesagt. Und Bruce Murray, noch ein Freund von mir, der Präsident der Jet Propulsion Laboratories – zum ersten Mal, dass ich jemanden kenne, der irgendwovon Präsident geworden ist! –, der ist ein Mensch, und darauf kommt es in erster Linie an, und in zweiter Linie ist er zufällig der Präsident einer großen Firma, die unsere Raketen zum Jupiter und zum Mars schickt. Ich glaube nicht, dass die Raumfahrt entmystifiziert wurde. Ich glaube, eine Menge Leute waren von Anfang an nicht bezaubert davon, und das ist eine Schande.«
Ist Bradbury froh über das Wachstum der Science Fiction? Gefällt ihm die moderne kommerzielle Ausbeutung des Genres – etwa in Filmen wie Krieg der Sterne?
»Krieg der Sterne – schwachsinnig, aber wundervoll, ein großartiger, dummer Film. Wie wenn man in eine wirklich dumme Frau verliebt ist.« Er lacht kurz, erheitert von seiner Metapher. »Aber man kann seine Hände nicht von ihr lassen, so ist das mit Krieg der Sterne. Und dann kommt Unheimliche Begegnung der dritten Art, und der Film hat Verstand, und so steigt man mit einem wundervollen Film ins Bett. Und dann kommt so was wie Alien vorbei, ein Horrorfilm im Weltraum, und er sieht großartig aus, großartig. Wir akzeptieren also jede Hilfe, die wir bekommen können, aber der Traum bleibt der gleiche: Überleben im All, Eroberung des Alls, und das eingedenk der ganzen Geschichte der menschlichen Rasse mit all unseren Dummheiten, eingedenk all der dummen Dinge, die wir sind, der schwachsinnigen Geschöpfe, der zerbrechlichen, gebrochenen Geschöpfe. Ich versuche das zu akzeptieren, ich sage, na gut, wir sind auch die Geister von Shakespeare, Plato, Euripides und Aristoteles, Macchiavelli und da Vinci und einer Menge erstaunlicher Menschen, die alles gegeben haben, um uns zu helfen. Das ist es, was mir inmitten all dieser Dummheit noch Hoffnung gibt. Wir werden also versuchen – und es auch tun –, zum Mond zu gelangen, zum Mars zu gelangen, nach Alpha Centauri zu gelangen, und das werden wir in den nächsten 500 Jahren schaffen, was ein sehr kurzer Zeitraum ist, vielleicht auch schon früher, in 200 Jahren. Und dann auf ewig überleben, darauf kommt es an. O Gott, wie gern würde ich alle 100 Jahre zurückkommen und uns beobachten.
Und das ist es, das ist das Wesen des Optimismus – dass ich glaube, dass wir es schaffen werden und dass wir stolz werden. Und wir werden dumm sein und all die dummen Fehler machen, und zeitweise werden wir uns selbst hassen, aber die andere Zeit werden wir feiern.«
(Mai 1979)
Historischer Kontext
Es war nicht leicht, ein Interview mit Ray Bradbury zu bekommen. Zunächst schickte er meine Anfrage mit einer an den unteren Rand gekritzelten Notiz zurück: »Mir ist derzeit nicht danach, noch mehr Teile von mir preiszugeben.«
Aber zu den Dingen, die ich im Journalismus gelernt habe, gehört, dass sich Hartnäckigkeit lohnt. Ich war damals mit Harlan Ellison befreundet und fragte ihn, ob er bei Ray ein gutes Wort für mich einlegen wolle.
Rückblickend habe ich den Eindruck, dass Ellison und Bradbury keine engen Freunde waren. Immerhin hatten sie ein gutes Verhältnis zueinander und erfreuten sich gegenseitiger Achtung, also erklärte sich Bradbury einverstanden, Ellisons Haus zu besuchen, als ich ein paar Wochen später dort untergekommen war. Das Problem war nur, dass Bradbury kein Auto fährt. Ich musste zu ihm fahren, ihn abholen und zu Ellison bringen.
Die Fahrt war ein wenig schwierig. Bradbury klammerte sich sofort mit einer Hand ans Armaturenbrett und hielt sich eisern fest, egal wie langsam ich fuhr. Vielleicht fühlte er sich damit ein wenig sicherer, oder es war seine Art, mich wissen zu lassen, dass ich wirklich sehr, sehr vorsichtig fahren sollte.
Als wir Ellisons Haus erreichten, entspannte er sich sichtlich. Bald lächelte und plauderte er, als Ellison ihn im Haus herumführte, Witze machte und zu jedem Ornament und jedem gerahmten Stück Kunst Hintergründe erzählte.
»Ein wunderbares Haus«, sagte Bradbury am Ende des Rundgangs. »Wunderbar!«
Er war anscheinend im Begriff, wieder zu gehen. »Also, was das Interview betrifft …«, sagte ich.
Er wandte sich mir zu. Unverhofft streckte er eine Hand aus und packte mich am Halse. Er schüttelte mich ein wenig, wie eine Katze, die prüft, ob eine Maus noch lebt. Er grinste aber dabei. »Schon gut, schon gut«, sagte er, und wir verabredeten uns für den nächsten Abend.
Als ich ihn besuchte, saß er während des ganzen Interviews auf dem Fußboden, wobei er sich manchmal nach vorn beugte, die Ellenbogen auf einem Couchtisch. Ich fühlte mich unbehaglich, wie ich so auf einem Stuhl saß und von meinem Aussichtspunkt herabschaute, aber so schien er es haben zu wollen. In Autos fühlte er sich offensichtlich unwohl, auf Stühlen also vielleicht auch.
Er gab ein gutes Interview, obwohl ich glaube, er hatte eigentlich immer noch keine Lust. Aus seiner Sicht war dabei nichts zu gewinnen. Mein Interview würde ihn weder berühmter machen, als er schon war, noch würde es die Verkaufszahlen seiner Bücher erhöhen. Aber ich denke, er konnte sich doch in Schriftsteller hineinversetzen, die weniger erfolgreich als er selbst waren, und als wirklich netter Bursche konnte er schlecht Nein sagen.
Das einzige andere Mal, bei dem ich ihm persönlich begegnet bin, war viele Jahre später, kurz vor seinem Tod. Abermals war er von Fans und Bewunderern umringt, obwohl er jetzt nach einem Schlaganfall im Rollstuhl saß. Noch immer lächelte er, noch immer war er energisch und heiter, und er hielt eine wunderbare Rede vor Studenten in einem College-Hörsaal.
Seine beliebtesten Werke waren noch immer jene, die er Jahrzehnte vorher geschrieben hatte – doch sei’s drum. Für ihn waren sie nicht so wichtig wie seine späteren Arbeiten, doch immerhin ermöglichten sie ihm, sich weiterhin eines Publikums zu erfreuen, das er liebte, voller Menschen, die ihn liebten.
Er starb im Juni 2012.
(Januar 2021)
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
»The Burning Man« (1975): »Der brennende Mann«. In: Lange nach Mitternacht (Goldmann, 1979)
Fahrenheit 451 (1951/53): Fahrenheit 451 (Die Arche, 1955; vielfach nachgedruckt)
The Illustrated Man (1951): Der illustrierte Mann (Diogenes, 1962; vielfach nachgedruckt)
The Martian Chronicles (1950): Die Mars-Chroniken (Marion von Schröder, 1972; vielfach nachgedruckt)
Something Wicked This Way Comes (1963): Das Böse kommt auf leisen Sohlen (Marion von Schröder, 1969; mehrfach nachgedruckt)
(DEUTSCH VON ERIK SIMON)
[1] So im englischen Text. Die tatsächliche Höhe beträgt 526 Fuß, rund 160 Meter. – A. d. Ü.
Frank Herbert
Mitte der 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts war Frank Herberts höchst ehrgeiziger Roman Dune scheinbar zum Scheitern verurteilt. Zweiundzwanzig New Yorker Verlage hatten ihn abgelehnt, alle mit der Begründung, dass er zu lang und zu kompliziert sei. Bei der Erstveröffentlichung in kleiner Auflage gab es nur negative Kritiken.
Aber Frank Herbert bewies, dass er sehr viel mehr über den Geschmack junger Amerikaner wusste als die Verleger und Kritiker. Inzwischen wurden mehr als zehn Millionen Bücher aus der DUNE-Saga verkauft, ein teuer produzierter Film[2] basiert auf ihr, und es handelt sich um eine der lukrativsten Science-Fiction-Reihen aller Zeiten.
Herberts Erfolgsgeschichte entspricht in gewisser Weise einem seiner Lieblingsmotive aus seinen Erzählungen: der Macht des Individuums, den Status quo zu ignorieren und sein Schicksal selbst zu gestalten, sei es nun in den Vereinigten Staaten oder Jahrhunderte später tief im All.
Er ist ein unnachgiebiger Verfechter der persönlichen Freiheit und davon überzeugt, dass ein einzelner Autodidakt sehr viel mehr Wirkung erzielen kann als ganze Organisationen sogenannter Fachleute.
Seine Erfahrungen mit Verlegern illustrieren das: »Mein Aufenthalt in New York City war aufrüttelnd für mich, ein Schock. Ich war ein Junge aus dem Westen, der glaubte, dass es die Besten nach New York City zöge. Ich traf pünktlich ein, meine Mappe in der Hand, den Hut in den Nacken geschoben, so eben, und habe an den hohen Gebäuden emporgestarrt. Und man lud mich zur Teilnahme an einer Verlegerkonferenz ein, bei der es darum ging, wie eines meiner Bücher beworben werden sollte. [Das war mehrere Jahre, bevor Herbert zu Berkley wechselte, seinem späteren Herausgeber.] Nach zehn Minuten bei dieser Konferenz wurde mir klar, dass ich mehr über den Markt wusste und darüber, was dort wirklich ablief und wie man dort gute Arbeit machte, als all die ›Fachleute‹, die um den Tisch herumsaßen.
Ich erinnere mich immer noch, wie verraten ich mich gefühlt habe – in gewisser Weise verloren –, als wäre ich mit einem Mal ganz allein. Hier sitze ich also, und all die anderen müssten eigentlich wissen, was sie tun, aber sie wissen es nicht! Sie haben keine Ahnung!« Er lacht ein herzhaftes Lachen und verstummt schließlich leise glucksend. »Also sind wir unserer Wege gegangen. Ich habe mich einfach still aus der ganzen Sache zurückgezogen und ging auf Lesereise, wo man wirklich direkt mit den Leuten in Kontakt treten muss, insbesondere an den Universitäten und Colleges. Junge, kommt da schnell ans Licht, wer nur ein Aufschneider ist! Ich hab meinen Kram also einfach selbst gemacht, zum Teufel mit New York. Sie wussten nichts davon. Deren hochklassige Buchreisen, bei denen man sich mit Kritikern trifft – ich bin davon überzeugt, dass es keinen einzigen Kritiker gibt, mich eingeschlossen, dessen Geschmack über jeden Zweifel erhaben ist. Kritiker kontrollieren nicht den Markt. Der Markt läuft ganz ohne sie, dafür ist Dune das perfekte Beispiel.«
Selbst in der zeitgenössischen wissenschaftlichen Forschung, die von großen Geldsummen und komplizierten Laboren be- herrscht wird, glaubt Herbert, gibt es für einsame Außenseiter nach wie vor die Möglichkeit, Wirkung zu zeigen. Seine eigene Arbeit als Amateurwissenschaftler ist ein Thema, über das er nur selten spricht. Er trägt ein liebenswürdiges und geselliges Bild von sich nach außen und hat ein gut eingeübtes Repertoire von schlagfertigen Erwiderungen und Sprüchen, aber in Wirklichkeit ist er ein Mensch, der eher für sich bleibt und sich immer wieder gern von seinem Dasein als Bestsellerautor zurückzieht, um kleine Forschungsprojekte in seiner Zuflucht an der Washington State zu unternehmen. Dieser »andere« Frank Herbert hat schon viele ehrgeizige Projekte verfolgt, von einem in Heimarbeit gebauten Computer bis hin zu alternativen Energiequellen.
Sein Zuhause ist ein großes, selbst umgebautes Giebeldachhaus mit einer Solarheizung auf der Südseite, Deckenlichtern und einem angeschlossenen Gewächshaus. Die Zimmer sind geräumig, und das grob gezimmerte Zedernholz, aus dem das Haus errichtet ist, wird in keiner Weise kaschiert. Haus, Veranda und Swimmingpool sind von dicht stehenden Bäumen umgeben, die die nahe Straße verbergen und stattdessen die Illusion erzeugen, dass man sich mitten im Wald befindet.
Die Entwicklung eines neuen Computers ist eine der größten Herausforderungen, denen Herbert sich bisher gestellt hat. Er arbeitet mit der Hilfe von Max Barnard daran, einem Elektronikingenieur.
»Ich wollte ein System, dass exakt auf den kreativen Schreibprozess zugeschnitten ist«, erklärt Herbert. »Keines der Systeme auf dem Markt hat meine Kriterien erfüllt, weil keines davon von einem Schriftsteller entwickelt worden ist. Also habe ich mich darangemacht, den denkbar einfachsten, schnellsten und besten Textverarbeitungscomputer zu entwickeln. Im Moment überarbeiten wir die Hardware zum dritten Mal. Alles ist fest verdrahtet; man muss das Ganze von Hand verdrahten, um die elektronische Architektur zu entwickeln. Sobald die steht, kann man dann Schaltkreise drucken.
Im Moment funktioniert der Computer manchmal, und manchmal nicht. Aber wenn er funktioniert, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn ich in die primitive Gegenwart zurückkehre und meinen Compaq verwende, dann weiß ich, dass ich mit einem Werkzeug arbeite, das hinter den Möglichkeiten zurückbleibt.«
Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit zwei Jungs in der Garage ihrer Familie Apple Computers ins Leben gerufen haben. Heimcomputer sind mittlerweile ein Riesengeschäft, und die meisten Leute, die die Industrie beobachten, glauben, dass man heutzutage über große Ressourcen verfügen muss, um ein völlig neues Computerkonzept zu entwickeln. Herbert ist natürlich anderer Meinung.
»Wir sind nur zu zweit, und wir sind vollkommen unabhängig. Und unsere Ziele gehen weit über die reine Textverarbeitung hinaus. Wir haben vor, einen Computer zu erschaffen, den praktisch jeder programmieren kann, mithilfe einer grafischen Programmiersprache. Man sieht ein Bild, man drückt auf die entsprechende Taste, und dann sagt das Bild einem, was es als Nächstes macht, so wie Straßenschilder einem sagen, was die Straße als Nächstes macht. Das unterstützt die Nutzer weit besser als eine herkömmliche Computersprache, die aus Wörtern besteht. Mit einem Bild bekommt man genau das, was man sieht.«
Herbert betrachtet diese Sprache als einen Weg, die Programmierung den Experten aus den Händen zu nehmen und die Computer unter die Kontrolle der Menschen zu bringen, die sie benutzen.
»Sagen wir mal, ein Arzt an der Stanford Medical School möchte für seine Forschung ein ganz bestimmtes Computerprogramm haben. Er stellt einen Programmierer ein, der kein Arzt ist und sich erst einmal eine Vorstellung davon machen muss, was gebraucht wird. Er kommt zu einer Näherung, und der Arzt sagt: ›Nein, nein, das wollte ich nicht, es muss etwas anderes machen, nämlich das hier.‹ Der Programmierer kehrt also zurück ans Reißbrett und kommt mit einem neuen Entwurf zurück, und irgendwann geben die Wissenschaftler einfach auf – ich habe schon von mehreren Ärzten gehört, dass es genauso gelaufen ist. Sie sagen dann einfach: ›Na gut, ich versuche, damit zu arbeiten.‹
Wenn man diesem Arzt innerhalb von vier oder fünf Tagen beibringen könnte, wie er den Computer dazu bringt, genau das zu tun, was er von ihm will, würde er sich einfach hinsetzen und das Programm selbst schreiben.«
Es erscheint ziemlich ehrgeizig für einen SF-Autor und einen Elektronikingenieur, einen neuen Computer und eine neue Programmiersprache nebenher in ihrer Freizeit zu entwickeln. Doch für Herbert handelt es sich um ein spannendes Spiel und nicht um eine gewaltige Herausforderung. Sein ansteckender Optimismus und seine bemerkenswerte Vitalität tragen dazu bei, jedes Problem klein erscheinen zu lassen, als könnte er Hindernisse durch seine schiere Willenskraft und seine starke Persönlichkeit überwinden.
Er erklärt diese Eigenschaft mit einer beiläufigen Bemerkung darüber, dass er auf einer Farm aufgewachsen ist. »Man findet bei den Menschen in dieser Gesellschaft in verschiedenem Maße die nötigen Eigenschaften, um selbst etwas ins Rollen zu bringen, und am stärksten sind sie bei denjenigen ausgeprägt, die in jungen, empfänglichen Jahren auf die eine oder andere Art auf dem Land aufgewachsen sind. Wenn die Zeit zum Heumachen kommt und die Heuballenpresse kaputtgeht und Wochenende ist und die praktische kleine Werkstatt zuhat, dann sagt man nicht: ›Tja, dann gibt es dieses Jahr eben kein Heu.‹ Dann springt man in die Bresche und repariert das Ding. Man stellt sich nicht mal die Frage, ob man es kann. Natürlich kann man das. Mein Vater war ein Meistermechaniker; ich bin mit einem Schraubenzieher in der einen und einer Kneifzange in der anderen Hand aufgewachsen.
Ich habe mich immer für Maschinenbau interessiert, und ich habe nie daran gezweifelt, dass ich so etwas hinbekomme. Ich glaube, dass Selbstbeschränkung das ist, was die Menschen auf der Welt normalerweise am meisten einschränkt. Die Menschen sind zu sehr viel mehr in der Lage, als sie glauben.«
Diese Haltung hat Herbert dazu angespornt, auch andere Forschungsprojekte in Angriff zu nehmen – das bekannteste davon ist eine Windmühle, die er in Zusammenarbeit mit John Ottenheimer entwickelt hat, dem letzten persönlichen Schüler Frank Lloyd Wrights.
»Mir ist aufgefallen, dass Windmaschinen nicht grundsätzlich neu entwickelt wurden, seit man sie vor Jahrhunderten in Holland eingeführt hat. Dadurch, dass wir inzwischen Flugzeuge entwickelt haben, wissen wir heute sehr viel mehr über Luftströme und Laminaroberflächen. Ich habe also Nachforschungen darüber angestellt und diese neuen Erkenntnisse auf Windmühlen angewandt.
Ich bin selbst kein Luftfahrtingenieur, aber ich kann mir die Forschung ansehen, meine Modelle bauen und sie auf den Prüfstand stellen. Und das habe ich getan. Ich habe eine ganze Menge Modelle aus Balsaholz angefertigt. Man braucht nur einen wachen Verstand und eine neue Idee; und dann kann man sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie funktioniert.«
Sein Interesse an Windturbinen erwachte erstmals in den 1970er-Jahren. Damals ging es ihm um die Frage, ob er mit ihnen Wasser pumpen und Strom für sein Haus erzeugen konnte. Die Konfiguration, die ihm am besten erschien, wird Panemone genannt. Sie besteht aus einem vertikalen Stiel, der von daran befestigten vertikalen Rotoren betrieben wird. Das Ganze ähnelt einem Schneebesen, der mit der Spitze nach oben steht.
Es erwies sich allerdings als Problem, sein Konzept auf die Probe zu stellen, weil ihm die Ressourcen fehlten, um einen richtigen Windtunnel zu bauen. Anstatt also große Mengen von Luft durch seine Windturbine zu bewegen, beschloss er, die Windturbine durch die Luft zu bewegen. Er befestigte seinen ersten ausgewachsenen Prototyp auf einem Pick-up-Truck, dessen Tachometer er mithilfe einer Radarpistole kalibrierte, die ihm ein hilfsbereiter Polizist geliehen hatte. Dann wurde der Truck bei verschiedenen Geschwindigkeiten hin und her gefahren und gleichzeitig die Stromproduktion der Windturbine gemessen.
Die Ergebnisse waren ermutigend. Herbert nahm einige Anpassungen vor, und 1984 wurde das erste funktionierende Modell auf einem Gebäudedach in Astoria, Oregon, installiert.
»Es hatte einen Durchmesser von einem Meter zwanzig und war drei Meter hoch. In einem Wind mit fünfzig Knoten kam es auf siebeneinhalb Pferdestärken.
Dieses gegenwärtige Modell ist effektiver als jeder andere Windmühlentyp, den ich kenne.
Meine Windturbine ist leise genug, damit man sie auf Hausdächern im Nordosten und Mittleren Westen anbringen kann. Ich glaube, das sie absolut geeignet für eine solche Verwendung ist. Im Winter ist die Abkühlung durch den Wind in diesen Landesteilen für Häuser nicht weniger relevant als für Menschen. Das kann die Stromrechnung verdoppeln. Aber eine Windturbine erzeugt Strom, mit der sich ein einfaches elektrisches Heizsystem betreiben lässt, und je stärker der Wind weht, desto besser heizt sie das Haus.«
Obwohl diese Windturbine das beeindruckendste Endprodukt ist, das Herberts amateurwissenschaftliche Betätigung hervorgebracht hat, hat er zahlreiche kleine Experimente durchgeführt, bei denen sich auch andere Energiequellen als brauchbar erwiesen, darunter ein Sonnenkollektor und ein Methangenerator.
»Ich habe eine passive Solarheizung entwickelt, mit vier mal sechseinhalb Fuß großen Isolierscheiben zweiter Wahl. Für die habe ich elf Kröten das Stück bezahlt, weil jede einen kleinen Kratzer oder so hatte. Vier Zoll dahinter sind halbierte Bierdosen in einem Bienenwabenmuster gestapelt. Diese Paneele werden dann in Richtung Sonne gedreht. Sie müssen dem Lauf der Sonne nicht genau folgen, weil ihre Strahlen aus unterschiedlichen Winkeln in die Bierdosen scheinen. Die Dosen fangen die Infrarotstrahlung ein und erhitzen sich dadurch. Die Hitze wird durch Konvektion auf die zwischen ihnen hindurchströmende Luft übertragen. Das ist sehr effizient.«
Das ist ein System, das er in seinem Haus installiert hat. Das Methanprojekt hingegen hat er zeitweise in einem Schuppen hinter seinem Haus verwendet.
»Ich habe mit verschiedenen Methoden experimentiert, um aus Hühnerkot Methan zu gewinnen. Ich wollte feststellen, ob das praktisch umsetzbar war, und das war es bis zu einem gewissen Grad. Die einfachste Methode bestand darin, den Innenschlauch eines Lasterreifens aufzuschlitzen, den Hühnerkot hineinzufüllen und den Schlauch dann wieder zu verschließen. Wenn der Kot sich dann zersetzte und das gewünschte Gas erzeugte, blähte sich der Schlauch und erzeugte den benötigten Druck zur Nutzung des Gases. Damals fielen die Hühner praktisch vom Himmel, und wir haben selbst geschlachtet. Wir haben das Methan verwendet, um sie abzuflammen, um ihnen die Federn wegzubrennen. Es war also ein bisschen so, wie wenn man beim Schwein alles bis auf das Quieken verarbeitet – und vielleicht sogar das Quieken mit.« Er lacht.
»Dort, wo an dem Lasterschlauch das Ventil war, haben wir einen Zapfhahn und ein Rohr angebracht. Das ließ sich mit einem kleinen Herd verbinden, auf dem wir manchmal Wasser gekocht haben. Das war alles improvisiert, und es sah – na ja, es sah ziemlich seltsam aus.«
Diese Art von primitiver Farmtechnologie erinnert an die Kommunen der späten 60er-Jahre, aber Herbert ist kein Anhänger der Counter-Culture-Philosophie, die besagt, dass wir der Gesellschaft den Rücken kehren und uns ganz auf uns selbst zurückbesinnen sollten.
»Die Leute sagen zu mir: ›Du versuchst, eine unabhängige Gesellschaft auf deiner Farm zu errichten‹, aber das ist völliger Unsinn. Die unabhängige, sich selbst versorgende Farm ist die moderne Variante davon, sich ein Segelboot zu bauen und damit nach Tahiti zu fahren. Sie ist von einem Mythos umgeben. Aber an den glaube ich nicht. Man ist Teil der Gesellschaft und sollte sich der Notwendigkeit bewusst sein, mit ihr in Wechselwirkung zu treten.«
Allerdings ist er trotzdem für Dezentralisierung dort, wo sie ihren Nutzen hat, und dafür, die Konzentration politischer Macht zu verringern.
»Ich glaube daran, den Menschen selbst die Macht in die Hand zu geben. Wir haben das System der Geschworenenjury bisher nie in dem Maß zum Einsatz gebracht, in dem es möglich wäre. Ich behaupte nicht, dass Geschworene immer das Richtige tun und immer für Gerechtigkeit sorgen. Aber die Menschen, die regiert werden, sollten sagen können: ›So soll man uns regieren.‹
Ich würde zum Beispiel auf lokaler Ebene automatisch Geschworene über alle Ausgaben des Schulamts entscheiden lassen, die 100.000 Dollar überschreiten. Man würde automatisch zwölf Juroren berufen, zufällig ausgewählt unter denjenigen, die bei den letzten Wahlen ihre Stimmen abgegeben haben. Und ich würde ihnen die Möglichkeit zur Strafandrohung geben, damit sie Unterlagen anfordern können und sie auch bekommen und dann Ja oder Nein zu den Ausgaben sagen können.
Das bringt einen natürlich in direkten Konflikt mit den Bürokraten des Bildungssystems, die sagen würden – nicht mit diesen Worten, aber sinngemäß schon: ›Ihr bildet euch doch nicht ein, dass irgendeine dumme Hausfrau etwas von diesen komplexen Angelegenheiten versteht, über die wir so viel besser Bescheid wissen als alle anderen?‹ Tja, ich glaube, dass eine Hausfrau diese Dinge durchaus verstehen kann.
Außerdem wäre das für die Menschen ein Anreiz zum Wählen. Ich glaube, die Leute würden sagen: ›Wenn ich meine Stimme abgebe, dann beruft man mich vielleicht in eine dieser Jurys.‹ Ich glaube, was die Leute derzeit vom Wählen abhält, ist unter anderem, dass ihre Stimme sehr wenig mit dem zu tun hat, was letztendlich passiert. Bringen wir also die Regierungsgeschäfte dorthin zurück, wo sie hingehören, in die Hände der Regierten.«
Herbert beschloss bereits zu Schulzeiten, dass er Schriftsteller werden wollte, und begann seine Laufbahn als Zeitungsreporter. Später arbeitete er als Redenschreiber für einen US-Senator, was seine Ansichten zur Politik geprägt hat. Er kam zu dem Schluss, dass große Machtzusammenballungen unausweichlich Menschen anziehen, die mit seinen Worten »entweder korrupt oder korrumpierbar sind. Als investigativer Reporter habe ich keine einzige Hauptstadt eines Bundesstaates kennengelernt, die keine Jauchegrube war, und ich glaube, dass die schlimmste Jauchegrube der Vereinigten Staaten Washington, D. C. ist. Deshalb glaube ich, dass wir die Macht von diesen Zentren weg verlagern und neu verteilen sollten.
Aber Politiker sind nur ein Teil des Problems. Wir müssen auch etwas gegen die Arroganz in den Machtstrukturen der Bürokratie unternehmen. Ich habe einmal gehört, wie ein sehr hochrangiger Bürokrat in Washington, D. C. von einem Senator gesprochen hat, der ihnen dort nur Ärger machte und damit drohte, ihnen das Budget zu kürzen und so weiter; und er bezeichnete diesen Senator als ›Durchreisenden‹. Stellen Sie sich vor, wie arrogant das ist. ›In einem Jahr oder so ist er weg, und ich bin dann immer noch hier.‹ Und diese Haltung findet man bei Bürokraten oft vor, desto mehr, je weiter man nach oben kommt.«
Seine Abneigung gegen Bürokratie macht ihn misstrauisch gegenüber allen großen, fest verankerten Institutionen. Und das schließt für ihn das wissenschaftliche Establishment ein.
»Irgendwann hat man Machtstrukturen, die auf bürokratischen Erfordernissen gründen und nicht auf den Erfordernissen der Forschung; und was die Bürokratie vor allem erfordert, ist dass man seinen Arsch ins Trockene bringt. Das ist bedauerlich, weil wir Risiken eingehen müssen – wir müssen es uns zunutze machen, dass Wagnisse sich manchmal bezahlt machen. Gebt jemandem mit einer verrückten Idee Forschungsgelder und lasst ihn herausfinden, ob sie funktioniert. Sagt nicht einfach gleich: ›Ach, so was Verrücktes, was bist du denn für ein Idiot, dass du überhaupt auf so was kommst.‹
Die meisten der wichtigen Durchbrüche in unserer Geschichte wurden von Einzelpersonen oder sehr kleinen Forscher- und Entwicklergruppen gemacht. Dagegen hat man es im bürokratischen System mit finanzdominierten Konzepten zu tun, bei denen die Leute alle mehr daran interessiert sind, ihr System am Leben zu erhalten, als am ursprünglichen Ziel, das mit dem System verfolgt wurde.«