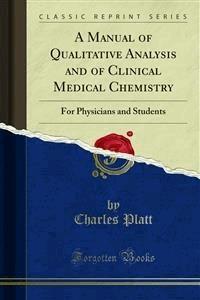8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Weltenschöpfer
- Sprache: Deutsch
Der dritte Band der drei Bände umfassenden Reihe präsentiert zwanzig der fast sechzig Essays, die auf Charles Platts Gesprächen mit bedeutenden SF-Persönlichkeiten basieren. Die Texte entstanden zwischen 1978 und 1982 und werden nun erstmals vollständig auf Deutsch vorgelegt. In zahlreichen zusätzlichen Texten und Ergänzungen, die Charles Platt jetzt, vier Jahrzehnte später, exklusiv für diese deutsche Ausgabe verfasst hat, erzählt er weitere Anekdoten und persönliche Erinnerungen an seine Gesprächspartner. In Band 3: Gespräche mit Andre Norton, Piers Anthony, Keith Laumer, Joe Haldeman, Fritz Leiber, Robert Anton Wilson, Poul Anderson, Jack Vance, Theodore Sturgeon, L. Ron Hubbard, Joanna Russ, Janet Morris, Joan D. Vinge, Harry Harrison, Donald A. Wollheim, Edward L. Ferman, Kit Reed, James Tiptree Jr., Stephen King und Charles Platt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Charles Platt
DIE
WELTEN
SCHÖPFER
Kommentierte Gespräche
mit Science-Fiction-Autorinnen
und -Autoren
Band 3
übersetzt von:
Frank Böhmert, Horst Illmer, Bernhard Kempen,
Martin Kettlitz, Matita Leng, Jasper Nicolaisen,
Michael Plogmann, Claudia Rapp, Sara Riffel,
Erik Simon, Anne-Marie Wachs,
Simon Weinert und Robert Wohlleben
Impressum
Die Weltenschöpfer erschienen im Original erstmals 1980 und 1983 in zwei Bänden unter dem Titel Dream Makers. In der vorliegenden Neuausgabe ist der ursprüngliche Text vom Autor überarbeitet worden – geändert, umformuliert, erweitert, stellenweise auch gekürzt.
Weitere Informationen zu den Originalausgaben finden Sie am Ende dieses Bandes.
Charles Platt
Die Weltenschöpfer – Band 3
© 2022 by Charles Platt
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
© der deutschen Ausgabe 2022 by Memoranda Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Hardy Kettlitz
Lektorat und Korrektur: Melanie Wylutzki & Christian W. Winkelmann
Gestaltung: s.BENeš [http://benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
Kontakt: [email protected]
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-74-8 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-75-5 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Inhalt
Andre Norton
Bibliografische Notizen
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Piers Anthony
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Keith Laumer
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Joe Haldeman
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Fritz Leiber
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Robert Anton Wilson
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Poul Anderson
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Jack Vance
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Theodore Sturgeon
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
L. Ron Hubbard
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Joanna Russ
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Janet Morris
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Joan D. Vinge
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Harry Harrison
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Donald A. Wollheim
Historischer Kontext
Edward L. Ferman
Historischer Kontext
Kit Reed
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
James Tiptree Jr.
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Stephen King
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Charles Platt
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Quellen und Originalausgaben der Porträts
Publikationsgeschichte und Copyrights
Bücher bei MEMORANDA
Andre Norton
Die träge Flut der Fahrzeuge schwappt von einer Ampel zur nächsten, als Kulisse dienen gigantische Werbeträger und riesige Wahrzeichen: Pizza Hut, Burger King, Hungry Man Restaurant, Puppies & Guppies, Pantry Pride, Kentucky Fried Chicken, International House of Pancakes, Bicycle Castle, Bob’s Pool Service, Majik Market, McDonald’s, Wendy’s Hamburger, The Sun Bank (»24 Stunden geöffnet«), Denny’s, eine Selbstbedienungstankstelle, die Sundance Wohneinheiten (»Wenn Sie hier wohnen würden, wären Sie jetzt schon zu Hause!«) …
Es ist eine Beton-Ödnis, die Orlando, Florida, umschließt und endlos zu sein scheint. Doch nach ungefähr 15 Kilometern erreiche ich Winter Park, ein ruhiges Städtchen, das vom vorstädtischen Zersiedlungsgebiet umschlossen ist. Hier sind die Gebäude älter und die Größenverhältnisse mehr den Menschen und weniger den Autos angepasst. In der Tat haben einige Leute ihre Autos verlassen und schlendern die Gehsteige entlang. Ein Rasensprenger sprüht Regenbogen; Eidechsen dösen in der Sonne; pastellfarbene Häuser im Ranch-Stil in Rosa, Blau und Grün stehen im Halbschatten von Eichen, Ahornbäumen, Fichten, Palmen und exotisch aussehenden farnartigen Bäumen, die in Florida heimisch, mir aber völlig fremd sind. Andre Nortons Haus steht in dieser Straße.
Früher, vor langer Zeit, war sie Alice Norton. Als sie aber in den 1930er-Jahren anfing Kurzgeschichten zu verkaufen, gehörte es sich einfach nicht für eine Frau, temporeiche Action-Abenteuer zu schreiben. So wählte sie Andre als angemessen opakes Pseudonym.
Sie ist eine grauhaarige, eher zurückhaltende, damenhafte Endsechzigerin. Sie gibt nur selten Interviews, schätzt ihre Privatsphäre, reist nie und gestattet keine Fotografien, wohl auch, weil diese dem Image, das sie in ihren Büchern pflegt, widersprechen würden. Als sie mich an der Haustür begrüßt und höflich hineinbittet, fühle ich mich plötzlich, als ob ich meine Tante besuchen würde.
Ihr Wohnzimmer ist groß, dämmrig und voller Schatten. Es gibt schier endlose Regalmeter mit Zierrat, Bildern und Miniaturen, alles peinlich sauber und ordentlich. Die Sitzordnung hat sie schon im Voraus festgelegt; sie führt mich zur Couch und nimmt mir gegenüber auf einem gut erhaltenen Sessel mit gerader Rückenlehne Platz. Zwei Katzen trippeln herbei und beschnüffeln mich, als ich das Mikrofon aufbaue. Eine andere sitzt, unergründlich schauend, auf dem Esstisch. Zwei weitere lauern in anderen Teilen des Raumes und nochmals zwei sind draußen in einem großen Käfig, der an der Rückseite des Hauses angebaut wurde, um es den Felis domestica zu ermöglichen, die Sonne Floridas ohne die Gefahren des Straßenverkehrs zu genießen.
Da in meiner Vorstellungswelt Andre Norton nicht daran gewöhnt ist, mit Fremden über sich selbst zu sprechen, beginne ich damit, sie einfach über die Eckdaten ihrer Karriere zu befragen.
»Ich schreibe seit 1934«, informiert sie mich. »Bis zum Ende dieses Jahres werde ich 98 Bücher veröffentlicht haben. Darüber hinaus habe ich sieben Anthologien herausgebracht und bei sechs Büchern mit anderen Leuten zusammengearbeitet.
Ich schrieb meinen ersten Roman in der Highschool, aber ich verkaufte ihn nicht. Ich verkaufte mein zweites Buch, als ich 21 Jahre alt war. Dann nahm ich mir das erste nochmals vor, überarbeitete es, und verkaufte es dann auch.
Ich mochte Science Fiction schon immer und las H. G. Wells, Jules Verne, Abraham Merritt und einige der anderen Pioniere. Als ich mit dem Schreiben begann, gab es in Amerika keinen Markt für Science Fiction in Romanlänge. Es war ausschließlich ein Genre für Kurzgeschichten, und mir fällt es sehr schwer, Kurzgeschichten zu schreiben. In meiner gesamten Karriere habe ich nur ungefähr ein Dutzend verfasst.
So begann ich in anderen Genres zu schreiben. Ich selbst habe immer Abenteuererzählungen bevorzugt, Talbot Mundy, Henry Rider Haggard und solche Sachen. Das war es auch, was ich bis in die frühen 1950er-Jahre schrieb, während ich 20 Jahre lang als Kinderbibliothekarin in meiner Heimatstadt Cleveland, Ohio, gearbeitet habe. Das war lange bevor ich nach Florida zog.
Meine Mutter stammte aus einer Familie, die zu den ersten Pionieren gehörte, die nach Ohio kamen.« Jetzt macht sie es sich in ihrem Sessel gemütlich und entspannt sich ein wenig, so als ob sie lieber über ihre Familie spricht als über ihr Werk. »Die Leute meiner Mutter bekamen ihr Land als Prämie. Wahrscheinlich wissen Sie nicht, was das bedeutet.«
Ich gebe zu, dass ich es nicht weiß.
»Also, die Männer, die im Unabhängigkeitskrieg gedient hatten, konnten danach wählen, ob sie, da der Staat pleite war, statt in Geld lieber mit Landbesitz im Westen entlohnt werden wollten. Der Staat Ohio wurde zum größten Teil von Männern besiedelt, die das Land als Prämie genommen hatten.
Einer ihrer Vorfahren, der im Maryland Line Regiment gedient hatte, nahm die Landprämie und heiratete eine Indianerin. Das war in den 1780er-Jahren. Aus seiner Ansiedlung ergab sich, dass meine Mutter eine ganze Menge an Hintergrundwissen über das frühe Ohio besaß. Als sie ihr siebzigstes Lebensjahr erreicht hatte, begann sie, ihre Lebensgeschichte als Kind in den 1870er-Jahren aufzuschreiben. Bei ihrem Tod hatte sie das Buch zur Hälfte geschrieben und hinterließ es mir mit ihren Unterlagen. Ich war in der Lage es fertigzustellen, damit eine Vorstellung von der Kindheit und dem Leben in einer Kleinstadt in einem landwirtschaftlichen Bezirk in Ohio um das Jahr 1878 erhalten bleibt. Es trägt den Titel Bertie and May; Mutter hieß Bertha, ihre Schwester May.
Meine Mutter begann damit mir Gedichte vorzulesen, als ich noch sehr, sehr jung war. Sie hatte eine Unmenge Gedichte gelernt. So bekam ich ein Gespür für Wörter, noch bevor ich verstand, was sie bedeuten. Als ich fünf war, las sie mir Little Women vor.
Mutter hatte auch eine faszinierende Bibliothek voller viktorianischer Romane, was mich dazu bewog, mein einziges Sachbuch zu schreiben, das übrigens nie veröffentlicht wurde. Es ist die Geschichte fünf amerikanischer Autorinnen, die zwischen 1840 und 1870 die meisten Verkäufe hatten. Sie übertrafen damals alle Männer; und sie waren es, die Nathaniel Hawthorne als die ›verdammten, schmierenden Frauen‹ bezeichnete, weil sie so hohe Verkaufszahlen erreichten und er nicht!
Drei dieser Frauen schrieben Bücher, die heute genauso gut lesbar sind wie damals. Sie wussten Handlung und Plot anzulegen und Geschichten zu erzählen. Mary-Jane Holmes, Maria Cummings und Elisabeth Wetherall. Wenn Sie wissen möchten, wie die Pionier-Leute um 1840 in New York lebten, müssen Sie nur Elisabeth Wetherall lesen. Sie beschreibt das tägliche Leben dieser Menschen.
Als ich meinen eigenen viktorianischen Roman, Velvet Shadows, schrieb, betrieb ich ausgiebige und tiefschürfende Nachforschungen über dieses Zeitalter. Die Geschäfte und die Bekleidung, die bei mir vorkommen, gab es wirklich. Wenn ich ein Kleid aus zarter goldener Webware, dessen Raffungen von ausgestopften Kolibris mit echten Rubinaugen gehalten werden, beschreibe, dann können Sie sich bildlich vorstellen, wie diese Zeit war. Ich schrieb über die 1870er-Jahre in San Francisco; die Leute waren neureich und warfen mit ihrem Geld nur so um sich.
Ich habe mich immer für das viktorianische Zeitalter interessiert. Meine Mutter war Viktorianerin und ich wuchs mit viktorianischen Geschichten auf. Sie besaß Bücher über gutes Benehmen, Speisen und so weiter aus dieser Zeit und es ist faszinierend, bezaubernd und spannend, zum Beispiel über Trauerbräuche zu lesen: wie viele Monate du einen Schleier vor dem Gesicht trägst, bis du es wagen kannst, ihn zurückzuschlagen und dann, etwas später, ein wenig weißes Band an die Vorderseite deiner Haube zu nähen. Das ganze Prozedere ging über drei Jahre, und wenn bis dahin jemand anderes gestorben war, fingst du wieder von vorn an. Meine Mutter erzählte, dass sie sich nicht erinnern konnte, ihre Mutter je ohne Trauergewandung gesehen zu haben.«
Inzwischen ist mir klar geworden, dass Andre Norton glücklich und zufrieden damit wäre, mir für die nächsten zwei Stunden Anekdoten über ihre amerikanischen Vorfahren zu erzählen. Aber ich will ja etwas über ihre Arbeit und ihr Werk erfahren. Daher unterbreche ich sie und frage nach ihrem ersten Science-Fiction-Roman.
»Ich verwendete meine Heimatstadt Cleveland und versuchte mir auszumalen, wie sie nach einem vernichtenden Krieg verlassen und zerstört wäre und die Menschen in einen barbarischen Zustand zurückgefallen wären. Das war Star Man’s Son. Bis heute hat er sich über eine Million Mal verkauft.« Sie lächelt.
»Gewiss waren meine Verkaufszahlen viele Jahre hoch, aber ich hatte überhaupt kein Ansehen bei der Literaturkritik. Ich arbeitete als Frau in einer Männerdomäne. Es gab überhaupt nur etwa vier Frauen und wir schrieben entweder unter männlichen Pseudonymen oder verwendeten unsere Initialen. Wir waren dazu gezwungen! Das hat mich nicht verbittert oder verärgert. Die Zeiten waren halt so. Damals gab es noch keine Frauenbewegung.«
Glaubt sie, dass es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Schreiben gibt?
»O ja. Eindeutig! Ich glaube, Frauen sind mehr an Charakterisierungen interessiert als Männer, und es gibt sehr wenige Männer, die eine gute Frau skizzieren können.« Sie nennt den Namen eines bekannten männlichen Autors als Beispiel, bittet mich aber, ihn ungenannt zu lassen, vermutlich um niemanden zu verärgern oder zu beleidigen. »Die meisten ihrer Frauen sind Schablonen, wohingegen Frauen über Männer schreiben und sie echt und glaubwürdig darstellen können. Ich kenne Frauen, die das tun.«
Sie hält inne, um mich an dieser Stelle darüber ins Kreuzverhör zu nehmen, wie viele Autorinnen in den Weltenschöpfern vorkommen. Werde ich Anne McCaffrey dazunehmen? C. L. Moore? Leigh Brackett? Marion Zimmer Bradley?
Ich erkläre, dass einige von ihnen Fantasy schreiben, was ich gar nicht mag.
»Sie bezeichnen Anne McCaffrey als Fantasy-Autorin? Das ist sie nicht. Und sie ist eine unserer besten Autorinnen. Wenn Sie sie auslassen, werden Sie Ärger bekommen.« Sie sagt das sehr nachdrücklich.
»Jacqueline Lichtenberg ist auch wichtig. Ihre Bücher sind schwer zu lesen, aber sie sind interessant.«
Da die meisten Namen, die Andre Norton genannt hat, seit vielen Jahren im Geschäft sind, frage ich sie, ob es moderne Autorinnen gibt, die sie bewundert.
»Natürlicherweise bin ich gerade sehr aufgebracht über die neue Haltung der Fantasy gegenüber Homosexualität. Ich habe das starke Gefühl, dass das falsch, verkehrt, schädlich und verletzend ist. Mindestens die Hälfte der Leserinnen und Leser von Fantasy sind unter zwanzig, manche der Lesenden (auch wenn das Ausnahmen sind) sind erst zehn oder zwölf.
Es gibt einige sehr unverblümte Bücher, in denen Homosexualität eine Rolle spielt. Eines davon fiel mir in die Hand, und ich war so empört, dass ich es glatt in den Mülleimer geworfen habe. Und dieses Buch war für eine Auszeichnung nominiert. Ein anderes wurde mir zugeschickt und ich schlug es mitten in einer Sexszene auf, die so widerlich und Übelkeit erregend war, dass mir körperlich schlecht wurde!
Diese Strömung wird stärker und stärker. Viele Jahre lang, als ich als Bibliothekarin arbeitete, wurden keine Science-Fiction- und Fantasy-Bücher eingekauft, weil sie für Schund gehalten wurden, was an diesen schrecklich abstoßenden Bildern auf den Umschlägen der Magazine lag. Daher kämpfte und kämpfte ich, um sie auf die Liste der Bibliothek zu bekommen.
Ich habe Freunde, die Science Fiction an der Highschool unterrichten, und sie sind jetzt so vorsichtig bei der Auswahl der Bücher, die sie bestellen, weil sie fürchten, dass dieser neue Trend von den Eltern abgelehnt wird.
Es fühlt sich an, als ob all die Arbeit, mit der ich versucht habe, Science Fiction als wirklich gute Lektüre durchzusetzen, untergraben wird.«
Erhebt sie beispielsweise Einspruch gegen John Normans Bücher über Krieger und versklavte Mädchen und Frauen?
»Also ich habe genau eines gelesen und ich hielt es für eine armselige Imitation von Edgar Rice Burroughs. Nein, sie sind sadistisch, aber ein anderes Buch, als Beispiel …« – sie bittet mich, den Titel auszulassen – »beschreibt nicht nur eine homosexuelle Beziehung, sondern auch eine inzestuöse zwischen zwei Brüdern, bis ins kleinste Detail.
Niemand muss nach skandalösen Stoffen suchen, um ein gutes Buch zu schreiben. Einige Leute schreiben heutzutage Bücher, die beeinflussbare junge Menschen in sehr fragwürdiger Weise beeindrucken können. Das ist eine böse und gefährliche Sache.«
Andere Themen erbosen sie ebenso stark. Insbesondere die Misshandlung von Tieren.
»Ich habe nicht allzu viel Respekt vor der Menschheit, aufgrund einiger Dinge, die sie getan hat. Beispielsweise das Totknüppeln von Babyrobben, das ist extrem grauenhaft! Das Töten der Wale! In einigen Staaten töten sie Tiere, indem sie aus Druckkammern[1] alle Luft absaugen. Das ist schrecklich. In Florida haben wir dagegen durch alle Instanzen der Gerichte geklagt und jetzt ist das hier verboten. Ich habe ein Buch, The Iron Cage, geschrieben, weil ich so wütend darüber war, was Tieren angetan wird.«
Auch darüber hinaus spielen Tiere eine große Rolle in vielen ihrer Fantasyromane. Wie aufs Stichwort kommt eine ihrer Katzen, klettert hoch und schnüffelt am Mikrofon.
»Das ist Ty.« Andre Norton stellt mir die Katze vor. »Sie ist ein Beispiel für das Züchten von roten Abessiniern, denn sie ist viel röter als die meisten ihrer Art. Die neigen dazu, eher eine gräuliche Schattierung zu haben. Na, Ty, willst du nicht hochkommen?«
Sie streichelt die Katze. »Wissen Sie, ich denke, die Menschheit beging zu Beginn der industriellen Revolution einen schweren Fehler. Wir stürzten uns auf Mechanisches und verwarfen anderes, das ebenso wichtig ist. Wir durchliefen den Übergang zu schnell. Ich mag mechanische Dinge nicht besonders. Und ich mag viele der modernen Lebensweisen nicht. Ich bevorzuge es, Dinge mit meinen Händen zu tun; ich denke, das braucht jeder Mensch. Die Leute müssen ihre Hände benutzen, um sich schöpferisch zu fühlen.
In England wurde früher überall auf dem Land gewoben. Dann bauten sie diese Fabriken, in denen die Bedingungen so furchtbar waren. Mir scheint, der Hauptgrund für die industrielle Revolution war Gier.
Jetzt wenden sich einige wieder mehr und mehr den alten Ideen zu. Ich bin keine Wissenschaftlerin; daher interessiert mich das Schreiben über exakte Wissenschaft eigentlich nicht. Aktuell habe ich einige Nachforschungen in Bezug auf das Okkulte und verschiedene psychische Entdeckungen, die wir zurzeit machen, angestellt. Das interessiert mich momentan.
Eines meiner Interessengebiete ist Wicca. Das ist Hexerei – weiße Hexerei, nicht der schwarze Satanismus, der nichts als eine Art Parasit ist, der sich im späten 17. Jahrhundert als Gegenbewegung zur Kirche entwickelt hat. Nein, Wicca geht auf die alte Religion zurück, die sich mit Kräutern und der Verehrung des Mondes befasst. Es ist eine weibliche Religion, wissen Sie, weil nur eine Frau die Energien und Kräfte leiten kann. Der gehörnte Priester steht unter der Priesterin.
Ich versuche nicht, damit irgendetwas zu tun, ich erforsche es nur. Ich verwende einige ihrer Sprüche oder Formeln und einige ihrer Rituale in meinen Büchern, aber immer verändere ich sowohl die Sprüche als auch die Rituale. Das ist wichtig. Ich habe Freundinnen und Freunde, die Wicca praktizieren, und sie sagen mir, dass das niemals unverfälscht in irgendeinem Buch verwendet werden darf.
Meine Freundin, die in der Nähe lebt und Wicca praktiziert, gehört zur Irish Congregation of Isis, deren Schwerpunkt es ist, Tieren in Not zu helfen. Die Menschen, die Wicca ausüben, sind überaus naturverbunden. Sie sind Bewahrende. Sie verwenden häufig Kräuter.
In der Tat waren es zwei Mitglieder der Wicca, draußen im Westen, die das Einhorn züchteten. Ein echtes Einhorn. Es sieht genauso aus wie auf den Wandteppichen. Ich habe sogar von einem eine kleine Strähne aus der Mähne zugeschickt bekommen.
Wissen Sie, ursprünglich waren die Einhörner keine Pferde. Wenn Sie sich die alten Tapisserien ansehen, sehen sie überhaupt nicht wie Pferde aus. Sie sehen aus wie eine Art Ziege, und das ist es, was sie gezüchtet haben; eine sehr große, weiße Ziege mit einem einzigen Horn, einem Kinnbart, einer langen Mähne und einem langen Schwanz.
Ich interessiere mich auch sehr für die Psychometrie, die mir tatsächlich bewiesen wurde. Bei der Psychometrie berührt eine Person einen Gegenstand und liest dessen Geschichte. Ich bin eine Zweiflerin, bis ich erlebe, dass etwas funktioniert, und ich habe es gesehen. Ich hatte drei Schmuckstücke dabei, jedes eine Antiquität, die ich einer sensiblen Person zu lesen gab. Vom ersten Stück dachte ich, es sei chinesisch, aber sie datierte es und las es als nicht chinesisch, denn sie beschrieb den Mann, der es getragen hatte, und seine Bekleidung war eindeutig mandchurisch, nicht chinesisch. Dann beschrieb sie den Mann, der es hergestellt hatte, und sogar das Material, aus dem es gemacht wurde.
Später zeigte ich es einem Kurator für chinesische Schmuckstücke und er bestätigte sie im Datum, im Umstand, dass es die Zeit war, als die Mandchu an der Macht waren, und dass es damals einen Aufstand gab. Sie hatte gesagt, dass der Besitzer hingerichtet wurde. Mithin hat sich der gesamte Hintergrund, den sie genannt hatte, als authentisch verbürgt herausgestellt, sogar ihre Beschreibung des verwendeten Materials.
Ein weiteres Stück war eine Brosche aus Mammut-Elfenbein, die aussieht, als wäre sie aus Achat gemacht. Sie legte sie nach einem kurzen Moment wieder auf den Tisch und sagte: ›Das kann ich nicht ertragen. Es ist ein großes Tier, das brüllt und stirbt! Damit will ich nichts mehr zu tun haben!‹«
Wir sprechen noch einige Zeit über Magie und ESP, aber das sind Themen, mit denen ich mich nicht gut auskenne. Ich bin mehr an ihr als Autorin interessiert; so verlassen wir das Wohnzimmer und sie nimmt mich mit in ihr Arbeitszimmer. Zusätzlich zu sehr vielen Büchern gibt es hier noch mehr Zierrat und Erinnerungsstücke. Ihre Leserinnen und Leser schicken ihr Modelle von den Kreaturen und Protagonisten ihrer Romane – sorgfältig geschnitzte Soldaten und Bäuerinnen und Drachen, die einfallsreich aus bunten Pfeifenreinigern geformt wurden, Figürchen, Zeichnungen und Tonmodelle. Hier sind auch ihre Auszeichnungen und Preise – ein Balrog Fantasy Award sowie weitere Plaketten und Schriftrollen.
»Ich tippe meine ersten Entwürfe immer noch selbst«, erklärt sie mir und zeigt auf eine elektrische Smith-Corona auf einem stählernen Schreibmaschinentisch, der neben einem alten hölzernen Schreibtisch steht, auf dem sich hohe Papierstapel türmen. »Ich achte erst mal nicht auf Rechtschreibung oder Grammatik, ich will nur meine Idee zu Papier bringen. Heutzutage denke ich, wenn ich versuche, nach einem Entwurf zu arbeiten, zerstört das meine Eingebung. Daher ist es jetzt so, dass ich beim Schreiben von einer Seite zur nächsten nicht weiß, was als Nächstes geschehen wird oder wer als Nächstes auftaucht.
Früher habe ich auch die zweite und dritte Fassung selbst getippt, aber in letzter Zeit hatte ich Rückenprobleme, sodass ich die erste Fassung mit Kugelschreiber korrigiere und sie an meine Sekretärin weiterreiche. Sie erstellt die zweite Fassung, die ich nochmals durchgehe. Danach tippt sie die Endfassung.«
Sie führt mich durch eine Tür in die ehemalige Garage. Sie reist nie und hasst es, das Haus öfter als absolut notwendig zu verlassen. Daher besitzt sie kein Auto und hat die Garage in eine Bibliothek verwandelt. Hier stehen endlose Regalmeter mit Büchern über Geschichte, Mythen und Legenden. Es gibt große Abteilungen mit chinesischer und japanischer Literatur, die sie besonders interessieren. Alles ist penibel nach Themen geordnet, das versteht sich von selbst, schließlich war sie über 20 Jahre Bibliothekarin.
Mit einem Schlag erkenne ich, wie passend es ist, dass sie ihre Bibliothek in der ungenutzten Garage untergebracht hat. Schließlich sind die Bücher ihre alternative Art des Reisens. Diese höfliche, sprachgewandte Dame mag hier in Florida isoliert wirken, zurückgezogen von der Welt; aber mithilfe der Bücher kann sie überallhin gehen. Sie sind ihre Fahrkarten ins Abenteuer, in Länder, die nur durch die Vorstellungskraft begrenzt sind.
Anmerkung: Einige Abschnitte in diesem Porträt wurden auf Bitten von Andre Norton gestrichen oder geändert.
Bibliografische Notizen
Viele der Romane, die Andre Norton schrieb, sind durch ständig wiederkehrende Figuren und gemeinsame Hintergründe verbunden, aber die WITCH WORLD-Serie, die aus zehn Romanen, von Witch World (1963) bis Trey of Swords (1977), besteht, steht für sich und bleibt wahrscheinlich ihr populärstes und erfolgreichstes Werk. Das Szenario enthält eine ganze Reihe Elemente, wie beispielsweise den Gebrauch von Magie, was den Büchern das Label »Fantasy« einbrachte, obwohl sie ganz gewöhnliche »Sword and Sorcery«-Abenteuer sind.
Andre Nortons erster Roman, Star Man’s Son (1952), ist in einem postapokalyptischen Cleveland angesiedelt, das unter verfeindeten Clans aufgeteilt ist und nach und nach von einem genmutierten Helden gegen die üblichen monströsen Feinde vereint wird. Im Laufe der vielen Jahre und durch die vielen Romane, die sie seit diesem frühen Werk geschrieben hat, wandte sie sich zunehmend weiblichen Protagonisten zu, die oft auf Augenhöhe von telepathisch begabten Tieren, besonders Katzen, unterstützt werden. Diese Abenteuer ereignen sich auf sehr, sehr weit entfernten Planeten oder auf Welten, die nur in der Vorstellungskraft existieren.
Obwohl sie als Autorin von Kinder- und Jugendliteratur angesehen wird, sind Andre Nortons verschiedene Serien auf unterschiedliche Altersgruppen zugeschnitten und sie sind meist auch überzeugende Literatur für Erwachsene.
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen:
Star Man’s Son (1952): Das große Abenteuer des Mutanten (Moewig, 1965)
Witch World (1963): Gefangene der Dämonen (Pabel, 1974); elf weitere Romane der Reihe um die Hexenwelt erschienen bis 1987 in den Verlagen Pabel, Moewig und Bastei Lübbe.
(DEUTSCH VON MATITA LENG)
[1] In den USA bis etwa 1985 übliches Verfahren der Tiertötung, gemäß dem ›Gesetz zur humanen Schlachtung von Nutztieren‹, das auch von der nationalen Tierschutzorganisation abgesegnet wurde. Anm. d. Übers.
Piers Anthony
In Inverness in Florida kommt man sich vor wie in Iowa mit Palmen. Es ist eine verschlafene Kleinstadt, in den Geschäften werden Dünger, Tierfutter und Farmausrüstung verkauft und davor stehen Pick-ups am Straßenrand. Was bringt einen Science-Fiction-Autor dazu, sich hier niederzulassen?
Ich rekapituliere noch einmal alles, was ich an Fakten und Gerüchten über Piers Anthony weiß. Geboren 1934. Verkauft seine ersten Storys in den späten 60ern. Hat den Ruf eines »schwierigen« Autors, der sich gelegentlich mit Verlagen angelegt hat, von denen er sich boykottiert fühlte. Vielschreiber; er hat ambitionierte Science Fiction geschrieben (Macroscope, Tarot), mit starker Betonung von strengen Formen, bei denen die Charaktere als Symbolfiguren in komplexen Rollen und Gleichnissen dienen. In den letzten Jahren hat er zahllose Fantasyromane verfasst (vor allem die XANTH-Reihe), die leichte Unterhaltung sind, sich vor allem an junge Leser richten und es immer wieder auf die Bestsellerlisten schaffen.
Er ist überzeugter Vegetarier – er isst und trägt nichts, das aus toten Tieren gewonnen wurde. Und er scheint ziemlich zurückgezogen zu leben: Viele Leute, die ich in der Science-Fiction-Szene kenne, darunter etliche Herausgeber, haben Piers Anthony nie getroffen, und selbst Keith Laumer, der weniger als 20 Meilen entfernt lebt, hat ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
Ich fahre über asphaltierte Landstraßen, an üppigen Feldern und gelegentlichen kleinen Wäldchen vorbei. Ich halte mich an die komplizierte Wegbeschreibung, die ich erhalten habe, und nehme eine unbefestigte Straße in ein Waldstück, das einer Neubausiedlung weichen sollte. Aber das Schild des Bauträgers am Straßenrand ist alt und verblichen, als wäre das Projekt nie richtig vom Fleck gekommen, und die ganze Umgebung wirkt vernachlässigt und heruntergekommen.
Piers Anthony hatte mir auf meine Anfrage wegen eines Interviews geschrieben: »Wenn Sie sich wirklich in die Wildnis wagen wollen, dann habe ich immer Zeit, außer dann, wenn die Pferde gefüttert werden müssen …«
Die unbefestigte Straße wird zu einem noch schmaleren Feldweg. Einfache Holzhäuser stehen vereinzelt zwischen Bäumen. Es macht den Eindruck, als hätten menschliche Wesen hier kaum Spuren hinterlassen.
Das Haus von Piers Anthony ist das einzige zweigeschossige Gebäude. Ein VW Bulli und ein Ford Fiesta parken im Gras davor. Hinter dem Haus befinden sich eine Koppel mit Pferden und ein Zwinger voller Hunde. Kleine Nebengebäude stehen in hohem Gras und zwischen Kakteen.
Ich stelle das Auto ab. Und da kommt er, rennt aus dem Wald auf mich zu, ein bärtiger Mann mit flackernden Augen in rotem T-Shirt und alten Jeans. Er sieht aus wie ein Landstreicher, der im Wald lebt. »Wie lange wollen Sie bleiben?« sind seine ersten Worte, nachdem ich mich vorgestellt und noch bevor ich die Autotür geschlossen habe. »Also, ich habe vor, die Fragen, oder was Sie da vorbereitet haben, zu beantworten, und dann habe ich hier noch ein paar Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich Ihnen stellen muss.« Er redet schnell und hastig, so als hätte er gerade von einer bevorstehenden Katastrophe erfahren und uns bliebe nur noch wenig Zeit. Ich werde seiner Frau vorgestellt, die verglichen mit ihm still, nachdenklich und bedächtig wirkt, und dann drängt Anthony mich – Tempo, Tempo! – an dem Pferdegatter, den Hunden und den Hühnern vorbei zu seinem Arbeitsplatz, eine kleine Scheune in einiger Entfernung vom Haus. Das Innere ist sehr einfach gehalten, aber mit vielen Bücherregalen. Ich habe kaum Zeit, den Kassettenrekorder einzuschalten, bevor er anfängt zu reden, weil er jeden Augenblick vollständig ausnutzen will.
»Sie müssen darauf achten, dass ich auch jede Ihrer Fragen beantworte«, warnt er mich. »Ich kann reden – es fließt nur so aus mir heraus – und ich kann schreiben – ich vermute, ich schreibe mehr als jeder andere, letztes Jahr waren das fast 480.000 Wörter in Manuskripten, die ich bei Verlegern abgeliefert habe, und ich erstelle jeweils drei Durchgänge auf einer klassischen Schreibmaschine, ich habe damals 450 Dollar bezahlt, und für den gleichen Preis hätte ich auch ein elektrisches Modell haben können, aber ich will nicht von einem Stromausfall ausgebremst werden, und manchmal dauern die bis zu vier Stunden! Diese Maschine, ein Büromodell, hat mich noch nie im Stich gelassen, und wenn ich bereit bin, dann schreibe ich mit meiner mir eigenen Geschwindigkeit. Deswegen habe ich auch diese besondere Tastenbelegung.« (Die Tasten seiner Schreibmaschine sind nach der Häufigkeit des Buchstabenvorkommens angeordnet statt mit der üblich Q-W-E-R-T-Belegung.) »Das ist die schnellste Tastatur der Welt; ich bin nicht der schnellste Tipper der Welt. Wenn es gut läuft, komme ich auf vielleicht dreißig Wörter pro Minute, zum Teil auch, weil mein Gehirn sonst nicht mehr mitkommt, und ich mache den ersten Entwurf hier auf diesem Klemmbrett – da, wie Sie sehen können, ist da so ein Fach dahinter, und darin sind die Seiten, die ich schon beschrieben habe, und leeres Schreibpapier. Ich habe gelegentlich schon fast tausend Wörter pro Stunde geschafft, mit der Hand. Früher habe ich die ersten Entwürfe getippt, doch dann kam die Geburt meiner kleinen Tochter – sie ist jetzt vierzehn –, aber damals, als sie sechs Monate alt war, ist meine Frau wieder arbeiten gegangen. Ich verdiente als Schriftsteller nicht genug. Das Wichtigste, was man als Schriftsteller braucht, ist eine Frau, die den Lebensunterhalt verdient, bis du es selbst schaffst, und deswegen habe ich mich dann um mein kleines Mädchen gekümmert. Ich habe ihr die Windeln gewechselt und diese Sachen, habe sie gefüttert, alles. Ich musste immer auf sie aufpassen. Sie ging überall dran, war hyperaktiv, machte lauter Unsinn, also musste ich eine Möglichkeit finden, zu arbeiten und sie gleichzeitig im Auge zu behalten. Deswegen bin ich dann zu dem Klemmbrett übergegangen. So hat sie meine Karriere als Autor gelenkt, aber auf eine gute Weise, wie es sich herausgestellt hat, weil ich jetzt immer das Klemmbrett habe, egal ob ich nachts aufwache oder irgendwo hingehe, egal wann – ich kann schreiben. Wenn ich irgendwo in einer Schlange stehe und auf etwas warten muss, zum Beispiel in einer Behörde, dann schreibe ich mehrere Hundert Wörter. Es kümmert mich nicht, ob die Leute das seltsam finden oder ob jemand denkt, ich bin vom FBI und mache Notizen, das ist mir alles egal, ich mache trotzdem weiter. Ich arbeite buchstäblich fast die ganze Zeit, die mir zur Verfügung steht, wenn ich nicht schlafe oder esse – genau genommen schreibe ich sogar, wenn ich esse. Und ich war noch nie auf einer Science-Fiction-Convention, ich reise nicht, ich bleibe zu Hause, und wenn ich nicht schreibe, dann beantworte ich Fanpost. Ich habe dreiunddreißig Fan-Briefe im letzten Monat beantwortet, das kommt davon, wenn man bekannt wird, das ist erst seit Kurzem so, also früher, da bekam ich vielleicht mal einen Brief pro Woche von einem Fan …«
Es gelingt mir, ihn hier zu unterbrechen, um zu fragen, ob seine Frau sich nicht an dieser ununterbrochenen Arbeitswut stört.
»Nein, meine Frau versteht das, sie musste sogar ihren Job aufgeben, weil es darauf hinauslief, dass ihr gesamter Lohn dafür draufging, die Steuern auf mein Einkommen zu bezahlen, und das wollte sie nicht mehr mitmachen. Wissen Sie, ich habe früher 500 Dollar im Jahr verdient, oder auch 1000 Dollar, dann 5000 Dollar, aber dann fing ich an, 70.000 Dollar zu verdienen, dann 100.000 Dollar und ich schätze, dieses Jahr werden das etwa 150.000 Dollar sein, ich bin richtig gut im Geschäft. Es gab da Auseinandersetzungen, ich hatte einen Streit mit Dean Koontz, der damit angegeben hat, dass er fast 100.000 Dollar verdient hat und dass er sich mit Wichten wie mir nicht abgeben muss. Ich weiß nicht, wie Dean Koontz jetzt finanziell dasteht – er schreibt unter Pseudonym billige Reißer, also glaube ich, die Rollen sind wohl eher umgekehrt. Ich mache jetzt richtig Geld, aber ich behaupte nicht, dass ich plötzlich ein Genie bin, nur weil ich so gut verdiene. Geld, wie Sie wohl wissen, verhält sich häufig umgekehrt proportional zum Verdienst, und meine anspruchsvollsten Werke bringen mir wahrscheinlich weniger Geld ein als die, für die ich am wenigsten nachdenken muss. Wenn ich einen XANTH-Roman schreibe, dann geht das etwa doppelt so schnell wie alles andere. Für Avon Books schreibe ich Science Fiction, für Del Rey Fantasy. Ich habe A Spell for Chameleon bei ihnen veröffentlicht, und damit den British Fantasy Award gewonnen, und danach verkaufte sich jeder weitere besser und besser, und die Bezahlung stieg und stieg. Es ist schön und gut, wenn man das schreibt, was man mag, aber man wird davon nicht unbedingt reich. Vielleicht bin ich der kommerziellste Autor, den Sie interviewen, weil ich billiges Zeug schreibe, das sich hervorragend verkauft. Ich habe eine richtige Ausbildung – ich habe einen Abschluss in kreativem Schreiben –, ich hatte die richtige Erziehung – ich bin in England geboren, meine Eltern waren beide in Oxford auf der Universität –, ich habe die richtige Ausgangsposition, ich habe den literarischen Background, und was mache ich? Seichte Unterhaltung. Aber, na ja, da ist das Geld – nachdem ich mich all die Jahre mit schlecht bezahltem Kram abgemüht oder es wenigstens versucht habe, habe ich mich jetzt neu orientiert. Und ich kann nicht sagen, dass mir das leidtut. Ich bedauere es zwar auf intellektueller Ebene und wünschte, ich hätte etwas so qualitativ Hochwertiges schreiben können, dass ich einen Preis vom Nobelpreiskomitee bekomme, aber stattdessen werde ich mit Geld entschädigt, und dann nehme ich doch das Geld! Ich verfasse immer noch den einen oder anderen ernsthaften Text, weil ich das nicht verlernen will. Ich will geistig fit bleiben, wie ich auch körperlich fit sein will, und deswegen treibe ich Sport. Ich bin körperlich – das kann man jetzt zweideutig auffassen –, ich betrachte mich als einen der gesündesten SF-Autoren meines Alters. Sie können die Griffspuren auf dem Balken dort sehen, ich mache da meine Klimmzüge und in Trainingskleidung schaffe ich fünfundzwanzig davon, und das ist doppelt so viel wie zu meiner Schulzeit. Gestern hatte ich meinen Lauftag und ich habe meine Bestzeit über drei Meilen geknackt. Ich beschäftige mich viel mit körperlicher Fitness und Gesundheit, nicht zuletzt natürlich, weil ich 47 Jahre alt bin. Ich bin in mittleren Jahren und das ist die Zeit, wo Menschen sich mit solchen Dingen auseinandersetzen.«
Während er monologisiert, sehe ich mich um. Diese große Hütte oder kleine Scheune riecht nach sonnendurchdrungenem Holz und verstaubten Büchern. Der Dachstuhl besteht aus nackten Bohlen und Balken. Der Arbeitsplatz ist umgeben von Stahlregalen voller Nachschlagewerke über Geschichte, Erdkunde, Technik und Politik. Unser Gespräch findet am anderen Ende des Gebäudes statt, auf einer ausziehbaren Couch. Das Holz hinter mir ist warm durch die darauf scheinende Sonne.
Ich finde es bemerkenswert, dass Anthony so ungeschminkt über seine Fantasy-Romane redet, aber es überzeugt mich nicht völlig. Sicherlich verdient man mit einem ernsthaften Roman wie Macroscope auf lange Sicht mehr Geld als mit einem humoristischen Fantasy-Schmöker, der schnell wieder vergessen ist, oder?
»Also, Macroscope ist 1969 erschienen und es hat mir etwa 28.000 Dollar eingebracht. Ich kann nachsehen, wie viel genau, ich bin bei so etwas sehr penibel. Source of Magic ist 1979 erschienen, zehn Jahre nach Macroscope, und bereits jetzt habe ich damit 31.000 Dollar verdient. Und den habe ich so aus dem Ärmel geschüttelt, einfach weil es schnell ging und Spaß gemacht hat.
»Die Sachen, an denen man fünf Jahre lang arbeitet und danach hundert Seiten vorweisen kann – auch dafür sollte es einen Markt geben, genauso wie für das Zeug, das man in zehn Tagen runterschreibt und das sich dann 250.000 Mal verkauft. Ich schreibe beides; bedauerlicherweise langt es aber bei mir bei dem hochwertigen Material nicht, und deswegen bin ich jetzt eher für die seichteren Romane bekannt, die ich schreibe. Ich bin sicher, dass Sie davon ausgegangen sind, dass ich die leichten Sachen verteidigen und betonen würde, wie toll die sind, aber das tue ich nicht. Die bringen gutes Geld, es ist gute Unterhaltung, aber ich würde sie nicht als echte Literatur bezeichnen.«
Ich frage ihn, wen er für diese Situation verantwortlich macht. Sich? Seine Leser? Seinen Verleger? Den Buchhandel?
»Alle. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Ich ringe da mit mir, ich frage mich ›Warum nur, warum?‹ und hämmere mit dem Kopf gegen die Wand. Aber ich betrachte dann auch mein eigenes Verhalten, wenn ich fernsehe. Ich lehne das Fernsehen nicht ab, auch wenn es meinetwegen eine ›intellektuelle Wüste‹ ist, aber wenn ich das höre, dann denke ich an die Wüste da draußen, und die ist auf den ersten Blick leer, aber wenn man genau hinsieht, dann stellt man fest, dass sie ihre eigene Ökologie hat. In der Wüste gibt es Dinge, die es nirgendwo sonst gibt und die erhalten werden sollten. Diese Leere bedeutet also nur, dass Menschen damit nicht viel anfangen können, für die Tiere und Insekten, die dort leben, ist sie nicht leer.
Jedenfalls, was sehe ich mir an, wo ich doch die volle Freiheit habe, mir im Fernsehen anzusehen, was ich will? Das ist die Frage, auf die ich jetzt so umständlich hinauswollte. Nun, höchstwahrscheinlich ist das irgendetwas Seichtes, Flaches, MAGNUM oder so etwas, wo ich mir doch auch die New Yorker Philharmoniker ansehen könnte. Aber wenn ich hart gearbeitet habe, dann will ich mich entspannen, ich will nichts, das meinen Intellekt fordert, ich will etwas, bei dem es nicht drauf ankommt, ob ich mich darauf konzentriere oder nicht. Ich will das, weil es so flach ist. Und so ist das auch mit meinen Lesern. Ich glaube nicht, dass die von Hause aus seicht oder unbedarft sind, die sind einfach müde, wenn sie nach Hause kommen, sie wollen dann nicht Krieg und Frieden lesen, sie wollen sich nur entspannen und unterhalten werden, ohne sich körperlich oder geistig anstrengen zu müssen, und dafür ist das Fernsehen gut, ebenso wie eine bestimmte Art von Unterhaltungsliteratur.«
Aber jetzt, wo er erfolgreich ist, könnte er da nicht vielleicht Anspruchsvolleres schreiben und darauf hoffen, dass es sich nun aufgrund des Namens verkaufen wird?
»Na ja, die Reihe, die ich gerade an Avon verkauft habe, BIO OF A SPACE TYRANT, ist eine Space Opera, und auch dafür konzipiert, und trotzdem stelle ich jetzt fest, während ich den ersten Entwurf schreibe, dass ich da mehr politische Aussagen unterbringe als je zuvor in meinem Leben. Ich sage nicht ›Ich bin berühmt und bedeutend, hört euch an, was ich zu sagen habe‹, ich schmuggle das einfach hinein.
Ich habe es dem Verleger so verkauft: ›Was, wenn jemand, der wirklich schreiben kann, sich an einer Space Opera versucht?‹ Es mag sein, dass vieles von dem, was ich sage, arrogant klingt, aber ich glaube das wirklich, ich glaube an mich, ich kann schreiben. Ich behaupte nicht, dass ich der beste Autor bin, aber ich bin gut. Ich kann so schreiben wie Sie, ich kann auch Auftragsarbeiten machen, ich kann das alles, und nicht viele können wirklich alles. Ich produziere die leichteste, lustigste Fantasy am Markt, da versucht niemand auch nur, in diesem Bereich mit mir zu konkurrieren. Ich habe diesen ganzen Markt für mich allein. Und ich kann die wirklich ernsten Themen bearbeiten. BIO OF A SPACE TYRANT basiert auf der Geschichte der vietnamesischen Boatpeople. Die flohen aus Vietnam und kamen nach Thailand, aber damit waren sie nicht gerettet. Die Männer wurden getötet, die Frauen vergewaltigt und die Kinder über Bord geworfen. Da sind Frauen zehn Mal vergewaltigt worden, bevor sie endlich Land erreichten, es gab nur noch zwei Überlebende – und niemand glaubt ihnen. Es heißt: ›Habt ihr Zeugen für das alles?‹ Aber all die Zeugen sind tot. Ich habe mich gefragt ›Was, wenn ich so etwas ins All verlege?‹, und dann fingen die grauen Zellen an zu rotieren, und jetzt bin ich mitten in einer Serie aus fünf Romanen. Ich habe die im Sonnensystem angesiedelt, meine Figuren sprechen Spanisch und sie gelangen schließlich zum Jupiter, dem Land der Verheißung. ›Schickt uns eure Heimatlosen‹ und all diese Versprechungen, aber dann heißt es ›Tut uns leid, wir haben eine neue Regierung, unsere Politik hat sich geändert, wir schicken euch wieder ins All zurück‹. Das ist die Politik, die Reagan vertritt. Wenn es nach ihm ginge, würde er diese Leute zurück aufs Meer schleppen lassen und sie dann vergessen.«
Für mich stellt sich da die Frage, ob jeder diese Reihe so politisch sehen wird, wie er es offenbar tut – vor allem die Literaturkritiker. Ist Piers Anthony der Meinung, dass er in der Vergangenheit von der Kritik unfair behandelt worden ist?
»Ja und nein. Ich hatte Probleme mit Ballantine Books, die mich ausgelistet haben, statt richtig mit mir abzurechnen, und dann bin ich zu einem Anwalt gegangen. Wenn jemand bereit war, die zu verklagen, dann war ich das. Sie haben ein Buch von mir nach England verkauft, eines nach Holland und eines nach Deutschland. Ich habe dafür nicht nur kein Geld bekommen, die Verkäufe tauchten auf ihren Abrechnungen gar nicht erst auf. Das machte mich wütend und ich habe ihnen einen geharnischten Brief geschrieben. Man hat mir hinterbracht, Betty Ballantine habe gesagt, das sei der unverschämteste Brief gewesen, den sie in ihrem ganzen Leben erhalten hat. Dabei habe ich nichts weiter verlangt als dass sie korrekt abrechnen. Aber ich sollte der Fairness halber hinzufügen, dass die Abrechnungen bei Ballantine Books heute ordentlich erfolgen.
Jedenfalls fing damit der Ärger an, denn ich landete auf einer schwarzen Liste, und das galt auch für Rezensionen. Es gibt immer noch Publikationen, in denen ich nicht besprochen werde, weil irgendwelche Leute gehört haben, was für ein furchtbarer Mensch ich bin.«
Für mich klingt das, als ginge er davon aus, dass jeder Verleger zu betrügen versucht, wenn er das kann und es ihm finanzielle Vorteile bringt; und deswegen ist er vorsichtig, mit wem er sich in der Welt da draußen einlässt. Hat das etwas mit Entfremdung in der Kindheit zu tun, von der so viele Science-Fiction-Autoren reden?
»Als Jugendlicher war ich sehr schmächtig. Als ich nach der neunten Klasse meinen Abschluss machte, wog ich gerade mal 45 Kilo und war 1,50 Meter groß. Ich war der Kleinste und Schmächtigste von allen Jungs und Mädchen in meiner Klasse in Westown School, Pennsylvania.
Und nicht nur dass ich so klein war, ich war auch noch im Alter von sechs Jahren aus England in dieses Land gekommen und alle versuchten, mir meinen englischen Akzent abzugewöhnen, und ich wollte das nicht. War ich ein Außenseiter? Ja, und dazu noch einer, der klein war. Das ist mir schon klar.
Aber ich wuchs noch. Von 1,50 zu schließlich etwa 1,73 Meter. Ich habe manchmal etwas zweifelhafte Anwandlungen, und eine davon genoss ich bei der Feier zum 25-jährigen Schulabschluss. Da stand ein Mann neben mir, 1,80 Meter groß, und er war fett geworden, mit Bierbauch und allem drum und dran, und ich hatte meine kleine Tochter dabei und hob sie hoch und da sagt er ›Vorsicht, die ist schwer!‹. Das bereitete mir deshalb eine solche Genugtuung, weil er damals der Klassenrowdy gewesen war. Damals war er schon 1,80 Meter, als ich noch mehr als einen Kopf kleiner war. Er hat mich damals verprügelt. Und jetzt, 25 Jahre später, hätte er mich nicht einmal zu fassen bekommen können, wenn er das gewollt hätte. Und falls doch, dann hätte er keine Chance gegen mich gehabt. Ich gewann eine ausgesprochen fiese Befriedigung daraus, dass ich das wusste und dass ich wusste, dass er das wusste.«
Für mich ist klar, dass er unter einem zwanghaften Leistungsdruck steht, angefangen bei seinem selbst auferlegten Arbeitspensum bis hin zu seinem Fitnessprogramm. Wenn er redet, dann betont er alle Verben – vor allem Wörter wie »kann« »werde« und »tue«.
»Es stimmt. Auch wenn ich laufe, versuche ich immer den eigenen Rekord zu brechen, selbst wenn ich rational natürlich weiß, dass das nur der sportlichen Betätigung dient. Warum renne ich dann die Meile unter sieben Minuten?
Einiges, was ich tue, ist wirklich zwanghaft. Wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann nur darauf. Ich versuche, mein Bestes zu schaffen in allem, was ich tue. Ich mache meine Arbeit, ich mache meine Hausaufgaben, Sie sehen ja all die Nachschlagewerke hier.
Wenn ich nicht schreibe, dann werde ich depressiv, etwa wenn ich zwei Tage damit verbringe, Fanpost zu beantworten und nicht zu schreiben. Das schleicht sich an mich ran. Ich will schreiben. Ich fühle mich dazu genötigt. Und wenn ich schreibe, bin ich glücklich, ich bin zufrieden.«
Aber wo kommt dieser Zwang her?
»Ich weiß es nicht. Ich beobachte die Tiere, und ich sehe, wie Welpen zusammen aufwachsen – wir haben zwei, der eine konkurriert mit allem und will sich immer beweisen, während der andere es locker angehen lässt. Das liegt nicht an unserer Erziehung, das liegt nicht an Umwelteinflüssen, das kommt von den Genen.
Mein Großvater war früher der Pilzkönig von Pennsylvania. Die Hälfte der Speisepilze, die in diesem Staat gezüchtet werden, stammen auch heute noch hier aus der Gegend. Er hat alles zwei Wochen vor dem Börsencrash von 1929 verkauft, aber die Leute, die er ausgebildet hat, haben das Geschäft dann weitergeführt. Er sah seine Lebensaufgabe darin, Geschäfte zu machen und Geld zu verdienen.
Mein Vater dagegen wurde Lehrer. Er hat Spanisch unterrichtet, hat sich mit Bildung beschäftigt und wurde deswegen auch nicht reich. Und jetzt ich – mein Vater hat sicherlich nicht geplant, dass ich Geschäftsmann werde, er verabscheut Geschäftemacherei. Die Idee, seine Energie darauf zu verwenden, Geld zu verdienen, stieß ihn ab – verständlicherweise. Ich selbst bin auch kein Geschäftsmann, aber ich habe die Veranlagung dazu, und ich verdiene viel Geld, so wie mein Großvater es getan hat. Ich bin nicht auf Geld fixiert. Ich verschwende es nicht, Sie werden nicht erleben, wie ich losgehe und mir Cadillacs kaufe, nein, ich bin hier und hacke Holz, weil wir einen Holzofen haben. Und unser warmes Wasser wird von einer Solaranlage erzeugt, und wenn die Sonne nicht scheint, dann gibt es eben kein warmes Wasser, weil ich keine Energierechnungen bezahlen will. Ich bin knauserig! Mir gefällt der Gedanke, dass mein Großvater, wenn er noch leben würde, sich umsehen und überlegen würde, wessen Lebensweise seiner am nächsten kommt – das wäre dann meine.«
In diesem Moment meldet sich seine Frau über die Gegensprechanlage und erklärt, dass das Mittagessen fertig sei. Er hat fast anderthalb Stunden geredet (ich habe hier vielleicht ein Drittel von dem wiedergegeben, was gesagt wurde) und er scheint nicht glücklich, jetzt aufzuhören.
Das Innere seines Hauses ist gemütlich, aber eine Bauruine. Er erzählt, dass sie von einem betrügerischen Bauunternehmen übers Ohr gehauen wurden, der ihnen ein verzinktes Dach statt des unverwüstlichen Edelstahldaches, für das sie bezahlt hatten, verbaut hatte. Sie verklagten den Unternehmer, er meldete Konkurs an und das Haus wurde nie fertiggestellt. Das war vor vier Jahren. Deswegen besteht der Fußboden aus nacktem Beton, die Deckenbalken sind unbehandelt und als ich das Badezimmer benutze, bemerke ich, dass da zwar ein Anschluss für eine Dusche existiert, die Badewanne aber nie eingebaut wurde. Stattdessen liegt da ein großer Haufen Zeitungen und Zeitschriften.
Piers Anthony erläutert mir weiter seine Lebensphilosophie, während wir zusammen Käseomeletts essen. Er hat seine Tantiemen nicht in sein eigenes Haus gesteckt (das aussieht, als hätte man eine Hippie-Kommune von Kalifornien nach Florida verpflanzt). Stattdessen hat er umliegendes Land gekauft. Er sagt »wir wollen uns nicht darauf verlassen, dass die Nachbarn, die dort hinziehen könnten, unseren Qualitätsansprüchen genügen. Deswegen kaufen wir so viel Land, wie wir können, und verhindern so, dass es besiedelt wird«. Bisher haben sie über sieben Hektar gekauft.
Nach dem Essen kramt seine Frau, die früher als Programmiererin gearbeitet hat, einen Atari Computer unter einigen Plastikfolien hervor, die ihn vor Staub schützen sollen, und demonstriert das Textverarbeitungsprogramm, das Piers Anthony nicht verwendet, weil der Atari über eine konventionelle Schreibmaschinentastatur verfügt und er sich an das spezielle Design seiner mechanischen Schreibmaschine gewöhnt hat. Und außerdem kann es bei Computern zu Stromausfällen kommen. Er bleibt lieber bei seinem vollkommen nicht elektrischen System.
Er horcht mich nach Klatsch aus New York aus und erklärt mir, wie hoffnungslos naiv ich doch bin, weil ich glaube, dass die meisten Verleger ehrlich und vertrauenswürdig sind. »Die meisten Verleger haben keine Moral. Die glauben, dass das, was sie tun, korrekt ist, aber als Autor sollte man sich vorsehen.«
Und mit dieser ominösen Warnung ist es für mich Zeit, mich zu verabschieden, weil ich noch am gleichen Nachmittag zu einem Interview mit Keith Laumer verabredet bin.
(16. März 1982)
Historischer Kontext
Jeder Autor, der in meinen ursprünglichen Interviewbänden vertreten war, bekam die Gelegenheit, meinen Text zu lesen und Änderungen zu verlangen. Sehr wenige haben von dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch gemacht.
Andre Norton und Jack Vance waren zwei Ausnahmen. Ihnen gefielen einige meiner Beobachtungen nicht und sie verlangten Änderungen. Piers Anthony war ebenfalls nicht glücklich über die Art, wie ich ihn dargestellt habe, aber aus Prinzip bestand er darauf, nicht in mein Recht auf freie Meinungsäußerung einzugreifen. Stattdessen stellte er seinen Standpunkt klar, indem er mich der gleichen Behandlung unterwarf, die er seiner Meinung nach von mir erfahren hatte. Er verfasste ein Miniporträt von mir, bei dem er meinen Stil satirisch aufgriff und meine Angewohnheit, Rückschlüsse aus relativ wenigen Indizien zu ziehen, auf die Spitze trieb.
Das war eine unangenehme Erfahrung, denn seine Satire traf ins Schwarze. Als ich ihn später näher kennenlernte, wurde mir klar, dass meine ursprüngliche Einschätzung von ihm vollkommen richtig war, aber ich muss zugeben, dass sie auf einer Einschätzung aufgrund einer Unterhaltung von nur wenigen Stunden beruhte.
Die Art, wie er mich zurechtstutzte, war typisch für die Art, wie er mit Leuten aus der Verlagswelt umging. Immer wenn er das Gefühl hatte, er werde unfair behandelt, wurde er streitbar. Wenn jemand ihn andererseits freundlich behandelte, war er einer der hilfsbereitesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Als wir miteinander in Kontakt blieben, nachdem ich ihn porträtiert hatte, bekam ich zu spüren, wie großzügig er sein konnte.
Es war 1986, und ein Freund von mir, der gerade Herausgeber in einem Verlag geworden war, suchte verzweifelt nach »namhaften« Autoren. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, die Erlaubnis zu bekommen, eine Fortsetzung zu einem von Piers Anthonys Romanen zu schreiben. Ich hatte so etwas noch nie gemacht, aber Piers’ Roman Chthon hatte mich schon immer fasziniert, weil er mir den Eindruck vermittelte, er sei voller dunkler Triebe und Andeutungen, die nie wirklich ausgeführt wurden. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie ich die in einer Fortsetzung deutlich unzweideutiger ausmalte.
Als ich ihn um seine Einwilligung bat, stimmte er sofort zu. Er überließ mir sogar die völlige kreative Kontrolle und lehnte sogar eine Bezahlung ab. Ich handelte einen Vertrag mit New American Library aus und war bereit, mich an die Arbeit zu machen, als ich einen Brief von ihm erhielt, in dem er mich daran erinnerte, dass er ja bereits eine Fortsetzung mit dem Titel Phthor geschrieben hatte. Er gehe davon aus, dass ich das wisse.
Nun, ehrlich gesagt, nein, das wusste ich nicht. Aber ich hatte bereits einen Vertrag unterschrieben und musste akzeptieren, dass ich jetzt den Folgeband zu einer Fortsetzung schreiben musste.
Piers schickte mir ein Exemplar von Phthor und ich musste begreifen, dass die Situation weit schlimmer war, als ich mir das vorgestellt hatte. Am Ende des Romans starb jede der handelnden Personen und der Planet, auf dem sie lebten, wurde pulverisiert.
Verärgert schrieb ich Piers an und fragte, warum er überhaupt zugestimmt hatte, dass ich eine Fortsetzung zu einer Handlung schreibe, in der jeder auf der letzten Seite tot ist. Seine Antwort war kurz und prägnant: »Glaubst du, das wüsste ich noch?«
Ich fand schließlich eine Lösung über ein Paralleluniversum, aber die Handlung wurde so kompliziert, dass selbst ich sie kaum noch begriff.
Ich ließ mich nicht abschrecken und auf eine andere Kooperation mit Piers ein, weil ich wusste, dass er 1969 einen Roman namens 3.97 Erect geschrieben hatte. Er hatte ihn an Essex Haus verkauft, einen Verlag, der sich eine kurze Zeit lang auf erotische Science Fiction spezialisiert hatte. Sie waren schon vor Erscheinen des Romans pleitegegangen, und er hatte keinen anderen Verlag gefunden, der sich da herantraute. So wie er meine Technik der Autorenporträts persifliert hatte, so persiflierte 3.97 Erect die Konventionen der Pornografie.
Dieser Roman konnte niemandem ernsthaft gefallen. Er würde die Leser nicht befriedigen, die gern Pornografie lasen, und würde sicherlich diejenigen entsetzen und abstoßen, die das nicht taten. Ich hatte immer eine Schwäche für Dinge, die den Konventionen zuwiderliefen, deswegen verdiente es dieses Buch in meinen Augen allemal, gedruckt zu werden.
Ich überlegte, dass es vielleicht noch weitere Autoren mit Werken wie 3.97 Erect