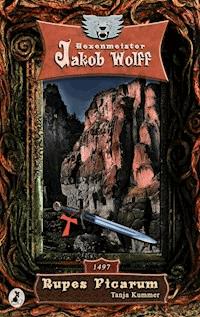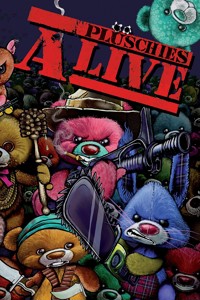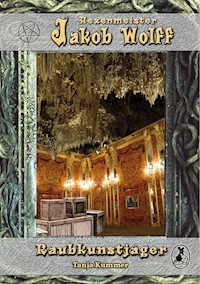Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leseratten Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Für Grace wird ihre Kindheit zu einem Wunderland, als sie den Gestaltenwandler Eweligo kennenlernt. Mit einem magischen Ring bringt er sie nach Tybay. Dort findet sie neue Freunde und verbringt viel Zeit in dieser Welt voller Magie und Legenden. Als sie dann aber die Liebe ihres Lebens in ihrer Welt kennenlernt, muß sie Tybay hinter sich lassen und wird gezwungen, diese Teile ihrer Kindheit zu vergessen. Viele Jahre später schicken sich die dunklen Mächte an, die Macht in Tybay an sich zu reißen. Ohne es zu wissen, wird Grace zum Angelpunkt dieser Auseinandersetzung und gerät in einen Strudel aus längst vergessenen Erinnerungen und dem Kampf um die Freiheit von Tybay. Sie fühlt sich hin und her gerissen zwischen ihrer neuen Liebe und ihrer Bestimmung. Ob sie es schafft, die Hoffnungen zu erfüllen, die eine ganze Welt in sie setzt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tanja Kummer
Die Weltenwandlerin
Roman
Leseratten Verlag
Tanja Kummer
Die Weltenwandlerin
ISBN 978-3-945230-02-2
1. Auflage, Backnang
© Alle Rechte vorbehalten
Leseratten Verlag, Marc Hamacher,
71522 Backnang
www.leserattenverlag.de
Für Marc, in Liebe
Für meine Lieben,
die immer daran geglaubt haben, daß ein Huhn fliegen kann.
Herzlichen Dank an meine Eltern, die mir ihre guten Eigenschaften mit auf den Weg gegeben haben. Auch an meine Schwestern, die immer meine ersten Opfer waren.
Besonderer Dank geht an meine beiden bärtigen Käuze, die mir unermüdlich dabei halfen, aus einer Geschichte eine unvergeßliche Reise zu machen. Und an meine Freundin in Berlin, die auch für die dümmsten Fragen immer ein offenes Ohr hatte.
Vielen Dank an Jamie und Del, die stets dafür sorgten, daß ich eine Pause machen mußte, wenn ich sie nicht wollte.
König Balinor
Die Nacht war finster. Dicke Wolkenwände verschleierten den Mond und die Sterne. Es roch nach Feuchtigkeit, und der erste Nebel stieg aus dem Laub und Wurzelwerk der dicht gewachsenen Bäume. Noch immer fielen schwere Tropfen aus den wirren Ästen der alten Eichen, obwohl es schon Stunden her war, daß der Regen aufgehört hatte. Doch das Wasser fand erst jetzt mit der Schwere des Nebels über das Blattwerk den Weg zur Erde.
Der Waldboden war fast völlig trocken. Nur vereinzelt waren die gefallenen Blätter feucht und glitschig. Hauptsächlich dort, wo das Blattwerk nicht so dicht wuchs, an Lichtungen und über dem Weg, dem Pferd und Reiter folgten. Im waghalsigen Galopp, daß die Hufe des Hengstes donnernde Schläge verursachten, ritten sie den kaum sichtbaren Weg entlang.
Sie waren nicht allein. Mehrere andere Pferde folgten ihnen dichtauf. Wäre da nicht sein Reiter gewesen, der ihn unbarmherzig antrieb, der Hengst wäre in einen leichten Trab zurückgefallen, um seine Artgenossen zu erwarten. Aber wieder spürte der Hengst die Hacken seines Reiters in seinen Flanken.
Der Reiter fühlte sehr wohl das erschöpfte Zittern seines Pferdes und gewahr mit Schrecken, daß es immer öfter aus dem Tritt kam. Ihr Vorsprung verkleinerte sich zusehends.
Sie waren viel zu schnell, bedachte man dem Umstand, daß man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Aber das dämmrige Licht würde Roß und Reiter ausreichen müssen, genügend Anhaltspunkte zu erspähen, um die Strecke in dieser Schnelligkeit bewältigen zu können. Sie hatten keine andere Wahl, wollten sie ihren Verfolgern entkommen.
Der Kopf mit dem einst schwarzen, jetzt ergrauten vollen Haar ruckte herum und erhaschte einen Blick über die Schulter. Aber es war zu dunkel, um seine Verfolger auszumachen. Er wandte den Blick wieder dem kaum erkennbaren Weg zu, dem das Streitroß folgte, und gewahr erst im letzten Moment das Hindernis, das auf dem Waldweg lag. Seiner Kehle entfuhr ein überraschter Schrei, und hastig ließ er den Hengst über den umgestürzten Baumstamm setzen. Auf der anderen Seite des Baumes strauchelte das Pferd und verlor auf dem feuchten Erdreich das Gleichgewicht. Im letzten Moment fing es sich wieder und entging nur knapp dem endgültigen Ende ihres Rittes. Wieder riss der Reiter unsanft an den Zügeln und setzte seinen halsbrecherischen Ritt fort.
Neben Reiter und Pferd stürzte ein Falke aus der Nacht heraus und schrie schrill auf.
»Ich weiß, mein Freund! Sie folgen uns dicht auf«, erwiderte der Mann. »Doch sprich! Meine Sorge gilt allein dem Thronerben des Landes. Hat Quinfee es geschafft, meinen Sohn und meine Gemahlin in Sicherheit zu bringen?«
Der blutrote Umhang bauschte sich im Wind des Rittes auf und entblößte einen schwarzen Harnisch, verbeult und blutverschmiert. Aber es war nicht das Blut des Reiters, denn das zusätzliche Kettenhemd darunter hatte ihn zu schützen vermocht. Der Reiter und das Pferd waren in der Finsternis nicht mehr als ein schwarzer Schatten. Ein Vorteil für sie, aber der König wußte, daß seine Verfolger ihn trotzdem finden würden.
»Ja, Mylord. Prinz Necom ist in Sicherheit. Quinfee hat sein eigenes Leben und das seiner Männer riskiert, um ihn in Sicherheit zu bringen«, erwiderte der Falke mit sanfter Stimme.
»Was ist mit meiner Königin, Eweligo?« Die Stimme des Königs wankte vor Sorge. Er ahnte, daß etwas Furchtbares geschehen war. Der Reiter warf dem Falken einen kurzen, besorgten Blick zu. Aber da war nicht mehr der Falke, sondern eine andere, menschliche Gestalt. Der Gestaltenwandler glich in seiner natürlichen Statur einem Menschen, ließ man außer Acht, daß er wenig größer als eine Elle war und ihm zwei große seidendünne Flügel aus dem Rücken wuchsen. Jetzt waren sie klar und durchscheinend. Doch wenn sich das Licht in den länglichen, libellenartigen Flügeln verfing, brach sich dieses darauf und erstrahlte in den Farben eines Regenbogens. Im Verhältnis zu seinem Körper waren seine Hände und Füße sehr groß und seine Zehen endeten in Saugnäpfen wie bei einem Frosch.
In den großen, grünen Augen stand echte, tief empfundene Trauer, als er in das von Sorge gezeichnete Gesicht seines Königs blickte. Mit einer Hand wischte er sich eine nasse Strähne des roten Haares aus der Stirn. Der König war ein Mann in den besten Jahren. Nicht mehr der Hitzkopf seiner Jugendzeit, sondern bereits mit erlesener Weisheit, aber noch nicht vom Alter gebeugt. Doch in jener finsteren Nacht glich sein Gesicht mehr dem eines alten Mannes. Eweligo hatte seinen Herrn noch nie so erschöpft gesehen, und das Elementarwesen wußte, daß es auch sein Herr wußte.
»Sie starb mit der ersten Morgenröte des gestrigen Tages, um Euren Sohn zu beschützen, mein König. Ein Stoßtrupp, knapp zwei Dutzend von König Kalidors besten Schergen, überfiel ihr Lager in der Dämmerung. Unsere Königin nahm ihr Schwert zur Hand und focht gut, aber einer derartigen Übermacht an geübten und kampferfahrenen Soldaten war die Gruppe nicht gewachsen. Sie gab Euren Sohn in Quinfees Obhut, damit er fliehen konnte. Sie selbst und die Soldaten hielten die feigen Mörder so lange auf, wie sie konnten.«
Der Wald brach vor ihnen auf und sie sprengten auf eine Lichtung und in den Nebel. Die Tränen auf den Wangen des Königs vermischten sich ungesehen mit der Feuchtigkeit des Nebels. Der Hengst begann zu tänzeln, als seine Hufe tief in den Morast einsanken. Wenige Augenblicke später erreichten sie die andere Seite der Lichtung und drangen wieder in den Wald ein.
Die Morgenröte stieg auf und der König wurde sich der Ironie gewahr, daß ihn die Nachricht um das Schicksal der Königin zur selben Zeit, jedoch einen Tag später erreichte, als es sie ereilt hatte.
Erneut warf er einen gehetzten Blick hinter sich, doch auch jetzt war noch nichts von seinen Verfolgern zu sehen. Der Ritt ging weiter und schließlich erreichten sie den Rand des Waldes. Vor ihnen erstreckte sich die Weite eines Tals. Endlich auf freier Fläche trieb der König sein Pferd noch schneller an. Seinen Schild, den Speer und all die anderen jetzt unnützen Dinge, die nur Ballast für das Tier gewesen waren, hatte er bereits vor Stunden in den Wald geschleudert. Dennoch würde er das Streitroß zuschanden reiten, wenn er es in diesem Tempo weiter hetzte. Doch selbst dieses Opfer war dem König nicht zu hoch, wenn das Gelingen seiner letzten Aufgabe davon abhing. Er mußte beenden, wozu er aufgebrochen war, wollte er sein Volk vor dem Feind retten. Danach konnte er sich seinen Herausforderern und seinem Geschick stellen.
Nun erblickte der König seine Verfolger, die ebenfalls aus dem Wald sprengten. Eine Masse dunkler Schatten auf noch schwärzeren Pferden. Obwohl die Pferde seiner Verfolger ebenso erschöpft sein mußten wie seines, glaubte er zu sehen, wie sie langsam und stetig aufholten. Eisiges Entsetzen ergriff von seiner Seele Besitz. Er erschauerte und das Zittern übertrug sich auf das Roß, das die Furcht seines Reiters spürte und energischer ausgriff.
König Balinor fürchtete nicht die Gefahr hinter sich, sondern das, was der Morgen bringen würde, falls er versagte. Vermutlich würde die Sonne gar nicht mehr aufsteigen, sondern ewige Dunkelheit fortan das Los seines treu ergebenen Volkes sein.
Es grenzte an ein Wunder, als sich der letzte Hügel vor ihm erhob. Hinter dieser Bergkuppe erwartete ihn der schönste Anblick, den zu sehen er schon nicht mehr zu hoffen gewagt hatte: den seines Schlosses. Lywell lag am jenseitigen Ende des nächsten Tals und für einen Moment wollte er hoffen, noch gewinnen zu können.
Ein kleiner Schatten, kaum weniger schwarz als die Nacht, schnellte an ihm vorbei und verschwand wieder in der Dunkelheit. Ein dumpfes Geräusch wurde laut, als der Falke in vollem Flug gegen den Reiter stieß. Überrascht blickte sich der König um und keuchte erschrocken auf, als er seine Verfolger neben und hinter sich sah. Mit einem Schrei und einer entschlossenen Bewegung zog er sein Schwert. Zum ersten Mal seit Stunden bereute er es, auch den Schild ins Unterholz geworfen zu haben.
Balinor riß an den Zügeln seines Pferdes, und mit einem entrüsteten Schnauben und zuerst bockend bäumte sich der Hengst auf und blieb dann stehen. Fast im selben Moment stürmten die Verfolger auf den König ein. Schwarze, gesichtslose Gestalten, die sich hinter ihren Rüstungen und Helmen versteckten.
Aber Eweligo war bereits wieder zur Stelle. Er stürzte sich auf einen der Soldaten und hackte mit seinem Schnabel, während dieser mit dem Schwert nach ihm schlug.
Matt schimmernde Klingen zerschnitten die Nacht und die Stille wurde von den Geräuschen des Kampfes erfüllt. Das Schwert des Königs zog blitzende Kreise, dennoch mußte er einen Hieb nach dem anderen hinnehmen. Seine Verfolger waren zu viert. Sie drängten sich um ihn, bewaffnet mit Speer, Schwert und Schild und waren scheinbar nicht im geringsten vom scharfen Ritt erschöpft.
Balinor schrie in wildem Zorn auf und hieb auf die Mörder seines Volkes und seiner Frau ein. Er wußte, daß dies nicht die Männer waren, die Quinfees Gruppe überfallen hatten, aber sie waren Soldaten desselben Herrschers. Dieses Wissen genügte, ihn vor Haß erzittern zu lassen.
Das Pferd unter seinen Schenkeln tänzelte nervös und schrie entsetzt auf, als ein Schwertstreich eine Wunde in seine Flanke schlug. Ein weiterer Hieb gegen die Beine des Tieres ließ es endgültig zusammenbrechen. Balinor schwang sich hastig vom Rücken des Pferdes und sprang beiseite, als es an der Stelle zusammenbrach, an der er noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte.
»Gebt auf und Euer Leben möge für den Augenblick verschont sein. Laßt Euch gefangennehmen und unserem König vorführen, um Euer Urteil zu hören.«
»Urteil? Weshalb bin ich angeklagt? Den Gesetzen Eures Herrn bin ich nicht Untertan! Sie haben in meinem Reich keine Gültigkeit!«, grollte der König.
»Euer Reich?«, höhnte der Sprecher. »Es gehört nicht länger Euch. Euer Schloß ist besetzt, Eure Krone ruht bald auf dem Haupt meines Herrn und Eure Hure und ihr Bastard dienen schon als Aasfutter. Welchen Anspruch könntet Ihr noch erheben?«
Balinor stürmte brüllend auf den Reiter ein. Die Breitseite seines Schwertes prallte gegen die Nüstern des Tieres, und dieses warf seinen Reiter mit jähem Schrecken ab. Der König mußte zur Seite springen, als das Tier sein Heil in der Flucht suchte.
Schwerter und Speere senkten sich und stachen nach Balinor. Eine Schwertklinge streifte seine Schulter und ein Speer verletzte seinen Schenkel. Inzwischen war der Sprecher, vom Abwurf unverletzt, aufgestanden. Brüllend vor Zorn hob er sein Schwert beidhändig über den Kopf und hackte nach Balinor. Die Klinge schnellte herab und Funken sprühten auf, als der König den Hieb parierte. Die Wucht, mit dem der Schlag geführt war, stieß die Gegner auseinander. Balinor sprang als Erster vor, griff den Sprecher an, täuschte einen von oben geführten Streich an, riß die Klinge herunter und führte sie gegen die Knie des Soldaten. Blut spritzte und der Sprecher brach schreiend zusammen.
»Mylord!«, schrie Eweligo.
Balinor wirbelte herum, wich dem heimtückischen Hieb von hinten in letzter Sekunde aus und verlor beinahe das Gleichgewicht. Er taumelte, fand wieder Halt und richtete sich auf. Die Lücke, die er geschlagen hatte, war wieder geschlossen. Eweligo, wieder in seiner eigenen Gestalt, flog enge Spiralen um des Königs Körper.
»Mylord!«, drängte Eweligo erneut. »Ihr müßt fliehen! Benutzt Euer Amulett!«
»Eweligo, wir müssen zum Schloß zurück, wenn nicht alles umsonst gewesen sein soll!«, rief der König verzweifelt.
»Vertraut mir, mein König!«, drängte das Elementarwesen weiter und zog engere Spiralen. »Es gibt noch einen anderen Weg!«
Wieder schlug einer der Soldaten auf den König ein, und diesmal verwundete er den Schwertarm Balinors schwer. Blut quoll in einem leichten Strom aus der tiefen Wunde. Binnen weniger Augenblicke würde sein Arm taub sein, so daß er das Schwert mit der linken Hand würde führen müssen. Doch das wäre dann nur noch ein letztes Aufbegehren, das Unvermeidliche so lange wie möglich hinauszuzögern.
Hastig riß der König an seinem Harnisch. Seine linke Hand glitt ungeschickt unter das Kettenhemd und suchte nach der Kette mit dem Amulett, während er mit dem Schwert einen erneuten Angriff unter Schmerzen abwehrte. Dann fanden seine Finger das münzgroße Geschmeide aus Gold, schlossen sich darum und zogen es hervor. Es war kunstvoll gefertigt. Den äußeren Rand zierten alte Zeichen, eine Schrift aus vergessenen Tagen. Im Innern leuchtete ihm das Symbol der Sonne entgegen, das Wappen seiner Familie.
»Ich bin der König, die Sonne und das Land!«, beschwor er die Macht des Amuletts. Seine Familie war nie im Besitz vieler magischer Gegenstände gewesen. Dieser Anhänger und das eine oder andere magische Geheimnis, das ihre Familie wahrte, waren alles, was sie besaßen. Die Magie dieser Welt starb und wurde vergessen. Es gab nur noch wenige, die den Umgang damit beherrschten, und noch viel weniger Wesen, deren Ursprung sie war. Eweligo war eines von ihnen, eines der letzten Elementarwesen, die noch verstreut in dieser Welt lebten.
»Zögert nicht länger!«, drängte Eweligo erneut und warf einen besorgten Blick in die Gesichter ihrer Gegner.
Balinor dachte an den Schwur, den er geleistet hatte, den magischen Anhänger nur in äußerster Not zu benutzen. War jetzt ein solcher Moment gekommen?
»Strahlen der Sonne, Wärme des Lichts, schwingt Euch herab und nehmt mich mit!«, drangen die Worte wie von selbst über seine Lippen. Das Amulett an der Kette, die er in der Faust hoch über seinem Kopf erhoben hielt, blitzte auf. Es tauchte das Land und seine Verfolger in ein fahles, weißes Licht und explodierte dann in einem Schwall greller Helligkeit. Balinor schrie auf, als ihn das Licht und die Hitze einschlossen und verzehrten.
Als er wieder zu sich kam, glaubte er blind zu sein, denn um ihn herum herrschte Finsternis. Der König lag im weichen, feuchten Gras einer Wiese und blinzelte heftig. Dann sah er den grauen Schimmer des Himmels und die funkelnden Sterne über sich und wußte, daß seine Blindheit lediglich die Folge des grellen Lichts zuvor war. Er schalt sich einen Narren. Neben ihm im Gras saß Eweligo und blickte seinem Herrn zitternd entgegen. Sorgsam hängte er sich das Geschmeide, das er noch immer in der Hand hielt, um den Hals und verbarg es wieder unter seinem Harnisch.
»Was ist geschehen?«, fragte der König und blickte sich um. Die Soldaten waren verschwunden. Nichts deutete darauf hin, daß sie je da gewesen waren. Kein Blut, keine Waffen, keine Spuren in der hohen, wilden Wiese. Keine Spuren!
Balinors Blick wandte sich mit einem erschrocken Keuchen in die Richtung, in der sein Schloß liegen sollte. Das fahle Licht der aufgehenden Morgensonne ließ es zu, umrißartig die Umgebung zu erkennen. Des Königs Augen wanderten über das mit Getreide bestellte Tal, weiter bis hin zu dem Haus auf der jenseitigen Anhöhe. Sein Schloß war nicht da. An jenem Platz erhob sich nun ein Hof in einem Baustil, den er nie zuvor gesehen hatte.
»Wo sind wir?«, fragte er. Eweligo flog leise surrend in die Höhe.
»In Sicherheit«, antwortete Eweligo einfach. »Rasch jetzt, mein König. Ihr seid verwundet und unser Weg ist noch weit.«
Balinor verband seine Wunden an Arm und Schenkel notdürftig mit abgerissenen Streifen seines Umhanges. Dann erhob er sich müde und folgte dem Elementarwesen.
Die Stunden zogen sich endlos, bis sie den Hof erreichten. Es war nun fast schon Mittag und Balinor war am Ende seiner Kräfte. Die durchwachte Nacht und seine Verletzungen hatten ihn mißmutig gestimmt, und er hatte alle Hoffnung verloren.
»Laß mich hier, Eweligo!«, keuchte Balinor. »Ich bin am Ende!«
»Aber mein König! Noch dürft Ihr nicht aufgeben, wir müssen noch einmal zum Schloß zurück. Habt Ihr es vergessen?«
»Zu welchem Schloß? Ich sehe Land, aber es ist nicht mein Land. Ich sehe ein Haus, aber es ist nicht mein Schloß! Wo sind wir?«
»Es ist schwer zu verstehen und ich würde es Euch gerne genauer erklären, aber wir haben jetzt keine Zeit«, sagte Eweligo leise. »Nur so viel, mein König. Dies ist eine andere Welt!«
»Wenn dem so ist, was soll ich dann hier, Freund?«
»Wir müssen zu dem Stall des Hauses. Dort befindet sich das Tor zurück in Eure Welt, direkt in den Stall Eures Schlosses!«, erklärte Eweligo.
»Dann geh alleine, ich bin erschöpft«, flüsterte Balinor müde.
»Mein Herr! In wenigen Tagen wird Euer Freund und Waffenmeister Gewolt aus dem Norden zurückkehren und mit ihm seine Mannen, die für Eure Krone an der Grenze kämpften. Sie werden das Schloß zurückerobern und den Frieden wiederherstellen. Aber vorher müßt Ihr zurückkehren, um die geheime Stätte Eurer Ahnen zu schützen.«
»Aber ich werde sterben, Eweligo! Hier und jetzt. Ich werde nicht mehr die Gelegenheit haben, meinen Fehler rückgängig zu machen«, widersprach der König erschöpft.
»Alles ist ruhig«, fuhr das Elementarwesen fort, ohne den Einwand des Königs zu beachten. »Vielleicht sitzen die Bewohner beim Mittagsmahl! Laßt es uns jetzt wagen, in den Stall zu gehen!«
»Eweligo, bemüh dich nicht. Es hat keinen Sinn mehr.«
»Grace! Grace! Geh nicht zu weit!«, mahnte die Stimme einer Frau. Der König und Eweligo blickten erschrocken in die Richtung, aus der die Stimme kam. Sie hatten sich unweit vom Eingang des Hauses und des Stalles in einer Reihe aus Büschen versteckt. Eine junge Frau, sehr schlank und hübsch, stand in der Tür. Fremdartige Kleidung zierte ihren Körper, und ihr Haar trug sie kurz und in einer Art geschnitten, wie es Balinor noch nie zuvor gesehen hatte.
Ihre Aufmerksamkeit galt nur kurz der Frau an der Tür. Dann wanderte diese zu der kleinen Gestalt, die sich ihnen zielstrebig näherte. Es war ein Kind, vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Blonde Locken wallten wie ein Wasserfall an ihr herab und rahmten das schmale, mit Sommersprossen bedeckte Gesicht. Auch ihre Kleidung war fremdartig und bunt.
Sie mußte sie entdeckt haben, denn als sie die Büsche erreichte, streckte sie neugierig ihren Kopf hinein. Ohne Umschweife fragte sie mit ihrer kindlichen, unverblümten Art, was sie da tun würden. In ihrer Stimme lag keine Angst, obwohl ihr gegenüber doch ein fremder Mann hockte, dessen Kleidung in ihren Augen genau so seltsam sein mußte, wie es umgekehrt war. Doch ihre großen blauen Kinderaugen leuchteten aufgeregt und erinnerten Balinor an die Augen seines Sohnes Necom.
»Wir spielen ein Spiel, mein Kind«, sagte Balinor sanft und lächelte. »Wir verstecken uns!«
»Oh, darf ich mitspielen? Ich zeige dir auch die besten Verstecke«, sprudelte es aus ihr heraus. Im selben Moment sah sie Eweligo und ihre Augen weiteten sich vor Staunen.
»Oh, wer bist du denn?« Sie kroch auch unter den Busch und drückte neugierig ihren Zeigefinger auf Eweligos Bauch. »So ein komisches Tier wie dich habe ich noch nie gesehen!«
»Nun ja, eigentlich bin ich auch kein Tier!«, schnaubte Eweligo entrüstet. Balinor grinste breit. »Laßt uns weiter gehen, Herr! Es ist gefährlich, sich mit den Einwohnern dieser Welt abzugeben«, sagte Eweligo zu Balinor.
»Sie sieht auch sehr gefährlich aus, mein Freund.« Balinor grinste wieder, doch dann nickte er ernst. »Möglicherweise hast du Recht, aber ich kann nicht mehr, sieh es endlich ein. Mein Arm ist völlig taub, meine Kehle brennt vor Durst und ich bin durch all die Entbehrungen der letzten Tage geschwächt.«
»Soll ich dir eine Limonade bringen?«, fragte das Mädchen. Balinor blickte sie verwirrt an. »Wir können danach noch etwas spielen.« Bevor es die beiden Reisenden verhindern konnten, krabbelte sie unter dem Busch hervor und rannte davon.
»Na bitte. Jetzt wird sie uns verraten und ehe wir wissen, wie uns geschieht, werden wir Gefangene ihres Königs sein!«
Doch Balinor war schon zu schwach, um sich darüber noch zu sorgen. Die Sonne am Himmel strahlte umbarmherzig herab und die Hitze des Tages ließ den König immer weiter ermüden. Es vergingen aber nur wenige Minuten, dann kam das Mädchen wieder. Sie trug einen roten Becher in ihren Händen, aus dem ständig etwas über den Rand schwappte. Grace kroch wieder zu ihnen herein und reichte Balinor das sonderbare Gefäß, das weder aus Holz, Metall noch Steingut war. Vorsichtig trank er einen Schluck. Das Wasser schmeckte süß, prickelte angenehm auf der Zunge und hatte einen sonderbaren Geschmack. Balinor wurde augenblicklich noch durstiger und leerte den halbvollen Becher in einem gierigen Zug.
»Meine Ma macht die beste Limonade! Möchtest du noch mehr?«
»Nein, es ist gut mein Kind. Ich danke dir. Leider können wir nicht länger bleiben. Kennst du einen Weg, auf dem wir ungesehen in den Stall kommen?«
»Aber natürlich«, sagte sie und wollte schon wieder loskrabbeln, aber Balinor hielt sie sanft zurück.
»Nein, Grace. Sag uns, wie wir gehen sollen. Begleiten darfst du uns aber nicht.«
Grace blickte ihn enttäuscht an. »Du hast gesagt, wir würden miteinander spielen«, begehrte sie trotzig auf und zog eine Schnute.
»Genau wie Euer Sohn!«, bemerkte Eweligo.
Balinor grinste wieder. »Du hast recht! Necom ist ebenso trotzig und aufgeweckt.« Grace blickte ihn aus großen Augen an. »Ich habe einen Knaben in deinem Alter, den ich sehr vermisse«, erklärte er.
»Gehst du jetzt, um Nerom zu sehen?«
»Necom!«, verbesserte er in tadelndem Ton. »Nein, mein Schatz, es werden viele Jahre vergehen und er wird ein Mann sein, bis wir uns das nächste Mal begegnen.« Der König lächelte wehmütig. »Es sei denn, du würdest uns jetzt von dem Weg erzählen.«
Grace nickte eifrig. Mit kurzen, kindlichen Sätzen beschrieb sie ihm, wie sie ungesehen zum Stall kommen könnten. Eweligo nickte dem König zu und dieser wußte auch ohne Worte, daß Eweligo den Weg zuerst prüfen würde. Das Elementarwesen verwandelte sich in eine schwarze Katze und huschte davon. Grace blickte ihr mit großen Augen sprachlos und staunend nach.
»Ich wäre sehr traurig, wenn ich meinen Papa so lange nicht mehr sehen würde«, sagte sie dann mitfühlend. »Aber jetzt wirst du ja heimgehen und ihn wiedersehen!«, fügte sie voller Freude hinzu. Sie nahm den Becher und wollte schon zurück ins Haus gehen, als sie sich noch einmal umdrehte und den Reisenden ansah. »Nur weiß ich nicht, was unser Stall damit zu tun hat!« Der König blieb Grace diese Antwort schuldig.
Mit einem lauten Krachen flogen die Zwillingstüren des Stalles auf. Ein halbes Dutzend Männer in schwarzen Harnischen und mit gezückten Schwertern, stürmten aus dem Stall heraus und formierten sich neu. Verwirrt und suchend sahen sie sich um.
»Sie haben uns gefunden!«, keuchte Balinor entsetzt. Seine Gedanken überschlugen sich vor Schrecken. Nur mit Mühe konnte er sich beruhigen, um wieder klar denken zu können. Dann reagierte er fast instinktiv. Sie hatten verloren. Seine Rückkehr zum Schloß war gescheitert. Das, wozu er aufgebrochen war und seine Frau und sein Kind verlassen hatte, würde er nicht mehr tun können. Jetzt konnte er nur noch versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Eweligo war noch nicht wieder zurück und entzog sich seinen Blicken. Nur das Kind war noch da, von all den Geschehnissen verwirrt und überrascht. Es gab nur diese eine Möglichkeit. Der König riß sich die Kette vom Hals, dann drückte er sie Grace in die Hand und hielt das Kind fest. »Verstecke dies! Diese Kette ist sehr wertvoll, mein kostbarster Besitz! Niemand darf wissen, daß du sie hast. Bewahre sie für mich und meinen Sohn gut auf«, sprach er eindringlich auf das Mädchen ein. Grace nickte. »Jetzt lauf ins Haus, mein Kind. Sieh dich nicht um! Bleib nicht stehen! Rasch, Grace!« Er ließ sie los und gab ihr einen Klaps.
Grace rannte los und wurde sofort von den Soldaten bemerkt. Sie verschwand aber kaum darauf wieder aus ihrem Blickfeld, als sie die Seite des Hauses erreichte und um eine Ecke lief. Zuerst schienen die Soldaten nicht zu wissen was sie tun sollten, denn schließlich stellte das Kind keinerlei Bedrohung dar und war auch nicht ihre Beute. Doch dann beschlossen sie nachzusehen, was das Kind dort überhaupt gemacht hatte. Inzwischen hatte sich der König mühsam hochgestemmt und humpelte geduckt auf das Feld zu, von dem er zuvor mit Eweligo gekommen war. Er hörte, wie sich die Soldaten näherten. Da er nicht ausschließen konnte, daß die Soldaten dem Kind folgen würden, gab er seine Deckung auf. Als die Schergen König Kalidors ihre Beute fliehen sahen, nahmen sie die Verfolgung auf.
Grace
Die kleine Grace hatte den Mann in dem Busch nie mehr gesehen, aber das merkwürdige geflügelte Wesen war einige Wochen später zurückgekehrt. Unbemerkt hatte sie es beobachtet und verfolgt, als es suchend die Stellen abgeflogen hatte, an denen es mit dem Mann gewesen war. Das Mädchen war sich unsicher, was es tun sollte, aber irgendwann platzte es fast vor Neugierde und verließ sein Versteck, um das Wesen anzusprechen.
»Hallo«, sagte sie leise, und das Wesen drehte sich zu ihr um und lächelte ihr freundlich entgegen.
»Hallo, Grace! Ich hatte schon befürchtet, du wolltest dich die ganze Zeit versteckt halten«, sagte es freundlich. Das Mädchen lächelte verlegen.
»Woher kennst du meinen Namen?«, fragte sie überrascht.
»Ich habe gehört, wie deine Mutter dich so nannte. Es ist ein sehr schöner Name.«
»Ja, danke!« Sie machte eine Pause, tippelte verlegen mit ihren Beinen und fragte ihn dann, »Und wie ist dein Name?«
»Ich bin Eweligo«, antwortete das Wesen und begann weiter zu suchen, was auch immer es zu finden hoffte.
»Suchst du etwas?«, wollte das Mädchen wissen.
»Ja, eine Kette. Ich fürchte, daß mein Herr sie verloren hat!«
»Oh«, sagte das Mädchen und kaute auf der Unterlippe. »Wird er kommen, um sie zu suchen?«
»Nein, meine Liebe.« Eweligo schüttelte traurig den Kopf. »Er wird nie mehr bei uns sein können.«
»Warum nicht?«, hakte sie nach.
Verzweifelt versuchte Eweligo, eine passende Umschreibung für den Zustand des Todes zu finden, als das kleine Mädchen fortfuhr, »Oh, meinst du, er ist in den Himmel gegangen?«
»Wenn man das bei euch so nennt, ja.«
»Hm«, machte das Mädchen nachdenklich. »Das tut mir leid für Necom! Wird der denn kommen?«
»Nein, meine Liebe!« Auch diesmal schüttelte das Wesen den Kopf. »Das ist zu gefährlich! Er muß an einem Platz bleiben, an dem es sicher für ihn ist.«
»Aber dann kann ich vielleicht zu ihm«, schlußfolgerte das Mädchen. Eweligo nickte überrascht.
»Das könntest du sicherlich. Aber zum einen ist die Reise für jemanden wie dich zu weit und gefährlich, zum anderen frage ich mich, was du so dringend von ihm möchtest?«
»Oh, nichts!« Sie blickte unschuldig. »Ich dachte mir nur, vielleicht hat er Lust mit mir zu spielen, weil ich hier doch ganz alleine bin«, vertraute sie ihm ihre Einsamkeit an. Eweligo legte den Kopf schräg und musterte das Mädchen. Sie war sehr hübsch und unter dem blonden Schopf lag ein über und über mit Sommersprossen besprenkeltes Gesicht, das nicht lügen konnte.
»Warum bist du hier denn ganz alleine?«, wollte er wissen und landete auf dem Boden. Sie setzte sich zu ihm in die Wiese und zuckte mit den Schultern.
»Ich bin alleine, ich habe keine Geschwister und es kommen nur selten Fremde her.«
»Haben denn deine Eltern keine Zeit für dich?«
»Mein Vater verbringt fast nie Zeit mit mir, er ist sehr beschäftigt. Mama ist auch beschäftigt, aber sie spielt manchmal mit mir, und abends liest sie mir Geschichten vor. Aber sie ist nicht gerne draußen, weil sie nicht schmutzig werden möchte.« Grace nickte bekräftigend. »Sie mag es auch nicht, wenn ich mich dreckig mache, aber das ist mir egal!« Ein verschmitztes Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht.
»Das sieht man«, bestätigte Eweligo grinsend und betrachtete die Erd- und Grasflecken auf ihrem hellblauen Kleidchen. Kleine Zweige steckten in der goldenen Haarpracht und Grace’ rechte Wange war mit feuchter Erde beschmiert. »Du hast dir ja viel Mühe gegeben, damit ich dich nicht sehe. Eigentlich ist das eine kleine Belohnung wert, zumal ich hier fertig bin und zurück sollte.«
»Zurück?«, fragte Grace. Eweligo lächelte und erhob sich in die Lüfte.
»Ja, das wirst du gleich sehen. Komm mit!«, forderte er sie auf und flog Richtung Herrenhaus. Grace sprang auf und folgte ihm. Das seltsame geflügelte Wesen schwirrte zum Stall, spähte durch den Spalt der geöffneten Doppelflügel und summte ins Innere. Grace, leicht außer Atem, weil sie nicht so schnell konnte, folgte ihm ohne zu zögern. Der Gestaltenwandler wartete am anderen Ende des Stalls auf sie. Als das kleine Mädchen hineinkam, spitzten die zwei Dutzend Pferde die Ohren und eines scharrte aufgeregt mit dem Vorderhuf. Aber Grace achtete nicht darauf.
»Und was jetzt?«, fragte sie Eweligo, als sie ihn erreicht hatte. Er flog zu ihr herab und streckte ihr seine Hand entgegen.
»Siehst du den Ring?« Grace blickte auf den Goldring und nickte. Eweligo fuhr fort. »Es ist ein Weltenring. Mit ihm kannst du durch ein Weltentor aus deiner Welt in andere Welten reisen.«
»Es gibt keine anderen Welten!« Grace schüttelte den Kopf, beleidigt über den Unsinn, den Eweligo ihr erzählte.
»Gibt es nicht?«, fragte er grinsend. »Dann gib gut acht!« Das kleine Wesen packte Grace an der Hand und zog sie mit unerwarteter Kraft vorwärts. Grace folgte ihm stolpernd, und gerade als sie glaubte, gegen die Holzwand des Stalles zu stoßen, verschwanden für einen Wimpernschlag alle Bilder vor ihr. Als sie wieder etwas sah, eröffnete sich vor ihr ein ihr vollkommen unbekannter Stall.
»Wo sind wir?«, fragte das Mädchen verblüfft und schaute sich staunend um. Der Stall lag innerhalb eines Gebäudes, denn die Wand war nicht verputzt, sondern bestand aus grauen, ungleich großen rechteckigen Steinen. Die Decke war in der Mitte nach oben gewölbt und an ihrem höchsten Punkt fast fünf Meter hoch. Grace Augen wurden kugelrund vor Staunen, als sie die Pferde sah. Es waren sicher mehrere Dutzend, die hier eng gepfercht beieinander standen. Sie sah große und kleine Pferde in verschiedenen Farben. Es waren auch Pferde dabei, die wie jene aussahen, die sie aus dem Stall ihres Vaters kannte. Dann wiederum entdeckte sie wahre Giganten von Pferden, die groß und massig waren. Solche hatte sie noch nie gesehen.
»Oooh!«, bewunderte sie die Menge und Vielfalt, die sie hier sah.
»Komm!« Eweligo winkte ihr zu und sie folgte ihm. Helles Tageslicht füllte den Torbogen vor ihnen.
Zwei Stalljungen drehten sich zu ihnen um und betrachteten das seltsame Paar.
»Wen hat Eweligo da bei sich? Er ist doch alleine durch das Weltentor gegangen?« Der zweite Stalljunge zuckte mit den Schultern.
»Hast du Angst vor einem Mädchen?« Er grinste seinen Freund an. Dieser verdrehte die Augen und machte sich wieder an seine Arbeit. »Eweligo wird wissen, was er tut. Er gehört dem Rat an. Du solltest dir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Das sind Angelegenheiten, die uns nicht zu kümmern haben«, schloß er das Gespräch ab und wendete sich wieder seinen Aufgaben zu.
Grace hingegen hatte die beiden Jungen nicht einmal wahrgenommen. Ihr Blick hing wie gebannt an dem Licht.
»Willkommen in Tybay!«, sang Eweligos Stimme überschwemmend an Gefühlen, als er mit ihr aus dem Schatten der Stallungen trat. Grace mußte blinzeln, um sich an das gleißende Sonnenlicht zu gewöhnen, und ihre Augen tränten ungewollt. Dann erkannte sie Umrisse und Konturen. Vor ihr öffnete sich ein Platz, von dem aus nach beiden Seiten breite Wege abgingen. Als sie weiter geradeaus blickte, konnte sie die Spitzen von Häusern und Türmen erkennen. Sie rannte vor, nutzte ihren Schwung und hüpfte auf die Begrenzungsmauer. Sie war noch sehr klein und hätte nur mit Mühe darüber sehen können, doch hier oben auf der Mauer war die Aussicht viel besser. Unter ihr ging es einige Meter hinab und darunter sah sie ein Dach aus Holz und Stein. Und als sie ihren Blick weiter schweifen ließ, sah sie, daß es nicht das einzige Haus war. Der Hang der Berges, auf dem sie sich befanden, war voller Häuser, wenn auch viele der Dächer fehlten oder schadhaft waren und den Blick in ein zerstörtes Inneres freigaben. Dazwischen schlängelten sich Wege, und hier und da sah sie Menschen in einfachen Leinengewändern in Gassen oder auf Plätzen.
»Warum sind so viele von den Häusern kaputt?«, fragte sie. Eweligo seufzte.
»Weil wir im Krieg sind«, erklärte er. »Ein Heer feindlicher Soldaten hat in der Stadt geplündert und Feuer gelegt.« Eweligo seufzte erneut. »Zum Glück waren sie nicht sehr gut organisiert, sonst wäre es nicht so leicht gewesen, die Feuer zu löschen. In einer Stadt sind die Häuser oft dicht beieinander gebaut und teilweise ganz aus Holz. Wenn sich das Feuer einmal darin festgebissen hat, ist es oft unmöglich, es zu löschen.«
»Oh«, sagte sie wieder, weil sie nicht genau wußte, was sie sagen sollte. Ihre Augen wanderten weiter bis zum Fuße des Berges. Dahinter konnte sie sehr weit ins Innere des Landes sehen, weil es dort sehr flach war. Rechts von ihr waren weitere Ausläufer des Berges, auf dem sie sich befanden. Längst nicht so hoch, aber sehr viel Wald war zu sehen. Geradeaus konnte sie fast nur Getreidefelder ausmachen, die immer wieder von Bauernhöfen, Hecken und kleine Wäldchen getrennt waren. Links sah sie weitere Felder, aber dort wurde es wieder hügeliger und es gab mehr Wald als in der Mitte des Tals. Der Ausblick war wunderschön. Der Gesang von Vögeln drang aus der Ferne herbei und sie hörte Flötenmusik. Unterschiedliche, leckere Düfte von zubereiteten Speisen zogen ihr in die Nase. Ungewollt knurrte ihr der Magen und sie senkte verlegen den Kopf.
»Hunger?«, fragte Eweligo freundlich, aber das Mädchen schüttelte schüchtern die goldene Mähne.
»Nein, aber es riecht lecker.«
»Das kann man wohl sagen! Komm, im Schloß gibt es sicher etwas zu essen«, lud er sie ein und flog davon.
Grace drehte sich im Sitzen um, und als sie von der Mauer springen wollte, blickt sie nach oben. Das Gebäude, das sich vor ihr erhob, erschien ihr so gigantisch, daß es fast den Himmel berühren könnte. Die Sonne, von der das Bauwerk bestrahlt wurde, ließ die Steine weiß und golden erscheinen, obwohl ihre wahre Farbe ein sanftes Grau war. Die Fenster waren mit Glas geschlossen. Sie fingen die Strahlen der Sonne ein, und für einen kurzen Moment gab sich Grace dem Gedanken hin, man hätte die Öffnungen mit flüssigem Gold gefüllt.
Der Stall, aus dem Grace gekommen war, bildete das unterste Gemäuer des Schlosses. Grace sah, daß der Stall in die Festungsmauer eingelassen war, welche von der einen bis zur anderen Seite des Berges reichte. Die Mauer schien ihr gigantisch hoch, teilweise war der natürlich gewachsene Fels mit hineingearbeitet worden. Endlich sprang sie von ihrer Mauer herunter und folgte Eweligo. Immer wieder sah Grace empor und entdeckte rechteckige Öffnungen in der Wehrmauer. Die Löcher gaben ihr Rätsel auf, zugleich aber ahnte sie, daß ihre Bedeutung nicht angenehm sein konnte. Sie beschloß, Eweligo besser ein anderes Mal nach deren Nutzen zu fragen. Dann erreichten sie das Tor. Es stand offen. Ein halbes Dutzend Soldaten standen dort und unterhielten sich. Sie trugen prächtige farbenfrohe Uniformen und an ihren Hüften Schwerter. Die Speere, die an der Mauer lehnten, gehörten sicher auch zu ihrer Ausrüstung, doch offenbar befürchteten sie keinen Angriff. Da sie Eweligo und Grace bereits kommen gesehen hatten, nickten sie dem Elementarwesen nur freundlich zu.
Eweligo beließ es dabei, ebenso zu grüßen. Die Formlosigkeit, wie sie hier herumlungerten, gefiel ihm nicht besonders, aber sie hatten recht, es bestand keine Notwendigkeit zur größeren Wachsamkeit. Die Berichte der Spähtrupps waren in letzter Zeit alles andere als alarmierend gewesen.
Der einzige Weg zum Schloß führte durch die Wehrmauer. Erst jetzt konnte Grace sehen, wie dick sie war. Sie war sich sicher, daß es in ihrem Innern Gänge gab, denn ihr fielen wieder diese seltsamen Öffnungen auf. Am anderen Ende des Durchgangs befanden sich ein hochgezogenes Fallgitter und weitere Soldaten.
Deren Stimmung war noch ausgelassener und Eweligo zweifelte, ob er das noch gut heißen konnte. Er nahm mit dem ranghöchsten Soldaten Blickkontakt auf und räusperte sich kurz. Dieser zuckte schuldbewußt zusammen, stand verlegen auf und rief seine Kameraden zur Pflicht.
Jenseits der Wehrmauer ging der Weg nach oben, führte in einem Schlenker nach rechts und endete auf einem Vorplatz. Dort stand das Schloß, und von hier aus betrachtet war es nicht einmal besonders prunkvoll gebaut worden. Dennoch strahlte es eine stolze Schönheit aus.
»Das ist Lywell«, stellte Eweligo die Stadt und das Schloß vor. Grace nickte auch jetzt nur. Wieder hatte es ihr die Sprache v erschlagen. »Komm!«, forderte er sie wieder auf und sie überwanden den Rest des steilen Weges.
Sie konnte sich einen überwältigten Ausruf nicht verkneifen, als sie in die Vorhalle traten. Der Raum war rund und ein halbes Dutzend Türen gingen im Erdgeschoß von ihm ab. Ihnen gegenüber erhob sich eine breite Treppe, die sich in der Mitte teilte. Sie führte links und rechts auf Galerien, über die man wiederum zu Türen gelangen konnte. Der Boden war mit kleinen, bunten Mosaiksteinen ausgelegt und zeigte in der Mitte das Bild einer Sonne. Fremdartige Symbole waren ringsherum angeordnet. Zu jedem Symbol gehörte ein Abbild: einen Menschen, ein Tier und einen Baum konnte sie mit einem flüchtigen Blick erkennen, denn das Bild stand für sie auf dem Kopf und war dazu gedacht, von oben angesehen zu werden. Die nach oben gewölbte Decke hatte in der Mitte eine große runde Öffnung, die mit Glas verschlossen war. Rund herum waren die Strahlen der Sonne in die hölzernen Stützbalken geschnitzt worden. Auf dem Stein sah sie bunte Portraits von Wolken, dem Mond und den Sternen.
»Beeindruckt?«, fragte Eweligo stolz.
»Ich habe so was noch nie gesehen«, stimmte sie ihm zu.
»Das glaube ich wohl«, kicherte das Wesen und flog weiter. »Komm, hier entlang!« Sie folgte ihm nach rechts durch die erste Tür. Sie gingen einen langen Gang entlang, dessen rechte Außenwand mit großen Fenstern versehen war. Der Boden war hier nur noch aus grauem Stein, dafür waren Teile der Wände mit edlen und kostbaren Wandteppichen behängt. In den Fenstern standen Vasen mit frischen Blumen, die einen angenehmen Duft verströmten. Sie folgten dem Flur, von dem immer wieder Gänge ins Innere des Schlosses führten. Als Grace bereits glaubte, daß sie bald einmal außen herumgelaufen sein müßten, kam das Ende des Flurs in Sicht. Durch einen Türbogen gelangten sie in einen Turm, der die Stockwerke mit einer Wendeltreppe verband. Eweligo schwirrte einen Stock tiefer und Grace folgte geschwind, um ihren Führer nicht zu verlieren. Mit jeder Stufe, die sie hinabstieg, wurde es kühler.
Kurz darauf standen sie in der Küche. Der Raum war mit Fackeln und Kerzen beleuchtet, obwohl er über mehrere Fenster verfügte, die aber alle nach Norden zeigten. Ein Feuer in dem riesigen Kamin sorgte für wohlige Wärme. Unzählige Gerüche unterschiedlicher Speisen schlugen Grace entgegen, und sie bestaunte das emsige Treiben dreier Küchenfrauen, eines Kochs, zweier Mägde und eines Knaben. Alle waren in die Vorbereitungen für das nächste Mahl vertieft. Grace fragte sich, wer das alles essen sollte, wonach es hier aussah.
»Das muß eine große Gesellschaft sein, die das alles essen will«, bemerkte Grace vorsichtig.
Eweligo lachte. Erst jetzt wanden sich die Köpfe den Besuchern zu. Eine der Köchinnen kam auf Grace zu und lächelte das Mädchen breit an. Sie war nicht sehr groß, rundlich und hatte ein rotwangiges Gesicht, das von nußbraunem Haar gerahmt wurde.
»Du kleines Dummerchen! Heute wurde geschlachtet und wir verarbeiten das Fleisch, um es haltbar zu machen«, erklärte sie mit warmer Stimme. »Ich bin Erma. Und du?«
»Grace«, sagte sie schüchtern und trat vorsichtshalber einen Schritt zurück. Die Frau lachte, wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. »Möchtest Du einen Becher Milch?« Grace nickte zögerlich.
»Nur zu!«, ermutigte Eweligo sie. »Erma ist unsere Küchenfee, sie sorgt für unser aller leiblich’ Wohl. Wäre sie nicht, wären wir wahrscheinlich längst alle verhungert.« Die Frau lachte herzhaft und dabei hüpfte ihr Bauch so sehr auf und ab, daß sich selbst auf Grace’ unsicherem Gesicht ein Lächeln widerspiegelte. Erma kehrte mit einem Holzbecher voll Milch zurück. Sie drückte ihn Grace in die Hand und schob das Mädchen an einen Tisch.
»Setz dich ruhig, mein Kind!«
Grace tat, wie man ihr geheißen hatte und beobachtete die Leute über den Rand ihres Bechers hinweg. Die Küche war sehr groß. Viele Tische standen entlang der Wände verteilt. Dem Eingang gegenüber war der gigantische Kamin, über dessen Feuer riesige Kessel hingen. Dort brodelte es und roch lecker. Links davon waren eine Wasserpumpe und ein Spülbecken aus Stein. Daneben eine Tür, die vermutlich in einen Vorratsraum führte.
Wie lange sie da gesessen und den Männern und Frauen bei der Arbeit zugesehen hatte, wußte sie hinterher nicht mehr. Dann aber riß sie das Erscheinen einer weiteren Person aus ihren Beobachtungen.
»Hier steckst du also, Eweligo! Ich habe dich im ganzen Schloß suchen lassen, weil … wer ist das denn?«, fragte der Neuankömmling entgeistert, als er Grace sah.
»Oh, Quinfee, entschuldige bitte, aber ich habe Grace etwas vom Schloß gezeigt!«
»Grace!«, rief Quinfee überrascht. »Doch nicht etwa die Grace?!«
»Doch, welche sonst?«, wollte Eweligo wissen und schüttelte den Kopf.
»Aber …«, stotterte der Mann, und plötzlich hielten auch die Männer und Frauen in ihrer Küchenarbeit inne und blickten den kleinen Mann an. Grace tat es auch und betrachtete die zwergenhafte Gestalt aufmerksamer. Sie stellte fest, daß seine Haut von langer Zeit unter freiem Himmel dunkel gebräunt war. Sein Gesicht war nicht wirklich alt, aber so voller Falten, daß nur noch das Wetter für die tiefen Furchen in seinem Gesicht verantwortlich sein konnte. Mitten in seinem breiten Gesicht lagen eine große, platte Nase, die etwas rosiger war, und ein viel zu großer Mund mit Zähnen, die ihr Leben lang noch keine Zahnpflege erlebt hatten. Wachsame graue Augen glitzerten ihr entgegen und darüber lagen dicke Augenbrauen. Das dünne braune Haar lichtete sich bereits an Stirn und Hinterkopf und ließ die rosige Haut darunter hervorschimmern.
»Eweligo, warum hast du sie hergebracht?«, wollte er wissen. Der kleine Gestaltenwandler zuckte mit den Schultern.
»Sie war alleine – und überhaupt – was spielt das für eine Rolle?«
»Wer weiß, wem sie alles hiervon berichten wird«, hielt Quinfee dagegen.
»Aber wenn sie alleine ist, wem soll sie dann davon erzählen?«
»Ihren Eltern?«, konterte Quinfee.
»Hm«, machte Eweligo nachdenklich.
»Ich werde meinen Eltern ganz sicher nichts erzählen!«, versprach Grace. »Sie würden mir ohnehin nicht glauben.«
»Eben«, stimmte Eweligo zu und Quinfee verdrehte die Augen. »Aber versprich mir trotzdem, daß du es nicht tun wirst!«, flüsterte Eweligo Grace ins Ohr. Sie kicherte und hob die Hand.
»Großes Ehrenwort!«
»Aber was jetzt? Sie wird doch nicht öfter kommen, oder?«, fragte Quinfee entsetzt.
»Wenn ich darf, würde ich das aber sehr gern!«, ergriff Grace das Wort, stand auf und trat vor ihn. Jetzt war es an Quinfee, ein unverständliches Geräusch von sich zu geben und mit den Schultern zu zucken.
»Meinetwegen«, gab er brummelnd nach.
»Vielen Dank!«, rief sie freudig und umarmte ihn impulsiv. Augenblicklich schoß Quinfee die Röte ins Gesicht und er schob Grace von sich. Er grummelte etwas in einen nicht vorhandenen Bart, bevor er sich an Eweligo wandte und ihn fragend ansah.
»Nein, ich habe nichts gefunden«, antworte der Gestaltenwandler knapp. Quinfee nickte, wandte sich auf dem Absatz um und verschwand.
Das Küchenpersonal begann jetzt aufgeregt durcheinander zu sprechen. Erma kam und drückte Grace liebevoll.
»Kind, das war außergewöhnlich tapfer«, flüsterte sie.
»Wieso?«, fragte Grace verwirrt und schaute die Frau an.
»Quinfee ist der Herr des Schlosses. Seit dem Tod unseres Königs ist er der Regent von Tybay, bis unser Prinz alt genug ist, das Land zu regieren«, erklärte sie. Grace wurde blaß.
»Heißt das«, fragte sie zittrig, »er ist so etwas wie der Präsident?« Ermas Stirn legte sich in Falten und sie zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß nicht, was ein Präsident ist, aber ein Regent ist nichts anderes als die höchste Person eines Landes. Was er befiehlt, das müssen wir tun. Und obwohl wir Quinfee alle seit Jahren als Berater an der Seite des Königs kannten, ist es doch für uns anders geworden.«
»Oh!« Grace nickte. »Ich verstehe! Aber dann war ich ziemlich respektlos.« Erma strich ihr über die Haare und lächelte sie an.
»Nein, Kind, das warst du nicht. Vielleicht ein wenig forsch. Aber dem alten Brummbär tut es gut, wenn er mal ein wenig Gegenwind bekommt.« Eweligo flog heran und zupfte Grace am Ärmel.
»Tut mir leid, Grace. Ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. Das war sicher alles sehr anstrengend für dich und wir sollten dich zurückbringen, bevor deine Mutter dich sucht.«
»Ja«, stimmte das Mädchen zu und Erma drückte sie nochmals, bevor sie wieder an ihre Arbeit ging. Grace winkte noch einmal, dann folgte sie Eweligo aus der Küche und dem Schloß. Erst als sie im Stall ankamen, brach sie die Stille.
»Zeigst du mir irgendwann noch mehr von dem Schloß?« Eweligo nickte.
»Ganz gewiß werde ich das! Aber zuerst mußt du wieder nach Hause.«
»Wann wirst du wiederkommen?«
»In einer Woche«, versprach er ihr lächelnd. Im nächsten Moment war er verschwunden, tauchte sogleich wieder auf, ergriff Grace’ Hand und zog sie mit sich durch das Weltentor.
»Wie ist es möglich, daß es so etwas wie ein Weltentor gibt?
»Magie!«, antwortete er lediglich und lächelte. Dann schwirrte er wieder durch die Wand.
Grace blickte ihm nach, aber natürlich war er augenblicklich verschwunden, als er durch das Tor trat. Dann rannte sie los.
»Maaamaaa!«, rief sie, als sie das Haus betrat.
»Grace, bist du okay?«, fragte ihre Mutter, als sie ihre Tochter so aufgeregt hörte. Sie sprang von dem Sofa auf, auf dem sie gerade mit einem Buch gesessen hatte.
»Ja, es war …«, aber weiter kam sie nicht.
»Um Himmels Willen, Grace, wie siehst du aus?«, rief ihre Mutter empört.
»Aber Mama, hör doch, da war …« Sie biß sich auf die Lippe, denn plötzlich fiel ihr der geleistete Schwur ein.
»Was?«, wollte ihre Mutter aber wissen und stemmte die Arme herausfordernd in die Hüften.
»Da war plötzlich eine Wurzel, über die ich gestolpert bin, aber wie durch ein Wunder habe ich mir nicht weh getan«, schwindelte sie und senkte den Kopf, damit ihre Mutter die Notlüge nicht sofort erkannte. Aber natürlich hatte ihre Mutter die Lüge als solche erkannt.
»Junges Fräulein, marsch nach oben und waschen! Von wegen Wurzel«, schimpfte sie. »Du darfst erst aus deinem Zimmer, wenn es Essen gibt, und daß ich von dir keinen Mucks höre!«, befahl sie. Grace schlich mit gesenktem Kopf aus dem Raum.
In ihrem eigenen Badezimmer tat sie zuerst einmal das, was ihr ihre Mutter aufgetragen hatte. Als sie gewaschen und umgezogen war, setzte sie sich nebenan in ihrem Zimmer auf die Truhe unter dem Fenster und blickte hinaus. Sie träumte von einem Schloß und stellte sich die Zimmer vor, die sie noch nicht gesehen hatte. Später setzte sie sich an den Schreibtisch und malte Bilder von dem Schloß und von Eweligo.
Die Woche zog sich endlos dahin und Grace konnte es kaum erwarten. Als der Tag endlich gekommen war, setzte sie sich in den Stall und wartete. Der Stallmeister beobachtete sie und wechselte ein paar Nettigkeiten mit ihr, aber dann brachte er die Pferde hinaus und ließ Grace allein.
»Wartest du schon lange?«, fragte plötzlich eine Stimme aus dem Nichts. Grace blickte sich um. Aber außer einigen Pferden und den Tauben auf den Dachbalken sah sie niemanden.
»Eweligo?«, fragte sie ins Leere. »Wo bist du?«
»Gleich hier!«, antwortete er. »Links von dir.« Grace blickte neben sich und sah dort eine Taube sitzen. Plötzlich verwandelte sich diese in Eweligo zurück.
»Oh, wie hast du das gemacht?«, fragte sie aufgeregt.
»Laß uns erst einmal von hier verschwinden!« Er nahm wieder ihre Hand, und sie traten durch das Weltentor.
»Und jetzt erkläre es mir!«, forderte sie neugierig und er zuckte ergeben mit den Schultern.
»Um das richtig erklären zu können, muß ich etwas weiter ausholen. Wenn du etwas nicht verstehst, dann sag es einfach.« Grace nickte. »Es gibt hier, in deiner und in anderen Welten, viele Tore, Grace. Auch Tore, die nur unterschiedliche Länder miteinander verbinden. Einst, als diese Welt und ihre Bevölkerung noch jung war, hatte ein jeder Ritter des Hochkönigs einen solchen Ring. So konnte ein König über eine gesamte Welt herrschen, und seine Mannen waren schnell an jedem beliebigen Ort. Aber der Hochkönig wurde gestürzt, die Ringe geraubt und die Weltordnung, wie man sie bis dahin gekannt hatte, erlebte einen Umbruch. Das große Weltreich zerfiel in viele kleine Länder, jedes mit einem unabhängigen Herrscher. So entstanden Tybay und all die anderen Länder unserer Welt. Inzwischen sind die meisten Ringe verlorengegangen oder vernichtet worden. Es gibt nur noch wenige Ringe, ein halbes Dutzend, glaube ich.« Eweligo seufzte traurig und fuhr dann fort. »Ich bin eines von sieben Elementarwesen, die es noch gibt.«
»Heißt das, daß es an einem anderen Ort noch andere deiner Rasse gibt?«
Eweligo nickte. »Ja, wir Elementarwesen sind fast so alt wie diese Welt. Wir entstanden durch ihre Magie. Die Druiden der alten Zeit, die uns geformt haben, leben schon lange nicht mehr. Die Lehren, die sie verbreiteten, wurden vergessen oder verboten. Ich bin kein geborenes Lebewesen. Meine Geschwister und ich wurden aus einem Stück Erde geformt und anschließend hauchte man uns Leben ein. Wir können uns nicht vermehren, wie wir wollen! Wir sind Diener! Man erschuf immer nur so viele von uns, wie man brauchte.«
»Aber wieso? Ihr könnt doch auch sterben!« Grace war schockiert.
»Sicher können wir das, aber wir sind nur dann verwundbar, wenn wir unsere Gabe der Verwandlung nutzen und uns in ein anderes Lebewesen verwandeln«, erklärte Eweligo. »Allerdings können wir nur solche Körper wählen, die höchstens so groß sind, wie wir selbst«, fügte er hinzu.
»Das sind aber nicht viele«, kicherte Grace, während sie ihm folgte.
»Sind aber genug, um mich vor dir verstecken zu können«, erinnerte er sie grinsend. Sie lachten zusammen, trotzdem grub sich diese kleine Geschichtsstunde tief in Grace’ Erinnerungen.
»Und was machen wir jetzt?«
Eweligo zuckte mit den Schultern. »Was immer du magst!«, überließ er ihr die Wahl. Sie wünschte sich, noch mehr von dem Schloß und den Zimmern zu sehen. Und weil Grace zu Anfang nie lange bleiben konnte, damit ihre Eltern nichts bemerkten, brauchten sie fünf Besuche, um alle Zimmer des Schlosses zu besichtigen. Am besten gefiel Grace der Thronsaal, der prunkvoll und vornehm war, und die Halle, in der große Feste gefeiert werden konnten. Obwohl der Saal nicht geschmückt war, strahlte er mit seinem polierten Boden und der hohen Decke eine lebendige Freude aus. Sie ging mit Eweligo auf die Empore, auf der sonst die Hofmusikanten zum Musizieren saßen, und rief in den Saal hinunter. Ihr eigenes Echo kam zu ihr zurück und sie lachte.
»Wann wird es wieder ein Fest geben?«, fragte sie und versuchte sich vorzustellen, wie der Raum aussah, wenn er mit tanzenden und lachenden Menschen gefüllt war.
»Das weiß keiner so genau. So lange Tybay noch im Krieg liegt, wird es wohl keine Feste geben«, seufzte der Gestaltenwandler. »Es sind hier sehr schöne Feste gefeiert worden, und wir alle sehnen uns nach der ruhigen Zeit zurück. Es ist noch gar nicht lange her, da hatten wir Jahrzehnte der Ruhe und Frieden im Lande, doch innerhalb weniger Tage hatte sich alles verändert. Unser ewiger Widersacher ist eine Königsfamilie aus dem Dunklen Land westlich von Tybay, ihr Haß gegen uns sitzt tief. Was immer wir ihnen auch angetan haben mochten, sie haben es uns nie verziehen. Inzwischen weiß hier keiner mehr, was das war.« Eweligo seufzte. »Es begann harmlos. Gruppen von Plünderern zogen nach Tybay. Obwohl das eigentlich nichts Ungewöhnliches war, wurden es bald so viele, daß unser geliebter König beschloß, sie Manieren zu lehren. Er schickte seinen Heermeister Gewolt mit seiner halben Streitmacht aus, um die Räuber zu vertreiben. In der Zwischenzeit unternahm unser König seine alljährliche Reise durch das Land, um dem Volk zu danken und mit ihm das Erntefest zu feiern. Zum Schutze des Königs bestand Quinfee darauf, daß er die Hälfte des verbliebenen Heeres mitnehmen sollte. Der König befolgte zwar die Wünsche seines Beraters, aber der Zug wurde trotzdem überfallen. Der König gab seine Gemahlin und seinen Sohn in die Obhut Quinfees, damit dieser sie an einen sicheren Ort bringen würde. Dann erreichte ihn die Kunde vom Überfall auf das Schloß und dessen Einnahme durch den Feind. Er eilte zurück, um die geheime Stätte, das Zentrum der Macht der Königsfamilie, die Grabstätte seines Vaters und seiner Urväter, Mütter und Urmütter mit einem magischen Bann vor einem räuberischen Einfall zu schützen. Aber es gelang ihm nicht. Die Schergen von König Kalidor erschlugen ihn. Als Gewolt die Nachricht erfuhr, kehrte er unverzüglich zum Schloß zurück und eroberte es. Zu unser aller Glück geschah das noch rechtzeitig, und der Geheimeingang in die heiligen Katakomben blieb dem Feind trotz seiner intensiven Suche verborgen. Wer weiß, was sonst aus uns und dem Land geworden wäre.«
»Oh, wie schrecklich!« Grace senkte betroffen den Kopf, aber Eweligo lachte munter.
»Eigentlich nicht, traurig wäre es gewesen, hätten wir verloren. Aber das Land und die Menschen hier leben von der Hoffnung an bessere Zeiten.«
»Aber wenn der Feind besiegt ist, warum seid ihr noch im Krieg?«
»Weil er nicht aufgehört hat, Armeen zusammenzustellen und gegen uns zu schicken. Zu unserem Glück haben wir König Kalidor nicht nur aus dem Schloß vertreiben können, wir konnten auch seinen Weltenring erobern. Das bedeutet, daß er sein Heer zu Fuß und zu Pferde schicken muß, was viel länger dauert. Seine Angriffe werden dadurch berechenbarer und er kann nur wenig Schaden anrichten.«
»Aber warum hört er dann nicht damit auf?«, wollte das kleine Mädchen wissen.
»König Kalidor versucht, Rache zu üben. Er ist ein alter, zorniger Mann und er versucht uns dafür zu bestrafen, daß wir ihn nicht nur besiegt haben, sondern daß wir seinen Sohn gefangennehmen und ihn ins Exil verbannen konnten.«
»Ins Exil verbannen? Was meinst du?«
»Er ist alleine, in einem extra für ihn erschaffenen Gefängnis, aus dem er nicht entfliehen kann. Dort wird er bleiben müssen, für immer.«
»Oh«, Grace nickte. »Ich verstehe. Wenn ihr mich von meinen Eltern trennen würdet, wäre das auch sehr schlimm für mich. In unseren Gefängnissen dürfen wir unsere Verwandten besuchen. Was hat er getan, um eine solche Strafe zu verdienen?«
»Eigentlich nicht viel. Aber er versucht sich an den alten Lehren der Druiden vergangener Tage, und das ist nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich. Die Überlieferungen sind fehlerhaft und verleiten zum Bösen. Was er tat ist böse, sehr böse, und wir wollten tun, was wir können, ihn aufzuhalten, bevor er zu mächtig für uns ist.« Eweligo zögerte, doch dann fuhr er fort. »Wir mußten eine schnelle Lösung finden, normale Fesseln konnten den Mann nicht an einer Flucht hindern. Die Alternative wäre sein Tod gewesen, doch niemand von uns konnte abschätzen, was das bewirken könnte.«
»Was meinst du?«, wollte Grace verwirrt wissen.
»Es gibt mächtige Zauberformeln, welche die Seele an den Körper fesseln können. Noch schlimmer, den Geist als solchen in der Welt der Lebenden zu halten. Er war mächtig genug, eine solche Formel zu kennen und zu benutzen. Sein Tod hätte uns vielleicht einen noch mächtigeren Gegner beschert.«
»Das klingt aber alles sehr verzwickt«, meinte Grace und blickte sich ein letztes Mal im Saal um, bevor sie ihn wieder verließen. »Wie lange wird König Kalidor euch angreifen?«
»Das wissen wir nicht. Wir glauben aber, daß er seinen Plan, die königliche Familie zu töten, nicht aufgegeben hat. Darum ist Prinz Necom nach wie vor in größter Gefahr.«
»Ich habe die Gemälde im Thronsaal gesehen, das waren sehr viele!«
Eweligo nickte zustimmend. »Ja, eine zähe Familie, die dafür geboren wurde, zu regieren. In ein paar Jahren wird Necom zu einem Mann gereift sein, und dann werden wir ihn krönen, er wird eine Frau zur Gemahlin nehmen und danach wird die Königsfamilie wieder gedeihen.«
»Das verstehe ich nicht«, erklärte Grace. »Was hat denn eine Frau damit zu tun?«, fragte sie auf ihre kindliche Art. Eweligo hatte bisher nicht gedacht, daß es viele Unterschiede zwischen den Kindern hier und Grace gab. Jetzt erkannte er, daß er gar nicht falscher liegen konnte.
»Nun ja«, er räusperte sich verlegen. »Wenn ein Mann und eine Frau einander lieben, dann bekommen sie für gewöhnlich Babys«, erklärte er bündig.
Grace’ Gesicht erhellte sich, als sie zu lachen anfing. »Ach, das kenne ich. Dann kommt der Storch und bringt das Baby.« Eweligo sah sie zweifelnd an.
»Vielleicht funktioniert das ja bei euch ein wenig anders«, sagte er und ließ es darauf beruhen.
Grace genoß die Momente, die sie in Tybay verbringen konnte. Sie lernte nicht nur das Schloß kennen und die Leute, die darin dienten, sondern auch die Stadt und das Volk. Sie erfuhr, wie die Menschen hier lebten. Ab und an besuchte Eweligo Grace auch in ihrer Welt. Dort zeigte Grace ihm, was sie dort für Wunder hatten. Zumeist hatte sich der Gestaltenwandler dann in einen Marienkäfer oder in eine Fliege verwandelt, daß es nicht weiter auffiel.
Doch der kleine Eweligo stand Grace nicht immer zur Verfügung; gelegentlich riefen ihn die ihm anvertrauten Pflichten und er verabschiedete sich von ihr. Er gab sie dann, falls er länger fort war, in die Obhut eines anderen. Mal traf es Erma, dabei lernte Grace vieles über die Arbeiten in der Küche. Obwohl sie zu Hause auch ab und an der Haushälterin half, war es hier was ganz Besonderes. Oder es traf den mürrischen Regenten Quinfee, der zwar immer so tat, als könne er mit dem Mädchen nichts anfangen, sie aber gerne mochte. Er erzählte ihr viel über die Geschichte von Tybay. Dann und wann mußten sich auch die Zwillinge Anders und Harmonie um Grace kümmern.
Anders und Harmonie waren nicht das, was sie auf den ersten Blick zu sein schienen. Als Grace den beiden das erste Mal vorgestellt wurde, dachte sie, daß die Zwillinge kaum älter als fünfzehn sein könnten. Doch sie fand sehr schnell heraus, daß das Äußere durchaus täuschen konnte. Der blonde Anders mit den großen blauen Augen und der kindlichen Statur war nicht nur sehr kräftig, sondern auch klug. Er war zwar hitzköpfig, aber für ein Kind viel zu erwachsen. Dasselbe galt auch für seine zartere und sehr viel ruhigere Schwester, die ihm, sah man von ihren weiblichen Formen ab, wie ein Ei dem anderen glich. Grace fand heraus, daß die beiden die letzten Überlebenden des Volkes der Uiani waren. Dieses hatte zuvor im Norden dieser Welt gelebt, bevor sie ausgerottet und ihr Land zerstört wurde. Aber das war schon sehr lange her, viele hundert Jahre und genau so alt war das Geschwisterpaar auch. Ihre Lebenserwartung war viel größer als die eines Menschen, denn ähnlich wie Eweligo stammten sie aus einem Geschlecht, das es lange vor dem Umbruch gegeben hatte. Im Gegensatz zu Eweligo waren sie allerdings nicht durch Magie geschaffen, sondern wußten diese zu nutzen und für ihre Zwecke einzusetzen. Fast augenblicklich freundete sich Grace mit ihnen an, später wurde Harmonie Grace’ beste Freundin, zu der sie ging, wann immer sie reden mußte. Und es war ganz gleich, mit welchem Problem sie zu ihr kam, Harmonie versuchte, ihr immer zu helfen.