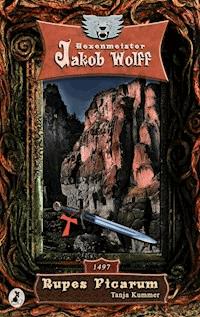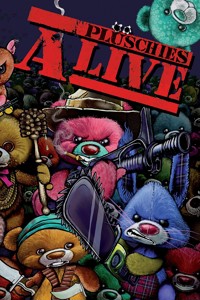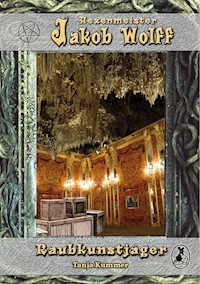26,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das grosse Fest – die grosse Angst Ein Roman über eine Frau mit wachem Verstand und grossen Ängsten Die Geschichte einer Frau, die alles daran setzt, dass niemand davon erfährt, worüber sie sich wirklich Gedanken und Sorgen macht Tanja Kummer erzählt eindringlich und mit gewohnt präzisem Stil Martina Ortolfi lebt mit Mann und Tochter am Bodensee. Sie arbeitet Teilzeit als Buchhändlerin und ist rund um die Uhr mit ihren Ängsten und Zwängen beschäftigt. Wann es angefangen hat, weiss sie nicht: Vielleicht nach der Geburt von Jona und den plötzlich aufflackernden Befürchtungen, dass dem Kind überall etwas zustossen kann? Lange sind ihre übermässigen Sorgen Fantasie geblieben, aber am letzten Weihnachtsfest ist wirklich etwas passiert. Seither wird Martina Ortolfi von der Angst überschwemmt und sie kann nicht anders, als mit Kontrolle Gegensteuer zu geben: Ist der Herd wirklich aus? Und die Kerzen? Was habe ich über dieses neue Buch gesagt? Kann man das falsch verstehen? Weiss bald die ganze Stadt, dass ich etwas Furchtbares gesagt habe? Wie koche ich, ohne die Lebensmittel zu berühren und Leute mit meinen Bakterien zu vergiften? Die Protagonistin greift zu immer mehr Beruhigungsmitteln. Sie erzählt niemandem von ihren Zuständen und setzt alles darauf, dass sich die Ängste zurückziehen werden, wenn sie nur das perfekte Weihnachtsfest ausrichtet.Der Countdown läuft: In vier Tagen ist Weihnachten, und Martina versucht unter Hochdruck, sich um das Essen, die Geschenke und das Herrichten der Wohnung zu kümmern. Sie lädt sich mehr und mehr auf – bis die Angstblase platzt. 'Tanja Kummer weiss die Saiten der Tristesse anzuschlagen, derweil uns ihre Sprache entgegenlacht.' NZZ online, Alexandra Kedve, Juli 2006
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Tanja Kummer
Sicher ist sicher ist sicher
Zytglogge Verlag AG
© 2015 Zytglogge, Basel
Gesetzt aus: Adobe Garamond Pro
Lektorat: Angela Fessler
Coverfoto: Stefan Kubli
Printed in Switzerland
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
eISBN ePUB: 978-3-7296-2046-9 / mobi: 978-3-7296-2047-6
www.zytglogge.ch
Tanja Kummer
Sicher ist sicher ist sicher
Roman
Zytglogge
Mittwoch, 20. Dezember
«Schweizer Literatur», sagt er, die Stimme scharf wie eine Schneide, «Schweizer Literatur, natürlich!»
Mein Blick klebt an seinen Augenbrauen, die aussehen wie verzwirbelte Spinnenbeine.
«Natürlich», wiederhole ich leise und weiche einen Schritt zurück. «Haben Sie an einen Klassiker gedacht? Oder möchten Sie etwas Aktuelles, vielleicht von einem Nachwuchsautoren? Wir hätten da zum Beispiel das neue Buch von diesem jungen Urner, der …»
Ich plappere, als wäre ich eine Puppe mit einem Schlüsselchen im Rücken, das man bis zum Anschlag aufgezogen und just losgelassen hat. Doktor Hugentobler setzt seinen Hut ab und legt ihn auf einen Stapel Familienplaner 2013. Die Schneesterne, die der pensionierte Mediziner draußen gesammelt hat, lösen sich auf, tropfen von der Hutkrempe auf die Buchstaben milienplan und die Druckerschwärze wird zu einem trüben Teichlein. Dann zieht Doktor Hugentobler mit einer Hand an seinem beigen Seidenschal, der ihm tatsächlich in einem Zug vom Hals gleitet, eine Geste, von der ein Hauch Houdini ausgeht. Die Aktentasche deponiert er auf dem Büchertisch. Dort ist ausgestellt, was sich vor Weihnachten besonders gut verkauft, Bestseller, Weihnachtsanthologien mit Geschichten von fröhlichen Feiertagen, Festtags-Tees, Duftkerzen und Christbaumkugeln in Form von dicken Wälzern.
Dann richtet sich Doktor Hugentobler auf, steht dünn und groß vor mir und fixiert mich mit strenger Erwartung im Blick. Bleib ruhig, mahne ich mein Herz, bleib ruhig, spüre aber schon das Pochen in der Brust, das immer pointierter wird, während ich ihm eifrig Buch um Buch vorstelle, so eifrig, als hätte ich die Lehrabschlussprüfung noch einmal zu bestehen, ganze 15 Jahre nachdem die Schweizerische Eidgenossenschaft mit einem Fähigkeitszeugnis bestätigt hat, dass Martina Rechsteiner Buchhändlerin ist. Französisch und Buchhaltung habe ich eher schlecht als recht bestanden, in Deutsch und Wissenschaftskunde schrieb ich zwei Sechser. Ich hatte die ganzen Sommerferien durch für die LAP gebüffelt und am ersten Tag die schweren, dunkelgrünen Fensterläden zugezogen, damit die Sonne nicht über meine Lehrbücher tanzen und mich daran erinnern konnte, dass ich viel lieber draußen wäre. Trotz der geschlossenen Fenster hörte ich das Juchzen der Badenden am nahen Kiesufer, mein Elternhaus liegt am Bodensee. Das Juchzen ärgerte mich, ich musste definitiv etwas falsch gemacht haben, ich war die Einzige, die keine freie Minute für eine schöne Zeit hatte.
Dafür, dass ich mich fünf Wochen lang mit Lernen gequält hatte, fand ich die Durchschnittsnote von 4,9, die schließlich in meinem LAP-Zeugnis stand, viel zu mies. Ich war gekränkt und versuchte, es mir nicht anmerken zu lassen. Ich ließ mich sogar zu Sprüchen wie «Also dafür, dass ich nichts gelernt habe, ist das gar nicht schlecht» hinreißen, aber nur, wenn ich sicher war, dass niemand in der Nähe war, der wusste, dass ich den Sommer über die Lehrbücher regelrecht gefressen hatte. Ich wünschte mir, ich hätte damals schon gewusst, dass mich heute niemand mehr nach dieser Note fragen würde.
Mit Ausnahme des Mutterschaftsurlaubes vor neun Jahren habe ich immer als Buchhändlerin gearbeitet, erst Vollzeit und seit Lili auf der Welt ist in Teilzeitanstellung. Ich mag meinen Beruf, außer, wenn Doktor Hugentobler vor mir steht.
«Nein danke, ich verzichte auf das neumödige Zeug. Ich will Uli der Pächter, die Ausgabe von 1998 im Wert-Verlag. Sie müssen es sicher bestellen. Es würde mich wundern, wenn Sie es an Lager hätten», sagt er abschließend.
Ich hasse es, dass er in die Buchhandlung kommt, sich ausbreitet, sagt, was er will, und jede Regung meinerseits mit Augenbrauenzucken quittiert. Die Spinnenbeine zittern. Irgendwie beneide ich ihn. Ich könnte das ja auch machen. Einfach sagen, was ich will. Aber dafür müsste ich erst einmal wissen, was ich will. Doch mein klarer Verstand ist überspült und wirbelt wie ein Stück Treibholz im See herum. Ich weiß nur, dass ich Sicherheit suche, so viel Sicherheit wie möglich, zum Beispiel in Form von Convenience-Food. Reis, Nudeln, Gemüse – man kann alles fixfertig kaufen und braucht die Säckchen nur noch in warmem Wasser zu erhitzen, ich brauche nichts mit den Händen zu berühren. Das ist gut für meine Planung, so weiß ich, wie ich zum Essen für meine Familie komme. Natürlich ist das völliger Verpackungsirrsinn. Unser Primarschullehrer wurde schon vor Jahren nicht müde, die Klassen in seinen Monologen mit furchtbaren Zukunftsvisionen aufzuschrecken. Wenn die Abfallberge so weiterwachsen würden, warnte er, könne man bald nicht mehr zum andern Seeufer hinübersehen. Als Dani und ich zusammengezogen sind, haben wir abgemacht, dass wir so gut es geht auf Plastik verzichten und bei Tuben und Lotionen diejenigen bevorzugen, die nicht noch zusätzlich in Karton verpackt sind.
Damit Dani den Convenience Food nicht sieht, bringe ich meine Einkäufe im Keller unter. Wenn ich weiß, dass er kocht, kaufe ich frische Lebensmittel und verziehe mich, damit er nicht fragen kann, ob ich ihm helfe. Auch wenn ich meine Hände oft wasche, werde ich den Gedanken nicht los, dass ich auf alles, was ich berühre, Bakterien übertrage. Ich will keine Lebensmittel mit bloßen Händen berühren. Das weiß ich. Und, dass ich Doktor Hugentobler nicht gerne bediene.
Nachdem ich Uli der Pächter für ihn bestellt habe, fragt er nach Oliwia. Für gewöhnlich erkundigt sich Doktor Hugentobler sofort nach ihr. Gleich, nachdem er die breiten Steinstufen zum Eingang der Buchhandlung genommen und die Glastüre, die vom violetten Teppich abgebremst wird, aufgeschoben hat. Dann kommt er mir vor wie ein Neandertaler, der den Stein vor seiner Höhle zur Seite schiebt, ins Morgenlicht blinzelt und überlegt, in welche Himmelsrichtung er zur Jagd aufbrechen soll. Wenn Doktor Hugentobler sein scharfes «Grüß Gott!» durch die Buchhandlung schickt, findet Oliwia so schnell sie kann zu ihm. Gerade hatte sie noch einen Kunden zu bedienen, darum musste Doktor Hugentobler mit mir vorliebnehmen. Nun steht Oliwia an der Kasse, drückt dem Kunden Buch und Quittung in die Hand und tänzelt dann auf uns zu.
«Hans!», ruft sie. «Was für eine Freude!»
Ich mag Doktor Hugentobler unter anderem deshalb nicht, weil er Oliwia das «Du« angeboten hat und mir nicht. Ich würde ihn nicht duzen wollen, aber es geht ums Prinzip. Oliwia gispelt in ihren Pluderhosen vor Doktor Hugentobler herum, die meine Eltern «Chegelfänger» nennen würden, der Schritt der weiten Stoffhose baumelt zwischen den Knien. Von Oliwias türkisem Pullover sieht man nur Arme und Rollkragen, denn sie trägt einen Schal, groß wie eine Decke und aus Fäden aller Töne des Farbkreises gewebt. In den Augen derjenigen, die periodisch und begeistert Tausendundeine Nacht lesen, sieht Oliwia bezaubernd aus. Besonders dann, wenn sie wie jetzt die rotblonden hüftlangen Locken über die Schultern wirft und die Arme in die Höhe reißt. Dabei rutscht ihr Armschmuck – eine Sammlung filigraner Ringe in türkis und gold – vom Handgelenk zum Ellbogen, es klingelt fein, als würde das Christkind mit einem Glöckchen zur Bescherung rufen und das passt wunderbar: In vier Tagen ist Weihnachten, Heiligabend, der 24. Dezember.
Oliwia ist die Geschäftsführerin der Buchhandlung, die sie nach ihrem Nachnamen benannt hat: Paschenko. Die Reaktionen darauf waren lauwarm. Einige fanden es stimmig, andere konnten nicht verstehen, warum man einer Buchhandlung in der Schweiz, in der es hauptsächlich um Produkte in deutscher Sprache gehe, einen ausländischen Namen geben könne. O-Ton Oliwia: «Das Gerede ist mir piepschnurz.»
Jetzt legt Oliwia Doktor Hugentobler die Hände auf die Schultern, reckt sich zu ihm hoch, haucht drei Küsschen neben seine Wangen, eins links, zwei rechts.
«Oliwia», sagt Hans Hugentobler tonlos, bestimmt benommen von ihrem Duft – eine Mischung aus Lavendeltütchen im Kleiderschrank und Räucherstäbchen im Wohnzimmer. Oliwia weiß sich so zu schminken, dass es nie zu viel ist, sie sieht immer gesund und lebenslustig aus.
Ich will nicht weiter zuschauen, wie sich Oliwia und Hans einander zuwenden, und versuche den Moment zu nutzen, um mein Herzklopfen zu beruhigen. Vor der Krimi-Ecke drücke ich den Daumen der rechten Hand auf das rechte Nasenloch, kippe den Kopf und lese die Wörter auf den Buchrücken. Langsam, Buchstabe für Buchstabe.
J-U-S-S-I--A-D-L-E-R--O-L-S-E-N--
V-E-R-A-C-H-T-U-N-G
ziehe die Luft mit dem freien Nasenloch ein,
P-A-T-R-I-C-I-A--H-I-G-H-S-M-I-T-H--
D-E-R--S-C-H-N-E-C-K-E-N-F-O-R-S-C-H-E-R,
presse den Zeigefinger auf das linke Nasenloch und atme rechts aus
M-I-L-E-N-A--M-O-S-E-R--
G-E-B-R-O-C-H-E-N-E--H-E-R-Z-E-N,
ich atme rechts wieder ein, lege dann den Daumen unterhalb des Nasenbeins auf das rechte Nasenloch und atme links aus. Und so weiter. Ich habe die Atemübung vor langer Zeit auf einer Yoga-Seite im Internet entdeckt, sie wurde als «ausgleichend» angepriesen und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie mich beruhigt. Unterdessen surfe ich nicht mehr im Internet, wie schnell hat man plötzlich Bilder vor Augen, die sich einem auf die Netzhaut brennen, schlimme Bilder von Gewalt an Menschen, von geschundenen Tieren. Ich war schon immer empfindlich, habe als Mädchen auf dem Schulweg alle Schnecken vom Gehweg ins Gras getragen, auch die Nacktschnecken, die niemand berühren wollte, weil das Gerücht herumging, ihr Schleim würde die Haut verätzen. Wenn ich eine tote Schnecke sah, deren zerquetscher Leib in Kalkscherben schimmerte, konnte ich den Rest des Tages nichts mehr essen.
Früher aber habe ich die Bilder nach einer Weile wieder vergessen. Heute ist mein Kopf ein Museum, in dem eine Dauerausstellung zum Thema «Schlimme Bilder» gezeigt wird. Dafür vergesse ich anderes. Als ich Lili einmal Lutschtabletten gegen ihr Halsweh mitgab, konnte ich an nichts anderes mehr denken, als dass ihr Hälschen doch viel zu klein ist für die großen Tabletten. Kann sie daran ersticken? Auch wenn ich mir am Morgen noch «Kehrichtsäcke!» auf den Einkaufszettel geschrieben hatte, kam ich ohne sie nach Hause, weil ich beim Einkaufen nur an Lili gedacht hatte. Ich rief in der Schule an und bat die Lehrerin, Lili die Tabletten wegzunehmen, mir wäre in den Sinn gekommen, dass Lili das letzte Mal allergisch auf sie reagiert hätte. Meine Sorgen machen es mir leicht, Ausreden zu finden.
Von der Krimi-Ecke aus beobachte ich die Kunden, die im Laden herumstöbern. Keiner schaut sich suchend nach einer Bedienung um. Einige stehen vor den Regalen, andere schlendern um die Büchertische. Die Tische stehen frei im Raum, genau wie die beiden Info-Pulte, einer ist vorne bei der Belletristik, der andere hinten beim Sachbuch. Ich deponiere meine Sachen beim vorderen Pult in der Belletristik. Den anderen belegt Linda, Österreicherin über drei Ecken, sie ist blond und chäch und fühlt sich wohl in ihren beiden Berufen. Sie erzählt gerne, sie sei Buchhändlerin und Familienmanagerin.
Ich lasse von meinen Nasenflügeln ab und gehe zur Kasse. Unterwegs richte ich hier ein Buch so aus, dass sein Cover im Schein des Deckenlichts glänzt, schiebe dort eines so ins Regal, dass es bündig zu den anderen Büchern steht. Dann warte ich auf Kundschaft und beobachte einen Kunden, der ein Buch vom Büchertisch nimmt. Er öffnet es sorgfältig, um den Buchrücken nicht zu brechen, und schaut auf den Satzspiegel. Ich sehe seine Iris hin- und hersausen, er wird die ersten Sätze lesen. Dann klappt er das Buch vehement zu und legt es zurück auf den Tisch.
«Grüezi Frau Ortolfi.»
Ich habe die Kundin nicht kommen sehen; auf einmal steht sie vor mir und lächelt mich an. Meinen Namen kennt man, weil Oliwia vor Weihnachten immer ein Inserat in die Zeitung setzt. Es ist gerade erschienen, der Text lautet: «Mit herzlichem Dank an alle unsere lieben Kundinnen und Kunden für die Treue und mit besten Wünschen für schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!» Daneben ist ein Bild unseres Teams, das die strahlende Geschäftsführerin zeigt, flankiert von Linda und mir, die neben ihr verblassen, wie die Stiefschwestern von Aschenputtel, nachdem der Prinz ihr den Schuh gebracht hat. Oliwia nennt mich ihren Ruhepol, und immer, wenn sie das tut, habe ich den Eindruck, dass sie sich Mühe gibt, dem Ausdruck etwas Positives abzugewinnen.
«Ihre Kaffeemaschine ist vielleicht kaputt», sagt die Kundin.
«Wie meinen Sie, vielleicht kaputt?»
«Es zischt nur, wenn man den Startknopf drückt. Wasser und Bohnen hat es genug.»
«Dann schauen wir doch einmal nach, was es sein könnte.»
Es ist, als wäre nicht Beraten und Bücherverkaufen, sondern Schauen mein Arbeitsbereich. Nach dem Rechten schauen, während Oliwia wie ein Schmetterling herumfliegt, Leute mit guter Laune bestäubt und beim Blinzeln ihren Lidschatten schillern lässt, violett, bläulich und golden. «Du könntest deine Augen auch zum Leuchten bringen, zum Beispiel mit hellem Silber. Und wenn dir Lippenstift zu heftig ist, probiers mit Gloss», hat sie mir geraten. Aber wenn ich mich schminke, sehe ich aus wie Lili, als sie Grippe hatte, nicht an den Fasnachtsumzug durfte und sich heimlich mit Filzstift ein Indianergesicht aufgemalt hat. Ich wusste nie, was ich mit meinen braunen, schnittlauchgeraden Haaren machen könnte, außer sie offen und schulterlang zu tragen. Und Mode sagt mir nichts. Ich habe keine Zeit für Shoppingtouren, bei denen man sich mit einer Batterie Kleider in der Umkleidekabine verschanzt, um sich vor einem Rundumspiegel in verschiedene Typen zu verwandeln. Wann sollte ich das machen, mit einer achtjährigen Tochter und einem Ehemann, der zu hundert Prozent als Sekundarschullehrer arbeitet und dazu die wöchentliche Elterngesprächsgruppe der Schule leitet?
Oliwia empört sich darüber, dass ich ein Rollenbild lebe, gegen das Generationen von Frauen gekämpft haben. Aber für mich ist es in Ordnung, wie es ist. Ich bin gern zu Hause und brauche die Zeit für meine Kontrollrundgänge. Außerdem habe ich ja die Arbeit in der Buchhandlung. In der Woche vor Weihnachten arbeite ich jeden Tag. Linda, Oliwia und ich haben keine Arbeitsaufteilung, außer, dass Oliwia diejenige ist, die abends abrechnet. Ansonsten machen alle alles, begrüßen die Kundschaft, geben Autorennamen und Buchtitel in den Computer ein, um nachzusehen, ob wir die gewünschten Bücher an Lager haben, ziehen die Titel aus den Regalen oder bestellen sie, kassieren, machen auf Wunsch Geschenkpäckli, kramen am Morgen die Titel, die über Nacht vom Kurier geliefert wurden, aus den Boxen und räumen sie in die Gestelle oder ins Abholfach, benachrichtigen die Kunden, wenn sie gewünscht haben, dass man ihnen Bescheid gibt, wenn ihr Buch eingetroffen ist.
Ich stelle ein Tassli auf das Gitter. Es scheppert, dann werden die Bohnen gemahlen, aber es läuft kein Kaffee in die Tasse.
«Schauen Sie sich doch noch ein bisschen um, ich übernehme das.»
Die Kundin wirft den Kopf in den Nacken und lacht: «Das muss man mir in einer Buchhandlung nicht zweimal sagen, da sehe ich mich gerne noch ein bisschen um!»
Ich drücke an der Maschine herum, es dampft, tropft, dampft wieder und dann macht sie keinen Wank mehr. Das Problem muss ich allein beheben. Oliwia hat keine Ahnung von der Maschine, auch wenn sie genau diese haben wollte; knallrot lackiert und im Sixties-Stil designt. Als die große Buchhandlung ennet der Grenze ein Lesecafé einrichtete, zog Oliwia sofort nach. – «Wir müssen am Ball bleiben», sagte sie. Es ist ein Problem für uns, dass viele Leute ihre Bücher drüben kaufen, weil sie dort günstiger sind.
So haben wir nun eine Lese-Ecke mit Kaffeemaschine. Sie steht auf einem Servierboy, davor gruppiert sich in U-förmigem Bogen eine rote Sofakombination. Die Kissen leuchten tomatenrot, orangerot, weinrot und beerenrot. Unser Sofa sieht der Couch von Sigmund Freud farblich zum Verwechseln ähnlich, stellte ich fest, als ich in einem Buch über die Psychoanalyse ein Bild seines Behandlungszimmers in Wien fand.
Ich hatte befürchtet, dass mit dem Sofa Probleme auf uns zukommen könnten. Vielleicht würden es sich einige Leute zu bequem machen und ewig sitzen bleiben, zum Beispiel dieser Mann, der aussieht wie 70, wohl aber jünger ist. Er hat einen verfilzten Bart, der ihm wie ein Niagara-Fall in Handtaschenformat übers Kinn hängt. Die Farben des Bartes wechseln von oben nach unten vom verregneten Ackerbraun ins helle Rauchgrau. Der Mann trägt immer dieselbe Stoffhose: schwarz mit hellen Flecken, könnte man meinen, aber dann sah ich, dass die hellen Flecken weiße Elefäntchen sind. Wenn die Hosen von einer Verkäuferin im Laden angepriesen würden, dann sicher mit den Worten: Es ist ein Teil, das African Feeling transportiert. Dazu trägt der Mann ein ausgebeultes, helles Jeanshemd. Ist er unterwegs, schiebt er ein Einkaufswägeli vor sich her, das mit Wolldecken und Plastiksäcken mit gerissenen und wieder zusammengeknoteten Henkeln gefüllt ist. Wenn er in einen Laden geht, lässt er das Wägeli vor der Türe stehen. Der Mann ist stadtbekannt, weil er immer wieder in der Zeitung erwähnt wird und zwar als Original, ein Glück für ihn, denn so kam niemand auf die Idee, ihm einen anderen Namen zu geben, Penner vielleicht oder Spinner.
Er hat keinem etwas getan, trotzdem weiche ich ihm aus, wenn ich kann. Einmal hat er sich bei uns aufs Sofa gesetzt, ist ein paar Mal auf- und abgewippt, hat mit den Händen über den Stoff gestrichen, den Kopf geschüttelt und ist leise fluchend von dannen gezogen. Seither bin ich von der Qualität des Sofas nicht mehr so überzeugt.
Wir haben besprochen, was wir machen würden, wenn einzelne Kunden das Sofa tagein, tagaus in Anspruch nehmen, dort sitzen und Bücher oder Zeitschriften endlos lange durchblättern – «… mit einer Papiertüte in der Hand, in der eine Flasche Wein versteckt ist», hatte ich hinzugefügt – «Du und deine Fantasie!», hatte Oliwia gesagt. Ich fand die Vorstellung nicht speziell fantasievoll. «Wer für 50 Franken einkauft, darf 25 Stunden die Woche auf dem Sofa sitzen!», versuchte es Linda halbernst. Aber bisher läuft alles geordnet. Die Leute setzen sich in die Leseecke, schmökern und kaufen die angelesenen Bücher auch meistens.
Die Kaffeemaschine funktioniert auf einmal wieder, warum auch immer. Ich habe nur ein weiteres Mal auf den grünen Startknopf gedrückt. Gleich werde ich die Kundin darüber informieren, dass es wieder Kaffee gibt, und sie auch gleich fragen: «Darf ich Ihnen einen Kaffee rauslassen? Möchten Sie Zucker? Assugrin haben wir natürlich auch!», aber erst schaue ich mich um, um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtet, und kontrolliere dann, ob der Stecker satt in der Buchse steckt, dazu drücke ich ihn einige Male in die Wand. Ich will mich vergewissern, dass er keinen Wackelkontakt hat und einen Kurzschluss auslöst, auch wenn ich noch nie gehört habe, dass das schon einmal passiert ist. Die Vorstellung hat sich von allein in meinen Kopf gestohlen.
Die Gefahr aus der Steckdose ist das eine Risiko. Das Kabel der Maschine, das in Brand geraten könnte, das andere. Das Ladekabel unseres alten PCs zu Hause wird schnell heiß, da fragt man sich schon, wie weit es mit der Isolation dieser Kabel her ist. Und warum sich alle in Sicherheit wiegen und glauben, dass ein Kabel nicht schmelzen und in Brand geraten kann. So verschiebe ich das Kabel, bis es wie eine dünne schwarze Schlange im halben Oval um die Maschine herumliegt. Mit einem Auge auf die Maschine gerichtet, frage ich die Kundin, ob sie einen Kaffee wolle.
«Nein danke, ich muss leider gleich weiter», sagt sie.
Das fuxt mich, schließlich hat sie mich doch auf die Maschine aufmerksam gemacht; ihretwegen habe ich sie in Gang gebracht.
Während ich ihren Hera-Lind-Roman und ein Synonymwörterbuch in die Kasse einlese, drehen meine Gedanken: Habe ich den Stecker wirklich gut in die Buchse gesteckt? Berührt das Kabel die Kaffeemaschine wirklich nicht? An keinem Punkt? Ist es absolut ausgeschlossen, dass das Kabel schmelzen kann?
Die Fragen dröhnen immer lauter in meinem Kopf. Ich fixiere die Kundin, starre ihre Lippen an, die sich wellen und schürzen, und erkenne darin eine Verabschiedung.
«Schöne Feiertage!», staggele ich.
Meine ich es nur, oder runzelt sie die Stirn? Ob ich etwas zu meiner Verteidigung sagen soll? Zum Beispiel, dass ich mich ein bisschen grippig fühle oder es heute in der Buchhandlung besonders streng ist, Sie wissen schon, so kurz vor Weihnachten, entschuldigen Sie bitte?
«Einfach lächeln, wenn du nicht mehr weiter weißt» ist Oliwias Motto. Und ich lächle. Lächle, nachdem die Kundin gegangen ist, noch immer ins Blaue hinaus, bis die nächste Kundin auf mich zukommt und sofort ein Lächeln aufsetzt, als sie mich sieht.
Über Mittag stehen die Kunden an der Kasse Schlange und wir surren wie fleißige Bienen herum, strecken und bücken uns, um an Bücher, Kalender und Konsorten zu kommen. Die Kluft zwischen dem, was die Kunden sich als Geschenk vorgestellt, und dem, was wir vorrätig haben, schwindet, die shoppenden Damen und Herren kaufen entlang der Buchempfehlungen ein und fragen: «Können Sie mir es bitte noch als Geschenk einpacken?»
Wenn ich Papier um die Päckchen wickle und mit der Schere Locken in die Bändel ziehe, kommt mir oft der Päcklitisch in der Migros in den Sinn: Über dem ausliegenden Geschenkpapier hängt eine Tafel:
Der Päcklitisch ist ausschließlich für Artikel aus dem Migros-Sortiment gerechnet. Bitte kein Geschenkpapier mit nach Hause nehmen. Besten Dank für Ihr Verständnis.
Mich rührt das gestelzte «gerechnet» und die Bitte.
Administratives bleibt in diesen Vorweihnachtstagen meist liegen und wird nach Ladenschluss erledigt. Um halb sieben bringen wir auch die verschleppten Bücher an ihre Plätze zurück. Ich trage Die kleine Raupe Nimmersatt von der Sprachabteilung zurück ins Kinderbuch. Die Anleitung zum Mondkalender muss vom Schulbuch wieder in die Esoterik und der neue Roman von Alex Capus hat es bis ins Sachbuch geschafft, zwischen ein Buch über Hundedressur und Die faszinierende Welt der Orchideen. So langsam wie möglich bringe ich Capus in die Belletristik und überprüfe zusätzlich, ob die C-Autoren in der richtigen Reihenfolge sind: C-a-b, C-a-c, C-a-d, C-a-e, C-a-f und so weiter.
Damit will ich Zeit vertrödeln, um den Tubeli-Check nicht machen zu müssen. Ganz am Schluss muss eine von uns prüfen, ob rundum alles in Ordnung ist, ob Licht und Kaffeemaschine aus und die Fenster zu sind. Das ist für mich eine schwierige Aufgabe. Nur schon mit der Ausrichtung des Kabels der Kaffeemaschine könnte ich Stunden verbringen. Am meisten liegt es mir auf dem Magen, wenn ich die Türe abschließen muss.
Im Herbst hatte ich beim Aufräumen einen Fleck auf dem Teppich entdeckt und mich mit Schwamm und Wasser darum gekümmert und ehe ich mich versah, waren Oliwia und Linda mit der Arbeit fertig und angezogen. «Kommst du?», riefen sie, bereits auf dem Weg nach draußen, und mir blieb nichts anderes, als die Türe abzuschließen.
Ich drehte den Schlüssel langsam, ganz langsam, damit ich das Klicken im Schloss hören konnte. Aber ich glaubte dem Klicken nicht und drückte die Türfalle. Und zog den Schlüssel aus dem Schloss. Dann drückte ich die Türfalle noch einmal und rüttelte daran. Ich drückte die Türfalle noch einmal und kniff die Augen zusammen, um ganz sicher zu sein, dass ich auch richtig sehe, dass die Türe zu ist. Das musste reichen, dachte ich. Oliwia und Linda warteten plaudernd beim Brunnen, das Echo ihrer Wörter hallte hell die Wände der schmalen Altstadthäuser hinauf. «Kommst du endlich?», rief Oliwia, und ich musste die Türe sein lassen.
Ich zog Luft ein und ging einige Schritte von der Türe weg, aber es zog mich zurück. Ich drückte die Falle noch einmal und zwar so grob, dass ich den Griff noch in der Hand spürte, nachdem ich ihn losgelassen hatte.
Zu Hause dachte ich an nichts anderes als an diese Türe. Als sich Dani nach dem Abendessen an den Schreibtisch setzte, schwindelte ich in Richtung seines Rückens, ich hätte vergessen, eine Literaturliste für einen Kunden anzufertigen, die er morgen in der Früh abholen würde, ich müsse noch einmal in die Buchhandlung.
Wie bei einem dieser Bilder aus der Buchserie Das magische Auge ließ ich meinen Blick auf seinem Rücken im grauen Pulli verschwinden. Dani besitzt ein Arsenal dieser Pullis mit V-Ausschnitt in verschiedenen Erdfarben und trägt sie winters über seinen Hemden. «Ist das okay für dich?» Er antwortete nicht und ich ging auf ihn zu und sah sein Profil, das vom Licht des Computers hell erleuchtet wurde, ein vertrautes Bild. «Kein Problem», sagte er und ich wusste, dass er keine Ahnung hatte, worum es ging. So sehr es mich sonst enttäuscht, wenn ich merke, dass er mir nicht zuhört, war ich froh, dass er mir damals, als ich neben seinem Pult stand, keine Aufmerksamkeit schenkte. So musste ich nichts erklären.
Ich ging los und je näher ich der Buchhandlung kam, umso lächerlicher kam ich mir vor. Auf einmal war ich mir so sicher, dass ich die Türe abgeschlossen hatte, dass ich dafür meine Hand ins Feuer gelegt hätte. Ich drückte die Falle: Natürlich war die Türe zu. Die Unsicherheit überkam mich erst, als ich wieder auf dem Heimweg war. War die Türe wirklich abgeschlossen? Ich ging zurück, drückte, drückte, drückte und hebelte an der Falle herum, bis ich wusste, dass es keinen Zweck hatte.
Da stand ich, ratlos. Wusste nicht, was tun. Ich vertrödelte Zeit, indem ich in die Buchhandlung hineinstarrte, mit dem Blick der Wendeltreppe folgte, die in den ersten Stock zu Oliwias Büro, dem Pausenraum und der Toilette führt. Die Wendeltreppe hat Gitterstufen, bei denen ich nicht runterschauen darf. Für einen Höhenkoller brauche ich keinen Aussichtsturm.
Dann ging ich um die ganze Altstadthäuserzeile herum, bis ich in der Parallelgasse stand, öffnete dort das Gartentörchen und stiefelte in den kleinen Hinterhof, dem hinteren Ende der Buchhandlung. Hier stellt Oliwia im Sommer einen von Rost angefressenen roten Tisch und zwei Liegestühle mit blauer Plastikbespannung hin, und wir nutzen den ruhigen Ort für unsere Pausen. Manchmal ärgern wir uns über die Nachbarn, die so viele Velos haben, dass sie sie manchmal bei uns abstellen, Velos mit quietschenden Gummitierköpfen statt Veloklingeln und Anhängern mit aufgesteckten Fähnli, mit denen Kinder herumgefahren werden, was ich nie verstehen werde – wie kann man sein Kind im Straßenverkehr hinter sich transportieren, wo man es nicht sieht?
Aber auch der Ausflug in den Hinterhof konnte mir keine Überzeugung schenken. So ging ich zurück zum Haupteingang der Buchhandlung, um die Falle noch einige Male zu drücken. Aber ich wusste, dass es zwecklos war. Ob ich noch lange hier stand oder nach Hause ging – es würde sich nichts ändern. Die Unsicherheit würde nicht aufhören mich zu umarmen, sie würde mir weiterhin über den Rücken streichen, damit ich sie auf keinen Fall vergesse.
Auf dem Rückweg ging ich dem See entlang, vorbei an dem Steg, an dem man im Sommer Pedalos mieten kann. Das Wasser schwappte an der Mauer auf und ab und die Vorstellung, nur schon eine Zehenspitze ins kalte Wasser zu stecken, ließ mich vor Kälte schaudern. In meinem Bauch aber blieb es heiß, so wütend war ich auf mich selbst. Wie hatte ich zur Sklavin von Gedanken werden können, die keinen Sinn ergaben? Ich tat Dinge, die ich nicht erklären konnte, und die mir bestimmt auch niemand erklären konnte, da brauchte ich gar nicht erst herumzufragen.
Einen Arzt konnte ich nicht besuchen, er würde mein Leiden bestimmt nicht für sich behalten können. Ich könnte wohl damit leben, wenn die Leute wüssten, dass ich verrückt bin. Aber mein Herz zieht sich zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass jemand Lili trifft und dabei denkt: Sie ist ein so tolles Kind, kaum zu glauben, dass ihre Mutter spinnt.
Wieder zu Hause tigerte ich in der Wohnung herum und musste mich zusammenreißen, um nicht noch einmal zur Buchhandlung zu gehen. In dieser Nacht schlief ich zwei zerstückelte Stunden. Am nächsten Tag hatte ich frei und erst, nachdem bis Mittag niemand angerufen hatte, konnte ich durchatmen. Dann überlegte ich mir, was Einbrecher, die dank der offenen Türe in die Buchhandlung hätten schlendern können, eigentlich mitgenommen hätten. Wir haben zwar einen Tresor, aber Oliwia schließt den Umsatz nie dort ein, sondern bringt ihn auf die Bank. Was hätte die Einbrecher sonst interessiert? Die Lehrmittel zum Rechnungswesen, um künftig clever mit dem geklauten Geld haushalten zu können? Oder die Sammelbände 1–6 von Hanni & Nanni für ihren Nachwuchs?
«Also Mädels, macht euch einen schönen Abend!», ruft Oliwia, als ich gerade bei C-e-m bin und kontrolliere, ob danach ein C-e-n oder ein Ausreißer folgt.
«So schön, wie es kurz vor Weihnachten halt geht», schickt sie hinterher.
Sie lässt uns ziehen. Sie wird den Tubeli-Check selbst machen und abschließen müssen.
In den Altstadtgassen glänzt das Pflaster im Licht der Straßenlampen, es schneit seit Tagen, manchmal wild, manchmal zärtlich. Ich bin auf einen Schlag so müde, dass ich befürchte, keinen Fuß mehr vor den anderen setzen zu können. Gerade noch füllten die Stimmen von Kunden, das Surren des Druckers und das Klicken der Computertasten meinen Kopf und jetzt ist es still. Gerade noch brauchte ich nicht darüber nachdenken, was ich als nächstes tue, es gab tausend Dinge zu tun. Jetzt muss ich nur eins – nach Hause. Das ist wenig, viel zu wenig, da ist nichts, woran ich mich halten kann, und ich falle in ein Loch. Früher dachte ich, in Löcher fällt man nur nach großen Ereignissen, schwierigen Prüfungen oder der Geburt eines Kindes, aber ich falle stetig, immer dann, wenn ich von außen wieder nach innen umschalten muss und in mir nur noch die nagenden Sorgen finde. Ablenkung hilft. Ich grüble das Mobiltelefon aus der Tasche der dicken Winterjacke und wecke es mit einem Knopfdruck. Auf dem Display springt mir ein Bild von Lili entgegen. Mit breitem Grinsen zeigt sie eine große Zahnlücke. Es hat niemand angerufen oder geschrieben.
Ich habe nicht viel Austausch. Sandra, meine beste Freundin aus der Schule, ist nach Göttingen gezogen und aller Beteuerungen zum Trotz haben wir den Kontakt nicht gehalten. Zu Beginn machten wir uns einen Spaß daraus, uns auf Briefpapier für Kinder zu schreiben, die Sets erinnerten mich an die Buchcover meiner Jugendlektüren, wie derjenigen von Federica de Cesco: Pferde, aufwirbelnder Sand, junge Menschen, Sonnenuntergänge. Wir schrieben uns, bis wir beide Mütter wurden. Dann schlief der Kontakt ein. Sandra war meine einzige Vertraute, zu den anderen Mitschülern hatte ich keine besondere Verbindung.
Als junge Mutter hätte es viele Gelegenheiten gegeben, um neue Kolleginnen zu finden, aber Lili zu haben und mit ihr in die Krabbelgruppe, zum Babyturnen und mit dem Buggy an die frische Luft zu müssen, forderte mich. Mir fehlte die Kraft, um die Mütter, die ich auf dem Spielplatz sah, auch privat zu treffen. Es fällt mir immer schwer, mich auf ein Gespräch mit jemandem zu konzentrieren, wenn Lili in der Nähe ist, weil ich sie nie aus den Augen lasse.
Dani und ich haben einige gemeinsame Freunde, die meisten sind alte Freunde von Dani und ebenfalls Lehrerinnen oder Lehrer. Von ihnen meldet sich niemand bei mir. So kontaktieren mich eigentlich nur Dani, meine Mutter oder meine Großmutter Sofie. Sofie wird sich allerdings in diesen Tagen nicht melden; sie ist verschwunden. So sehr ich mich um die absurdesten Dinge sorge: Sofies Unauffindbarkeit macht mir keinen Kummer. Sie wird wieder auftauchen, vermutlich am 24. Dezember und mit Statler im Schlepptau. Nach dem Spektakel vom letzten Jahr wird sie sich den Weihnachtsabend nicht entgehen lassen wollen. Noch vier Tage bis Weihnachten. Vier, drei, zwei, eins. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Und ich muss noch so viel vorbereiten, damit ich wieder ins Lot bringen kann, was ich vor einem Jahr kaputt gemacht habe. Und damit meine ich nicht in erster Linie die Weingläser, sondern das, was in mir seither nicht mehr funktioniert.
«Seid ihr parat?» In der einen Hand halte ich die Pfanne mit den Bohnenburgern, in der andere das Mischgemüse aus der Tiefkühlpackung, alles huschhusch gebraten beziehungsweise aufgewärmt und mit Gewürzen aufgepeppt. Dazu gibt es Mayo aus der Tube.
«Ja», sagt Dani, faltet die Zeitung zusammen, legt sie auf die Bank und greift nach den Holzuntersätzen, die Lili in der ersten Klasse bemalt hat. Die Lehrerin sagte mit ernster Miene, sie fände die explosive Bemalung sehr ausdrucksstark. Dani begann laut zu lachen und ich schämte mich für ihn, die Lehrerin hatte es doch nur gut gemeint. Ich stelle die Pfannen ab und rutsche neben Lili auf die Eckbank.
«Ist wieder mal spät», bemerkt Dani.
«Ja.»
Auf eine Diskussion habe ich keine Lust. Wenn ich bis Ladenschluss arbeite und danach noch in der Buchhandlung aufräume, wird es immer spät.