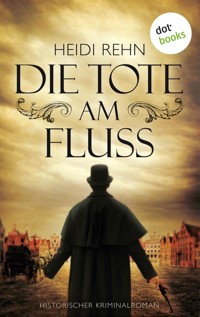9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland im Dreißigjährigen Krieg: Die kluge Söldnertochter Magdalena arbeitet als Wundärztin im kaiserlichen Tross. Bald entbrennt sie in großer Liebe zu dem Kaufmannssohn Eric – eine verbotene Liebe. Als Eric plötzlich spurlos verschwindet, muss die inzwischen schwangere Magdalena schweren Herzens allein im Tross weiterziehen. Zwei Jahre später geschieht das Unerwartete: Der tot geglaubte Eric liegt schwer verwundet vor ihr – und wird des Mordes beschuldigt. Magdalena steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 876
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Heidi Rehn
Die Wundärztin
Knaur e-books
Über dieses Buch
Warum verlieben sich Frauen immer wieder in Männer, die das Schicksal ihnen nicht bestimmt hat, so daß diesen nur die Wahl bleibt, wider das eigene Wesen zu handeln oder sie zu hassen?
MARGUERITE YOURCENAR (1903–1987)
Der FangschußAus dem Französischen von Richard Moering, © 1986 Carl Hanser Verlag, München
Für Lilli und Beatrix
Prolog
Magdeburg
Ende Mai 1631
Für einen Moment wurde es totenstill in dem schmalen Hof. Mitten im Zank hielten die beiden Mädchen inne. Der eben noch straff gespannte Stoff schlackerte schlaff in ihren Händen. Ein Ruck würde genügen, ihn der anderen zu entreißen. Keine von beiden aber wagte, sich zu rühren. Stocksteif standen sie einander gegenüber, die Augen weit aufgerissen. Angst und Anspannung spiegelten sich darin.
Im Gebälk der nahen Scheune knarrte es. Eine Latte krachte herunter. Für einen quälend langen Moment kehrte die Stille wieder zurück, bis die hölzerne Scheunenwand unter gewaltigem Getöse in sich zusammenstürzte. Haushoch wirbelten Funken auf, Ascheregen rieselte nieder. Schreckensbleich stierten die kleine Blonde und die schmächtige Rothaarige in das Flammenmeer.
Dort, wo eben noch die Scheune gestanden hatte, tanzte nur mehr dichter, stinkender Rauch. Das Holz am Boden glühte. Begierig leckte das Feuer an den Balken entlang. Abermals brauste der Wind in den Hof, wehte eine weitere Wolke Asche und Glut herein. Undurchdringlicher Qualm umnebelte die Kinder. Das Luftholen wurde zur Qual, jeder Atemzug biss schmerzhaft in die Brust. Abrupt drehte der Wind und riss das Feuer mit sich herum, um es zum nächsten Hof zu jagen. Das Prasseln der Flammen wurde leiser, und die Hitze schwand so rasch, wie sie gekommen war. Hustend und spuckend rangen die Mädchen nach Luft.
Seit dem frühen Morgengrauen wütete das Feuer in der ehedem so prächtigen Stadt an der Elbe. Satt aber war es noch lange nicht. Stunde um Stunde fraß es sich durch die Gassen, leckte mit tausend Zungen in die Höfe und Häuser hinein, um binnen Augenblicken mit abertausend hungrigen Flammen aus den Fenstern zu schlagen. Auf der Straße wälzte sich der Zug der Fliehenden vorbei. Verzweiflungsschreie hallten von den rußgeschwärzten Mauern wider. Von der sanften Maisonne war nirgendwo etwas zu ahnen.
»Gib endlich her!« Als Erste erwachte die blonde Elsbeth aus der Erstarrung. Entschlossen zerrte sie an dem Stoff, den die beiden Mädchen in Händen hielten. Durch den Ruck wurde auch die rothaarige Magdalena wieder lebendig. Erstaunt blickte sie Elsbeth an. Die Augen ihrer Cousine verengten sich zu schmalen Schlitzen, die sonst so vollen Lippen bildeten gerade Striche in dem ebenmäßigen Gesicht. Energisch hielt sie den Stoff fest. Straff wie eine Flagge spannte er sich zwischen ihnen.
»Er gehört mir!« Magdalena stemmte den rechten Fuß in den Boden, lehnte den Oberkörper zurück und legte ebenfalls alle Kraft in ihr Ziehen. Nur weil Elsbeth ein gutes Stück größer war als sie, sollte sie nicht wieder die Oberhand behalten. Sie fuhr sich mit der Zunge über die aufgesprungenen Lippen und schmeckte die salzigen Tränen, die ihr die Wangen hinunterkullerten.
»Nein, mir!« Wut funkelte in Elsbeths Augen. Die alabasterweißen Arme schimmerten im Feuerschein. Ein Heiligenschein aus gelbroten Flammen umkränzte ihren Kopf. Kein Zweifel: Der dunkle Taftrock würde sie in eine wahre Prinzessin verwandeln. Darum sollte sie den Rock auch nicht haben! Magdalena kniff ebenfalls die Augen zusammen und klammerte die kurzen Finger um den Stoff. Auch sie würde wunderschön darin sein. Schon sah sie den stolzen Blick ihres Vaters vor sich. Ihre smaragdgrünen Augen würden mit dem tannengrünen Stoff um die Wette leuchten, kühn würde sich der Taft beim Tanzen bauschen. Die Traumbilder schienen ihr mit einem Mal so wirklich, dass sie erst wieder verschwanden, als ihr der harte Stoffwulst in die Handflächen schnitt und der Schmerz sie jäh in den kahlen Hof zurückholte. Die roten Locken klebten ihr auf der Stirn, sie wegzuwischen, fehlte die Zeit. »Lass los!«
»Mir hat ihn Babette geschenkt!« Entschlossen zerrte Elsbeth ein weiteres Mal an dem Stoff.
»Du lügst! Sie ist meine Mutter! Deshalb hat sie den Rock mir gegeben!« Wütend stampfte Magdalena auf und versuchte gleichzeitig, den glatten Taft festzuhalten.
»Nein, mir!« Elsbeth genügte ein neuerlicher Ruck, um Magdalena ins Straucheln zu bringen. Ein lautes Ratschen war zu hören. Haltlos purzelten beide Mädchen nach hinten und betrachteten entsetzt die Fetzen in ihren Händen. Sofort stimmte Elsbeth ein markerschütterndes Schreien an.
Im selben Moment schoss Magdalenas Mutter Babette um die Ecke, einen großen Berg Weißzeug vor der Brust, die ansehnliche Beute vormittäglichen Mausens in der frisch eroberten Kaufmannsstadt. Ein Blick auf die jammernde Elsbeth und die stumm dasitzende Magdalena genügte. Zornig warf sie das Weißzeug zu Boden, ohne auf den Dreck zu achten, und verpasste Magdalena rechts und links zwei Maulschellen. »Dich werd ich lehren, deiner armen Cousine alles wegzunehmen! Bist du denn zu gar nichts zu gebrauchen?«
Elsbeths neuerliches Aufschreien unterbrach ihr Schimpfen. Magdalena nutzte die Gelegenheit, sich unter der halberhobenen Hand wegzurollen. Nach einem kurzen Blick auf Babette, die sich besorgt über die wimmernde Elsbeth beugte, beschloss sie wegzulaufen, hinaus auf die Gasse, hinein in das unübersichtliche Menschengewühl, weiter, immer weiter, einfach dem Strom der Fliehenden hinterher. An einer Straßenecke geriet der Zug ins Stocken, kam schließlich ganz zum Stehen. Rechts und links brannten die Häuser lichterloh. Das stete Prasseln schmerzte in den Ohren, die Hitze nahm den Atem. Ein süßlicher Geruch breitete sich aus. Verbranntes Fleisch! Magdalena stockte das Herz. Kaum wagte sie Luft zu holen. Gleichzeitig wurde die Enge um sie her unerträglich. Schulter an Schulter stauten sich die Menschen, schimpften und schrien, weil es nicht mehr weiterging. Angst packte Magdalena. Sie konnte nicht mehr länger in der Menge ausharren, sie musste weg. Wohin? Sie reckte und streckte sich, doch es nutzte nichts. Mit ihren sechs Jahren war sie einfach zu klein, um über die anderen hinwegsehen zu können. Flink duckte sie sich und versuchte, zwischen den Beinen der Großen nach vorn zu schlüpfen. Als auch das nicht gelang, beschloss sie, einen anderen Weg zu suchen. Sie zwängte sich an der Menge vorbei in ein halbwegs intakt aussehendes Gemäuer. Ächzend schwang eine Tür auf. Dahinter empfingen sie nichts als rauchende Schuttberge, Wände und Mauern waren eingestürzt. Das Feuer hatte auch hier ganze Arbeit getan. Mitten in einer einsam aus Trümmern aufragenden Wand entdeckte sie eine weitere Tür. Als sie sie öffnen wollte, hob ein ohrenbetäubender Lärm an.
»Nicht!« Jemand riss sie fort. Im selben Augenblick stürzte auf der anderen Seite der Tür ein brennender Balken herab und riss die gesamte Wand mit sich zu Boden. Verwundert fand sich Magdalena zwei Schritte neben der Stelle, an der sie eben noch gestanden hatte, und betrachtete die hoch aufschlagenden Flammen.
»Glück gehabt.« Die Stimme kam von dicht neben ihr und gehörte einem rotblonden, kräftigen Jungen, der sie um mehr als zwei Köpfe überragte. Sie schätzte ihn auf mindestens zwölf, also gut doppelt so alt wie sie. Erleichtert lächelte er sie an. In seinen tiefblauen Augen und dem durchdringenden Blick blitzte etwas auf, was sie tief im Innersten berührte. Sofort fasste sie Zutrauen und schob ihre kleine Hand in die seine.
»Komm mit. Hier können wir nicht bleiben«, sagte er und zog sie fort. Hand in Hand kletterten sie über die glimmenden Trümmer, suchten sich zwischen den Ruinen einen Weg und erreichten bald eine Straße. Auch die war voller Menschen. Die Richtung, die sie einschlugen, schien dem Jungen zu gefallen. Zufrieden schmunzelte er, umfasste ihre Hand noch ein wenig fester und reihte sich mit ihr in den Strom der Fliehenden ein. Wenig später bereits gelangten sie zu einem Tor, das aus der Stadt hinausführte.
»Wo gehörst du hin?« Kurz vor dem Tor zog er sie in eine Mauernische. Verwundert bemerkte sie, dass seine Stimme zitterte. Sie blickte zu ihm auf, konnte aber nicht viel von seinem Gesicht erkennen. Der vorragende Mauersturz überschattete seine Augen. Die Menschen drängten so dicht vorbei, dass sie Mühe hatte, nicht mitgerissen zu werden. Alte, Junge, Männer, Frauen, Kinder rempelten sie an, Bürger und Habenichtse schoben vorbei, alle geeint in der Sorge, sich aus dem brennenden Inferno zu retten.
Jetzt erst überkam sie die Furcht. Babettes wutverzerrtes Gesicht tauchte vor ihr auf, Elsbeths siegesgewisses Lachen. Unwillkürlich klammerte sie sich an dem fremden Jungen fest. Bei ihm könnte sie doch einfach bleiben, fortan immerzu in diesen wundervollen blauen Augen versinken! Die Seinen nahmen sie vielleicht freudig bei sich auf. Doch da schob sich das Gesicht ihres Vaters vor ihre Augen. Sie meinte zu hören, wie er zärtlich nach ihr rief. Dabei war es ihr halbwüchsiger Retter, der sie am Arm fasste und noch einmal fragte: »Wo gehörst du hin?«
»Zu den Pappenheimerschen.« Ohne nachzudenken, kamen ihr die Worte über die Lippen, die der Vater ihr eingeschärft hatte. Stolz fügte sie hinzu: »Wir kämpfen für die gerechte Sache des Kaisers!«
In den Mundwinkeln des Jungen zuckte es. Ein Beben lief durch seinen dünnen, langen Körper. Er räusperte sich, bevor er heiser erklärte: »Dann bring ich dich eben dorthin.« Wie selbstverständlich reihte er sich bei den vorbeiziehenden Söldnerweibern ein. Keine achtete auf die beiden. Hochbepackt mit Beute, eilten sie zur Elbe, um mit einem der vielen Kähne auf die östliche Flussseite überzusetzen, wo sich das Quartier der kaiserlichen Truppen befand. Jemand half ihr ungefragt in den Kahn. Sie zögerte, fürchtete, ihr junger Retter nutzte die Gelegenheit, sie im Stich zu lassen. Dann aber tauchte sein rotblonder Haarschopf neben ihr auf, und sie griff beruhigt nach seiner Hand.
Friedlich schlummerte das Heerlager im milchigen Licht der schrägstehenden Nachmittagssonne. Die zigtausend Soldaten- und Trossweiberfüße hatten längst die zart keimenden Frühlingsblumen auf den Wiesen ringsum niedergetrampelt. Den Geruch des lichterloh brennenden Magdeburg in der Nase, schien es Magdalena, als ströme ihr nun aus jedem Winkel üppiger Maiduft entgegen. Begierig sog sie ihn ein. Endlos weit erstreckte sich das Lager: Zelte reihten sich an Zelte, Wagen an Wagen, dann folgten wieder Zelte, dazwischen waghalsige Verschläge aus Decken, Ästen und dornigem Gestrüpp, bevor die Gassen abermals breiter und die Unterkünfte wieder prächtiger wurden. In jedem Winkel tummelten sich Männer, Frauen und Kinder, Soldaten und Handwerker. Dazwischen feilschten Marketender und Huren mit ihrer Kundschaft, buhlten Spielleute und Wahrsagerinnen um Aufmerksamkeit. Das Gerassel der Säbel, das Klirren der Klingen und das Knacken der Gewehre waren vertraute Musik in Magdalenas Ohren, selbst die dumpfen Befehle, mit denen ein Feldwebel seine Rotte durch die Gassen scheuchte, wurden zu beruhigendem Gesang. »Da lang!« Ihr rechter Zeigefinger schnellte nach vorn. Noch bevor der Junge sich besinnen konnte, führte sie ihn zielsicher durch das Gewirr der Zelte und Gassen, so wie er sie vorhin durch die Trümmer Magdeburgs gelotst hatte.
In weiter Ferne verklangen die letzten Schüsse und Explosionen. Auch der Trubel im Lager wurde bedächtiger. Bis zur Unterkunft der Eltern am östlichen Rand war es noch ein gutes Stück zu gehen. Überrascht bemerkte Magdalena, wie die Schritte ihres Retters zögerlicher wurden, und seine Hand fühlte sich feucht an. Sie beschloss, ihn abzulenken. Munter plapperte sie davon, wie Babette, Elsbeth und sie gleich bei Tagesanbruch zum Mausen in die Stadt aufgebrochen waren. Nach der Aufzählung all der vielen Stoffe, Kleider, Töpfe und Tücher, die sie aus den Häusern geholt hatten, ging sie dazu über, zu erklären, dass Elsbeth die Tochter der Schwester ihrer Mutter war, die im letzten Winterlager gestorben war. Auch dass sie mit der schönen Cousine um den tannengrünen Taftrock gestritten hatte, verschwieg sie nicht. Erst als sie zu der Stelle kam, wie er sie vor dem brennenden Balken gerettet hatte, hielt sie erschöpft inne und warf ihm einen ängstlichen Blick zu. Beharrlich starrte er nach vorn. Ein bitterer Zug umspielte seine Mundwinkel, und auf der Wange glitzerte eine Träne. Hastig wischte er sie fort. Es sah nicht so aus, als wolle er noch mehr von ihren Geschichten hören. Also schwieg sie.
Lange liefen sie nebeneinander her. Magdalena wurde müde und stolperte bald mehr, als dass sie ging. Doch der Junge verlangsamte seinen Schritt nicht. Glutrot leuchtete die Sonne schließlich in ihren Rücken auf, entzündete am Abendhimmel dasselbe Feuer wie am Tag die hungrigen Flammen in der Stadt. Um die Erinnerung zu verscheuchen, richtete Magdalena die Augen stur nach vorn, Richtung Osten, wo irgendwo das Zelt der Eltern sein musste. Endlich tauchte ein gutes Stück entfernt von den übrigen Leiterwagen die vertraute Silhouette eines einzelnen Fuhrwerks mit einem angrenzenden Zelt auf.
»Meister Johann!« Magdalenas Stimme überschlug sich vor Freude. »Der Wagen da vorn gehört Meister Johann, unserem Feldscher. Endlich sind wir da!«
»Bist du sicher?« Ihr Retter gab sich keine Mühe, die Enttäuschung in seiner Stimme zu verbergen.
Heftig nickte sie und fragte, als er stehen geblieben war: »Du hast wohl keinen mehr, zu dem du gehen kannst? Komm doch mit! Meister Johann wird wissen, wo du hinkannst, wenn du sonst niemanden mehr weißt.«
»Meinst du?« Schüchtern sah er sie an.
»Ganz bestimmt.«
Ein Zug der Erleichterung huschte ihm über das Gesicht. Zwei helle Falten gruben sich oberhalb der Nasenwurzel ein. Tastend suchte er mit den Fingern unter seinem Hemdkragen und zog behutsam etwas darunter hervor: eine Lederschnur mit einem honiggelben Stein. Im letzten Licht der untergehenden Sonne glich er erstarrtem Feuer. Etwas Schwarzes schien darin gefangen.
»Hier, für dich. Der passt auf dich auf, damit dir nichts Böses geschieht. Mit seiner Hilfe findest du künftig auch allein zu deinen Leuten zurück.«
»Auch ohne dich?«
»Auch ohne mich.« Eine Spur zu hastig beugte er sich herunter und band ihr die Schnur um den Hals. Dabei hörte sie ihn leise aufschluchzen.
»Danke«, sagte sie und steckte den Stein unter ihr Hemd. Niemand sollte den Schatz entdecken, vor allem nicht Elsbeth, ihre habgierige Cousine.
»Wie heißt du eigentlich?« Noch einmal suchte sie den Blick seiner tiefgründigen blauen Augen, spürte den Strudel darin, der sie mit sich fortreißen wollte.
»Eric.«
»Danke, Eric, für den Stein. Auch dich werde ich jetzt immer wiederfinden können, ganz gleich, wo du steckst.«
Verschwörerisch zwinkerte sie ihm zu. Dann wandte sie sich um und führte ihn zu Meister Johanns Wagen. Kaum waren sie auf wenige Schritte heran, kam ihr Vater unter der Plane des angrenzenden Zeltes hervor.
»Vater!« Magdalena flog ihm in die Arme. Freudig drückte er das Mädchen an sich und vergrub das Gesicht in ihren roten Locken. Schließlich drehte er sich zu ihrem jungen Retter um. Sobald er seines Gesichts gewahr wurde, setzte er sie ab und trat zwei Schritte zurück. Dabei erblasste er, das Lächeln in seinen Augen erstarb. »Nein!« war alles, was er herausbrachte.
Bestürzt verfolgte Magdalena den plötzlichen Sinneswandel. »Das ist Eric. Er hat mich aus dem Feuer in Magdeburg gerettet und zurückgebracht.«
Zur Bestätigung wollte sie den Stein unter ihrem Hemd hervorziehen und dem Vater zeigen. Der aber schüttelte den Kopf. Wortlos wandte er sich ab und zog sie ohne weitere Erklärung mit sich fort.
Erster Teil
Belagerung
Freiburg im Breisgau
Juli bis August 1644
1
Viel zu schnell war die Nacht vorüber, viel zu früh graute der Tag. Eine Taube begann ihr aufdringliches Gurren, eine Amsel stimmte tiefkehlig in den morgendlichen Gruß ein. Magdalena schmiegte den schmalen Körper an Erics nackte Brust. Verträumt fuhren ihre Fingerspitzen die Adern seiner muskulösen Oberarme nach. Winzige Schweißtropfen perlten auf der sonnengebräunten Haut. Zärtlich saugte sie die mit den Lippen auf und sog seinen Geruch ein. »Ich liebe dich.«
»Ich dich auch.« Sacht presste er sie auf den Rücken, ließ den Blick über ihren bloßen Leib gleiten und hauchte einen sanften Kuss mitten darauf. Ihr Atem ging schneller. Ein leichtes Zittern durchlief sie. Schaudernd vor Wonne, stellten sich ihr die Nackenhaare auf.
»Wie gut, dass wir uns wiedergefunden haben«, flüsterte sie und schnappte spielerisch mit den Zähnen nach seinem Ohrläppchen. »Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich je ohne dich und deine Liebe sein konnte. Das will ich nie mehr erleben.«
»Ich hoffe nicht, dass du das jemals musst.« Mit einem leidenschaftlichen Kuss verschloss er ihre Lippen und begann abermals, ihren alabasterweißen Körper mit Liebkosungen zu verwöhnen. Eine neue Woge der Lust durchflutete sie, bis ein lauter Trompetenstoß sie auffahren ließ. Erschrocken sahen sie einander an. Abermals ertönte die Fanfare. Unruhe machte sich unterhalb ihres Liebesnestes breit. Es befand sich auf dem Heuboden einer Scheune in der Freiburger Gerberau. Dort hatten die Zimmerleute der Kaiserlichen, zu denen Eric seit einigen Jahren gehörte, Quartier bezogen.
»Ob es tatsächlich losgeht?« Magdalena spähte durch die Giebelluke auf den Hof hinunter. Im diffusen Graublau der Dämmerung liefen ein gutes Dutzend Zimmerleute zusammen. Schwere Schritte knallten auf dem Steinboden, Holzdielen knarrten, Rufe wurden laut. Manche der Männer knöpften sich noch im Laufen die Hosen zu und gähnten herzhaft, andere wirkten bereits hellwach und für alles gerüstet. Übermütig schwenkten sie die breitkrempigen Hüte, schulterten die Äxte und schoben sich Zangen und Hämmer in die Gürtel. Sie hatten es eilig, zum Schanzenbau vor den Toren der Stadt auszurücken.
»Da übt gewiss einer, damit er das Trompeten nicht verlernt.« Eric pustete eine rotblonde Haarsträhne aus dem Gesicht und machte nicht die geringsten Anstalten, sich zu erheben und den Kameraden zu folgen. Stattdessen begann er, die Strohhalme aus Magdalenas roten Locken zu zupfen. Es war bereits die zweite Nacht, die sie gemeinsam auf dem Heuboden verbrachten. Noch immer bekam er nicht genug von ihr, wie seine gierigen Küsse bewiesen. »Vergiss doch endlich die Franzosen! Auch wenn sie letztens ehrenvoll mit Pauken und Trompeten aus Freiburg abgezogen sind, sind sie vorerst geschlagen. Unser tapferer Mercy jagt ihnen viel zu viel Angst ein. Solange er mit seinen Truppen hier ist, trauen die sich nicht wieder zurück. Der Bau von neuen Schanzen hat also noch viel Zeit. Unterdessen sollten wir uns lieber Wichtigerem widmen.« Damit wollte er sie von neuem sanft, aber entschieden ins Heu ziehen.
»Du redest, als wärst du immer schon einer von uns gewesen.« Magdalena widersetzte sich erfolgreich seinem Begehren und betrachtete nachdenklich den Geliebten. Das sanfte Licht der Morgendämmerung hob die Konturen seines wohlgestalteten Körpers hervor. Selbst im Sitzen war Eric sehr groß. Die meisten Männer des Regiments überragte er um einige Handbreit. Sein muskulöser, sonnengebräunter Oberkörper zeugte von der harten Arbeit, die er als Zimmermannsgeselle zu verrichten hatte. Die feingliedrigen Hände mit den langen, grazilen Fingern verrieten, dass er eigentlich nicht zu dieser Arbeit geboren worden war. Auch das Profil seines Gesichts wies edle Züge auf. Hell flimmerte der Bartflaum auf Kinn und Wangen. Wenn er lächelte, so wie im Moment, gruben sich auf beiden Seiten des Mundes zarte Grübchen ein. Ebenmäßig blitzten die weißen Zähne zwischen den Lippen hervor. Schweren Herzens unterdrückte Magdalena den Wunsch, ihn abermals zu umarmen. Ihre kleinen, apfelgleichen Brüste dürsteten nach der Berührung mit seiner warmen Haut, vorwitzig reckten sich die Brustwarzen hervor. Gewiss aber war es besser, sie ließen es für dieses Mal bewenden. Die Aufbruchsstimmung unten im Hof wurde dringlicher. Bedauernd sprang sie auf, schlüpfte in das leinene Mieder, knöpfte es zu und streifte sich den Rock über. Abschließend fuhr sie mit den schlanken Fingern durch das gelockte, offen fallende Haar. Dabei verharrte der Blick ihrer smaragdgrünen Augen weiterhin auf Eric. Sie liebte ihn, wie sie noch nie einen Menschen geliebt hatte. Seit ihrer ersten Begegnung, nachdem er seine Familie bei der Magdeburger Hochzeit verloren und sie aus den Trümmern der brennenden Stadt gerettet hatte, zog er im kurfürstlich bayerischen Heerestross mit. Jahrelang hatten sie sich aus den Augen verloren, bis sie sich erst in diesem Frühjahr wiedergefunden und rettungslos ineinander verliebt hatten. Seither teilten sie jede freie Minute miteinander. Keiner konnte ahnen, wie viel Zeit ihnen vergönnt war. Umso wichtiger war es, dass sie jeden Augenblick miteinander auskosteten. Längst hatte sie das Gefühl, jedes einzelne Haar seines Körpers zu kennen, jeden Gedanken in seinem Kopf erraten zu können, bevor er ihm selbst überhaupt bewusst wurde. Und dennoch spürte sie, dass etwas an ihm ihr fremd blieb, trotz aller Liebe und Vertrautheit nicht so recht in ihr Leben im Tross passen wollte.
»Du täuschst dich gewaltig.« Zärtlich strich sie ihm über die glattrasierte Wange. »Vater meint, die Franzmänner warten nur auf Verstärkung aus dem Hinterland. Sobald die eintrifft, schlagen sie von neuem los. Immerhin liegt Turenne kaum zwei Meilen von hier auf dem Batzenberg mit zehntausend Mann bereit. So schnell geben die Franzosen Freiburg nicht auf, noch dazu, wenn auch der Weimarer an ihrer Seite gegen uns mit von der Partie sein will.«
»Wenn dein Vater das sagt, wird es schon stimmen, meine kleine geliebte Söldnerin. Dann ist es erst recht höchste Zeit, dass wir zuvor noch unsere privaten Angelegenheiten regeln. Wer weiß, wie viel Zeit uns bleibt.« Lächelnd kniff er sie in die Wange und küsste sie erneut leidenschaftlich auf den Mund. »Tut mir leid, dass ich vergessen habe, wie sehr dir als Soldatentochter das Verständnis für die kriegerischen Ränke im Blut liegt. Ich dagegen bleibe wohl für immer der unbelehrbare Kaufmannssohn, der nie verstanden hat, was da gespielt wird. Wahrscheinlich bin ich dir ganz und gar verfallen, weil mir einzig die Liebe zu dir noch das Überleben garantiert.«
Ehe sie sich versah, hatte er ihr den Rock hochgeschoben, das Mieder geöffnet und das unterbrochene Liebesspiel wieder aufgenommen. Dabei störte ihn die Unruhe im Hof nicht im Geringsten, auch das abermalige Trompetensignal beachtete er nicht. Ganz im Bann seiner Zärtlichkeiten, vergaß auch sie bald, was um sie herum vorging. Er hatte recht: Die wenigen gemeinsamen Stunden waren zu kostbar, um nicht in vollen Zügen genossen zu werden.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel. Vorwitzig kitzelte ihr Strahl Magdalenas Nasenspitze. Sie öffnete die Augen und blinzelte in die gleißende Helligkeit hinein. Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, wo sie sich befand. Eric lag noch immer quer über ihren Oberschenkeln. Seine Haut glitzerte schweißnass. Sie waren beide noch einmal eingeschlafen.
»Los, du Faulpelz! Es ist lichter Tag! Wenn wir uns nicht vorsehen, kommt uns doch noch jemand auf die Schliche.« Sie schob ihn weg und klaubte ihre Kleidungsstücke aus dem Heu zusammen. Behende schlüpfte sie hinein und half auch ihm, sich anzukleiden und die verräterischen Strohhalme aus Hemd und Haar zu entfernen. »Dein Meister vermisst dich bestimmt schon. Auch Meister Johann wird nicht gerade erfreut darüber sein, dass ich mich den ganzen Morgen noch nicht habe blicken lassen. Dabei habe ich ihm versprochen, beim Anrühren neuer Salben zu helfen. Wenn es zum Gefecht kommt, müssen wir auf alles vorbereitet sein.«
»Meine tapfere kleine Wundärztin! Wie brav du immerzu an deine Pflichten denkst.« Sanft versetzte er ihr einen Nasenstüber. »Ich male mir lieber nicht aus, wie fürsorglich du all die Verletzten behandelst und wie zart du ihnen die Salben auf die Wunden streichst. Nur zu gern wäre ich auch mal einer deiner Patienten. Dann müsstest du mich mit sehr viel Hingabe gesund pflegen.« Seine Finger liebkosten ihr spitzes Gesicht, fuhren die Bögen ihrer hohen Wangenknochen nach.
»Wünsch dir das lieber nicht! Oder hast du schon vergessen, wie viele uns unter der Hand wegsterben? Von all den Toten nach einer missglückten Operation ganz zu schweigen.«
»Meister Johann und dir sagt man Zauberhände nach. Es muss lange her sein, dass euch beiden ein Patient gestorben ist. Überall in Armee und Tross erzählt man sich eure Wundertaten.«
»Es ist beileibe kein Zuckerschlecken. Von ganzem Herzen wünsche ich mir, dich nie als Patienten vor mir liegen zu haben. Dich zu pflegen geht auf andere Weise sehr viel besser.« Von neuem schlang sie die Arme um ihn und küsste ihn. Widerstandslos ließ er es geschehen, dann aber unterbrach er ihre Zärtlichkeiten und sah sie mit ernster Miene an.
»Viel lieber wäre mir etwas ganz anderes.« Entschlossen umfassten seine Hände ihr spitzes Kinn. Seine blauen Augen versanken in ihren grünen. Es war ihr, als könne er bis auf den Boden ihres Innersten blicken, jedes Geheimnis tief in ihr aufspüren. »Tag und Nacht will ich mit dir zusammen sein, offen und ehrlich mein Leben mit dir verbringen. Wir müssen endlich einen Weg finden, uns nicht mehr heimlich treffen zu müssen. Ich liebe dich, und alle Welt soll das wissen!«
Ehe sie sich versah, nahm er sie hoch und wirbelte sie ungestüm über den Scheunenboden. Die Balken ächzten unter seinen tänzelnden Schritten. Schon geriet er ins Straucheln und ließ sie mitten ins Stroh fallen. Sie kreischte vor Freude auf und balgte noch ein wenig mit ihm herum. Dann aber wurde sie wieder ernst. »Lass gut sein, Eric. Wenn uns jemand hört und hier oben zusammen findet, gibt es nur Ärger.« Bei diesen Worten spürte sie wieder diesen eigenartigen Stich in der Brust, den sie stets empfand, wenn ihr bewusst wurde, wie erbittert sich ihre Familie gegen ihn stellte. »Du weißt, dass es nicht geht.«
Sie senkte den Blick und versuchte, die düsteren Erinnerungen zu verdrängen. Schon damals, als Eric sie aus Magdeburg hinausgeführt und dem Vater zurückgebracht hatte, war dessen feindliche Haltung offenbar geworden. Seither hatte der Vater alles darangesetzt, ihn aus ihrem Umfeld zu verbannen. Warum, hatte er ihr nie erklärt. Wüsste er, dass sie sich längst wieder getroffen hatten und ein Liebespaar geworden waren, geriete er außer sich vor Zorn.
»Wie vernünftig du sein kannst.« Bedauernd küsste Eric sie in den Nacken, spielte abermals mit ihrem Haar. Sein Blick glitt in weite Fernen, bis er sich auf einmal kerzengerade aufrichtete und sie voller Unternehmungslust an den Schultern packte: »Lass uns weggehen von hier, weit weg von Heer und Tross und all dem erbärmlichen Kriegsgemetzel. Irgendwohin, wo es keine Rolle spielt, dass du eine Söldnertochter und ich ein heimatloser Geselle bin. Wo uns keiner kennt und keiner etwas gegen unsere Liebe hat.«
»Weggehen?« Unwillig schüttelte sie seine Hände ab. »Wohin? Wie stellst du dir das vor? Dieses erbärmliche Kriegsgemetzel, wie du es nennst, ist alles, was ich kenne. Es ist mein Zuhause. Damit lebe ich, dafür lebe ich. Schließlich bin ich Wundärztin.«
»Als Feldscherin oder Wundärztin findest du jederzeit auch anderswo dein Auskommen. Verletzte und Kranke gibt es überall, selbst jenseits der Schlachten, und das mehr, als dir lieb sein kann.«
»Die gehen aber wohl kaum zu einer Frau, um Hilfe zu erhalten, noch weniger zu einer wie mir, die sie nicht kennen. Dir wird es als Zimmermannsgeselle nicht anders ergehen. Oder denkst du, in einer fremden Stadt oder einem unbekannten Dorf wird man uns mit offenen Armen empfangen? Niemand will uns haben. Söldnerkinder sind wir beide, verlottertes Volk, heimatloses Gesindel, marodierendes Pack. Das gilt für mich ebenso wie für dich, auch wenn du das nicht wahrhaben willst.«
»Das stimmt doch nicht. Wir haben ein ehrbares Handwerk erlernt. Außerdem gibt es noch die eine oder andere Verbindung meiner verstorbenen Eltern. Vielleicht hilft uns einer der alten Freunde weiter, irgendwo Fuß zu fassen.«
»Hat dir einer dieser angeblichen Freunde deiner Eltern in den letzten Jahren jemals geholfen? Hat dir jemand beigestanden, nachdem du bei der Magdeburger Hochzeit alles verloren hast? Komm, Eric, vergiss diese Träumerei. Im Tross liegt unsere Zukunft, hier können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir werden gewiss einen Weg finden, dass wir unsere Liebe bald offen zeigen können.« Zärtlich legte sie ihm die Hand auf die Wange. Er hauchte einen Kuss auf ihre Finger.
»Im Tross werden wir keine gemeinsame Zukunft haben. Das weißt du genauso gut wie ich.« In seiner Stimme schwang Bitterkeit mit.
»Es ist das einzige Leben, das ich führen kann.« Sie spürte, wie die plötzlich aufsteigenden Tränen das Sprechen erschwerten. »Oder glaubst du im Ernst, du kannst mich auf Dauer in ein Haus einsperren, an den Herd ketten und mir ein Kind nach dem anderen machen, während du dich munter draußen herumtreibst?«
»Dich unglücklich zu sehen, ist das Letzte, was ich will.« Seine Worte rührten sie. Gebannt wartete sie, ob er noch mehr sagen würde. Als er schwieg, wandte sie sich ab und ging zur Leiter.
»Warte.« Hastig kam Eric ihr hinterher. Dabei nestelte er etwas aus den Tiefen seiner Hosentaschen und ließ es dicht vor ihrer Nasenspitze baumeln. Ihr wurde heiß vor Scham, als sie erkannte, was es war: der kostbare Bernstein, den er ihr in Magdeburg geschenkt hatte. Sie musste ihn verloren haben, als sie sich im Heu gebalgt hatten – und sie hatte es nicht einmal gemerkt! Eric hielt das kostbare Stück noch ein Stückchen höher, mitten in die warmen Sonnenstrahlen, die durch die Luke im Giebel fielen.
»Du musst besser auf ihn aufpassen«, sagte er und knüpfte ihr behutsam das ledernde Band um den Hals. »Der Stein ist das Einzige, was mir von meiner Familie geblieben ist. Du bist damit alles, was ich jetzt noch habe. Ich liebe dich, Magdalena, für immer und ewig.«
Ihm versagte die Stimme. Wieder fielen sie einander in die Arme und verharrten fest ineinander verschlungen. Als sie sich endlich von ihm löste, nahm sie den honigfarbenen Stein in die Hand und betrachtete ihn versonnen. Noch immer streckte das schwarze Insekt darin seine Glieder aus, für alle Ewigkeit in der Bewegung erstarrt. Behutsam umfasste sie das kostbare Stück und presste es fest gegen die Brust. In Zukunft würde sie besser darauf achten. Eric hatte recht: Der Stein war mehr als ein Talisman. Er war das Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit, ihrer ewigen Liebe, ganz gleich, was noch kommen mochte. Ein warmer Strahl durchlief ihren Körper, ließ sie die Kraft fühlen, die ihr der Stein spendete. Vorsichtig versenkte sie ihn wieder an seinem gewohnten Platz, der warmen, tiefen Spalte zwischen ihren Brüsten. Dann hob sie den Kopf und sah Eric in die tiefgründigen Augen. »Auch ich liebe dich, Eric. Mein ganzes Leben will ich an deiner Seite verbringen. Nichts soll uns je voneinander trennen. Das schwöre ich dir!«
2
Kurz darauf eilte Magdalena aus dem Quartier der Zimmerleute Richtung Münster. Von dem kleinen Zwist mit Eric über ihre gemeinsame Zukunft schwirrte ihr der Kopf, andererseits fühlte sie sich von tiefer Liebe zu ihm durchströmt. Es musste eine Lösung geben, dass sie miteinander leben und beide ihre Zukunftsträume verwirklichen konnten! Als sie um die nächste Hausecke bog, stolperte sie über ein Ferkel, dem eine Frau hinterherjagte. Sicher hatte sie das Tier gerade günstig erstanden, um es für den nächsten Winter zu mästen. Seit dem letzten Winterlager im badischen Durlach war Freiburg die erste Stadt, in der sich das kurfürstlich bayerische Heer unter Mercy nebst zugehörigem Tross für längere Zeit aufhielt. Jeder nutzte die Verschnaufpause, sich mit Vorräten einzudecken und frisch Erbeutetes bei den Händlern und Kaufleuten in bare Münze umzuwandeln.
Die Belagerung der Stadt hatte erstaunlich wenig Kraft gekostet. Nach der Kapitulation hatte man die Franzosen wohlgemut mit klingendem Spiel und fliehenden Fahnen abziehen lassen und sich anschließend umso gieriger an die Plünderung gemacht. Trotz der sechsjährigen französischen Besatzung hatten die Freiburger einiges an Hausrat und Vorräten gehortet, was sich einzuverleiben lohnte. Entsprechend vielfältig war das Angebot, das sich nun auf dem Münsterplatz und überall in den Straßen und Gassen der Stadt fand. Nicht nur Marketender hatten ihre Stände aufgeschlagen. So manches Trossweib und sogar Söldner boten ihre frisch erworbenen Schätze feil.
Laut pries einer mehrere dicke Stapel feinsten Papiers an, die er wohl aus einer Druckerei entwendet hatte. Ein anderer versuchte, kupferne Kochtöpfe und Pfannen zu Geld zu machen, blitzblank gewienert, kaum verbeult oder von Ruß geschwärzt. Neben ihm wartete eine Frau in Magdalenas Alter mit allerlei Schuhen und Schusterflickzeug auf, was sogleich eine Handvoll Interessenten anzog. Mit Kennermiene prüften sie die Qualität der Sohlen und Leisten. Eine andere versuchte es mit einem saftigen Schinken und einem halben Dutzend Würsten, die sie sich um den Hals geschlungen hatte. Der Duft nach frisch Geräuchertem war zwar äußerst verführerisch, der Preis aber, den sie dafür verlangte, verdarb nicht nur Magdalena gleich wieder den Appetit. Noch war die Frau guter Dinge, dass sie dennoch bald auf ihre Kosten kommen würde.
An einer Kiste mit Büchern blieb Magdalena stehen. Vielleicht fand sie darin ein Werk über Heilkunde, das sie noch nicht kannte. Der Händler bemerkte ihr Interesse und verfolgte argwöhnisch, wie sie sich über die Buchrücken beugte und die Titel las. Dabei fiel sein Blick in den Ausschnitt ihres Mieders. Rasch legte sie die Hand darauf, damit er den Bernstein nicht entdeckte.
»Suchst du was Bestimmtes?« Offensichtlich hatte er den Stein unter dem Mieder nicht entdeckt, sondern eine andere Art der Bezahlung im Sinn. Er leckte sich mit der Zunge über die Lippen und rückte dicht an sie heran. Sein Atem roch faulig, und aufs Waschen verzichtete er wohl gern zugunsten eines Trinkgelages.
»Hab nichts gefunden. Danke.« Rasch drehte sie sich um und mischte sich abermals in das Gewühl. Gerade trieb ein Junge eine Handvoll magerer Ziegen vorbei, die aufgeregt meckerten, als Magdalena sie ungeduldig beiseiteschob. Kurz darauf stieß sie gegen eine Frau, die an einer Hauswand kauerte und ein Huhn rupfte. Ein kleines Mädchen zu ihren Füßen versuchte, die Federn in ein Leinensäckchen einzusammeln. Als Magdalena ihm ausweichen wollte, schlitterte sie über das glitschige Straßenpflaster. Der heftige Gewitterschauer vom Tag zuvor hatte selbst mitten in der Stadt seine Spuren hinterlassen. Das Pflaster glänzte im Schatten noch immer nass, sofern es zwischen dem angeschwemmten Unrat überhaupt zu erahnen war. Die Stadtbäche, die Freiburg durchzogen, quollen über von schlammigem Wasser. Wo der Boden nicht gepflastert war, standen selbst jetzt noch tiefe Pfützen. Der sonst festgestampfte Lehm war vielerorts aufgeweicht. Jenseits des Walls wälzte die Dreisam endlose braune, schäumende Fluten vorbei.
Ungern malte Magdalena sich aus, wie es in den windigen Unterständen und Planwagen des Lagers außerhalb der Stadttore an diesem Vormittag zugehen mochte. Inzwischen brannte die Sonne zwar wieder vom Himmel und trocknete, was der Regen gestern durchweicht hatte. Dafür aber schürte die Hitze den Durst. Wohl dem, der ein schattiges, kühles Plätzchen fand und Gelegenheit hatte, seinen Durst zu stillen! Sauberes Trinkwasser würde schnell knapp werden. Schon sah sie vor sich, wie viele Durchfallpatienten demnächst bei ihr um Hilfe anstehen würden. Über diesen Gedanken wuchs die Vorfreude auf den Brunnen im Hof der Apotheke, in der Meister Johann derzeit logierte. Dort würde sie sich gleich ungestört erfrischen können. Das mehrstöckige, schmale Eckhaus befand sich in einer ruhigen Straße südlich des Münsters. Dank des Reichtums seines eigentlichen Besitzers wies es außer dem sauberen Brunnen im Hof noch vielerlei weiteren Komfort auf.
Bevor Magdalena die Offizin trat, betrachtete sie prüfend ihr Gesicht im frisch polierten Glas der Eingangstür. Die roten Locken steckte sie fester unter das helle Kopftuch. Ihre schmalen, eng beieinanderliegenden Augen wirkten leicht verquollen, ein Tribut an die lange Nacht mit Eric. Katzenaugen nannte er sie zärtlich, was sowohl die ungewöhnliche Form als auch die hervorragende Sehkraft bestens beschrieb. Das spitze Kinn war leicht gerötet, wie so oft, wenn sie direkt mit Heu in Berührung kam. Das fiel bei den Temperaturen aber gewiss nicht auf. Insgesamt konnte sie zufrieden sein mit ihrem Spiegelbild. Die Linien ihres Gesichts waren ebenmäßig. Zart, wie es war, wirkte es dennoch offen und unterstrich den neugierig der Welt zugewandten Blick. Mochten die Bürgerlichen in den Städten das rote Haar und die grünen Augen mit Argwohn betrachten, in Regiment und Tross erregte sie damit keinerlei Aufsehen. Dort lebten Rothaarige und Blonde, Weißhäutige und Dunkle, Kroaten wie Dänen, selbst Katholische und Protestantische friedlich mit dem ursprünglichen Kern der Pappenheimerschen zusammen. Letztlich kämpften sie alle für denselben Herrn: den Kaiser.
Sie befeuchtete die schmalen Lippen, damit sie richtig glänzten, und schob die Lederschnur des kostbaren Bernsteins unter den Stoff ihres Mieders. Schwungvoll drehte sie sich einmal um die eigene Achse, dass sich der weite Rock aus buntbedrucktem Kattun, den ihr der Vater vor wenigen Tagen geschenkt hatte, lustig aufbauschte. Zweifelsohne handelte es sich um ein Beutestück aus den Truhen des wohlhabenden Kaufmanns, in dessen prächtigem Haus die Eltern untergekommen waren. Stolz streckte sie die Fußspitzen unter dem Saum hervor. Auch ihre kleinen, schmalen Füße konnten sich sehen lassen, steckten sie doch in ebenfalls neuen, rotgefärbten Lederschuhen. In der Kammer der Apothekergattin war sie gestern erst darauf gestoßen. Noch waren sie vorn nicht abgestoßen, sondern lediglich staubig. Rasch polierte sie die Spitzen mit einem Rockzipfel glatt. Gutgelaunt sprang sie die drei Stufen zur Tür nach oben und drückte die Klinke.
Die Glocke tönte hell, als sie den Verkaufsraum betrat. Sogleich umfing sie der erfrischende Duft von Minze. Sie brauchte einen Moment, um sich an das düstere Licht in der Offizin zu gewöhnen. Blinzelnd glitt ihr Blick über den Raum. Büschel frischer Minze hingen zum Trocknen an einer Stange vor einem dunklen Eichenregal. Darauf reihten sich große, mit Pergament verschlossene Tonkrüge sowie bauchige Schraubgläser. Sorgfältig beschriftete Schilder wiesen auf getrocknete Blätter sowohl von heimischen wie auch von exotischen Heilpflanzen aus fernen Gefilden.
Die Tür zum angrenzenden Laboratorium öffnete sich, und der eigentliche Hausbesitzer, ein hagerer Mann mit einer schlohweißen Haarmähne, trat heraus. Müde schlurfte er zum Tresen, der sich wie ein mächtiger Riegel quer durch die gesamte Breite des Raumes spannte.
»Euer Meister ist nicht da. Lediglich Rupprecht ist hinten im Laboratorium und geht mir mit den Salben zur Hand.«
»Wo ist Meister Johann denn hin?« Ohne ihm viel Beachtung zu schenken, wollte sie sich an ihm vorbeidrängen, um zu erkunden, was Rupprecht, der zweite Feldschergehilfe, trieb. Hoffentlich hatte Meister Johann nicht sein Versprechen gebrochen und ihm das Rezept für seine berühmte Wundersalbe verraten.
Der blasse Apotheker versperrte ihr den Weg. »Wo wird er schon sein? Wahrscheinlich beim Würfeln oder Kartenspielen. Euer Vater hat ihn gerufen. Die beiden zechen doch wohl gern miteinander.« Sein Tonfall ließ keinen Zweifel, wie liederlich er dieses Verhalten fand. Kaum merklich schüttelte er den Kopf. »Dabei macht er eigentlich einen ganz soliden Eindruck. Zum ersten Mal hatte ich bei eurem Auftauchen das Gefühl, all meine Schätze hier«, seine Arme kreisten durch die Luft, um das gesamte Inventar der Offizin zu umfassen, »fielen endlich einmal den Richtigen in die Hände. Gestern Nachmittag noch haben wir Schulter an Schulter im Laboratorium die verschiedensten Mixturen ausprobiert. Wir könnten viel voneinander lernen.«
Die Augen hinter den runden Brillengläsern blickten traurig. Abermals schüttelte er das Haupt. Magdalena fühlte sich bemüßigt, ihn zu beruhigen: »Macht Euch keine Sorgen. Bei Meister Johann sind Eure Vorräte an Kräutern und Pigmenten wirklich bestens aufgehoben. Hat er Euch nicht schon vorgeführt, wie viele verschiedene Wundpflaster er herzustellen weiß? Soweit ich mich erinnere, wart Ihr ganz begeistert, weil Ihr sie noch nicht alle kanntet.«
»Ja, ja«, murmelte der Weißhaarige, schien aber nicht restlos überzeugt. Sie legte ihm die Hand auf den Arm und fügte hinzu: »Auch mit den fertigen Tinkturen und Rezepturen weiß er etwas anzufangen. Außerdem reißt er die Gerätschaften und Waagen, all die Tiegel, marmornen Mörser und die sündhaft teuren Destilliergefäße ganz gewiss nicht einfach an sich, um sie beim nächsten Marketender schnell zu Geld zu machen. Das wird er alles für seine Feldscherei verwenden und auch uns Gehilfen stets zu einem sorgfältigen Umgang damit anhalten. Verlasst Euch darauf.«
»Derzeit sieht der sorgfältige Umgang wohl eher so aus, dass er sich mit meinen Apparaturen Schnaps brennen wird, den er abends mit seinen Kumpanen versäuft. Meine Bestände an Aquavit und die Kisten mit dem Konfekt hat er sich jedenfalls schon einverleibt, um in seiner Kartenrunde Eindruck zu schinden. Ach, ihr Trossleute seid doch alle gleich. Wie konnte ich nur ernsthaft glauben, Meister Johann wäre eine Ausnahme?«
Noch bevor Magdalena einen weiteren Versuch zur Ehrenrettung ihres Lehrmeisters unternehmen konnte, wurden sie unterbrochen.
»Magdalena, endlich!« Unwirsch schob sich Rupprecht aus dem Laboratorium nach vorn in die Offizin. Die wendige, sehr kleine Gestalt, die Magdalena kaum überragte, ließ ihn neben dem weißhaarigen Apotheker wie einen unbedarften Lehrjungen wirken. Sie wusste, wie sehr er unter seiner wenig eindrucksvollen Erscheinung litt. Wie sie zählte er bereits achtzehn Jahre und arbeitete ebenfalls als ausgelernter Wundarztgehilfe bei Meister Johann. Da man ihm das allerdings nicht ansah und ihn deshalb nicht sehr respektvoll behandelte, war er oft übel gelaunt. Auch jetzt schien er nicht gerade gut aufgelegt. »Dein Vater sucht dich. Komm mit!«
Als er sie zur Tür drängte, stieß er gegen einen Korb mit Lavendel, der vor ihm auf dem Tresen stand. Im letzten Moment konnte Magdalena ihn auffangen und verhindern, dass sich die getrockneten Rispen über den Boden ergossen. Rupprecht quittierte das nicht einmal mit einem Lächeln. Seine schwarzen Locken wippten, als er ruckartig den Kopf hob und sie in seine finsteren, nahezu schwarzen Augen schauen ließ. Trotz seines Ärgers schimmerte Sorge darin. Er streckte die Hand mit den dunkelbehaarten Fingern nach ihr aus, hielt aber auf halber Höhe inne.
»Was ist denn los?« Ungeduldig sah sie ihn an.
»Mach schnell«, sagte er leise.
»Ist was mit meiner Mutter oder mit …?« Fritzchen, hatte sie sagen wollen, wagte es aber nicht, den Namen ihres wenige Wochen alten Bruders auszusprechen: Es durfte einfach nicht sein, dass schon wieder ein Kind ihrer Eltern so kurz nach der Geburt starb! Ihr schwindelte. Dabei hatte es so gut ausgesehen. Eine leichte, rasche Geburt war es gewesen während des Marsches von Überlingen in den Breisgau, ohne alle Schwierigkeiten, fast, als wäre es nichts, so ein Bündel Mensch lebend aus sich herauszupressen. Selbst Roswitha, die alte Hebamme und Vertraute Meister Johanns, hatte das hinterher gemeint.
Rupprecht nickte nur, während er sie aus der Offizin zog. Auch im Freien gewährte er ihr keinen Moment, sich zu fassen. Rücksichtslos eilte er ihr durch das Gewimmel unweit des Münsters voraus. Die Angst legte sich wie ein schwerer Umhang aus Blei auf ihre Schultern. Jeder Schritt schien ihr wie ein gewaltiger Kraftakt, trotzdem hatte sie rasch zu ihm aufgeschlossen. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Was war nur mit dem Kleinen? Hatte die Mutter ihm vor lauter Liebe und Fürsorge Schlechtes getan? Ihn zu fest gedrückt, zu warm in Kissen gepackt, zu eng gewickelt? Nur zu gut erinnerte sie sich an sein verzweifeltes Keuchen, weil ihm beim Trinken an Babettes prallem Busen die Luft weggeblieben war. Wie oft hatte sie in den letzten Tagen deswegen mit der Mutter gestritten! All ihre Vorwürfe und Ratschläge hatte Babette jedoch unwirsch zurückgewiesen. Mit ihren vierzig Jahren war sie schließlich keine unbedarfte Wöchnerin. Mehr als ein Dutzend Geburten hatte sie hinter sich. Lediglich Magdalena, ihr erstes und damals noch uneheliches Kind, hatte überlebt. Kein Wunder, dass Fritzchen, inzwischen immerhin schon sechs Wochen alt, neue Hoffnungen geweckt hatte. Meinte es das Schicksal so schlecht mit ihr, dass es ihr diesen Wunsch wieder zunichtemachen wollte?
»Beeil dich!« Energisch fasste Rupprecht Magdalena am Arm.
»Ich tue, was ich kann.« Sie keuchte. Die Seiten schmerzten, ihr wurde schwindlig vor Anstrengung, aber sicherlich auch vor Angst.
Rupprecht gab nichts auf ihren Zustand. »Meister Johann und Roswitha sind schon lange bei deinen Eltern. Überall haben wir dich gesucht, aber du warst nirgends zu finden. Hast wohl wieder was Besseres zu tun gehabt, was?«
Ein seltsamer Blick streifte sie. Plötzlich ahnte sie, dass er wusste, wo sie gesteckt hatte.
»Warum bist du nicht gekommen und hast mich geholt?«
»Hättest du das wirklich gewollt?« Noch bevor sie etwas erwidern konnte, fügte er hinzu: »Ist dir eigentlich klar, was das für deine Eltern bedeutet?«
In seiner Frage schwang mehr mit als nur Sorge um ihre Eltern. Er war doch nicht etwa eifersüchtig? Abrupt blieb sie stehen, zwang ihn, ebenfalls innezuhalten. Prüfend musterte sie ihn. Ja, das war es: Er konnte es selbst nicht ertragen, dass sie sich mit Eric traf! Wie hatte sie die ganze Zeit nur so blind sein können? Viel zu sehr war sie in den letzten Tagen mit Eric beschäftigt gewesen. Deshalb waren ihr wohl die Veränderungen bei Rupprecht entgangen. Nein, sie musste ehrlich mit sich sein: Sie hatte es nicht sehen wollen. Immerhin war er seit Kindertagen ihr Gefährte. Niemand war ihr so vertraut, nicht einmal Eric. Darüber aber sollte sie nicht jetzt nachdenken, da es um das Leben ihres kleinen Bruders ging. Sie gab sich einen Ruck. »Geh zurück und lass mich allein. Das ist meine Familie, nicht deine.«
Verblüfft starrte er sie an. Sie wartete seine Reaktion nicht ab, sondern verschwand um die nächste Ecke. Bis sie das Haus des Kaufmanns erreichte, in dem ihre Eltern logierten, wagte sie es nicht, sich umzudrehen. Dennoch war sie sicher, dass Rupprecht ihr nicht folgte.
Eine gespenstische Ruhe empfing sie in der kühlen Diele des mehrstöckigen Anwesens vis-à-vis der Martinskirche. Außer Atem stürmte sie die Treppen in den ersten Stock hinauf, wo ihre Mutter im weitläufigen Schlafgemach der ursprünglichen Hausbesitzergattin residierte. Gerade streckte sie die Hand nach der Türklinke aus, da ertönte ein Schrei. Verwirrt schoss sie herum.
»Wo kommst du jetzt her?« Wie aus dem Nichts stand Elsbeth vor ihr und verstellte ihr den Weg.
Im düsteren Flur war es zwar angenehm kühl, dennoch spürte Magdalena, wie ihr die Hitze ins Gesicht stieg. »Was schleichst du dich hier herum? Warum bist du nicht drinnen bei Babette und dem Kleinen?«
»Das fragst ausgerechnet du?« Kerzengerade richtete sich die Cousine auf, verschränkte die Arme vor der Brust und blickte von oben auf sie herab. Sie war gut einen Kopf größer als Magdalena. Die wasserblauen Augen funkelten zornig im dämmrigen Licht. Energisch warf sie das lange blonde Haar zurück, das sie wie immer offen trug. Ihrer einnehmenden Schönheit war sie sich sehr bewusst. »Warum stehst du nicht selbst längst am Krankenbett deiner Mutter und tust alles, um deinem kleinen Bruder das Leben zu retten? Das wäre doch eher die Aufgabe der Tochter als der Nichte, noch dazu, wenn das verehrte Fräulein Tochter Wundärztin ist, eine allseits hochgepriesene mit angeblichen Zauberhänden noch dazu!«
»Lass mich durch!« Magdalena wollte sie beiseiteschieben, doch sie war nicht stark genug und musste abwarten, bis Elsbeth den Weg freigab. Dazu war diese aber nicht bereit.
»Eins lass dir gesagt sein«, hob sie an, »du bist keineswegs die Bessere von uns beiden. Nur weil ich die Tochter von Babettes verstorbener Schwester bin und vor meinem prügelnden Stiefvater bei euch Zuflucht gesucht habe, musst du mich nicht behandeln wie eine Leibeigene.« Ihre Stimme ging in ein wütendes Zischen über: »Statt dich mit zwielichtigen Schurken wie diesem Eric im Stroh zu wälzen, hättest du heute Nacht lieber hier sein und der armen Babette helfen sollen. Vielleicht wäre es dann gar nicht erst so weit gekommen mit dem Kleinen. Aber du hattest ja wieder Besseres im Sinn als das Wohl deiner Familie. Du denkst immer nur an dich.«
»Halt endlich die Klappe und lass mich vorbei!« Magdalena gab sich alle Mühe, ihre Stimme fest klingen zu lassen. Doch sie hörte selbst, wie sehr man ihr das schlechte Gewissen anmerkte.
Die Cousine kostete das in vollen Zügen aus. »So viel Undank hat deine arme Mutter wirklich nicht verdient. Glaub mir, eins weiß sie genau: Wenn ihr jetzt auch dieser Sohn im Kindbett verreckt, trägst du allein die Schuld daran.«
»Du bist wohl die Letzte, die das entscheiden kann. Noch ist gar nicht klar, was ihm fehlt und ob man überhaupt etwas für ihn tun kann.«
»Ob man jetzt noch was für ihn tun kann, solltest du eher sagen.« Elsbeth stemmte die Hände in die Hüften. »So wie es aussieht, hätte man ihm in den ersten Stunden nämlich noch ganz sicher helfen können. Dein Meister Johann und die alte Roswitha, auf deren Hebammenkünste du so gern schwörst, haben das beide sofort gesagt.«
Magdalena schnappte nach Luft. Am liebsten hätte sie sich auf die Cousine gestürzt und ihr die Augen ausgekratzt. Insgeheim musste sie ihr jedoch recht geben. Schon den ganzen Weg über hatte sie sich mit ähnlichen Vorwürfen gequält: Wäre sie letzte Nacht bei Babette geblieben, statt in Erics Arme zu sinken, hätte sie Fritzchen wohl vor Schlimmem bewahren können. Sämtliche Mahnungen zum Beispiel wegen der vielen Federkissen, die Babette auf den Kleinen türmte, hatte sie als bloße Eifersucht ihrer Tochter gedeutet. Kein Wunder also, dass Magdalena nach einem neuerlichen Streit verärgert weggestürmt war.
Bei all der Lust und Wonne, die sie bei Eric gefunden hatte, war ihr die Sorge um den Bruder völlig entfallen. Hätte sie nicht eine Nacht darauf verzichten können?, fragte sie sich bangen Herzens. Noch dazu, da sie sich dann den Streit mit Eric über ihrer beider Zukunft erspart hätte. Hätte, immerzu dieses quälende »hätte«– es half nichts: Für Vorwürfe war es zu spät. Sie musste zu ihrem Bruder. Eine vage Hoffnung, ihn zu retten, gab es vielleicht noch.
3
Als Magdalena das Schlafgemach betrat, empfing sie unheilverkündende Stille. Die dicken, roten Vorhänge vor den beiden Fenstern waren fest zugezogen und verwandelten das einfallende Sonnenlicht in ein geheimnisvolles Glühen. Gespenstisch zuckte der Lichtschein flackernder Kerzen über die Silhouetten der Anwesenden. Klopfenden Herzens trat Magdalena näher. Auf ihr Räuspern erfolgte keine Reaktion. Sacht berührte sie Roswitha, deren halbkahler Schädel auf dem krummen Buckel sich deutlich von den anderen Umrissen abhob, an der Schulter. Die alte Hebamme fuhr zusammen, bevor sie sich umwandte. Dabei schwankte ihr gedrungener Körper beträchtlich. Das Schnaufen verriet, dass ihr selbst diese kleine Anstrengung Mühe bereitete. Trotz dieser Schwerfälligkeit entfaltete die langgediente Wehmutter im Notfall eine Wendigkeit, von der manch Jüngere nur träumen konnte. Bittend sah Magdalena auf sie hinunter. Roswitha war der einzige erwachsene Mensch, den sie kannte, der ihr nur bis zur Schulter reichte. Der Blick, den sie ihr aus den wässrigen, trüben Augen zuwarf, war nicht eben freundlich, doch das musste nichts heißen. Selten sah Roswitha jemanden sonderlich erfreut oder gar liebenswürdig an. Ihre Zuneigung pflegte sie auf andere Art zu zeigen. Außerdem erschwerten die vielen Falten, die Mimik des runden Mondgesichts zu erkennen.
»Was?« Das heisere Krächzen aus dem kleinen Mund mit den überraschend guten Zähnen zu hören beruhigte Magdalena. Es klang nicht anders als sonst. Schnaubend machte die Hebamme Platz, damit sie an das Bett treten konnte. Nach einem flüchtigen Blick in die Runde erkannte Magdalena neben der gedrungenen Gestalt ihres Vaters die beeindruckende Figur Meister Johanns sowie überraschenderweise auch den massig wirkenden Hagen Seume, seines Zeichens Regimentsprofos und zweiter Taufpate ihres Bruders. Seiner Position entsprechend war Seume auch jetzt feudal gekleidet. Golden flimmerten die Tressen am Rock, bunte Litzen zierten das helle Wams. Ein so hoher Besuch am Krankenbett war kein gutes Zeichen, wenn auch die Mienen der Männer abweisend, aber nicht sonderlich traurig schienen. Vorsichtig linste sie zu dem eigentlichen Patienten, von dem zunächst kaum mehr als ein dunkelbehaartes Köpfchen zu erkennen war. Friedlich schlummerte er in den Armen der Mutter, und die lag hellwach in der prall aufgebauschten Spitzenbettwäsche der vor wenigen Tagen davongejagten Kaufmannsgattin. Babettes kastanienbraunes Haar fiel locker auf die Schultern herab. Ein blütenweißes Leinennachthemd, sicherlich ebenfalls aus dem Bestand der Geplünderten, hob sich umso heller davon ab. Ihre Wangen glühten, die Stirn glänzte. Vorwurfsvoll blitzten ihre grünen Augen Magdalena an. Der zierliche Mund spitzte sich bereits, auch das Kinn ragte vorwitzig auf. Noch aber sagte sie nichts. Aufdringlicher Rosen- und Lavendelduft umgab sie. Wie immer hatte sie in ihrem Eifer übertrieben und ein besonders dickes Büschel der getrockneten lila Pflanzenstengel in einem Krug mitten auf dem Nachtkästchen drapiert und eine große Schale Rosenblätter gleich danebengerückt. Nun schien das selbst ihr den Atem zu nehmen. Übertrieben fächelte sie sich mit der freien Hand Luft zu und hüstelte trocken.
»Was willst du?«, fragte sie endlich mit ihrer viel zu schrillen Stimme und schob sich ein Stück höher in die Kissen. »Reichlich spät ist es. Dass du dich überhaupt noch hertraust! Wo hast du dich herumgetrieben, wenn ich als deine Mutter mal bescheiden nachfragen darf?«
Missbilligend glitt ihr Blick über die Tochter. Verlegen zwirbelte Magdalena an einer Locke, ärgerte sich aber im nächsten Moment, dass Babette sie überhaupt verunsicherte. Schon nickte die Mutter dem Vater zu, wie um ihm ein Zeichen zu geben, dass es an ihm war, eine ordentliche Standpauke zu halten. Er aber reagierte nicht. Abermals senkte sich bleiernes Schweigen über die Anwesenden. Unbehaglich rekelte sich der Vater, ein dicklicher Mann Mitte vierzig. Auch wenn er es selbst nicht zugeben wollte, waren ihm die zwei Jahrzehnte, die er unter den Waffen lag, deutlich anzumerken. Die grauen Augen entbehrten jeglichen Glanzes und blickten flatterig in die Welt. Seine fleischigen Finger fuhren über die schlechtrasierten Wangen, wobei der Stumpf des linken Zeigefingers deutlich sichtbar wurde. Erst im letzten November hatte der Vater die Fingerkuppe in der ruhmreichen Schlacht bei Tuttlingen verloren. Magdalena hatte die Wunde versorgt. Sein spitzer Bauch, der sich unter dem Wams abzeichnete, wackelte, weil er statt loszuschimpfen immer unruhiger auf den Fußspitzen wippte. Dankbar suchte Magdalena seinen Blick. Nur zu gut wusste sie, wie sehr ihm an ihr lag. Fritzchen hin oder her – sie war bislang sein einziges Kind geblieben, mit dem er vernünftig sprechen konnte. Auch wenn sie nur ein Mädchen war, hatte sie ihm in den letzten Jahren durch ihre Klugheit und ihr Geschick als Feldscherin so manchen Anlass für eine stolzgeschwellte Brust gegeben. Selbst das Exerzieren hatte sie sich als kleines Mädchen von ihm beibringen lassen. Magdalena meinte, so etwas wie Zustimmung in seinen Augen zu entdecken, gleichzeitig blitzte Traurigkeit darin auf. Ahnte er etwas von ihrer Liebe zu Eric? Wenn sie doch nur wüsste, was ihn so gegen ihn aufbrachte!
Meister Johann sah geflissentlich beiseite, Roswitha schnaubte. Lediglich Hagen Seume tat es der Mutter nach und musterte Magdalena gründlich vom Scheitel bis zur Sohle. Schamlos glotzte er ihr schließlich direkt auf den Busen. Unwillkürlich fasste sie sich ans Mieder und zog es enger zusammen. Daraufhin verzog er den Mund zu einem breiten Grinsen.
Der Vater ging indes noch immer nicht auf Babettes stumme Aufforderung ein. Kurz entschlossen nahm sie es deshalb selbst in die Hand, ihrem Ärger Luft zu verschaffen: »Während du dich offenbar mit einem Burschen im Heu vergnügt hast, ist dein Bruder fast erstickt. Tiefblau angelaufen war der arme Wurm schon. Kaum ein Schnaufen hat er mehr herausgebracht. Zum Glück war deine Cousine da und konnte zu Roswitha und Meister Johann laufen. Elsbeth weiß wenigstens, was sie zu tun hat.«
Im selben Moment trat die Erwähnte auf leisen Sohlen ins Zimmer. Eine leichte Röte überzog ihr engelsgleiches Gesicht, was es umso anziehender machte. Theatralisch streckte Babette die freie Hand nach ihr aus. Nicht weniger eindrucksvoll sank Elsbeth ihr zur Seite nieder und blickte lächelnd auf Fritzchens Köpfchen.
»Verzeih. Das habe ich nicht gewollt«, murmelte Magdalena. Versonnen fuhr Babette Elsbeth durch das offene blonde Haar, eine Geste, zu der sie sich in Magdalenas Gegenwart gern herabließ.
»Keine Sorge«, krächzte Roswitha, »Fritzchen ist schon wieder über den Berg. Die Hitze und das Gewitter gestern haben ihm wohl arg zugesetzt. Außerdem hat er kaum Luft bekommen. Kein Wunder, wenn er in so viele Schichten Spitzen und Leintücher gewickelt ist. Dass er da nicht trinken kann, sich vor lauter Durst aber verschluckt, ist doch klar. Ein paar Lagen weniger um den armen Wurm herum, und schon geht es ihm sichtlich besser.«
Sie schnaubte noch einmal betont, dann wandte sie sich ab, tätschelte Magdalena die Wange und wackelte ohne weiteren Gruß davon. Meister Johann folgte ihr. Als sich die Tür hinter ihnen schloss, hörte man, wie sie draußen im Weggehen ein angeregtes Gespräch begannen. Wie gern wäre Magdalena ihnen gefolgt! Das Gesicht der Mutter aber ließ es ihr angeraten sein, vorerst zu bleiben. Hagen Seume nutzte die Gelegenheit, sich ebenfalls wortreich zu verabschieden. Dabei warf er Magdalena noch einen zweideutigen Blick zu und stolzierte hocherhobenen Hauptes hinaus.
»Ja, also«, sagte der Vater zögerlich und machte Anstalten, ebenfalls das Weite zu suchen. Babette allerdings ließ ihm das nicht durchgehen. »Willst du nicht endlich deiner Tochter sagen, was sich gehört? Oder muss ich wieder alles allein …«
»Reg dicht nicht auf. Das schadet nur dir und dem Kleinen«, sagte der Vater und beugte sich vor, um Fritzchen über das Köpfchen zu streicheln. Das besänftigte die Mutter. Unwillkürlich versetzte sie Elsbeth einen Stups mit dem Ellbogen und schob sie zur Seite. Beleidigt erhob sich die Cousine. Offensichtlich war sie enttäuscht, dass Magdalena ohne die gewünschte Schelte davonkam. Ihnen beiden blieb nichts anderes, als Seite an Seite abzuwarten, bis Babette die vorübergehende Eintracht mit Vater und Sohn wieder löste.
Der Kleine lag mit rosigen Wangen an Babettes üppiger Brust. Zwischen all den Kissen und Decken, die sich weiterhin um ihn türmten, war er kaum zu sehen. Friedlich schlummerte er, während Babette ihn lächelnd betrachtete und der Vater ihn sanft liebkoste. In ihren Augen lag so viel Glück, dass es Elsbeth einen tiefen Stich versetzte. Mit solch einer Liebe war sie noch nie bedacht worden. Wie viel besser mochte das sein als alle hitzigen, rasch verfliegenden Wonnen mit ungestümen Burschen im Heu! In diesem Moment wünschte sie sich nichts sehnlicher, als ein eigenes Kind in Armen zu halten. Das würde ihr endlich die Wärme schenken, die sie bislang vergeblich gesucht hatte. Schon spukte ihr eine Idee durch den Kopf, wie sich dieser Wunsch rasch erfüllen ließe.
Auch Magdalena fühlte sich ausgeschlossen aus der familiären Vertrautheit. Das wollte sie Babette jedoch nicht zeigen. Leise drehte sie sich um und schlich zur Tür. Kaum hatte sie die erreicht, da hörte sie die Mutter rufen: »Nicht so eilig, mein Fräulein! Dein feiner Zimmermann kann ruhig noch ein bisschen warten. Wird ohnehin Zeit, dass er seinem Meister zur Hand geht, statt bei dir zu liegen.«
Boshaft lachte sie, während Magdalena die Wangen zu glühen begannen. Kaum wagte sie, den Vater anzusehen.
»Welcher Zimmermann?«, fragte er tonlos, um gleich, als er Babettes triumphierende Miene sah, nachzusetzen: »Doch nicht etwa …?«
»Genau der!«, fiel Babette ihm ins Wort. »Das hättest du nicht gedacht, dass dein Augenstern mit dem Sohn deines Todfeindes anbändelt, was?«
»Wieso wisst ihr …?« Ein rascher Blick auf Elsbeths befriedigtes Lächeln bestätigte Magdalena den ungeheuren Verdacht: Die Cousine war ihr nachgeschlichen und hatte anschließend nichts Eiligeres zu tun gehabt, als die Mutter über ihre Entdeckung zu unterrichten. Ihre Gedanken überschlugen sich. Wenn ihre Eltern es nun ohnehin schon wussten, war vielleicht endlich die Gelegenheit, nachzufragen, warum sich der Vater so vehement gegen Eric sperrte. Was hatte Babette da eben mit »Sohn deines Todfeindes« gemeint? Waren die Eltern ihr nicht auch eine Erklärung schuldig?
»Das ist nicht wahr, Magdalena, oder?« Eher traurig als wütend sah der Vater sie an. »Sag mir jetzt sofort, dass du nicht mit Eric Grohnert zusammen bist.«
Beim Aussprechen des Namens zitterte seine Stimme. Wie die Mutter es vorhergesehen hatte, machte ihm weniger die Tatsache zu schaffen, dass sie sich körperlichen Freuden hingab, als vielmehr die Erkenntnis, mit wem sie es trieb. Der Triumph, einen Keil zwischen Vater und Tochter zu treiben, sollte Babette nicht auch noch gegönnt sein! Sanft berührte Magdalena seinen Arm.
»Was ist mit dir und Erics Vater?«, fragte sie vorsichtig. »Seit dreizehn Jahren ist er tot. Sein Sohn hat mir damals in Magdeburg das Leben gerettet. Warum kann dich diese selbstlose Heldentat nicht für ihn gewinnen?«
»Das sind uralte Geschichten.« Der Vater wich ihr aus. Ohne sie noch einmal anzusehen, stellte er sich ans Fenster, schob mit der Hand die Vorhänge auseinander, so dass ein gleißender Sonnenstrahl hereinfiel, und starrte blicklos nach draußen. »Darüber will ich nicht mehr reden. Eins jedoch musst du wissen: Dieser Eric bringt dir Unglück, seine ganze Familie bringt Unglück. Am eigenen Leib haben ich und die Meinen das erfahren müssen.«
»Warum willst du mir nicht endlich sagen, was damals geschehen ist? Was hat Erics Vater dir und deiner Familie angetan?« Magdalena bebte am ganzen Körper, konnte ihre Stimme kaum beherrschen. Der Vater schüttelte nur den Kopf.
Erst als Babette hörbar die Luft einzog, um sich in das Gespräch einzuschalten, sprach er endlich weiter: »Alles haben sie uns genommen. Sogar meinen Bruder. Tot ist er, weil Erics Vater ihn vernichtet hat. An dem Kummer sind am Ende auch meine Eltern zugrunde gegangen. Deshalb habe ich es in der Heimat nicht mehr ausgehalten und bin fort, ganz weit fort. Bis ich mich in Ulm von den Pappenheimerschen habe anwerben lassen und da endlich auch mein Glück an der Seite deiner Mutter gefunden habe.«
Langsam wandte er sich wieder um und sah sie offen an, während Elsbeth und Babette gebannt vom Bett aus zuhörten. »Versuch, Eric Grohnert zu vergessen, mein Kind. Das ist das Beste für uns alle.«
4
Am Abend des folgenden Tages verließ Rupprecht das Haus des Apothekers und brach zu seinem üblichen Rundgang durch die Stadt auf. Die rot verglühende Sonne warf bereits lange Schatten auf das Pflaster, und ein sanfter Wind strich durch die aufgeheizten Häuserschluchten. Nach dem heftigen Gewitter vor zwei Tagen war das Wasser in den kleinen Kanälen endlich abgeflossen. Die Pflastersteine und Lehmböden waren dank der Hitze längst wieder trocken, und der strenge Unratgeruch war verflogen. Von den Wasseradern inmitten der Stadt ging endlich wieder wohltuende Erfrischung aus.