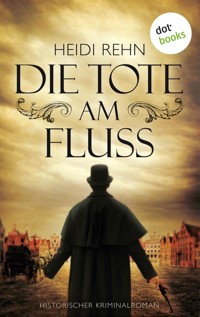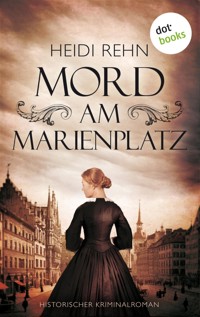9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Emil Graf
- Sprache: Deutsch
Die Unschuld der Täter.
München, 1946. In einer Siedlung am Nordrand der Stadt wird die Leiche einer Frau gefunden. Am Tatort begegnet Mordermittler Emil Graf ausgerechnet der jungen Reporterin Billa Löwenfeld, die mit ihrer neuen Reportage Licht ins Dunkel der Verbrechen der Nationalsozialisten bringen will. Im Zuge ihrer Recherchen macht sie den ehemaligen Blockwart der Siedlung ausfindig. Nur widerwillig räumt er ein, dass seine Frau spurlos verschwunden ist. Billa und Emil suchen nach weiteren Hinweisen und kommen einem Geheimnis auf die Spur, das sie bis in die Keller des Hauses der Kunst – Hitlers vormaligen „Kunsttempel“ – führt ...
Ein hervorragend recherchierter Kriminalroman über die Frage, welchen Preis die eigene Unschuld hat
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Fotoreporterin Billa Löwenfeld ist während der Recherchen zu ihrer neuen Reportage in einer „Reichskleinsiedlung“ am Münchner Stadtrand unterwegs. Knapp ein Jahr nach Kriegsende wollen die Bewohner einen Schlussstrich unter die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit ziehen, doch Billa setzt alles daran, dass die Vergehen der Nationalsozialisten nicht totgeschwiegen werden. Als eine Frauenleiche gefunden wird, übernimmt der junge Kriminalkommissar Emil Graf die Ermittlungen. Billa findet heraus, dass der ehemalige Blockwart der Siedlung seit Tagen seine Frau vermisst, und sie spürt, dass er belastende Informationen zurückhält. Sie verstrickt sich immer tiefer in die Ermittlungen, nicht ahnend, welcher Gefahr sie sich aussetzt ...
Über Heidi Rehn
Heidi Rehn, geboren 1966, studierte Germanistik und Geschichte in München. Seit vielen Jahren schreibt sie hauptberuflich. In München bietet sie literarische Spaziergänge „Auf den Spuren von …“ zu den Schauplätzen ihrer Romane an, bei denen das fiktive Geschehen eindrucksvoll mit der Historie verbunden wird. Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane „Die Tochter des Zauberers – Erika Mann und ihre Flucht ins Leben“ sowie „Das doppelte Gesicht“, der Auftakt der Krimireihe um Emil Graf und Billa Löwenfeld erschienen. Mehr zur Autorin unter www.heidi-rehn.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Heidi Rehn
Die letzte Schuld
Ein Fall für Emil Graf
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Prolog — Mittwoch, 17. April 1946
Kapitel 1 — Mittwoch, 24. April 1946
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6 — Donnerstag, 25. April 1946
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13 — Freitag, 26. April 1946
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20 — Samstag, 27. April 1946
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26 — Sonntag, 28. April 1946 Nürnberg
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog — Dienstag, 30. April 1946
Nachbemerkung
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
»Wer das, was schön war, vergißt, wird böse.
Wer das, was schlimm war, vergißt, wird dumm.«
Erich Kästner, In memoriam memoriae
Prolog
Mittwoch, 17. April 1946
Da ging etwas gründlich schief. Das erkannte Korbinian Loibl selbst aus der Ferne. Dabei konnte er von seinem Versteck aus kein einziges Wort von dem hören, worüber sich die drei Männer vorn an der Weggabelung unterhielten. Einzig, dass sie Deutsch miteinander sprachen, stand wohl fest. Sonst würde sein Freund, Ignaz Niedermeier, der eine der drei, kaum so lange mit den beiden anderen reden. Er konnte kein Englisch.
Auf seine Worte hin wurden die zwei zunehmend wütender. Immer erregter liefen sie auf und ab, fuchtelten bald wild mit den Armen durch die Luft.
Sie trugen dunkle Lederkluft. Im schwindenden Licht konnte Korbinian ihre Gesichter nicht sehen.
Offenkundig wollte Ignaz sich die Behandlung nicht gefallen lassen. Bedrohlich plusterte er sich vor ihnen auf, stemmte die Hände in die Seiten und reckte den Kopf geradezu trotzig nach oben.
Daraufhin umkreisten die beiden Unbekannten ihn enger. Der eine von ihnen war gut einen Kopf größer als Ignaz, und seine Bewegungen wirkten dank seiner athletischen Figur besonders beeindruckend. Jetzt stellte er sich so nah vor Ignaz, dass sie einander fast berührten. Selbst auf die Entfernung stach Korbinian das auffallend eckige Kinn des Mannes ins Auge. Der zweite bezog in Ignaz’ Rücken Position und schlug ihm mit einer sehr schwungvollen Handbewegung den Hut vom Kopf.
Plötzlich zog der Athlet etwas aus der Brustinnentasche, aber nur so weit, dass Ignaz einen Blick darauf werfen konnte. Ein Messer oder gar eine Pistole? Leider konnte Korbinian das von seiner Position aus nicht genauer erkennen. Ignaz dafür umso besser. Ihm genügte der Anblick, um erschrocken zurückzuweichen.
Ausgerechnet der! Korbinian schnaubte entrüstet. Vor ihm markierte Ignaz gern den starken Mann. Ihn jetzt einmal so unterwürfig zu erleben erfüllte Korbinian mit einem Anflug von Genugtuung. Dennoch haderte er mit sich, ob er nicht besser eingreifen und Ignaz helfen sollte. Andererseits: Was würde er in seiner gegenwärtigen Verfassung schon gegen zwei so übermächtige Gegner wie diese beiden da vorn ausrichten können? Selbst wenn Ignaz dank seines Einschreitens neuen Mut schöpfte und sich selbst noch einmal aufbäumte, machte das die offensichtliche Überlegenheit der beiden anderen kaum wett. Wahrscheinlich waren sie zudem bewaffnet.
Korbinian überlegte. Währenddessen bedrohten die Männer Ignaz weiter. Doch Korbinian war sich sicher, dass sie ihn nicht töten würden. Zumindest noch nicht. Vorerst brauchten sie ihn noch, um die Geschichte weiter durchzuziehen. Also blieb Korbinian in seinem Versteck hinterm Baum und verfolgte von dort aus, was noch geschah.
Zweifellos würde die Begegnung Konsequenzen haben. Nicht nur für Ignaz, sondern auch für ihn. Zu tief steckte er mit drin, wenn auch alles andere als freiwillig. Ignaz hatte ihn in der Hand. Seit Jahren schon. Und ließ ihm keine andere Wahl, als weiter mitzumachen. Für immer und in Ewigkeit. Wie eine Marionette.
Er wischte sich über die schweißnasse Stirn. Nein! Er hielt inne. Damit war es vorbei. Die Stunde Null war längst angebrochen, schon seit fast einem Jahr. Damit waren endlich neue Zeiten da. Für alle. Auch für ihn, und für sein Verhältnis zu Ignaz. Es mochte vielleicht noch nicht ganz vorbei sein, doch er konnte ihm zumindest sagen, dass Schluss war mit diesen Geschichten. Dass sie jetzt besser aufhörten, bevor sie in etwas hineinschlitterten, dem sie nicht gewachsen waren. Weil es mehr als eine Nummer zu groß für sie war. Wie man gerade sehen konnte. Sie sollten die Finger davon lassen. So schnell wie möglich.
Ein Ruck ging durch Korbinians schmächtigen, noch immer ausgezehrten Leib. Lang vermisste Zuversicht erfüllte ihn. Sobald die Männer weg waren, würde er mit Ignaz reden, um ihn zur Vernunft zu bringen. Ignaz war auf ihn angewiesen. Ohne ihn konnte er nichts ausrichten. Das verlieh Korbinian neue Kraft. Er streckte den Rücken durch und sah wieder zu den drei Männern an der Wegkreuzung hinüber.
Der Größere der beiden Fremden verpasste Ignaz einen kräftigen Kinnhaken. Rücklings kippte er um. Während der Zweite das Motorrad startete, das nur wenige Meter entfernt stand, sah der Erste von oben auf Ignaz herunter und trat ihm mit dem Stiefel noch einmal heftig in die Eingeweide. Vor Schmerz krümmte sich Ignaz im Dreck. Der Mann sprang in den anrollenden Beiwagen, und das Gefährt brauste mit aufheulendem Motor davon.
Flach presste Korbinian sich gegen den Baumstamm. Hielt die Luft an, als könnte ihn jetzt doch noch ein Atemzug verraten. Im Stillen begann er zu zählen. Gelangte bis zwanzig. Dann atmete er tief durch.
Es war vorbei.
Eine trügerische Stille legte sich über die einsame Wegkreuzung oberhalb der Hirschau im Münchner Norden. Korbinian vernahm den kehligen Lockruf einer Amsel. Im Unterholz knackte es. Ein Eichhörnchen schoss aus dem Gestrüpp und hielt mitten auf dem Weg in Habachtstellung inne, bevor es nahezu lautlos den nächsten Baumstamm emporhuschte.
Erleichtert schnaufte Korbinian auf. Natürlich hatte er sich viel zu weit weg befunden, um je ernsthaft in Gefahr zu geraten. Außerdem hatte er schon vorhin, als er Ignaz zu dem Treffen im Gehölz gefolgt war, strikt darauf geachtet, nicht entdeckt zu werden. Wenn er eins in den letzten Jahren gelernt hatte, dann war es, sich unsichtbar zu machen. Das hatte ihm im Lager in den entscheidenden Momenten das Leben gerettet.
Mühsam rappelte Ignaz sich vom Boden auf, hob die geballten Fäuste über den Kopf und brüllte vor Wut laut auf.
Korbinian zuckte zusammen. Idiot! Die tiefe Bassstimme röhrte durch den nächtlichen Wald wie das Gebrüll eines brunftigen Hirschs. Wären die Zeiten andere, würde es Korbinian nicht wundern, wenn der Schrei Rotwild anlockte. So bestand nur die Möglichkeit, damit übles Gesindel aufzuscheuchen. Ein einzelner Mann bei heraufziehender Dunkelheit allein auf weiter Flur – das war ein gefundenes Fressen für das Geschwerl jeglicher Couleur, das seit Kriegsende vor knapp einem Jahr in der Stadt und vor allem in ihren nördlichen Außenbezirken sein Unwesen trieb, dem allmählich besser ausgebauten Polizeiapparat und den strengen Patrouillen der amerikanischen Besatzungsmacht zum Trotz.
Zu allem Überfluss hob Ignaz jetzt auch noch einen großen Stein vom Boden auf und schleuderte ihn unter neuerlichem Gebrüll dem längst in der Ferne verschwundenen Motorradgespann nach. Korbinian musste ihn zur Besinnung bringen, bevor er weitere Dummheiten beging.
Kurz entschlossen gab er die Deckung auf und eilte von hinten auf den einige Jahre älteren, aufgrund der Umstände allerdings weitaus kräftigeren Mann zu. Er packte ihn an den Schultern, riss ihn mit aller Kraft herum und rüttelte an ihm.
»Lass gut sein! Richtest jetzt eh nichts mehr aus gegen die.«
»Korbinian, du?«
Ungläubig starrte Ignaz ihn aus den bernsteinfarbenen Augen an. Die hohen Wangenknochen verliehen seinem Gesicht eindrucksvolle Kanten. Er brauchte offenbar einen Moment, bis er vollends begriff, wen er vor sich hatte und was Korbinians Worte bedeuteten. Wahrscheinlich steckte ihm der Schreck noch zu tief in den Knochen. Nur äußerst langsam sickerte die Erkenntnis in sein Hirn. Korbinian konnte es wie auf einer Kinoleinwand in Zeitlupe verfolgen.
»Aufhören sollten wir mit den Geschäften.« Korbinian ließ ihn los. »Eine Nummer zu groß ist das für uns. Mit solchen wie denen ist nicht gut Kirschen essen. Wir beide sind denen nicht …«
Er kam nicht mehr dazu, den Satz zu beenden. Im nächsten Moment dröhnte Ignaz abermals los und stürzte sich auf ihn, begann blindlings mit beiden Fäusten auf ihn einzudreschen.
Von der Wucht des Angriffs, aber auch, weil ihn die letzten Jahre nicht nur Gewicht, sondern auch die vertraute Boxerschlagfertigkeit wie Behändigkeit gekostet hatten, ging er zu Boden und zog Ignaz mit nach unten. Schon presste dessen Gewicht ihm die Luft ab. Voller Verzweiflung versuchte Korbinian, sich dem weitaus Kräftigeren und durch die bessere Position klar im Vorteil Befindlichen durch eine abrupte Drehung zu entwinden. Als das misslang, probierte er es mit schnellen Bewegungen mal nach rechts, mal nach links, denn Ignaz war trotz allem schwerfälliger und im direkten Kampf weniger geübt als er. Gelernt war eben gelernt, auch wenn seine letzten Wettkämpfe über zehn Jahre und eine schier unendliche, grausame Lagerhaft zurücklagen.
Fast hatte er es geschafft. Ignaz keuchte vor Anstrengung. Sein Gesicht färbte sich dunkelrot. Kein Zweifel, das war er nicht gewohnt. Die Adern an seinen Schläfen schwollen an.
Korbinian schöpfte neuen Mut. Offenkundig wusste Ignaz nicht mehr, wie er den unter sich heftig hin und her Zappelnden packen sollte.
Gerade wollte er ihn von sich stoßen, da bemerkte er entsetzt, dass Ignaz einen großen, spitzen Stein in der rechten Hand hielt und damit weit ausholte. Wo und wann hatte er den gegriffen?
Der Film auf der Leinwand wechselte von neuem in die Zeitlupe, dieses Mal allerdings in Korbinians eigenem Kopf. Ganz langsam rieselte das Bevorstehende in sein Bewusstsein. Wenn Ignaz jetzt mit dem Stein zuschlug, von oben auf seinen Schädel eindrosch, mit der ganzen Wut und der enormen Wucht, die er in sich hatte, dann war es vorbei. Dann war er nur noch Matsch und Brei.
Eine ungeheure Angst überfiel ihn. Hatte er dafür überlebt? Hatte er sich dafür all die Jahre über die tiefsten Abgründe menschlichen Seins gerettet, mehr als einmal wider besseres Wissen die eigene Menschlichkeit verdrängt? War er dafür durch die Hölle gegangen und noch einmal zurück, nur um jetzt im Wald bei Freimann, kaum eine halbe Stunde Fußweg von Grete und den Kindern entfernt, sein schmähliches Ende zu finden? Ausgerechnet durch Ignaz, dem er schon seit so viel mehr Jahren ausgeliefert war? Der schon so lange vor dem Sieg von Hitler und seinen braunen Schergen sein Schicksal bestimmt hatte. Und der nach dessen Untergang und der vorgeblichen Befreiung durch die US Army gleich schon wieder auf den Plan getreten war, um ihn von neuem in die Zange zu nehmen. Der ihn schon so oft ans Messer hätte liefern können und es dann doch nie getan hatte, weil er ihm lebendig so viel nützlicher war als tot. Daran hatte sich doch auch jetzt nichts geändert.
Ein fürchterlicher Schrei gellte durch den Wald.
Für einen Moment wurde es totenstill.
Dann setzte das Rufen der Amsel wieder ein.
1
Mittwoch, 24. April 1946
Die frühlingshafte Szenerie war berauschend. Und das am nördlichen Stadtrand Münchens, der eigentlich von grauen Fabriken, trutzigen Kasernen und furchterregenden ehemaligen Zwangsarbeiterlagern geprägt war. Binnen weniger Hundert Meter gelangte man von dort allerdings bereits in eine friedlich anmutende Kleinbürgeridylle mit winzigen, hell getünchten, sauberen Häusern in umso größeren, sorgsam gepflegten Gärten.
Eine ganze Herde Schäfchenwolken tupfte weiße Flecken an den tiefblauen Himmel darüber, warmes Sonnenlicht umschmeichelte das frische Grün auf den Wiesen. Gelb, rot, blau, violett – in allen nur denkbaren Farben leuchteten die Blüten auf. Ausgelassen tobten Kinder darüber, trampelten auf der Jagd nach einem zerfledderten Lederball mit ihren groben Holzsandalen jeden Grashalm erbarmungslos nieder, tanzten unwillkürlich Ringelreihen oder pflückten bunte Blumensträuße. Die meisten der Kleinen schätzte Billa auf sechs bis höchstens zehn Jahre.
Für den Bruchteil einer Sekunde dröhnte Marschmusik in ihren Ohren, überlagerte das muntere Gebrumm der Insekten und das unbeschwerte Singen der glockenhellen Kinderstimmen. Sie schreckte zusammen. Plötzlich sah sie die Mädchen und Jungen in gestärkten hellen Blusen und kurzen Röcken oder hellbraunen Uniformen mit roten Binden am Arm im Gleichschritt vorbeimarschieren, die rechte Hand zum fatalen Gruß erhoben, die linke eng an die Flanke gepresst und die Augen starr geradeaus auf einen imaginären Feind gerichtet. Ihr wurde angst und bange. Sie hatten es nicht anders gekannt. Sie waren zu jung, um sich an andere Zeiten zu erinnern.
Nein! Energisch zwang sich Billa, die düsteren Bilder aus ihrem Kopf zu verscheuchen. Die Kinder waren zum Glück jung genug, um sich binnen eines Jahres auf Besseres zu besinnen und Neues als scheinbar schon immer vertraut anzunehmen. Fragte sie eines von ihnen, wusste es gewiss kaum mehr, wie es gewesen war, als endlose Kolonnen von zu Skeletten abgemagerten Zwangsarbeitern aus den benachbarten Lagern wie Vieh durch die breiten Siedlungsstraßen zum BMW-Werk getrieben worden oder mit Bomben beladene britische und amerikanische Tiefflieger über die Dächer der Häuser zum nahe gelegenen Fluggelände Schleißheim gedonnert waren, um die Militäranlagen in Schutt und Asche zu legen. Und das angrenzende Dorf weitgehend gleich mit. Kinder vergaßen ebenso schnell das Vergangene, wie sie Neues erlernten. Das schenkte Hoffnung.
»Hey, du Traumliesl. Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte Lydia sie auf Englisch und berührte sie sacht am Arm.
»Hast du etwas gesagt?«
Ertappt blieb Billa stehen und hob die flache Hand an die Stirn, um die Augen gegen die Sonne abzuschirmen und der gut einen halben Kopf größeren Kollegin ins Gesicht zu sehen.
Lydia hatte ebenfalls angehalten, zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche, bot ihr eine an und gab ihr Feuer, bevor sie sich selbst eine anzündete. Genüsslich nahm sie einen Zug und ließ dabei ihre strahlend blauen Augen über die etwas kleinere und gut zwölf Jahre jüngere Billa wandern. Ein fürsorgliches Lächeln umspielte ihre knallrot geschminkten Lippen, die im Vergleich zu ihrem sonst eher burschikosen Auftreten überraschend weiblich wirkten.
Billa brauchte einen Moment, um sich darauf zu besinnen, wen sie vor sich hatte. Wie immer trug Lydia die von ihr so geliebte Uniform der offiziell bei der US Army akkreditierten Reporterinnen, die ihre hochgewachsene, athletische Figur wie auch ihren hellen Teint und das weißblonde Haar hervorragend zur Geltung brachte. Quer über der flachen Brust baumelte der Riemen ihrer Fototasche und über der rechten Schulter der ihrer Handtasche, in der sie so wichtige Dinge wie die Zigaretten und das Feuerzeug aufzubewahren pflegte, außerdem eine Brille mit dunklen Gläsern zum Schutz ihrer lichtempfindlichen Augen vor der Sonne. Zudem war Lydia Linkshänderin, weshalb es für sie so wichtig war, Block und Bleistift für ihre Notizen an der rechten Körperseite zu tragen. Im Falle eines Falles hatte sie die schnell griffbereit.
»Natürlich habe ich etwas gesagt«, entrüstete Lydia sich unterdessen, schüttelte allerdings amüsiert den Kopf.
»Ich habe dir gerade vorgeschlagen, dass wir zum Wagen gehen und uns von Sam zurück zur Reportervilla nach Bogenhausen fahren lassen. Dort können wir uns auf die Terrasse setzen, die Füße hochlegen und uns ausruhen. Ich brauche unbedingt eine Erfrischung. Und du siehst aus, als könntest du jetzt auch einen doppelten Whiskey vertragen.«
»Wahrscheinlich reicht ein doppelter gar nicht«, räumte Billa ein. »Ich muss die vielen Eindrücke von heute erst einmal verdauen.«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und stützte die Hand mit der Zigarette auf dem unteren Arm ab.
»Ist es nicht verrückt, was wir gerade erleben? Wie schnell sich die Welt verändert?«, fragte sie, nachdem sie beide gedankenverloren eine Weile geraucht hatten und im Anblick der Umgebung versunken waren. »Kaum ein Jahr nach Kriegsende spazieren wir schon wieder mitten durch eine deutsche Vorstadtsiedlung, die aussieht, als hätte der Krieg nie stattgefunden. Dabei versinkt die Münchner Innenstadt wie viele andere Städte nach wie vor unter einem gewaltigen Trümmerhaufen. Millionen sind noch immer quer durch Europa unterwegs und versuchen, in ihre alte Heimat zurückzukehren oder eine neue zu finden. In diesem Fleckchen Erde aber erinnert nichts mehr an den Schrecken, der hinter uns liegt. Und das kaum eine Handvoll Meilen entfernt von Hitlers unversehrt gebliebenen Prachtbauten, und wenig mehr als einen Steinwurf entfernt vom KZ Dachau.«
Sie pflückte ein weißes Blütenblatt von ihrer weinroten Kostümjacke und richtete den schräg sitzenden Hut auf ihrem maronibraunen, kurz geschnittenen Haar. Im Gegensatz zu Lydia mied sie bei jeder Gelegenheit die offizielle Uniform, die streng genommen auch die Journalistinnen unter der Obhut der US Army tragen sollten.
»Stimmt«, pflichtete Lydia ihr bei. »Es ist wirklich verführerisch, in einer solchen Idylle schnell zu vergessen. Doch wir und die Jungs aus unserer Army sind hier, um genau das zu verhindern und die Verantwortlichen alle zur Rechenschaft zu ziehen.«
Lydia gönnte sich zwei weitere, sehr ausgiebige Züge an ihrer Zigarette.
»Und ebenso die anzuprangern, die dabei mitgemacht haben«, ergänzte Billa. Unwillkürlich reckte sie das Kinn. »Was wir Juden hier vor dem Krieg erlebt haben, war ein Alptraum. Dabei waren wir hier zu Hause, haben uns als Münchnerinnen und Deutsche gefühlt wie alle anderen auch. Wir müssen zurückkommen und dabei helfen, das Unrecht wiedergutzumachen.«
»Leider sehen das nicht alle so. Seit deiner Flucht sind nur knapp acht Jahre vergangen, eine verdammt kurze Zeit. Dir wird noch mancher von damals begegnen, den du vielleicht nie mehr wiedersehen wolltest.«
»Oder der mich nie mehr wiedersehen wollte«, warf Billa betont munter ein.
Von neuem ließ sie ihren Blick über die Umgebung schweifen. Diesen Teil Münchens hatte sie in ihrer Kindheit und Jugend an der Isar nie kennengelernt. Hier würde sie wohl kaum jemandem von früher über den Weg laufen.
Die Straße war nicht geteert, franste an den Seitenrändern in einen Streifen munter wuchernden Unkrauts aus. Die ungewöhnliche Trockenheit des Frühjahrs sorgte für eine zentimeterdicke Staubschicht, die sich gelblich auf Schuhe und Kleidung legte und im leicht verschwitzten Haar und auf der Haut klebte, wenn man sich längere Zeit im Freien aufhielt, so wie Lydia und sie. Oder wie die Frauen mit den bunten Tüchern um den Kopf und den geblümten Kittelkleidern, die sich in den Gärten und Gemüsebeeten zu schaffen machten, die Fenster an den Häusern putzten oder den unartigen Kindern über die Straße hinterherrannten, um sie für den ungeliebten Besuch in der Badewanne einzufangen.
Auf einmal hatte Billa wieder die lange Schlange Wartender bei der Egerländer Schule nur wenige Hundert Meter entfernt vor Augen. Auch die waren alle vom Staub gezeichnet gewesen. In einer ordentlichen Zickzacklinie hatte sich die Schlange über den Schulhof gewunden. Auf dem Giebel des vierstöckigen Gebäudes fand sich unter der Sonnenuhr nach wie vor eine Inschrift in Fraktur, die die 1938 errichtete Schule der »Heimkehr der Sudetenlande ins Deutsche Reich« widmete. Wie viele Jahre es wohl dauerte, bis solche Relikte endgültig aus dem Straßenbild verschwanden?
Die vielen Wartenden waren natürlich nichts Ungewöhnliches. An deren Anblick hatte man sich längst gewöhnt – die in der Schlange Stehenden genauso wie die darüber in alle Welt berichtenden Reporter und die Besatzer der US Army. Seit Monaten harrten die Münchner stundenlang bei Wind und Wetter vor den offiziellen Ausgabestellen der Lebensmittelkarten aus. Ebenso reihten sie sich später widerspruchslos vor den behelfsmäßig instand gesetzten Geschäften ein, um die erstandenen Karten gegen streng rationiertes Brot, Gemüse, Milch, Käse oder mikroskopisch kleine Mengen Fleisch zu tauschen, oder am besten gleich gegen illegal aufgetriebene amerikanische Zigaretten oder andere angebotene Luxusartikel wie Shampoo, Seife, Seidenstrümpfe oder Medikamente.
Das Besondere an der heutigen Schlange war jedoch, dass jeder der darin Wartenden zuerst seinen ausgefüllten Fragebogen mit den berühmten einhunderteinunddreißig Fragen zu seiner jüngsten Vergangenheit abgeben musste, um überhaupt einen gültigen Bezugsschein zu erhalten. Das war das Resultat des Anfang März erlassenen »Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus«, mit dem die endgültige Entnazifizierung der Deutschen in der amerikanischen Besatzungszone in Angriff genommen werden sollte. Entsprechend gereizt war die Stimmung gewesen, trotz des fast schon sommerlichen Wetters, der überraschend hohen Geschwindigkeit, mit der sich die Schlange vom Fleck bewegte, und der Aussicht auf neue Lebensmittelmarken.
»Schon auffallend, wie sich die Leute vorhin über diesen Fragebogen aufgeregt haben«, sagte Lydia, als könnte sie ihre Gedanken lesen.
»Dabei ist er ein guter Garant für den gerechten Neuanfang, den sich alle seit Kriegsende so sehnlich wünschen«, stimmte Billa zu. »Schließlich müssen ihn alle Deutschen gleichermaßen ausfüllen.«
»Zumindest in der amerikanischen Zone«, stellte Lydia klar. Beim Ausatmen pustete sie eine muntere Reihe runder Zigarettenrauchkringel in die Luft. »Die Beantwortung von mehr als einhundert Fragen stellt allerdings eine enorme Herausforderung für jemanden dar, der es nicht gewohnt ist, sich ausführlich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, erst recht nicht mit dem eigenen Verhalten in den letzten zwölf Jahren. Insofern ist es durchaus nachvollziehbar, dass so mancher es als Zumutung empfindet, sich den Besatzungsbehörden gegenüber derart offenbaren zu müssen. Das ist fast, als müsste er sich mitten auf dem Marktplatz nackt ausziehen.«
»Einen Schönheitswettbewerb wird derzeit wohl keiner gewinnen.« Billa versuchte sich in einem müden Lächeln. »Aber irgendwie muss man die Sache in den Griff bekommen. Die Fragebögen garantieren wenigstens dieselbe Chance für alle, Auskunft über ihr Mitwirken bei der Partei und in öffentlichen Ämtern zu geben.«
»Sofern die Fragen ehrlich beantwortet werden. Meist finden gerade diejenigen, die tatsächlich etwas zu verbergen haben, einen Weg, sich erfolgreich durchzuschummeln.«
»Das wird man nie ganz verhindern können«, entgegnete Billa. »Aber zum Glück hat man auch in den letzten zwölf Jahren in Deutschland viel Wert auf Bürokratie gelegt und alles ordentlich dokumentiert, bis in die untersten Ämter und Positionen. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr groß, im Zweifelsfall rasch aufzudecken, wer schummelt und wer nicht. Wer sich tatsächlich nur als kleines Rädchen im Getriebe erweist und keine wirkliche Verantwortung getragen hat, hat nichts zu befürchten. Wer dagegen Zweifel mit seiner Darstellung erregt, der wird sich letztlich vor einer Spruchkammer verantworten müssen.«
»Es war ein kluger Schachzug, die nur mit Deutschen zu besetzen und nicht mit Vertretern der amerikanischen Besatzung. Von Siegerjustiz kann also schwerlich die Rede sein.«
»Auch nicht davon, dass wir Rückkehrer uns zum Richter über die Dagebliebenen aufschwingen, weil auch von uns niemand darin sitzt. Anders, als viele denken, liegt das den meisten von uns sowieso völlig fern.«
Dabei wäre es oft mehr als berechtigt, fügte sie im Stillen hinzu. Sie erinnerte sich an das ein oder andere bekannte Gesicht von früher. Auf einmal hatte sie Erlebnisse vor Augen, die sie sonst nachts aus dem Schlaf aufschreckten. Obwohl sie dank ihrer Mutter und deren Beziehungen lange privilegiert und unbehelligt von den allgemeinen Schikanen in München, der ›Hauptstadt der Bewegung‹, gelebt hatte, war sie froh, bislang den wenigsten Menschen von damals wieder begegnet zu sein. Zu groß war ihre Unsicherheit, wie sie auf sie reagieren würde. Und natürlich umgekehrt auch die auf sie.
»Es muss schlimm sein, im eigenen Land plötzlich als fremd zu gelten. Noch dazu, da du deine Heimat nicht freiwillig verlassen hast.«
Abermals schien Lydia zu ahnen, was gerade in ihr vorging.
»Es ist wirklich paradox«, stimmte Billa zu. »Kaum einer will mir zugestehen, dass das hier nach wie vor mein Zuhause ist. Sobald klar ist, dass ich eine aus dem Exil zurückgekehrte Jüdin bin, fühlt sich jeder erst einmal dazu verpflichtet, mir sein Verhalten in den letzten Jahren zu erklären.«
»Ich sehe schon. Es gibt noch vieles, was wir uns gemeinsam anschauen sollten, um darüber für unsere Leute in Amerika zu berichten.« Lydia gab sich entschlossen. »Die Fragebögen sind nur der Anfang. Die ersten Kommentare haben wir heute gehört. Wenn auch bislang nur sehr vorsichtige. Und nur gegen mindestens eine Handvoll Zigaretten.«
»In den nächsten Tagen trauen sich gewiss schon mehr Leute, endlich Tacheles mit uns zu reden«, wagte Billa zu prophezeien. »Es beschäftigt die meisten doch viel zu sehr, als dass sie auf Dauer dazu schweigen können.«
»Sofern wir bereit sind, mehr als nur ein paar Zigaretten für die Auskünfte springen zu lassen«, bekräftigte Lydia.
»Ich glaube nicht, dass es den Leuten allein darum geht.«
»Bestimmt nicht, aber ein materieller Gegenwert für eine Aussage ist durchaus ein probates Mittel, um die Leute zum Reden zu animieren. Gerade jetzt, da seit Anfang des Monats die ohnehin schon lächerliche Zuteilung für einen Erwachsenen von 1550 Kalorien noch einmal weiter auf nur noch 1275 Kalorien reduziert wurde. Jede einzelne Zigarette bedeutet bares Geld auf dem Schwarzmarkt und dadurch etwas mehr Speck, Butter und Brot auf dem Teller zu Hause.«
Billa sagte nichts mehr dazu. Noch hegte sie die Hoffnung, dass sie auch ohne solche Hilfsmittel Auskünfte erhielten.
»Ist es nicht ein seltsamer Zufall, dass die Fragebögen ausgerechnet von Gründonnerstag bis Karsamstag ausgeteilt wurden und direkt nach den Feiertagen zurückgegeben werden mussten?«, wechselte sie nach einer längeren Pause das Thema. »Im überwiegend katholischen Bayern besitzt Ostern eine ganz besondere Bedeutung. Darauf hätte man Rücksicht nehmen müssen.«
»Viel unglücklicher finde ich, dass das Ganze an die Ausgabe der Bezugsscheine gekoppelt ist«, entgegnete Lydia. »Das suggeriert, ohne richtige Antwort gäbe es kein Essen.«
»Manche behaupten ohnehin schon, die Fragebogenaktion stelle die gesamte deutsche Bevölkerung unter Generalverdacht.«
»Was man durchaus als Ausdruck eines schlechten Gewissens verstehen kann.«
»Das gewiss nicht von ungefähr kommt.«
Mit großer Wucht flammten in Billa erneut Erinnerungen an Erlebnisse vor ihrer Flucht im November 1938 auf. Sogar an solche mit langjährigen Nachbarn und Bekannten, Lehrern, Schulkameradinnen und deren Familien. Sechzehn war sie damals gewesen. Zu jung, um bereits das ganze Ausmaß des Geschehens zu begreifen, aber schon alt genug, um mehr mitzubekommen, als mancher gehofft hatte.
Um die Bilder gleich wieder im Ansatz zu ersticken, warf sie die Zigarette mit Schwung zu Boden und bohrte sie mit der Schuhspitze regelrecht in die Erde.
»Ein doppelter Whiskey ist wirklich das Mindeste, was wir jetzt brauchen.«
Entschlossen hakte sie sich bei Lydia ein und dirigierte sie in die Ecke der Siedlung zurück, in der sie vor einer gefühlten Ewigkeit aus dem Jeep gestiegen waren und ihren Fahrer Sam zurückgelassen hatten. Willig kam Lydia mit.
»Wenn ich mich hier umschaue, kann ich mir gut vorstellen, wie das mit dem Nationalsozialismus in den letzten zwölf Jahren in Deutschland funktioniert hat.«
Mit der freien Hand wies Lydia beim Weitergehen auf die endlose Abfolge weißer Häuschen mit roten Satteldächern, winzigen Sprossenfenstern und aufgeklappten Fensterläden inmitten von weitläufigen Gärten. Das milde Frühlingswetter wurde in jedem Winkel genutzt, um Zäune zu reparieren, Beete zu harken, Wäsche aufzuhängen oder die kleinen Hühner- und Kaninchenställe auszumisten, die sich nahezu an jeder Hauswand fanden.
Irgendwo hatte Billa gelesen, dass die Haltung von Kleintier eine der Voraussetzungen gewesen war, um sich für den Erwerb eines der Siedlungshäuser zu bewerben. Ebenso das Anlegen von Gemüse- und Obstgärten. Selbstversorgung war das oberste Prinzip solcher Anlagen, eine weitsichtige Forderung der früheren Machthaber in Bezug auf Hitlers Kriegspläne. In der aktuellen Lage allerdings auch ein Segen. Dennoch waren die Bewohner ebenso auf die Lebensmittelkarten angewiesen wie die übrige Bevölkerung. Alles konnte man in einem solchen Anwesen eben doch nicht selbst anbauen.
Sie und Lydia schlenderten weiter. Hin und wieder streiften sie die misstrauischen Blicke der Siedlungsbewohner. Zwei Frauen wie sie, die eine in amerikanischer Uniform, die andere im Kostüm, fielen schon von Weitem auf, noch dazu, wenn sie so eng aneinandergeschmiegt rauchend und fröhlich plaudernd über die Straßen flanierten.
»Ein eigenes Heim mit Obst- und Gemüsegarten für ›mustergültige deutsche Familien‹«, knüpfte Lydia an ihre vorherige Bemerkung an. »Sieht ganz so aus, als stünden die Häuser vor Dankbarkeit ähnlich stramm in Reih und Glied, wie die Parteigenossen damals hinter der Hakenkreuzfahne marschiert sind.«
»So habe ich das noch nie gesehen.« Nachdenklich betrachtete Billa die akkurat angelegte Siedlung. »Aber du hast recht. Das hier atmet tatsächlich bis ins kleinste Detail den Geist der autoritären Zeit. Nichts tanzt aus der Reihe, nichts ist dem Zufall überlassen. Jede Linie ist mit dem Lineal gezogen, jeder Winkel exakt angelegt. Und jedes Detail genau festgelegt.«
»Selbst die Blumen in den Beeten scheinen nach einem vorgegebenen Muster gepflanzt und die Obstbäume vorschriftsmäßig geschnitten.« Lydia schmunzelte.
»Es würde einen nicht wundern, wenn abends exakt zur selben Zeit aus jeder Tür jeweils exakt die gleichen Frauen und Kinder herauskämen, um die von der Arbeit heimkommenden Väter zu begrüßen.«
»Natürlich gibt es auch bei uns in Amerika oder sonst wo auf der Welt solche akkurat am Reißbrett entworfenen Vorstadtsiedlungen.«
»Dennoch stößt einem diese hier vor dem Hintergrund der Zeit, in der sie entstanden ist, besonders auf«, entgegnete Billa. »Sie wirkt, als hätte die Partei hier alles unter Kontrolle gehabt, und jeder Einzelne hätte folgsam getan, was von ihm verlangt wurde.«
»Umso erstaunlicher, dass man den Bewohnern trotz des allgegenwärtigen Führerkults eine kleine Kirche zugebilligt hat.« Lydia nickte mit dem Kopf nach rechts vorn, wo ein von einem Walmdach bekrönter Kirchturm über einem lang gestreckten Hallenbau aufragte. Die klobige Form erinnerte an umgefallene Bauklötze. Überhaupt schien ein einfacher Baukasten Pate für die Grundrisse der gesamten Siedlung gestanden zu haben.
»Mich wundert eher, dass die strikt durchgeplante Ordnung die Wirren der letzten Kriegsmonate und das Chaos des ersten Nachkriegsjahres überstanden hat. Und das ohne den geringsten Kratzer. Nicht einmal die Scheiben sind zu Bruch gegangen, geschweige denn dass eine Zaunlatte fehlt oder ein Fensterladen schief hängt.«
»Du meinst, plündernde Horden hätten das alles eigentlich überrennen und blindlings niederbrennen müssen?«
»Sie hätten zumindest die Gemüsebeete zertrampeln, die Obstbäume fällen oder die Hühner und Hasen schlachten müssen«, sagte Billa.
»Vielleicht hat noch die Angst nachgewirkt. Die ehemaligen SS‑Kasernen im Osten wie auch die Luftwaffenstützpunkte Richtung Schleißheim sind nah. Die dort stationierten Truppen haben die Gegend sicherlich bis zuletzt allein durch ihre bloße Anwesenheit in Angst und Schrecken versetzt.«
»Auch das ehemalige ›Judenlager Milbertshofen‹ grenzt gleich im Süden an die Häuser, wie du vorhin bei unserer Ankunft sehen konntest«, gab Billa zu bedenken. »Nachdem man die Juden von dort nach Kaunas in den Tod geschickt hat, waren darin italienische Zwangsarbeiter für das BMW-Werk untergebracht, ebenfalls bestimmt nicht unter sonderlich menschlichen Bedingungen. Die hätten also auch mehr als einen nachvollziehbaren Grund gehabt, um sich nach der Befreiung an den gut bestellten Gärten und den schönen Häuschen mitsamt ihren Bewohnern schadlos zu halten.«
»Stimmt«, pflichtete Lydia bei. »Noch dazu, wo deren Bewohner während des ›Tausendjährigen Reichs‹ vor ihrem Elend pflichtschuldig Augen und Ohren geschlossen haben. Sie haben einfach weggesehen, wenn die Ausgemergelten zu Tausenden tagein, tagaus direkt an ihren Fenstern vorbei zur Arbeit in die Fabriken gepeitscht wurden.«
»Was ich nicht sehen will, das sehe ich einfach nicht.« Billa wurde sarkastisch.
»Jeder zimmert sich eben seine eigene Wirklichkeit zurecht, gerade was die Ereignisse der letzten zwölf Jahre betrifft. Ein allzu menschliches Bedürfnis, wenn du mich fragst.«
»Womit wir wieder beim Thema Rechenschaft und den Fragebögen wären. Und bei der Notwendigkeit, schnellstens an einen doppelten Whiskey zu kommen.«
Einvernehmlich beschleunigten sie ihre Schritte. Das Barackenlager rückte in Sichtweite. Trotz weißblauem Himmel und strahlendem Frühlingssonnenschein bot es einen trostlosen Anblick, der sich beim Gedanken an seine beklemmende Geschichte noch weiter verstärkte. Selbst die sonst so neugierigen Siedlungskinder mieden dessen Nähe, als spürten sie, dass es nach wie vor kein geeigneter Platz für Unbekümmertheit und Unschuld darstellte.
Eine bedrückende Stille hing über den Holzunterkünften. Im Innern mochten sie nach wie vor heillos überfüllt sein. Darauf deuteten das unübersichtliche Gerümpel vor den Türen und die viele zerschlissene Wäsche an den kreuz und quer gespannten Leinen zwischen den Hütten hin. Hinter den trüben Fensterscheiben tauchte ein verängstigtes Kindergesicht auf. Sofort wurde es von einer nicht weniger ängstlich aussehenden Frau weggezogen. Ansonsten war keine Menschenseele zu sehen. Lediglich eine räudige Katze drückte sich zwischen den Baracken herum.
Kaum passierten Billa und Lydia die letzte Straße, die wie fast alle in der Gegend einen böhmischen Ortsnamen trug, entdeckten sie bereits den Jeep mitsamt Billas Lieblingsfahrer Sam. Der Wagen parkte noch an derselben Stelle am südlichen Ende des Lagers, an der sie vor zwei oder drei Stunden ausgestiegen waren. Allerdings stand er dort inzwischen nicht mehr allein. Weitere Fahrzeuge hatten sich am Straßenrand um ihn herum gesammelt, umzingelt von einem größeren Pulk Kinder, die die Wagen von allen Seiten begafften und dabei die von den überwiegend dunkelhäutigen GIs der US Army großzügig verteilten chewing gums voller Wonne schmatzten.
Es waren nicht allein Wagen der amerikanischen Militärpolizei. Auch ein vor Kurzem erst vom Wehrmachtsgrau in sattes Tannengrün umgespritzter Adler der Münchner Schutzpolizei sowie der ebenfalls erst unlängst in Dienst genommene Mercedes der Mordkommission befanden sich darunter, wie Billa beim Näherkommen entdeckte. Offenkundig würde sie an diesem vermeintlich friedvollen Frühlingsnachmittag noch einen weiteren Grund für einen doppelten Whiskey auf der Terrasse der Villa für amerikanische Kriegsreporter in Bogenhausen haben.
2
»Sieht mir ganz danach aus, als gäbe es hier gleich noch eine gute Zeitungsstory aus dem Münchner Norden. Und das exklusiv für uns beide«, rief Lydia geradezu übermütig und lief schneller. »Wenn amerikanische Militär- und Münchner Kriminalpolizei gemeinsam anrücken, muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Wir schlagen wohl genau im richtigen Moment auf, um uns vor allen anderen Kollegen die ersten Informationen zu sichern.«
Ihr journalistischer Jagdinstinkt war geweckt, die Erschöpfung verflogen. Im Weiterlaufen angelte sie in ihrer Tasche bereits nach Notizblock und Stift, rückte auch die Kamera vor ihrer Brust zurecht, um sofort einsatzbereit zu sein. Zielstrebig steuerte sie auf das ehemalige Zwangsarbeiterlager zu, das in dieser Ecke in einer schmalen Brache auslief, die sich bis zum nahen Bahndamm erstreckte. Die Strecke gehörte zum Nordring, der zu Beginn des Jahrhunderts angelegt worden und nahezu ausschließlich Militär- und Güterzügen vorbehalten war, um sowohl die Kasernen als auch die Industrieanlagen in diesem Teil Münchens für den Transportverkehr zu erschließen.
Je schneller Lydia rannte, desto langsamer wurde Billa. Im Gegensatz zu ihr hatte sie es auf einmal nicht mehr eilig, zum Ort des Geschehens zu gelangen. Was weniger daran lag, was sie dort womöglich Schreckliches erwartete, als vielmehr daran, wem sie dabei mit großer Wahrscheinlichkeit begegneten. Bereits aus der Ferne hatte sie eine ihr nur zu vertraute Gestalt unter den Anwesenden erspäht.
So schnell hatte sie ihr Wiedersehen nicht erwartet. Vor allem nicht so unvorbereitet wie in diesem Moment. Und nicht unter diesen Umständen, inmitten von so vielen anderen, die über sie beide Bescheid wussten. Sowie wahrscheinlich ausgerechnet am Fundort einer Leiche.
»Mach jetzt nur nicht schlapp.« Sobald Lydia ihr Zaudern bemerkte, drehte sie sich zu ihr um. Allerdings deutete sie es falsch. »Nach allem, was du in den letzten Monaten gesehen hast, dürfte dich der Anblick eines Toten nicht mehr schockieren. Selbst wenn er unter die Räder eines Zuges gekommen und damit alles andere als appetitlich anzusehen sein sollte. Aber vielleicht entpuppt sich das Ganze auch als völlig harmlos oder als falscher Alarm.«
»Auf einen Toten mehr oder weniger kommt es mir wirklich nicht an.«
Billa hoffte, Lydia bemerkte das Zittern ihrer Stimme nicht. Im letzten Jahr war sie mehr als einmal unfreiwillig an einen Tatort gelangt. Was angesichts der vielen Kapitalverbrechen, die seit Kriegsende in der Stadt geschehen waren, kaum verwunderte. Der Anblick eines gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen entsetzte sie nicht mehr. Einmal war sie sogar diejenige gewesen, die das Mordopfer als Erste gefunden hatte. Die sich daraus entwickelnde Geschichte hätte für sie jedoch beinahe verhängnisvoll geendet und beschäftigte sie bis zum heutigen Tag. Allerdings seltsamerweise weniger deswegen, sondern aus einem völlig anderen Grund. Und genau der stellte auch jetzt die Ursache für ihr Zögern dar.
Als ihre Freundin sollte Lydia ihre Beweggründe kennen. In diesem Augenblick schien sie jedoch keinen einzigen Gedanken daran zu verschwenden.
»Vorsicht, die Damen! Passen Sie auf!«, raunzte sie ein schmächtiger, älterer Mann in Zivil an, der gerade mit einem anderen baumlangen und weitaus jüngeren Kollegen kleine, quadratische Blechschilder mit eingestanzten schwarzen Nummern auf dem Boden verteilte. Offenbar sicherten sie Spuren. Es handelte sich um Ludger Seidl und seinen Assistenten Eberhardt Dollinger. Kurz blitzte in Billa ein Déjà‑vu auf. Die beiden waren vom Erkennungsdienst, dem Kommissariat K 6, dem auch die Kriminaltechnik angegliedert war. Mit ihnen hatte sie es bei der Leiche damals in Nymphenburg auch gleich als Erste zu tun gehabt. Wo sie auftauchten, war etwas geschehen. Mindestens ein mysteriöser Unfall, noch wahrscheinlicher jedoch ein Verbrechen.
Sie schienen sie allerdings nicht wiederzuerkennen. Seidl würdigte sie nicht einmal eines Blickes, Dollinger hielt zumindest inne und betrachtete sie aufmerksam. Deutlich war ihm anzumerken, wie es dabei hinter seiner hohen Stirn arbeitete.
»Billa Löwenfeld«, erlöste sie ihn aus der Grübelei und streckte ihm die Hand entgegen. »Wir sind uns bereits einige Male begegnet. Ich bin Fotoreporterin. Und das ist meine Kollegin, Lydia Persson.«
»Sie schon wieder. Ich erinnere mich. Der Tote in der Villa in Nymphenburg letzten Sommer. Der Auftakt einer ziemlich üblen Geschichte«, schaltete Seidl sich nicht sonderlich freundlich ein und drängte Dollinger beiseite, um ihre Hand zu schütteln. Lydia gegenüber lupfte er nur kurz den eingedellten Hut auf dem fast kahlen Schädel.
»Tatorte scheinen Sie immer noch anzuziehen, sonst wären Sie jetzt wohl nicht hier. Doch freuen Sie sich nicht zu früh. Inzwischen ist unsere Ausrüstung entscheidend besser geworden. Dieses Mal haben wir selbst einen Film für die Kamera dabei. Auf Ihre Hilfe sind wir bei unserer Arbeit nicht mehr angewiesen.«
Wie eine Trophäe hielt er die kleine Ledertasche hoch, die er an einem brüchigen Lederriemen quer über den Leib trug.
»Was tun Sie hier? Unbefugte haben den Tatort unverzüglich zu verlassen«, ertönte eine weitere Männerstimme.
Auch die erkannte Billa sofort. Sie wandte sich in die Richtung, aus der sie die Stimme vernommen hatte. Ihr Herz begann zu rasen. Dabei hatte sie sich doch eben schon ausgemalt, was ihr bevorstand, und sich darauf vorbereitet, einen zumindest ansatzweise gelassenen Eindruck zu erwecken.
»Billa, du?« Emil Graf erreichte sie. Und starrte sie mindestens genauso perplex an wie sie ihn.
Im ersten Moment kam ihr kein einziges Wort mehr über die Lippen.
Er sah noch genauso gut aus wie im letzten Jahr, wenn nicht sogar besser, fiel ihr stattdessen auf. Mit dem kleinen Unterschied, dass er inzwischen einen hellen, tadellos sitzenden leichten Anzug nebst passendem Hut und weißem Hemd trug, was seine groß gewachsene, schlaksige Gestalt vorteilhaft unterstrich. Ebenso steckten seine Füße statt in klobigen Winter- in fast schon eleganten Lederschuhen. Ob seine Zimmerwirtin von neuem die Kleiderschränke ihres gefallenen Ehemannes für ihn geplündert hatte? Warum hatte sie ihm den dünnen Anzug nicht letzten Sommer schon überlassen? Mehr als einmal hatte Billa es bedauert, wie sehr Emil damals in seinem Winterzeug unter der sengenden Augusthitze gelitten hatte.
War sie verrückt geworden? Hatte sie etwa vergessen, wen sie vor sich hatte und wer noch alles zugegen war? Obendrein, dass sie sich gerade am mutmaßlichen Ort eines Verbrechens befanden? Ihr Gesicht begann zu glühen.
»Was für eine Überraschung!«, mischte Lydia sich ein und erlöste sie aus der Verlegenheit. »Kommissäranwärter Emil Graf vom Kommissariat K1 Verbrechen wider das Leben höchstpersönlich. Schön, Sie wiederzusehen. Wir sind uns im letzten Jahr leider nur kurz begegnet. Wahrscheinlich erinnern Sie sich gar nicht mehr an mich.«
»Doch, natürlich erinnere ich mich an Sie.« Er lächelte sie an. »Sie sind Billas unerschrockene Kollegin Lydia Persson, die seit letztem Herbst jeden Prozesstag in Nürnberg aufmerksam verfolgt und zuvor schon die Landung der Alliierten auf Sizilien und in der Normandie an vorderster Front begleitet hat. Hut ab vor Ihrem Mut!«
»Sie meinen, ich wäre besonders tapfer, weil eine Frau nicht unbedingt an die Front gehört? Dabei bin ich nicht die Einzige, die ganz vorn mit dabei gewesen ist.«
»Wohl eher, weil ich es bewundernswert finde, wie entschlossen Sie als Amerikanerin gegen Hitler und den Faschismus gekämpft haben. Schon einen Teil Ihres Muts hätten wir hier mehr als nötig gehabt.«
»In der Normandie hätten wir uns fast begegnen können.«
»Allerdings auf verschiedenen Seiten der Front. Was leider nicht zu meinen Ruhmestaten zählt.«
»Man sucht sich nicht aus, auf welcher Seite man geboren wird. Wenigstens sind Sie bereit, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich.«
Lydia schenkte ihm ein aufmunterndes Lachen.
Billa beneidete sie um die Unbeschwertheit, mit der sie Emil gegenübertrat. In den Monaten, die sie ihn nicht gesehen hatte, musste ihr die völlig abhandengekommen sein.
»Verrätst du uns, weshalb ihr an diesem wunderschönen Nachmittag in so großer Formation in diese nicht eben sonderlich gemütliche Ecke Münchens ausgerückt seid?«, versuchte sie, ihre Befangenheit zu überspielen und das Augenmerk auf die aktuelle Situation zu lenken. »Wie ich sehe, bist du mit Captain Simon vom Public Safety Office da und nicht mit deinen Kollegen vom K1. Dass Angehörige der Militärpolizei mit dabei sind, wird einen Grund haben. Herkömmliche Morde darf die Münchner Polizei inzwischen doch längst eigenständig aufklären.«
»Wie immer bist du bestens informiert.«
»Das ist mein Job.« Sie erlaubte sich ein Lächeln, was für ein flüchtiges Aufflackern in seinen maronibraunen Augen sorgte. Ermutigt setzte sie nach: »Dann handelt es sich also um einen außergewöhnlichen Fall. Hat er etwas mit dem Flüchtlingslager auf dem Gelände des früheren Judenlagers zu tun? Stammt das Opfer von dort? Oder aus dem Lager für Displaced Persons in Schleißheim? Das liegt ebenfalls in fußläufiger Entfernung und würde die Anwesenheit der amerikanischen Militärpolizei erklären.«
»Kennst du dich in der Gegend aus? Oh stimmt, ich vergaß. Einer unserer Zeugen im letzten Sommer war als ehemaliger ukrainischer Zwangsarbeiter in Schleißheim untergebracht. Deshalb warst du bereits einige Male dort.«
»Lydia und ich recherchieren hier für eine neue Reportage. Deshalb sammeln wir so viele Informationen wie möglich über die Gegebenheiten vor Ort.«
»Wart ihr in den letzten Stunden zufällig in der Gegend unterwegs, habt mit den Leuten hier geredet und dabei vielleicht das ein oder andere aufgeschnappt?«
In seinen Worten schwang eine vorsichtige, aber deutlich herauszuhörende Hoffnung mit. Schon zückte er das ihr wohlvertraute schwarze Notizbuch, das ihm sein Mentor Joe Simon geschenkt hatte und das er wie seinen Augapfel hütete. Sie wunderte sich, dass er darin überhaupt noch leere Blätter fand, so viel, wie er zu notieren pflegte. Vielleicht hatte Joe ihm mittlerweile jedoch ein neues besorgt. Als Angehöriger der Streitkräfte saß er im Gegensatz zu Emil an der Quelle für solche Dinge.
»Du hörst dich an, als könntest du unsere Hilfe gebrauchen.« Billa merkte sogleich, wie sehr sie das insgeheim freute.
»Am besten kommt ihr erst einmal mit.«
Er machte eine einladende Armbewegung. Einen Moment länger als nötig sah er ihr dabei in die Augen. Nur zu gern befolgte sie seinen Vorschlag.
3
Seite an Seite liefen Billa und Emil mit Lydia zu der Gruppe, die sich in einigen Metern Entfernung vor einem Gebüsch am Bahndamm aufhielt. Neben Emils amerikanischem Vorgesetzten, Captain Joe Simon, erkannte Billa den Gerichtsmediziner Ringseisen von der Münchner Kripo. Zwei andere Offiziere des Public Safety Office unterhielten sich mit ihm, Joe hörte ihnen ebenfalls aufmerksam zu. Sobald sie die Männer erreicht hatten, sah er auf und begrüßte sie.
»Wie schön, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen, Billa. Wenn auch wieder unter nicht sonderlich angenehmen Umständen. Zwischenzeitlich waren Sie für längere Zeit zurück in New York, wie ich gehört habe. Bei Gelegenheit müssen Sie mir davon erzählen. Manchmal habe ich großes Heimweh.«
»Als Südstaatler Heimweh nach der Ostküste? Dann ist es schlimm um Sie bestellt.«
Amüsiert beobachtete sie, wie er übertrieben das Gesicht verzog.
»Auch von mir ein besonders herzliches Grüß Gott, Fräulein Löwenfeld.«
Ringseisen nahm sich Zeit für einen galanten Handkuss und lupfte bei der Verbeugung sogar den Hut, wodurch er den Blick auf seinen schütteren grauen Haarkranz und den wulstigen Nacken freigab.
Rasch stellten sich auch die beiden anderen Offiziere sowie Lydia vor. Emil erklärte, warum er sie hinzugebeten hatte.
Wie immer sprachen sie Englisch miteinander. Billa wunderte sich nicht zum ersten Mal, wie gut sogar Ringseisen, der nicht eben nach Weltenbummler aussah und es aufgrund seines fortgeschrittenen Alters wohl auch kaum mehr werden würde, das beherrschte. Emil verdankte es dagegen seinen ausgezeichneten Sprachkenntnissen, dass er im Gefangenenlager in der Normandie für Joe hatte dolmetschen dürfen und so die Chance erhalten hatte, ihn zum Aufbau der neuen Kriminalpolizei nach München zu begleiten.
»Wenn Sie die letzten Stunden mit den Leuten aus der Siedlung zu tun hatten, können Sie uns vielleicht weiterhelfen«, riss Joe Billa aus ihren Gedanken. »Die Tote liegt da vorn.«
»Eine Frau?« Sofort zückte sie Notizblock und Stift.
»Hat Emil das noch nicht erwähnt? Viel mehr können wir bislang leider noch nicht sagen. Doch sehen Sie selbst.«
Er ging zum Gebüsch. Billa und Lydia folgten ihm, auch Emil kam mit. Aus der Ferne protestierte Seidl zwar von neuem dagegen, doch die Markierungen auf dem Boden wie die auf einem Stativ befestigte Kamera ließen darauf schließen, dass die Aufnahme der Spuren in diesem Bereich bereits abgeschlossen war. Ohnehin machte die Szene den Eindruck, als wären die Untersuchungen bereits weitgehend beendet und es wurde lediglich noch auf das Eintreffen des Leichenwagens gewartet, sonst würde Joe sie kaum dorthin führen.
»Entgegen den ersten Mutmaßungen sind wir uns inzwischen relativ sicher, dass sie doch nicht aus dem DP‑Lager in Schleißheim stammt«, berichtete Joe noch im Gehen. »Das Hinzuziehen der Militärpolizei war so gesehen überflüssig. Zunächst hieß es lediglich, eine unbekannte Leiche sei beim Barackenlager in Milbertshofen gefunden worden. Da schrillen bei uns sofort die Alarmglocken. Die Exzesse aus den ersten Monaten nach Kriegsende sind mittlerweile zwar abgeebbt, aber nach wie vor stehen viele Gewaltdelikte in Zusammenhang mit den Flüchtlingen und den Displaced Persons, die sich immer noch in hoher Zahl in der Stadt aufhalten. Nachher schicken wir jemanden ins Lager, der sich dort umhören soll. Vielleicht findet er Zeugen, die etwas Aufschlussreiches bemerkt haben.«
Sie erreichten die Leiche. Ein dunkelblau uniformierter Schandi, wie die Gendarmen der Münchner Schutzpolizei nach wie vor genannt wurden, hielt Wache. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt sah er stur in eine andere Richtung, um so wenig wie möglich von der Leiche mitzubekommen. Die Tote war jedoch nicht unter einen Zug geraten, wie sich zu Billas Erleichterung nach dem ersten Blick auf sie herausstellte.
»Für mich sieht sie sehr ›deutsch‹ aus«, bekannte Joe. Er umrundete die Tote, um sie noch einmal von allen Seiten zu betrachten. »Sie muss seit letzter Nacht hier liegen. Das hat Doktor Ringseisen bereits festgestellt.«
»Er geht davon aus, dass sie gegen Mitternacht getötet wurde. Und zwar genau hier«, ergänzte Emil.
Billa machte sich erste Notizen.
»Wahrscheinlich ist sie mit dem Strick erdrosselt worden«, fuhr Joe fort. »Der Täter muss direkt hinter ihr gestanden haben, wie die Spuren im Gras verraten. Sie kniete mit dem Rücken zu ihm, ihre Hände waren nach hinten gefesselt.«
Das waren sie noch immer, wie sich zeigte.
»Sieht nach Hinrichtung aus«, stellte Emil fest.
»Möglicherweise vor jemand Drittem. Ob er Mittäter oder Zeuge war, wird den entscheidenden Unterschied machen.«
Die brennende Zigarette in der Hand, deutete Joe auf eine Stelle beim Gebüsch, an der das Gras genauso platt getreten war wie am Fundort der Leiche.
Lydia begann zu fotografieren. Offenbar war Joe einverstanden, denn er hinderte sie nicht daran. Emil schwieg.
»Wer hat sie gefunden?«, fragte Billa.
»Die beiden dort drüben.«
Joe wendete den Kopf nach links, wo sich in sicherer Entfernung zum Gebüsch und zu den Offizieren, aber unter strenger Bewachung eines weiteren Schandis ein halbwüchsiges Pärchen ängstlich aneinanderschmiegte. Ihre Gesichter waren noch immer blass, die Augen schreckgeweitet. Billa schätzte sie auf sechzehn, siebzehn, also bestes Backfischalter, und entschied, vorerst auf eine Befragung der beiden zu verzichten. Wahrscheinlich brachten die zwei ohnehin noch kein vernünftiges Wort heraus.
»Die sind geschockt fürs Leben.« Emil klang mitleidig. »Und das, nachdem sie sicherlich schon auf der Flucht Schlimmes erlebt haben. Hier wollten sie jetzt eigentlich ein Schäferstündchen abhalten. Ungestört von lästigen kleinen Geschwistern, viel zu strengen Eltern und der ganzen Bagage, die ständig ein Auge auf sie hat. Sie stammen nämlich aus dem Flüchtlingslager.«
»Sudetendeutsche«, ergänzte Joe auf Deutsch, was dem Wort dank seines starken Akzents Exotik verlieh. »Statt romantischer erster Küsse jetzt also das.«
»Wenigstens waren sie mutig genug, die Polizei zu alarmieren, und sind nicht einfach weggerannt«, betonte Emil.
»Kannten sie die Tote?«, hakte Billa ein.
»Angeblich nicht.«
»Das schließt noch nicht aus, dass sie nicht auch aus dem Lager stammt«, schaltete Joe sich wieder ein. »Dort wohnen derzeit so viele Menschen, außerdem herrscht ein reges Kommen und Gehen, dass kaum einer den Überblick behält, wer dorthin gehört und wer nicht.«
Er trat die Zigarette auf dem Boden aus, verschränkte die Arme vor der Brust und stellte sich breitbeinig hin.
Sein sonnengebräuntes Gesicht mit der Boxernase auf dem kurzen, kräftigen Hals sowie das ausgebleichte Haar und die stahlblauen Augen ließen ihn in dem Moment ganz nach dem zielstrebigen Cop aus Florida aussehen, der er im zivilen Leben vor dem Krieg gewesen sein musste und vor dem kein Ganove sich in Sicherheit hatte wiegen dürfen. Billa widerstand der Versuchung, sich das weiter auszumalen, und wandte sich stattdessen wieder der Leiche zu, betrachtete sie ebenfalls von allen Seiten.
Joe hatte recht. Sie wirkte unverkennbar ›deutsch‹. Sie mochte um die vierzig sein und trug eine lieblose, blaugraue Schürze mit den entsprechenden Spuren von Hausarbeit über einem fadenscheinigen geblümten Kleid, keine Strümpfe. Das strähnige, schlecht frisierte aschblonde Haar und das ungeschminkte Gesicht erweckten den Eindruck, als wäre sie direkt vom Herd, in jedem Fall von ihrem derzeitigen Zuhause, hierher verschleppt worden. Dass sie alles andere als freiwillig mitgekommen war, schien durch die gefesselten Hände festzustehen.