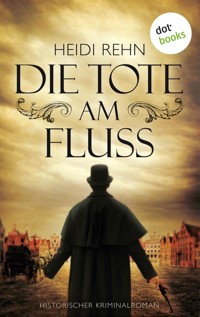9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Emil Graf
- Sprache: Deutsch
München, Stunde null – ein grausames Verbrechen und eine alte Schuld.
München, August 1945. Der Krieg ist zu Ende, die Stadt versinkt im Chaos. Die Reporterin Billa Löwenfeld, eine aus dem Exil zurückgekehrte Jüdin, soll den Kriegsheimkehrer Viktor von Dietlitz interviewen – und findet ihn erschossen auf. Der junge und noch unerfahrene Ermittler Emil Graf soll den vermeintlichen Routinefall aufklären. Schon bald geschehen zwei weitere Morde nach demselben Muster. Und Emil findet heraus, dass ausgerechnet Billa die gesuchte Verbindung zwischen den drei Opfern sein könnte …
Ein hervorragend recherchierter Kriminalroman im München der Nachkriegszeit über die Frage, was einen Menschen zum Täter macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
München, Stunde null – ein grausames Verbrechen und eine alte Schuld.
München, August 1945. Der Krieg ist zu Ende, die Stadt versinkt im Chaos. Die Reporterin Billa Löwenfeld, eine aus dem Exil zurückgekehrte Jüdin, soll den Kriegsheimkehrer Viktor von Dietlitz interviewen – und findet ihn erschossen auf. Der junge und noch unerfahrene Ermittler Emil Graf soll den vermeintlichen Routinefall aufklären. Schon bald geschehen zwei weitere Morde nach demselben Muster. Und Emil findet heraus, dass ausgerechnet Billa die gesuchte Verbindung zwischen den drei Opfern sein könnte …
Ein hervorragend recherchierter Kriminalroman im München der Nachkriegszeit über die Frage, was einen Menschen zum Täter macht
Über Heidi Rehn
Heidi Rehn, geboren 1966, studierte Germanistik und Geschichte in München. Seit vielen Jahren schreibt sie hauptberuflich. In München bietet sie literarische Spaziergänge »Auf den Spuren von …« zu den Themen ihrer Romane an, bei denen das fiktive Geschehen eindrucksvoll mit der Historie verbunden wird. Im Aufbau Taschenbuch ist von ihr der Roman »Die Tochter des Zauberers – Erika Mann und ihre Flucht ins Leben« erschienen.Mehr zur Autorin unter www.heidi-rehn.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Heidi Rehn
Das doppelte Gesicht
Ein Fall für Emil Graf
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Epilog
Nachbemerkung
Impressum
»Es genügt nicht, dass die Zustände anders werden,
sie müssten auch besser werden.«
Hans Habe, Off Limits. Roman der Besatzung Deutschlands
Prolog
Mittwoch, 15. August
Fast war es geschafft. Er konnte es kaum glauben. Wie es aussah, kam er wohl tatsächlich noch einmal davon. Nur noch wenige Tage, und der ganze Schlamassel lag hinter ihm. Dann konnte er endgültig einen Schlussstrich unter alles ziehen. Vergessen und neu beginnen. So wie die anderen.
Lautes Donnern schreckte ihn auf. Die Erde begann zu beben. Er zitterte plötzlich am ganzen Leib. Schweiß trat ihm auf die Stirn, seine Kehle wurde eng. Eine Bombenexplosion! Panisch sah er sich nach einem Versteck um.
In der nächsten Sekunde fuhr ein Blitz über den gelbgrünen Himmel. Das grelle Zucken blendete. Ein zweiter Donner folgte.
Doch nur ein Gewitter. Er atmete auf. Starrte gebannt vom Terrassenfenster in die dunkle Weltuntergangsstimmung nach draußen. Dicke Regentropfen setzten dort gerade zum Trommelfeuer auf die Erde an. In Rekordzeit verwandelte sich der Rasen in eine Kraterlandschaft. Löcher rissen auf, Furchen gruben sich ein. Das schlammige Wasser sammelte sich in knöcheltiefen Pfützen. Die kostbaren englischen Rosen waren ohnehin längst Gemüsebeeten gewichen.
Obwohl das Unwetter dem Garten übel zusetzte, blieb er eine Oase. Deutschland lag in Schutt und Asche, ganze Städte hatten sich in monströse Schutthalden verwandelt, durch die graue, hoffnungslose Schatten als stumme Zeugen des Untergangs geisterten. Unweit des Nymphenburger Schlosses aber war davon nichts zu ahnen. Hier war die Welt noch in Ordnung. Intakte Fensterscheiben in beeindruckend großzügigen Gründerzeitvillen, umgeben von penibel gepflegten Gartengrundstücken, deren wohltuende Ruhe nur gelegentlich vom Kläffen eines Wachhundes oder dem Auftauchen einer Patrouille gestört wurde, zeugten von einem Idyll, das völlig aus der Zeit gefallen schien. Als hätte es den Krieg nicht gegeben. Zumindest nicht hier.
Dass der heutige Mittwoch, Mariä Himmelfahrt, ab sofort wieder ein Feiertag war, passte dazu. Am liebsten würde man nahtlos an das Leben anknüpfen, das vor der jüngsten Epoche gelegen hatte, und komplett vergessen, dass es geradewegs in die Katastrophe geführt hatte. So wollte auch er das handhaben. Das Dazwischen war ausradiert. Restlos. Dafür hatte er soeben die letzten Weichen gestellt.
Er steckte sich eine Zigarre in den Mundwinkel, zündete sie an, zog genüsslich daran und stieß den Rauch in kleinen Kringeln gegen die Scheibe aus. Das Fenster beschlug. Mit der Handkante wischte er es frei. Hässliche Schlieren zeichneten sich darauf ab. Die Pfaffinger sollte besser putzen! Schluss mit Feiertag und dem katholischen Getue. Gleich morgen würde er sie sich zur Brust nehmen.
Noch einmal krachte es draußen markerschütternd. Dieses Mal folgte der Blitz nur Bruchteile von Sekunden später.
Er war in Sicherheit. Nichts konnte ihn jetzt mehr erschrecken. Fröhlich begann er zu pfeifen. Einen Schlager, auf den er unzählige Male getanzt hatte. Auch das würde er bald wieder tun. Im Dreivierteltakt tänzelte er zum Schrank, goss sich einen großzügigen Schluck Weinbrand ein. Mit dem bauchigen Glas in der einen und der dicken Zigarre in der anderen Hand schlenderte er vom Herren- ins angrenzende Wohnzimmer hinüber.
»Auf dich, mein Lieber!«
Amüsiert prostete er einem Porträtfoto zu, das auf dem glänzenden schwarzen Flügel inmitten einer ganzen Batterie von Familienbildern in edelsten Gold- und Silberrahmen stand. Es zeigte einen attraktiven jungen Mann mit fülligem, blondem Haar in Wehrmachtsuniform. Gänzlich unversehrt. Zu mehr als zum Leutnant hatte er es zu seinem Bedauern zwar nicht gebracht, das aber erwies sich jetzt sogar als Vorteil. Die hellen Augen verträumt in unergründliche Ferne gerichtet, um den schmalen Mund ein Anflug von spöttischem Lächeln, dazu die prägnante Kerbe am Kinn, die das untrügliche Erkennungszeichen der ganzen Sippe war. Er wirkte beneidenswert unschuldig. Drei oder höchstens vier Jahre mochte das Foto alt sein, doch es war ihm auf einmal, als läge ein ganzes Zeitalter dazwischen.
Gemächlich durchquerte er das gediegen mit dunklen Lederfauteuils und Kirschholzmöbeln eingerichtete Wohnzimmer, gelangte ins vornehme Esszimmer. Dunkelrote Samtpolsterstühle, weit ausladender Mahagonitisch, schwere Kerzenleuchter auf der Anrichte, feinstes Porzellan in der Vitrine, kostbarer Kristalllüster an der Decke.
Das Gewitter entfernte sich. Das Donnern wurde leiser, die Blitze schwächer. Ihr Licht reichte dennoch, um die Details in Augenschein zu nehmen. Kaum zu glauben, dass er die Wohnung derart intakt vorgefunden hatte. Wer den Zustand der Münchner Innenstadt kannte, von den Plünderungen der letzten Kriegstage wusste, musste ein solches Ambiente für reine Halluzination halten. Kein Glas war zersprungen, nicht ein Teller zerschlagen, kein Silberlöffel entwendet. Selbst die Teppiche lagen noch da, wo sie hingehörten, und die Gemälde hingen an ihren angestammten Plätzen. Wenn auch die Szenen ländlicher Idylle, allesamt beste Dachauer Schule, inzwischen wie reinster Hohn auf den Betrachter wirkten. Gewiss war es nur eine Frage der Zeit, bis die Yankees auch hier der bürgerlichen Behaglichkeit ein Ende bereiten und ihre rüpelhaften, Kaugummi kauenden und schamlos mit deutschen Flittchen tanzenden Boys in diesem behüteten Paradies einquartierten. Bis dahin aber war er längst auf und davon. Er schlenderte weiter in den Flur, der eher eine kleine Diele war.
Von Neuem erschütterte ein lauter Schlag die Luft. Der Boden unter seinen Füßen bebte. Das Gewitter kehrte zurück. Der nachfolgende Blitz schleuderte sein Licht durch die Terrassenfenster Granaten gleich bis zu ihm. Aus dem Garderobenspiegel starrte ihm sein entstelltes Antlitz entgegen.
Fasziniert und abgestoßen zugleich musterte er es. Tatsächlich war mehr als ein Zeitalter vergangen, seit seine Wangen ähnlich glatt und makellos gewesen waren wie die auf dem Foto. Von links betrachtet schien er ganz der Alte, wirkte lediglich etwas ausgezehrter und blasser als früher. Über die gesamte rechte Gesichtshälfte jedoch zog sich eine weiße, stellenweise rötlich wund schimmernde Narbe. Der Augenwinkel war deutlich nach unten gezogen, der Mund völlig schief. Das verlieh ihm einen missmutigen Ausdruck. Trotzdem hatte der Chirurg hervorragende Arbeit geleistet. Mehr war aus den Fetzen einfach nicht mehr herauszuholen gewesen.
Die Fratze war trotzdem sein großes Glück. Zwar hatte die Pfaffinger Viktor von Dietlitz fast nicht mehr erkannt. Wie aber hatte sie den Leutnant zurückerwartet, nachdem er vor mehr als achtzehn Monaten bei einem Fronteinsatz als vermisst gemeldet worden war? Im Vergleich zu dem, was er hinter sich hatte, war ein halb zerfetztes Gesicht eindeutig das kleinere Übel. Davon hatte er schließlich auch die Pfaffinger überzeugt. Die Aussicht auf feste Arbeit und ein sicheres Einkommen mochte ein weiteres Argument für den Sinneswandel der Aufwartefrau gewesen sein. Damit konnte er leben. Ohnehin war es nicht für lange Zeit.
»Auf die Zukunft!«
Abermals hob er das Glas, dieses Mal, um im blitzhell erleuchteten Flur seinem Spiegelbild zuzuprosten. Das spöttische Lächeln um die Mundwinkel wirkte etwas steif.
Mitten im Donnern meinte er ein Klingeln zu vernehmen. Er musste sich täuschen. Das Prasseln der Regentropfen ließ vorübergehend nach. Das Klingeln wurde lauter. Er sah auf die Uhr. Besuch um diese späte Stunde war ungewöhnlich, erst recht unangemeldeter. Aber was war inzwischen noch gewöhnlich? Das Klingeln schwoll trotz Gewitterlärm an. Bald wurde ungeduldig gegen die Tür gehämmert. Einbrecher waren das wohl nicht.
Er stellte das Glas ab, behielt die Zigarre zwischen den Fingern, richtete einhändig Kragen und Gürtel des dunkelroten Seidenhausmantels, bevor er das Haar aus der Stirn nach hinten strich und zur Tür ging, um zu öffnen. Ein Wagnis, so ganz allein in einer prall gefüllten Wohnung in wirren Zeiten wie diesen.
1
Donnerstag, 16. August
Schon nach kurzer Zeit an der frischen Luft waren Billas Wangen nass. Nass vom Sommerregen, der aus stetig wechselnden Richtungen durch die Straßen fegte, und nass von Tränen. Mit der rechten Hand zog sie das Revers ihres hellen Trenchcoats eng über der Brust zusammen, mit der linken hielt sie den Schirm schräg vors Gesicht. Der Lederriemen der schweren Tasche schnitt schmerzhaft in ihre Schulter.
Vor ihr lag ein gutes Stück Weg. Sie war froh, noch etwas Zeit zu haben, um ihre Gedanken zu sortieren. Zu viele Eindrücke schwirrten ihr seit ihrer Ankunft in München vor gut zwei Wochen durch den Kopf. Deshalb war sie einige Hundert Meter vor dem Ziel ausgestiegen und hatte ihren Lieblingsfahrer Sam Shephard mit dem Wagen weggeschickt. Jetzt verlangsamte sie ihre Schritte, näherte sich zögernd der Gerner Brücke über den Nymphenburger Kanal und blickte sich reichlich verblüfft um. Binnen Minuten war sie in eine völlig andere Welt versetzt. Eben noch war sie von Sam im Jeep der US-Army in halsbrecherischem Tempo durch die nahezu vollständig zerstörte Innenstadt chauffiert worden. Nach unzähligen Luftangriffen befand sich dort kaum noch ein Stein auf dem anderen. Die ehemaligen Prachtbauten der Wittelsbacher Könige in der Maxvorstadt waren nur mehr kümmerliche Relikte, das legendäre Schwabing ähnelte mehr einem verwirrenden Trümmerlabyrinth denn dem einstigen Lieblingsviertel der Bohème, und entlang der Eisenbahntrasse vom Hauptbahnhof westwärts nach Pasing zog sich eine breite Schneise der Verwüstung. Hunderttausende Münchner irrten, so hieß es, obdachlos zwischen den Ruinen umher, dabei war die Bevölkerung im Lauf des Krieges ohnehin um die Hälfte geschrumpft.
Das alles aber musste auf einem anderen Planeten stattgefunden haben. Der Eindruck drängte sich Billa jedenfalls auf, als sie jetzt mutterseelenallein am Nymphenburger Kanal stand und weder unbehauste, verzweifelte Münchner noch epochale Zerstörungen durch Fliegerangriffe oder Spuren von den Plünderungen der letzten Kriegstage entdeckte. Die schmucken Villen mit ihren runden Erkern, spitzen Türmchen, verglasten Veranden und verspielten Vorgärten schlummerten im Dornröschenschlaf und schienen von unbeschwerten Vorkriegstagen zu träumen.
Dunkel stiegen in Billa Erinnerungen an Einladungen bei steifen Gesellschaften auf, an denen sie hier vor einigen Jahren mit ihrer Mutter Lilo teilgenommen hatte. Schon damals war ihr die Atmosphäre der Gegend seltsam aufgestoßen. Nun wirkte sie geradezu unheimlich auf sie. Vielleicht rührte das auch daher, dass sie mit der Begegnung, die ihr gleich bevorstand, haderte.
Wahrscheinlich war es ein Fehler gewesen, sich überhaupt darauf einzulassen. Von irgendwoher kam ihr der Name ihres Gesprächspartners bekannt vor. Leider brachte sie nicht zusammen, von woher. Ihr Informant Piotr hatte den Termin arrangiert und sie bei der Gelegenheit um einen großen Gefallen gebeten. Äußerst ungern hatte sie eingewilligt. Sie hasste es, sich als Botin missbrauchen zu lassen, vor allem in einer etwas zwielichtigen Angelegenheit. Andererseits wollte sie helfen. Die Ungerechtigkeit, die Piotr widerfahren war, stank zum Himmel. Also hatte sie seiner Bitte trotz aller Bedenken zugestimmt.
Entschlossen lief sie weiter. Zum Umkehren war es ohnehin zu spät. Erst in zwei Stunden würde Sam sie wie verabredet am östlichen Ende des Nymphenburger Kanals wieder aufsammeln. Unwillkürlich tastete sie nach der Pistole in der rechten Manteltasche. Sollte es gefährlich werden, war sie durchaus in der Lage, sich zu wehren. Den Gebrauch der Pistole beherrschte sie im Schlaf.
Ihre Schritte wurden sicherer. Dennoch knickte sie mehrmals auf dem holprigen Pflaster um oder tappte in eine Pfütze. Bald waren ihre Schuhe wasserdurchtränkt, die Füße pitschnass und die Seidenstrümpfe mit Dreck bespritzt. Obwohl es warm war, fror sie.
Auf der Brücke über den Kanal verharrte sie einen kurzen Moment, wandte den Kopf nach links zum Schloss. Wie eh und je ragte es unschuldig in den Himmel, als wäre nichts geschehen. Nicht darüber nachdenken!, mahnte sie sich. Doch plötzlich musste sie heftig schluchzen. Eine Windböe frischte auf, zerrte am Schirm. Der straff gespannte Stoffbezug klappte um, ein Schwall Wasser klatschte ihr auf den Kopf. Mit der nächsten Böe klappte der Schirm zurück. Sie zog ihn tiefer vors Gesicht und lief weiter.
Allzu weit konnte es nicht mehr sein. Wenn sie es richtig im Kopf hatte, lag die Malsenstraße nur eine Querstraße nördlich vom Kanal. Allmählich gewöhnte sie sich wieder an den Anblick intakter Häuser inmitten gepflegten Grüns und unversehrter Straßen, genoss es sogar, für eine Weile den herumstreunenden Jammergestalten aus der Innenstadt entflohen zu sein, die in der einst so stolzen ›Hauptstadt der Bewegung‹ mittlerweile jeden Stolz vergessen hatten und gegenüber den amerikanischen Besatzern so taten, als wären ausgerechnet sie die Opfer und nie die Täter gewesen.
Die ausgestorbenen Straßen in Nymphenburg konnten jedoch ebenfalls aufs Gemüt drücken. Weder Hund noch Katze oder sonst ein lebendiges Wesen ließ sich blicken, nicht einmal Vogelgezwitscher war zu hören. Unterm Strich war diese völlige Leere ebenso schaurig wie die Horden abgerissener Elendsfiguren, die einem rund um den Hauptbahnhof, am Stachus oder vor allem am Sendlinger Tor auflauerten.
Sams eindringliche Warnung vor Mitgliedern des berüchtigten Werwolf-Kommandos, der offiziell zwar längst aufgelösten, inoffiziell allerdings weiter existierenden Untergrundorganisation der Nazis, fiel ihr ein. Vermutlich waren in Nymphenburg aber eher plündernde Banden das Problem. Im Zweifelsfall war es einerlei, wer davon ihr begegnete – zu verlieren hatten die einen so wenig wie die anderen.
Billa hob den Schirm und betrachtete die Villen entlang der Straße. Vom üppigen Grün der Büsche und Hecken wurden sie nur dürftig verdeckt. Man konnte sich leicht ausrechnen, welche Schätze hinter den zugezogenen Vorhängen und Fensterläden noch verborgen waren, selbst wenn die Bewohner die Stadt vor Wochen schon mit Kisten und Koffern voll Schmuck, Silber und sonstigen Schätzen verlassen hatten.
Mit der freien Hand schlug sie den Kragen ihres Trenchcoats auf, zog fröstelnd die Schultern hoch. Was war das? Huschte da nicht etwas Schwarzes ins Gebüsch? Sie erstarrte. Automatisch glitt ihre Hand wieder in die Seitentasche mit der Waffe. Angestrengt lauschend wartete sie einen Moment, die Augen auf die Stelle gerichtet, hinter der sie das Versteck vermutete. Nichts. Sie atmete auf. Offenbar hatte sie sich getäuscht. Trotz weicher Knie zwang sie sich weiterzugehen, umklammerte die Pistole nur noch etwas fester.
Fast hätte sie sie gezogen. Zwei dunkel gekleidete Männer mit blauen Schiebermützen und bedrohlichem Blick bogen um die Ecke. In ihren Gürteln Gummiknüppel, an ihren rechten Oberarmen schmutzig weiße Armbinden, wie sie erst auf den zweiten Blick entdeckte. Mitglieder privater Wachdienste. Sie atmete auf und lockerte den Griff um die Waffe in ihrer Manteltasche. Die beiden patrouillierten im Auftrag der Militärpolizei, um die personell noch viel zu schwach aufgestellte Münchner Polizei zu unterstützen.
Höflich grüßte Billa sie. Überrascht über ihr akzentfreies Deutsch machte einer der beiden Anstalten stehen zu bleiben. Vermutlich, um ihre Papiere zu kontrollieren. Sein Kumpan winkte ab. Sie nickte ihnen zu und lief weiter. Nur zu gut wusste sie, dass man ihr inzwischen schon von Weitem ansah, dass sie Amerikanerin war. Die sieben Jahre in New York hatten ihre Spuren hinterlassen, nicht nur in Schuhen und Kleidung. Sie wechselte den Schirm in die rechte Hand, wischte sich mit der linken über die nassen Wangen und schob den verrutschten Riemen der schweren Fototasche über der Schulter hoch.
Wie erwartet wohnte oder vielmehr residierte Dietlitz in einem gut erhaltenen bürgerlichen Jahrhundertwende-Vorstadt-Traum. Während Billas Blick über die üppig verzierte Fassade wanderte, kramte sie in ihrem Gedächtnis nach Hinweisen, woher ihr der Name bekannt vorkam. War sie früher schon einmal hier gewesen? Sie konnte sich nicht entsinnen. Vielleicht fiel es ihr ein, wenn sie Dietlitz gegenüberstand. Zu ihrer Beruhigung tastete sie erneut nach der Pistole in der Manteltasche. Das kalte Metall an den Fingern zu spüren, tat gut.
Durch das Gartentor lief sie über den glitschigen Steinplattenweg zur Haustür. Noch einmal meinte sie kurz, aus dem Augenwinkel einen verräterischen Schemen zu erspähen. Jäh fuhr sie herum, maß ihre Umgebung unter größtem Herzklopfen Zentimeter für Zentimeter mit den Augen. Ein dürres Eichhörnchen sprang über den Weg und scheuchte einen Vogel auf, als es einen Baumstamm erreichte und emporkletterte. Erleichtert drehte Billa sich wieder zum Eingang um.
Auf dem goldglänzenden Schild befanden sich drei Klingeln, zwei auffällig dicke für die gediegenen Wohnungen in Erd- und erstem Obergeschoss, eine weitaus kleinere für die einfache Wohnung im Souterrain, in der vermutlich der Hausbesorger untergebracht war. In Zeiten wie diesen wichtiger denn je, auch wenn Billa sofort hässliche Erinnerungen mit dem Blockwart in den Sinn kamen.
Auf ihr Läuten tat sich nichts. In den nassen Schuhen und Strümpfen fror sie inzwischen erbärmlich. Sie stapfte von einem Fuß auf den anderen, um sich aufzuwärmen, rang um Geduld. Als sich immer noch nichts regte, drückte sie abermals den Klingelknopf, schließlich noch einmal und noch einmal. Zuletzt läutete sie Sturm. Wieder nichts. Verärgert sah sie auf die Armbanduhr. Neun Uhr. Sie war pünktlich. Hatte Dietlitz ihre Verabredung vergessen?
Schon wollte sie sich zum Gehen wenden, da fiel ihr auf, dass die schwere Eichenholztür einen winzigen Spaltbreit offen stand. Offenbar rastete der Schließer nicht richtig ein. Fatal in Zeiten von Plünderern und Werwölfen. Billa drückte gegen die Tür. Sie schwang auf, einen Tick zu heftig. Der Flügel knallte gegen die Wand. Es klang wie ein Schuss. Erschrocken zuckte Billa zusammen. Die Finger ihrer rechten Hand schlossen sich fester um die Pistole. Mit angehaltenem Atem und weichen Knien trat sie ein.
Offenbar hatte das Schlagen der Tür gegen die Wand niemanden alarmiert. Zumindest ließ sich drinnen keiner blicken. Stattdessen empfing sie dämmriges Licht. Ein schmales Fenster über der Tür ließ zaghaft etwas Helligkeit herein. Es dauerte einen Moment, bis Billa sich an die Sichtverhältnisse gewöhnt hatte. Den tropfnassen Schirm stellte sie in einen bereitstehenden Ständer und inspizierte die Umgebung.
Rechts führte eine mit rotem Läufer ausgelegte Treppe in den ersten Stock, links war eine schmale Holztür mit ovalem Sprossenfenster, die vermutlich zum Kellerabgang gehörte, geradeaus eine doppelflügelige Tür, auf der ein weiteres goldenes Schild in schwarz verschnörkelter Schrift von Dietlitz verkündete. Auch die war nur angelehnt. Ehe Billa sich recht besann, öffnete sie sie bereits. Das kühle Metall der Pistole in ihrer rechten Hand schenkte ihr Sicherheit. Ebenso die Tatsache, noch immer niemanden aufgeschreckt zu haben.
»Herr von Dietlitz?«, rief sie in die Stille der Wohnung.
Keine Antwort. Sie wagte die nächsten Schritte in den Flur hinein. Er war überraschend großzügig geschnitten, aber spärlich möbliert. Neben einer dunklen Kommode hing ein mannshoher Spiegel.
Eine weit offen stehende weiße Tür gab den Blick frei in ein geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit einem auf Hochglanz polierten Flügel. Links davon ging es in ein eher modern gehaltenes Arbeitszimmer. Auf der rechten Seite entdeckte Billa unter einem opulenten Kristallleuchter einen pompösen Esstisch mit viel zu vielen Stühlen drum herum. Sofort stachen ihr die wertvollen Bilder an den Wänden ins Auge. Erleichtert atmete sie auf. Geplündert worden war die Wohnung nicht. Auch hatten keine Flüchtlinge die Räume okkupiert, was ein Wunder darstellte, gerade bei angelehnter Tür.
Über der Zimmerflucht lag trotzdem eine beklemmende Stille, die nichts Gutes verhieß. Umkehren aber wollte sie in keinem Fall mehr. Trotz aller Angst hatte sie plötzlich eine brennende Neugier gepackt. Klopfenden Herzens zog sie die Hand mit der entsicherten Waffe aus der Manteltasche. Dabei glitt ihr die schwere Fototasche von der Schulter. Sie stellte sie auf dem Boden ab und wiederholte ihr Rufen, wandte sich instinktiv nach rechts. Als sie den Esstisch erreichte, stieß sie einen entsetzten Schrei aus.
Sofort ging sie neben dem reglosen Körper vor dem Fenster zu Boden, packte ihn mit einer Hand an den Schultern und drehte ihn um. Dabei ahnte sie in der nächsten Sekunde, dass jede Hilfe zu spät kam. Zu groß war der Blutfleck, der sich in Höhe der linken Brust um das Loch auf dem Hausmantel des Mannes abzeichnete.
»Hilfe!«, gellte es plötzlich schrill in ihren Ohren.
Als Billa den Kopf wandte, sah sie in das schreckensbleiche Gesicht einer etwa fünfzigjährigen Frau mit weißer Schürze. Und ließ die Pistole fallen.
2
Das hatte ihm gerade noch gefehlt! Abrupt blieb Emil in der offenen Tür zum Esszimmer stehen. Wer war diese fremde Frau mit der Kamera in der Hand dort beim Fenster? Was hatte sie am Tatort verloren?
Angesichts ihrer tadellosen Erscheinung konnte sie nur Amerikanerin sein. Sie passte zwar auch in die heile Welt am westlichen Rand der nahezu völlig verwüsteten Stadt, dennoch empfand Emil die Unbekannte sofort als Fremdkörper in der Wohnung. So wie der helle Trenchcoat über einem der Stühle, der vermutlich ihr gehörte. Zu den Besatzungskräften zählte sie gewiss nicht. Ihr Habitus stammte eindeutig aus einer anderen Welt als der der Militärs. Wie aber kam sie dann dazu, in der Wohnung zu fotografieren? Noch dazu offenbar die Leiche, die direkt vor ihr auf dem Boden liegen musste? Genaueres konnte Emil nicht sehen. Der riesige Tisch versperrte ihm die Sicht. Am Tatort hatte die Unbekannte jedenfalls nichts zu suchen. Er musste sie schleunigst wegschicken. Immerhin trug er heute hier die Verantwortung.
Entschlossen machte er einige Schritte auf sie zu. In seinem schlecht sitzenden, dunklen und für die Jahreszeit viel zu warmen Wollanzug und den schäbigen Schuhen – beides aus den Beständen seiner wohlmeinenden, aber leider auch etwas aufdringlichen Zimmerwirtin – fühlte er sich wie der letzte Lump. Was musste die Fremde von ihm denken? Dabei legte er nicht allein wegen der Anweisung seines obersten Bosses, sich als Vertreter der Ordnungsmacht jederzeit korrekt zu kleiden, größten Wert auf sein Äußeres. Mehr aber war unter den gegebenen Umständen momentan einfach nicht drin.
Die junge Frau war derart auf ihre Kamera konzentriert, dass sie ihn nicht bemerkte. Von der Kripo war sie vermutlich nicht, davon hätte Emil gehört. Eine Frau in den Reihen der Ettstraße wäre eine Sensation, die sich rasch unter den Kollegen verbreitet hätte. Auch wenn es angesichts der schwierigen Suche nach geeigneten Mitarbeitern vernünftig wäre, endlich auch auf den weiblichen Teil der Bevölkerung zurückzugreifen. Ebenso hätte Emil längst mitbekommen, wenn sich neuerdings aufseiten der Amerikaner eine Frau im Ermittlerteam befände. Vermutlich würde sie dann außerdem Uniform tragen. Oder zumindest eine behelfsmäßige weiße Armbinde mit dem Kürzel »MP« darauf, wie die meisten der derzeit in der zerstörten Stadt eingesetzten Polizisten, Wachhabenden oder Sicherheitsleute.
Emil rieb sich das glatt rasierte Kinn. Es musste etwas gründlich schiefgelaufen sein, wenn eine unbekannte Zivilperson ungestört am Tatort fotografieren konnte. Er ahnte Komplikationen. Und das ausgerechnet jetzt, da er zum ersten Mal allein zu einem Tatort ausgerückt war, als verantwortlicher Vertreter des Kommissariats K 1 – Kriminaluntersuchungsabteilung Verbrechen wider das Leben. Wie stolz er vorhin gewesen war, als Captain Joe Simon ihn mit einem aufmunternden »Your chance, Emil!« losgeschickt und der deutsche Leiter der Münchner Kripo und zugleich Chef des Kommissariats K1, Oberinspektor Andreas Grasmüller, das nur mit einem knappen Nicken kommentiert hatte. Jetzt verfluchte er den Moment bereits. Seine Vorgesetzten hielten ihre Präsenz bei der offiziellen Amtseinführung von Franz-Xaver Pitzer als Polizeipräsident für wichtiger als diesen Mordfall. Dabei hatte Pitzer nach Ende des Ersten Weltkriegs schon einmal an der Spitze der Münchner Sicherheitskräfte gestanden. Seine neuerliche Ernennung drei Monate nach Kriegsende entsprach also einer gewissen Logik. Umso verwunderlicher, dass Emils Vorgesetzte die Zeremonie derart wichtig einschätzten, dass sie einen Fast-Laien wie ihn allein an den Tatort beorderten.
Der Fundort des Getöteten in dieser Gegend bewies, wie dramatisch die Situation in der Stadt nach wie vor war. Allein in den ersten zehn Wochen nach Einmarsch der US-Army hatte es einhundertfünfundfünfzig registrierte Mord- und Totschlagopfer gegeben, wie Emil inzwischen die Fallzahlen nahezu im Schlaf herunterbeten konnte. Hinzu kamen einundachtzig aktenkundig gewordene Tote infolge von Kampfhandlungen. Oft genug wurde ihnen das von ihren amerikanischen Vorgesetzten vorgehalten. Seit vier Wochen gingen die Kapitaldelikte allerdings allmählich zurück. Ein erster, überaus erfreulicher Erfolg nach dem Wiederaufbau der Münchner Kriminalpolizei durch die US-Sicherheitskräfte. Dennoch fiel auf, wie selten das Viertel rund um das Nymphenburger Schloss bislang Schauplatz roher Gewalt geworden war. Angesichts des nach wie vor unübersehbaren Reichtums der Bewohner ein wahres Wunder. Einen blutigen Anfänger wie Emil als verantwortlichen Vertreter der Mordkommission an einen solchen Tatort zu schicken, wirkte vor dem Hintergrund wie ein Kardinalfehler.
Die Situation mit der Unbekannten überforderte ihn auch gleich. Er begann zu schwitzen. In seiner Schnellausbildung bei der Mordermittlung hatte er noch nicht gelernt, was zu tun war, wenn er eine unberechtigte Person am Tatort antraf. Schon holte er Luft, um sie zurechtzuweisen. Im selben Moment drehte sie sich um und lächelte ihn an.
Ihm stockte der Atem.
»Guten Tag, Herr Kommissär. Ihr Kollege bat mich, die Tatortfotos für ihn zu machen. Ihm fehlt leider ein Film im Apparat.«
Als er sie ansah, ratterte in seinem Kopf das jüngst eingetrichterte Programm zur Feststellung wichtiger Erkennungsmerkmale ab: kastanienfarbene Locken, leuchtende maronibraune Augen, eine schmale, an der Spitze leicht gebogene Nase sowie ein fein gezeichneter Mund. Sie war gertenschlank, eher athletisch denn abgemagert, vermutlich durchschnittlich groß, was angesichts der hochhackigen Schuhe nicht eindeutig festzustellen war, und etwa Anfang zwanzig, also vermutlich wenige Jahre jünger als er.
Langsam blies Emil die Luft wieder aus. Zu seinem Ärger bekam er als Erwiderung nur ein heiseres, fast schon trotzig anmutendes »Ich bin kein Kommissär« heraus. Was genau er war, welche Funktion ihm, dem völlig Unbedarften, in der sich gerade neu konstituierenden Münchner Kriminalpolizei zukam, wusste er selbst noch nicht so recht.
Um seine Verlegenheit zu kaschieren, nahm er den nassen Hut vom Kopf und behielt ihn in der rechten Hand. Die linke vergrub er tief in der Hosentasche. Die Unbekannte brauchte nicht zu sehen, wie heftig seine Finger vor Nervosität zitterten.
Wo steckten nur die Kollegen? Durch die offene Zwischentür links sah er, wie zwei von ihnen, die mittlerweile wieder beim K6 – Erkennungsdienst und Kriminaltechnik in der Ettstraße beschäftigt waren, das Wohnzimmer auf verwertbare Spuren absuchten.
Die Männer waren ganz in ihre Arbeit vertieft, trotz der kargen Ausstattung, die von der einst so versierten Abteilung nach deren Auslagerung kurz vor Kriegsende auf das vermeintlich sichere, dann aber vollständig ausgeplünderte Schloss Berg am Starnberger See übrig geblieben war.
Im selben Moment eilte ein fast glatzköpfiges, spinnenartiges Männlein aus der entgegengesetzten Ecke der Diele herbei. Ludger Seidl, ein mehr als penibler Jäger und Sammler von allen nur erdenklichen Spuren. Noch im Laufen richtete er sich Hosenbund und Jacke. Offenbar kam er von der Toilette. Wann bot sich einem schon einmal die Gelegenheit, wie in Vorkriegszeiten ein funktionierendes, nicht verstopftes Wasserklosett zu benutzen? Sosehr Emil es ihm nachfühlen konnte, verstieß es gegen die Vorschriften. Er verdrehte die Augen. Auf Vorschriften schien an diesem schwül-feuchten Vormittag Mitte August aber sowieso kaum jemand etwas zu geben. Er lockerte seine Haltung. Seidl schnappte sich die Kamera vom Tisch und hielt sie ohne die geringste Spur von Verlegenheit mit der offenen Klappe in die Luft.
»Kein Film«, erklärte er das Offensichtliche und wies mit der Hand auf die Fremde, grinste triumphierend. »Zum Glück konnte die Dame für uns einspringen. Sonst müssten wir uns jetzt wie anno dazumal mit Zeichenblock und Bleistift begnügen. Dafür haben wir heute ausreichend Argentorat und Folie aufgetrieben, um Fingerabdrücke zu nehmen. Man kann halt nicht alles haben. Mit den Fußspuren wird’s allerdings schwierig, nachdem hier alle Welt mit nassen Schuhen einfach mittendurch marschiert ist.«
Mit dem spitzen Kinn nickte er auf den mit dicken Teppichen ausgelegten Parkettboden. Als wäre das ein Zeichen, flitzte einer der Kollegen herüber, kniete nieder und begann mit einer Lupe in der einen und einer Pinzette in der anderen Hand gleich an der Tür, den Perser Zentimeter für Zentimeter nach was auch immer abzusuchen.
Emil sparte sich einen Kommentar. Nur zu gut wusste er, wie sehr Seidl selbst am meisten darunter litt, angesichts der lückenhaften Ausrüstung nur mehr unzureichende Arbeit leisten zu können. Improvisationstalent war derzeit die gefragteste Eigenschaft bei den Kripoleuten, ob bei alten Hasen aus der Vorkriegszeit wie dem nervigen Seidl oder bei blutigen Anfängern wie ihm. Insofern war es wohl wirklich Glück, wenigstens die Fotos der Unbekannten für den Bericht zu haben.
Inzwischen knipste sie von allen Seiten und aus den verschiedensten Positionen heraus den Tatort. Das erinnerte Emil daran, endlich seiner Pflicht als Ermittler nachzukommen. Er ging um den wuchtigen ovalen Tisch mit den acht gepolsterten Stühlen herum und blickte zu Boden.
Erstaunlicherweise hielt sich die Sauerei in Grenzen. Das Opfer lag auf dem Bauch. Vermutlich durch einen gezielten Schuss niedergestreckt, abgegeben von einem geübten Schützen. Angesichts der vielen an der Waffe trainierten Soldaten derzeit keine außergewöhnliche Qualifikation.
Neben dem in einen eleganten Seidenmorgenrock über nicht minder eleganten Hosen gekleideten Toten lag eine Pistole. Emil stutzte, wollte in die Knie gehen, um sie genauer zu betrachten.
Entschlossen stellte sich ihm die unbekannte Fotografin in den Weg und streckte ihm forsch die Hand entgegen.
»Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Billa, also eigentlich Sybilla, Löwenfeld, Fotoreporterin aus New York. Das ist meine Waffe. Ich habe sie vorhin fallen lassen, als ich den Toten entdeckt habe. Ihr Kollege hat gleich festgestellt, dass daraus kein Schuss abgeben wurde. Falls Sie meine Berechtigung von der Army sehen wollen …«
»Nicht nötig«, wiegelte er ab, wechselte den Hut in die Linke und ergriff mit der Rechten ihre Hand.
Ihr Händedruck war angenehm fest. Anders als seine fühlte sich ihre Hand wohltuend warm an. Zugleich fiel ihm jetzt die eher süddeutsche Färbung ihrer Aussprache auf. Gebürtige Amerikanerin war sie ganz sicher nicht. Ihr Nachname ließ ihn automatisch an jüdische Wurzeln denken, wahrscheinlich also eine Exilantin. Eine emigrierte Jüdin namens Löwenfeld – wie tief das alte Denken in ihm steckte! Verärgert spürte er eine leichte Röte auf den Wangen. Für den Bruchteil einer Sekunde schloss er die Augen, schluckte.
»Emil Graf, Ermittler bei der Mordkommission«, hörte er sich wie aus weiter Ferne sagen, als er die Augen wieder öffnete und eine Verbeugung andeutete.
Der Leiter des Public Safety Office in der Ettstraße, Major Brown, dem die Polizei der Stadt München unterstand, erwartete von seinen Mitarbeitern tadellose Umgangsformen. Ein Grund mehr, warum Emil nach den unliebsamen Erfahrungen der letzten Jahre so gern mit ihm und seinen Leuten zusammenarbeitete.
»Haben Sie auf den Mann geschossen?«, besann er sich auf das wenige, was ihm bislang über seine neue Tätigkeit beigebracht worden war.
»Um anschließend die Polizei persönlich zu empfangen und in aller Seelenruhe mein Opfer von allen Seiten für sie zu fotografieren?« Amüsiert schüttelte sie den Kopf, setzte nach einer kurzen Pause betont geduldig nach: »Wie ich schon sagte, wurde aus meiner Pistole nicht geschossen. Sie ist mir aus der Hand gefallen, als ich den Toten gefunden habe.«
»Verzeihung, ich vergaß. Das sagten Sie bereits.«
Die Farbe auf seinen Wangen wechselte von leichtem zu glühendem Rot. Wie konnte er sich nur derart blamieren?
Sie tat, als bemerke sie seine Verlegenheit nicht, und legte die Kamera, die zusammen mit dem Blitzgerät ein beträchtliches Gewicht haben musste, auf den Tisch.
Es sah aus, als tue sie das alles in größter Seelenruhe. Emil war fasziniert. Um im nächsten Augenblick jäh zusammenzuzucken. Die Spuren! Alarmiert blickte er sich nach Seidl oder einem der anderen Erkennungsdienstler um.
Billa verstand den Wink und nahm den Fotoapparat wieder in die Hand, stützte diese mit der zweiten ab.
»Entschuldigung. Wie gedankenlos. Rauchen ist hier natürlich verboten, oder? Dabei wäre mir jetzt sehr danach.«
»In welcher Beziehung stehen Sie zu dem Toten?«, überging er die Frage. Längst verlangte ihn ebenfalls nach einer Zigarette, aber die musste warten. Er hatte nur noch eine, die er anstandshalber ihr anbieten müsste.
»In gar keiner«, antwortete sie. »Ich kannte ihn nicht persönlich.«
»Wie kommen Sie dann hierher?«
»Ich recherchiere für eine Reportage über Kriegsheimkehrer«, erwiderte sie. Auf einmal versagte ihr die Stimme, sie räusperte sich hastig. »Das New Yorker Magazin, für das ich arbeite, hat mich hergeschickt. Viktor von Dietlitz wurde mir als Gesprächspartner vermittelt. Um neun waren wir verabredet. Ich war pünktlich, aber auf mein Klingeln hat niemand reagiert. Stattdessen stand die Wohnungstür offen. Mehrmals habe ich nach Dietlitz gerufen, aber keine Antwort erhalten, deshalb habe ich mich in der Wohnung umgesehen …«
»Mit der entsicherten Pistole in der Hand?«, unterbrach Emil sie.
»Was hätten Sie getan?« Beharrlich hielt sie seinem Blick stand.
»Ich habe keine Waffe. Kein Münchner Polizist hat derzeit eine«, stellte er klar und schob die Hände in die Seitentaschen seines viel zu warmen Jacketts.
»Er lag schon tot auf dem Boden, als ich ihn gefunden habe«, stellte sie noch einmal klar. »Ich habe ihn umgedreht, um zu sehen, ob er noch lebt. Aber es war zu spät.«
»Deshalb haben Sie ihn zurück auf den Bauch gelegt.«
»Mir war sofort klar, dass es sich um Mord handelt.«
Einen Moment schwiegen sie beide.
»Angst haben Sie wohl keine«, bemerkte er schließlich.
»Den Luxus habe ich mir abgewöhnt.« Kurz lachte sie auf. »Und Sie?«
Ihre Blicke verharrten aufeinander. Ihm fiel es schwer, sich loszureißen. Sie lächelte kaum wahrnehmbar.
»Als ordentliche Bürgerin habe ich natürlich sofort die Polizei alarmiert«, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort. »Zum Glück gibt es auf dem Schreibtisch hinten im Herrenzimmer einen Anschluss.«
»Das Telefon funktioniert?«, fragte er ungläubig. Zwar verfügten seit knapp vier Wochen die ersten Haushalte wieder über einen Privatanschluss, allerdings mussten sie zuvor eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bei den Amerikanern beantragen. Der Hinweis auf den Telefonanschluss war also eine wichtige Information über den Toten. Emil klemmte den Hut unter den linken Arm, nahm Notizbuch und Bleistift aus der Jackettinnentasche und schrieb erste Stichworte auf.
Billa behielt ihn aufmerksam im Blick. »Ein amerikanisches Notizbuch?«
»Ein Geschenk von einem guten Freund«, rechtfertigte er sich eine Spur zu hastig für den offensichtlichen Luxus. Ebenso kam ihm die Behauptung, das Notizbuch stamme von einem guten Freund, auf einmal vermessen vor. Hastig berichtigte er sich: »Von meinem Vorgesetzten, Captain Joe Simon vom Public Safety Office.«
»Wenn er Sie allein hierhergeschickt hat, muss er große Stücke auf Sie halten. Oder hat er einfach nur genug von den vielen Toten und will das alles nicht mehr sehen?«
»So geht es uns wohl allen.«
Es überraschte ihn, wie vertraut sie offenkundig mit den Vorschriften für die Münchner Polizei war.
»Ist es nicht Ihr Job, dafür zu sorgen, dass das endlich ein Ende hat?«
»Ich tue mein Bestes.«
Mit dem Rücken zur Wand zu stehen musste sich ähnlich anfühlen.
»Aus dem Mund eines Münchner Kripobeamten klingt das noch sehr ungewohnt für mich.«
»Sie dürfen sich daran gewöhnen. Die Zeiten ändern sich.«
Das klang zuversichtlicher, als er war.
»Hoffentlich.«
Wieder verschränkten sich ihre Blicke ineinander. Bis dieses Mal sie als Erste auswich und leise nachsetzte: »Sie ahnen nicht, wie leid ich es bin. In den letzten Jahren musste ich mich viel zu oft an zu viel Neues gewöhnen.«
Ihr Blick schweifte zum Fenster, verlor sich in dem steten Regen, der für einen sehr nassen August sorgte. Was für ein Desaster für all jene, die kein festes Dach mehr über dem Kopf hatten, schoss es Emil in den Sinn.
»Ganz egal, wie viel Mühe Sie sich geben: Die maßlose Verrohung wird uns wohl noch lange begleiten«, stellte Billa fest, als sie sich wieder ihm zuwandte. »Es gibt viele, die mehr als einen guten Grund haben, sich für das zu rächen, was ihnen von den braunen Schergen angetan wurde.«
»Die Frage ist nur, ob ihre Rache immer die Richtigen trifft.«
»In diesem Fall wohl schon. Haben Sie sich schon genauer in der Wohnung umgeschaut?« Ihre Stimme wurde scharf. Mit dem Kopf wies sie auf das wuchtige Gemälde über dem Vertiko. »Sieht nicht so aus, als hätte Dietlitz jemals zu den Verlierern gehört, weder vor noch nach der Kapitulation. Das wird nicht allen gefallen haben. Gut vorstellbar also, dass sich jemand an ihm rächen wollte.«
»Zu den Verlierern gehört er in jedem Fall. Und das auf ganzer Linie.«
Überrascht fuhren Emil und Billa herum, als sie die tiefe Stimme hörten.
3
Ein etwas schwerfälliger älterer Mann mit Halbglatze stand in der Verbindungstür zum Wohnzimmer. In der einen Hand trug er einen unhandlichen, ledernen Arztkoffer, in der anderen hielt er ein Taschentuch, um sich in kurzen Abständen den schwitzenden, wulstigen Nacken trocken zu wischen. Über sein rotes Gesicht perlte ebenfalls der Schweiß.
Gerichtsmediziner Ernst Ringseisen. Erleichtert atmete Emil auf. Ringseisen war ein väterlicher Typ. Er schätzte ihn auf Mitte, höchstens Ende vierzig, aber wer wusste noch eindeutig zu sagen, wie alt einer war? Alle sahen älter aus, als sie in Wahrheit waren, insbesondere diejenigen, die es im »Tausendjährigen Reich« nicht leicht gehabt hatten. Zu denen gehörte Ringseisen. Noch nie hatte er Ambitionen für höhere Posten oder wissenschaftlichen Ehrgeiz gehegt. Dafür war er mit großer Geduld gesegnet und legte Wert darauf, seine Arbeit nicht nur ordentlich, sondern vom ersten Moment an auch nachvollziehbar für alle Beteiligten durchzuführen.
»Gestohlen wurde offenbar nicht viel.« Mit diesen Worten tauchte auch der Erkennungsdienstler Seidl wieder hinter Ringseisen auf. Anscheinend hatte er einen Rundgang durch die restliche Wohnung unternommen und sich bei den Kollegen nach ersten Erkenntnissen erkundigt. Er baute sich direkt neben dem massigen Ringseisen auf, was ihn noch kleiner und spinnenartiger wirken ließ, und blätterte eifrig in seinem zerfledderten Notizblock, leckte dabei die Fingerkuppen, um das Papier besser fassen zu können.
»Haben Sie die Pistole am Boden schon registriert?«, erkundigte Emil sich.
»Kann sie einstecken. Daraus wurde nicht geschossen«, erwiderte Seidl beiläufig, bevor er unbeirrt mit seiner Schilderung fortfuhr: »So wie’s ausschaut, hat das Opfer dem oder den Tätern selbst die Tür geöffnet. Aufgebrochen wurde sie jedenfalls nicht. Auch eingeschlagene Scheiben gibt’s keine. Dabei wär’s hier im Erdgeschoss einfach, direkt vom Garten einzusteigen. Bei dem dichten Gebüsch rund ums Haus sieht keiner was von der Straße aus. Auch nicht, wenn jemand was Größeres wegschafft. Fehlen tut allerdings nur das, was im Wandtresor hinten im Herrenzimmer war. Die Tresortür steht offen. Wird wohl ein bisserl Bargeld gewesen sein. Die Wertpapiere sind noch da. Spricht dafür, dass der Täter keine Ahnung hat, was noch was wert ist, sonst hätte er das Geld liegen und die Aktien mitgehen lassen. Der Rest ist ganz ordentlich hier. Nichts umgeworfen oder durchwühlt. Und die wertvollen Bilder hängen auch noch alle da, wo sie hingehören, sonst gäb’s hässliche Flecken und Ränder auf der Tapete. Sagt jedenfalls auch die Wirtschafterin.«
»Sagt wer?« In Emil stieg Wut auf, als er den Satz in seiner ganzen Bedeutung erfasste.
Seidl grinste.
Das ärgerte Emil noch mehr. Er konnte sich denken, mit welcher Genugtuung der Erkennungsdienstler ihn auflaufen ließ. Das geschah nicht zum ersten Mal. Dass Emil auf höhere Anordnung allein an einem Tatort aufgetaucht war, missfiel altgedienten, erst nach längerem Zögern seitens der Amerikaner wieder eingesetzten Kollegen wie Seidl. Es war ein deutliches Signal, was sowohl sein verantwortlicher Captain vom Public Safety Office als auch Oberinspektor Grasmüller ihm bereits nach wenigen Wochen im Dienst zutrauten. Damit taten sich die alten Hasen schwer. Trotz der jüngsten Vergangenheit hielten sie sich für die besseren, weil erfahreneren Polizisten.
»Wo steckt die Frau?«, herrschte Emil Seidl zornig an. »Warum sagen Sie mir erst jetzt, dass es noch eine zweite Zeugin gibt?«
»Sie hockt in der Küche. Ist schlecht beieinander«, mischte Ringseisen sich in seiner ruhigen Art als Schlichter ein. »Grad hab ich ihr einen Kamillentee aufgebrüht. Wenn hier alles fertig fotografiert ist, lassen Sie mich jetzt endlich kurz den Toten anschauen.«
Er schob sich an Emil und Billa vorbei, stellte die Tasche auf dem Boden ab und beugte sich keuchend über den unten liegenden Toten.
»Holen Sie die Wirtschafterin«, wies Emil Seidl schroff an. »Und sorgen Sie dafür, dass der Kollege draußen an der Wohnungstür die beiden anderen Etagen im Haus abklappert, ob sonst noch jemand da ist, der was gehört oder gesehen hat. Sofort!«
Die Wirtschafterin betrat just in dem Moment das Esszimmer, in dem Ringseisen die Leiche auf den Rücken drehte und sachlich konstatierte: »Herzschuss aus nächster Nähe.«
»Jesses Maria!«, schrie sie beim Anblick des Toten und schlug die Hände vors Gesicht.
Geistesgegenwärtig sprang Billa ihr zur Seite. Die Frau schwankte bereits gefährlich, als Billa sie am Arm packte, fürsorglich zu einem der Stühle führte und ihr half, sich zu setzen. Dankbar nickte die Wirtschafterin ihr zu.
Emil haderte mit sich. Streng genommen musste er Billa wegschicken, während er die Zeugin befragte. Andererseits schien sie einen beruhigenden Einfluss auf die Frau zu haben. Vorschriften waren an diesem Vormittag schon genug missachtet worden. Auf eine mehr oder weniger kam es also nicht mehr an, noch dazu, wo keiner sich so recht auskannte, was wirklich noch vorgeschrieben war und was nicht.
»Viel ist wirklich nicht mehr übrig von der alten Schönheit«, stellte Ringseisen ungerührt fest. »Schon tragisch, wenn jemand so entstellt von der Front heimkommt. Und das in dem Alter. Der ist gerade mal Mitte dreißig.«
»Da hat es noch viel Jüngere viel übler erwischt«, warf Emil nach einem hastigen Blick auf das von einer blutunterlaufenen Narbe auf der rechten Wange verzerrte Gesicht des Toten ein. »Wenigstens ist er überhaupt zurückgekommen.«
»Ob das immer ein Glück ist? Für ihn war es leider eh nur für kurze Zeit.« Ringseisen betrachtete die Leiche nachdenklich. »So wie es ausschaut, hat er den Täter vermutlich gekannt. Warum sonst hätte er ihn so nah an sich herangelassen? Wahrscheinlich hat er freundlich mit ihm geredet und ist von dem Schuss völlig überrascht worden.«
»Sie kennen den Toten?«, wandte Emil sich an die Zeugin. Sie sah aus, wie man sich die typische Wirtschafterin eines Junggesellen aus gut betuchten, adeligen Kreisen gemeinhin vorstellte: etwa Ende vierzig, Anfang fünfzig, grauhaarig, sympathisches Gesicht. Die leicht untersetzte Figur verriet gute Kochkünste, die sie sich offenbar über den Krieg bewahren und angesichts eines verboten gut gefüllten Vorratskellers auch weiter anwenden konnte. Sofort dachte Emil an das Gemüsebeet, das er zuvor im Garten entdeckt hatte. Praktisch veranlagt war sie offenkundig auch.
Statt zu antworten, nickte sie, fingerte in der weiß gestärkten Schürze nach einem Taschentuch und schnäuzte sich vernehmlich.
Emil zwang sich zur Geduld. Flüchtig sah er auf Billa. Als hätte sie seinen Blick gespürt, hob sie im selben Moment den Kopf und lächelte. Er räusperte sich.
»Lassen Sie uns nach nebenan gehen«, schlug er vor.
Erleichtert erhob sich die Frau und ging zwischen Billa und ihm ins angrenzende Wohnzimmer. Doch statt in einem der tiefen Ledersessel Platz zu nehmen, steuerte sie auf den Flügel zu, griff zielsicher ein Porträt aus den unzähligen Fotografien in Silberrahmen heraus und hielt es Billa und Emil fast schon triumphierend unter die Nase.
»So hat er mal ausgeschaut. Ein schöner Mann, nicht wahr? Und noch so jung!«
Ehe Billa ihm zuvorkommen konnte, nahm Emil den schweren Rahmen in die Hand und betrachtete das Porträt. Tatsächlich zeigte es einen attraktiven jungen Herrn in Leutnantsuniform mit hellem Haar, den Blick verträumt in die Ferne gerichtet, um die Mundwinkel ein fast schon spöttischer Zug, am Kinn eine ausdrucksstarke Kerbe. Zweifelsohne besaß er eine besondere Ausstrahlung. Zugleich wirkte er auf eine gewisse Weise unschuldig-naiv. Oder interpretierte Emil das hinein, weil er aus eigener Erfahrung wusste, was an der Front passiert war und welche Gräuel in den berüchtigten Lagern stattgefunden hatten? Den verträumten Blick und den spöttischen Zug um die Mundwinkel hatte Dietlitz bei seiner Rückkehr gewiss längst verloren.