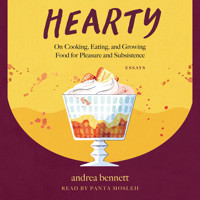9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Galina Petrowna ist seit vielen Jahren verwitwet und lebt in einer kleinen Stadt in der russischen Provinz. Beherzt schlägt sie sich durch den Alltag, stets begleitet von ihrer geliebten dreibeinigen Hündin Boroda. Doch eines Tages wird Boroda von einem Tierfänger entführt, einem finsteren Gesellen, der im Auftrag der Föderation arbeitet. Als Galinas Verehrer Wasja versucht die Hundedame freizukaufen, wird er kurzerhand wegen Bestechung verhaftet. Galina ist wild entschlossen, ihn und Boroda zu befreien, und macht sich zusammen mit ihrer exzentrischen Freundin Soja auf eine Rettungsmission, die sie mitten ins abenteuerliche Moskau führt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Galina Petrowna lebt in einer Kleinstadt im Südwesten von Russland, pflegt mit Hingabe ihren Gemüsegarten und spielt gerne komplizierte Kartenspiele mit ihren Freundinnen. Sie ist kein sentimentaler Mensch, aber selbst die Unsentimentalsten unter uns brauchen jemanden, der sie vervollständigt, und für Galina ist das ihre Mischlingshündin Boroda. Entsprechend entsetzt ist sie, als Boroda eines Tages heimtückisch entführt wird. Dahinter steckt Mitja, ein düsterer Geselle, der nichts und niemanden leiden kann. Nur seinen Job als Hundefänger im Auftrag der russischen Föderation nimmt er sehr ernst. Als Galinas Verehrer, der Seniorenclubvorsteher Wasja, versucht, Boroda wieder freizukaufen, wird er gleich auch noch wegen Bestechung festgenommen. Und so macht sich Galina mit ihrer exzentrischen Freundin Soja auf nach Moskau, um einen mit Soja verwandten Minister um Hilfe zu bitten. Währenddessen trifft Mitja auf die engelsgleiche Katja, die von Anfang an nur an das Gute in ihm glaubt …
Autorin
Andrea Bennett studierte Geschichte und Russisch an der Universität von Sheffield und verbrachte dann einen guten Teil der »Jelzin-Jahre« in Russland. Wieder zurück in Großbritannien folgten einige Jobs im öffentlichen Dienst, derzeit arbeitet sie für eine Wohltätigkeitsorganisation. Sie lebt mit ihrer Familie und ihrem Hund in Kent. »Die wundersamen Abenteuer der Galina Petrowna« ist ihr erster Roman.
ANDREA BENNETT
Die wundersamen Abenteuer der Galina Petrowna
Roman
Aus dem Englischenvon Eva Kemper
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»Galina Petrovna’s Three-Legged Dog Story«
bei The Borough Press, HarperCollins UK.
Zitat »Leben ist kein Gang durch freies Feld« aus dem Gedicht »Hamlet« von Boris Pasternak: »Gedichte und Poeme«. Gesammelte Werke in Einzelbänden. Hrg. v. Fritz Mierau © Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 1996, 2008 (für die Übers. v. Richard Pietraß).
Zitat »Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde!« aus Shakespeares »Heinrich V.«, Übersetzung nach August Wilhelm Schlegel.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Andrea Bennett
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagmotiv: © Getty Images / Dmitry Mordvintsev
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-16460-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Familie, vor allem für Louis
Anmerkung der Autorin
In den Neunzigern gab es wirklich eine dreibeinige Hündin ohne Halsband namens Boroda. Sie lebte in Asow bei einer alten russischen Dame, die sich auf ihrer Datscha abrackerte.
Alles andere in diesem Buch wurde zwar von meinen Erinnerungen an die Menschen und Landstriche Russlands inspiriert, ist aber rein fiktional und möge auch nur als solches betrachtet werden.
Hauptfiguren
Boroda – eine dreibeinige Hündin
Galia, auch Galina Petrowna Orlowa – Borodas Besitzerin
Soja, auch Sinaida Artjomowna Krasowskaja – Galias älteste Freundin
Mitja der Exterminator, auch Michail Borissowitsch Plowkin – ein Hundefänger
Wasja, auch Wassili Semjonowitsch Wolubtschik – Vorsitzender des Altenklubs des Kulturhauses von Asow und ergebener Bewunderer Galias
Baba Plowkina, auch Schenja Plowkina – Mitjas Mutter
Katja – eine hübsche junge Frau
Milizionär Kulakow – ein Polizist
Grigori Michailowitsch Semetschkin – Sojas Cousin, der in Moskau wohnt
Russische Namen bestehen aus drei Bestandteilen: dem Vornamen, dem Vatersnamen (der vom Vornamen des Vaters abgeleitet ist) und dem Familiennamen. Häufig verwendet man Kurzformen des Vornamens oder Kosenamen, aus Galina wird zum Beispiel Galia. Das deutet auf Freundschaft und Vertrautheit hin. Für die förmliche Anrede, die zugleich ein Zeichen von Respekt ist, benutzt man den Vornamen und den Vatersnamen.
1 – Ein typischer Montagnachmittag
»Hallo! Gorjun Tigranowitsch! Hören Sie mich?«
Noch einmal klatschte eine warme braune Hand mit solcher Wucht gegen die Tür, dass sie in den Angeln bebte.
»Er ist tot, ganz bestimmt! Wahrscheinlich haben ihn schon seine Katzen gefressen. Vier Stück hat er, wissen Sie. Vier flauschige weiße Katzen! Wer braucht denn vier flauschige weiße Katzen? Weiße? Lächerlich!«
»Babuschka, hören Sie irgendwo eine Katze miauen?«
Die beiden Damen, eine unbeschreiblich alt und zerfurcht und die andere erst auf dem Weg dorthin, warteten still vor der Wohnungstür und horchten angespannt. Die winzige Baba Krjutschkowa beugte sich ein wenig herab, um ein Ohr gegen das Schlüsselloch zu drücken. Sie schloss die Augen und saugte die Wangen ein.
»Ich höre nichts, Galia«, sagte sie nach einem Moment.
»Das ist doch gut, oder nicht, Baba? Das heißt, dass Gorjun Tigranowitsch wahrscheinlich in Urlaub an die Küste gefahren ist oder vielleicht einen Freund in Rostow besucht und die Katzen bei jemandem untergebracht hat. Und dann liegt er auch nicht tot in seiner Wohnung.«
»Aber Galia, vielleicht sind sie alle tot! Die Katzen und Gorjun Tigranowitsch! Alle tot! Vielleicht war er so zäh, dass sie ihn nicht fressen konnten, und sie sind verhungert! Es sind doch jetzt schon mehrere Tage.«
Das Gesicht der älteren Frau knitterte noch mehr, als sie sich die verhungerten Katzen und die verdorrte, verfallene Leiche von Gorjun Tigranowitsch vorstellte. Sie begann zu schluchzen und rieb sich mit einer knorrigen roten Faust über die Apfelkernaugen. Entlang des staubigen Flurs knarrten und ächzten Türen, und nach und nach tauchten die grauen Köpfe der Nachbarn auf, mit ihren Rosinenaugen, die neugierig nachsehen wollten, was dort solchen Lärm und Aufruhr verursachte. Ein dumpfes Summen ging von einem Ende des Hauses zum anderen, als die betagten Bewohner gleichzeitig von ihrem Mittagsschläfchen aufwachten, ob so geplant oder nicht, und das Schauspiel beobachteten, welches sich im dritten Stock von Haus 11 am Karl-Marx-Prospekt der südrussischen Stadt Asow abspielte. Galia seufzte, bot der älteren Frau ihr Taschentuch an und schnalzte beruhigend mit der Zunge.
»Baba Krjutschkowa, hier draußen auf dem Flur können wir nichts machen. Gorjun Tigranowitsch ist bestimmt bei bester Gesundheit. Er ist noch so rüstig – und er verreist oft, das wissen Sie doch. Erst letzten Monat war er in Omsk.«
Galia stolperte nicht über die Worte, sie sprach sie mit fester, gleichmäßiger Betonung, und trotzdem klangen sie in ihren eigenen Ohren nicht überzeugend: Bei ihrer letzten Begegnung hatte der Herr ausgeschaut wie ein Stück trockener Baumrinde in einem Anzug. »Ich habe ihn letzte Woche gesehen, das weiß ich noch, unten auf dem Markt. Er hat Wassermelonen gekauft. Wenn jemand Wassermelonen kauft, stirbt er nicht bald, er genießt das Leben; er ist kräftig und voller Zuversicht. Wassermelonen sind ein sicheres Zeichen. Wahrscheinlich hat er sie als Geschenk für denjenigen gekauft, den er besuchen wollte. Er kommt bestimmt bald zurück.«
Melonen hin oder her, Gorjun Tigranowitsch legte großen Wert auf seine Privatsphäre, und es hätte ihm nicht gefallen, dass die versammelte betagte Nachbarschaft auf dem Flur über ihn redete. Galia wollte die ältere Dame dazu bewegen, nach Hause zu gehen.
»Trinken Sie doch erst mal eine schöne Tasse Tee, und ich bringe Ihnen ein selbstgebackenes Brötchen. Das wird Ihnen guttun, meinen Sie nicht?«
Die ältere Frau zog immer noch das gleiche Gesicht, aber der Blick ihrer winzigen wässrigen Augen war jetzt auf Galia gerichtet.
»Und wenn er bis zum Ende der Woche nicht wieder aufgetaucht ist, fragen wir den Hausmeister, ob er eine Ahnung hat, wo Gorjun Tigranowitsch steckt.«
»Er hat mir einen Kürbis versprochen, wissen Sie«, sagte Baba Krjutschkowa über die Schulter, als sie über den Flur davonschlurfte. Na, dachte Galia, also da liegt der Hund begraben: Sie fühlt sich um das versprochene Gemüse geprellt.
»Sie können von mir einen Kürbis haben, Baba Krjutschkowa. Meine schmecken genauso gut wie die von Gorjun Tigranowitsch.«
Baba Krjutschkowa zuckte gleichgültig mit den Schultern und schloss ihre Tür, und so blieb Galia wenig anderes übrig, als mit der Zunge zu schnalzen, sanft den Kopf zu schütteln und in ihrer eigenen Wohnung zu verschwinden. Boroda stand in ihrem Karton unter dem Tisch auf, begrüßte sie mit einem dezenten Schwanzwedeln und streckte sich elegant.
Diese tiefe, gutmütige Faulheit der Hunde macht wirklich ihren Zauber aus, dachte Galia. Und die Tatsache, dass sie nicht sprechen können.
Im Gegensatz zu vielen ihrer Nachbarinnen und all ihren Freundinnen im Altenklub des Kulturhauses von Asow weinte Galina Petrowna Orlowa, kurz Galia genannt, so gut wie nie. Während die anderen glitzerten wie Bonbonpapier, das Gorjun Tigranowitschs Katzen zerkaut hatten, saß sie, von der Sonne sanft gebräunt, aufrecht auf ihrem Stuhl, ballte die muskulösen Hände zu leicht geschwollenen Fäusten und bettete sie auf den Blümchenstoff über ihren Oberschenkeln. Aufmerksam hörte sie sich die Klagen der anderen an, und wenn ihr Gegenüber Geschichten aus einem Leben erzählte, das nicht einfach war, seufzte sie und brummelte mitfühlend. Galia schwelgte nur selten in Erinnerungen. Sie fand, sie lebe in der Gegenwart. Wichtig waren ihr gutes Essen, ihr Gemüsegarten, knifflige Kartenspiele und ihre Freundinnen. Sie war stolz auf ihre Stadt und den Landstrich, und fraglos hätte sie ihr Vaterland gegen jede Kritik verteidigt, die nicht von ihr selbst stammte. Ganz sicher war sie kein sentimentaler Mensch.
Aber selbst die Unsentimentalsten unter uns brauchen etwas oder jemanden, und im Herbst ihres Lebens hatte Galia etwas gefunden, was sie vervollständigte, eine Quelle, aus der sie ihr Mitgefühl, ihre Geduld, ihre Sicherheit und ihre Kraft schöpfte. Es waren weder die Kirche noch der Alkohol, nicht Klatsch oder Gartenarbeit: Die Quelle ihrer inneren Ruhe war ihre dreibeinige Hündin.
Die Hündin hatte ein schmales Gesicht und elegante Beine, auf denen das drahtige graue Fell in kleinen Büscheln wuchs. Ihre dunklen Augen saßen schräg über hohen Wangenknochen; sie mochten an einen längst verlorenen Verwandten erinnern, einen Barsoi, der in den Ebenen des Ostens unter einem Baldachin aus erkalteten, tränengleichen Sternen wartete. Das war Galias erster Eindruck gewesen, als sie die Hündin zum ersten Mal von Weitem vor der Fabrik entdeckte, allerdings ohne ihre Brille. Bei näherem Hinsehen machte die Mischlingshündin keinen besonders blaublütigen Eindruck mehr: Sie hatte den Platz unter einer besonders widerlichen Imbissbude zu ihrer Bleibe erkoren und suchte verhuscht und mit eingezogenem Schwanz nach etwas Essbarem. Galia würdigte das Tier keines Blickes. Fünf Tage lang tat Galia so, als sei die Hündin gar nicht da, und wandte verstohlen den Kopf ab, wenn sie auf dem Weg zum Gemüsegarten oder nach Hause an dem Tier vorüberging. Und dann, am sechsten Tag, sah sie, wie die Hündin mit ihrer verbliebenen Vorderpfote versuchte, ein Stück Knochen unter dem vollgepinkelten Imbiss auszugraben. Armer Hund: nur drei Beine. Er rief in Galia ein Gefühl wach, einen vagen Hauch von jemandem oder etwas vor langer Zeit, das längst fort war. Etwas, das sie festhalten wollte, aber nicht einmal berühren konnte. Die alte Dame beobachtete die Hündin und seufzte. Bei dem Geräusch spitzte das Tier die Ohren und hörte auf zu scharren. Ein kurzes, atemloses Innehalten drängte sich in den geschäftigen Nachmittag, und ein langer Blick aus dunkelbraunen Augen fuhr direkt durch Galias Wollstrickjacke in ihr Herz. Ihrer beider Schicksal war besiegelt, ob es ihr gefiel oder nicht.
Vorsichtig grub Galia das Knochenstück mit ihrem Taschenmesser aus und gab es der Hündin, die es behutsam zwischen die weißen Zähne nahm. In der einsetzenden Dämmerung folgte die Hündin Galia in höflichem Abstand nach Hause, ohne auf die gebrummelten Kusch-Laute zu achten, die träge wie sonnenverwöhnte Bienen Galias Kehle entstiegen. Die Hündin saß geduldig vor der Wohnungstür, während die Dunkelheit den Flur entlangkroch, und saß immer noch dort, als sich die Sonne über den Horizont schob und die Amseln ihren Gesang anstimmten. Nach einer Nacht tief in Gedanken gab Galia nach und öffnete die Tür weit. Die Hündin schlüpfte herein, setzte sich ruhig unter den Küchentisch und sah sich mit ihren strahlend neugierigen mandelförmigen Augen um.
»Wie sollen wir dich denn nennen, Hundedame, hm? Ob du schon mal einen Namen hattest? Wahrscheinlich Fido oder Shep oder Scharik oder etwas ähnlich Hässliches, das gar nicht zu dir passt. Aber egal. Sieh dich nur an, du hübsche Dame, mit deinen Wangenknochen und dem spitzen Bart: Wir nennen dich Boroda, die Bärtige. Da haben wir doch was.«
Und so nannte Galia die Hündin Boroda, um ihren feinen, spitzen Bart zu würdigen.
* * *
Manchmal, wenn Galia die kräftigen Arme in eine große, kühle Schüssel mit Teig steckte und die klebrige Masse zu den köstlichsten Leckerbissen diesseits von Charkow knetete, wanderten ihre Gedanken in die Vergangenheit. Zwar betonte sie immer, sie würde in der Gegenwart leben, aber seit sie langsam alt wurde, hatte sie hin und wieder das Bedürfnis, sich zu erinnern. Nicht, um Antworten zu suchen oder einen längst vergessenen Streit zu verarbeiten oder um zu weinen und zu vermissen und nachzuhängen, sondern um sich daran zu erinnern und sich zu vergewissern, wer sie war und woher sie kam. Auch jetzt stand Galia in ihrer Küche, rollte den Teig zu riesigen schneeweißen Fladen aus, die sie in Hunderte Teiglinge schneiden, füllen, zusammendrücken und kochen wollte. Sie schwitzte in der Mittagshitze, und gelegentlich fielen die salzigen Tröpfchen auf den wachsenden Fladen vor ihr. Ihre Stirn wurde feucht, und ihre Miene verfinsterte sich, während sie das Essen weiter vorbereitete und die Erinnerungen sie bedrängten, und Boroda zog sich weiter unter den Tisch zurück und kletterte in ihren Pappkarton in der dunkelsten, kühlsten Ecke.
Galia hatte ihre Eltern, ihre Jungfräulichkeit und einen Großteil ihrer Zähne im Großen Vaterländischen Krieg verloren. Alles Dinge, die sie in der Erinnerung nicht noch einmal durchleben wollte. Innerhalb weniger Wochen, die ihr vorkamen wie ihr ganzes Leben – und gleichzeitig kaum länger als ein Fingerschnipsen, weil die Zeit stillgestanden hatte oder erloschen war oder schlicht explodiert –, war sie erwachsen geworden. Diese Handvoll Wochen hatte sie in ihrem Gedächtnis weiter verdichtet, zu etwas Unberührbarem, und es in eine schwarze Kiste gesperrt. Hätte jemand den Deckel geöffnet, hätte er nichts anderes gehört als einen nicht enden wollenden Schrei und nichts gesehen außer einer riesigen mechanischen Hand, die über verdorrte Gebeine scharrte, und er hätte nichts gefühlt außer dem eisigen Wind der Steppe und unbändigem Hunger. Eine Kiste voller Erinnerungen, die leugneten, dass es die Sonne, Tiere, Bäume, Lachen oder eine Kindheit jemals gegeben hatte. Eine Kiste, der sich Galia nur selten zu nähern wagte.
Diese Zeit der sinnbetäubenden Veränderungen, Schmerzen und Opfer bescherte ihr auch – wie ein ausgesprochen großes und schwieriges Bündel, das der Storch brachte – einen Ehemann. Einfach so! Auch über diese Tatsache grübelte sie nicht gerne nach, aber sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, wie das passiert war. Damals war sie ein schmächtiges Mädchen gewesen, mit milchweißer Haut und kleinen blonden Locken, die sie unter einer speckigen khakifarbenen Mütze versteckt hielt. Mutterseelenallein und derart verängstigt, dass sie sich nicht einmal an die Gesichter ihrer Eltern oder an ihr eigenes erinnern konnte, hatte sie sich irgendwie mit Pascha und seiner Feldküche und einer Gruppe versprengter Soldaten zusammengetan, weit hinter der Front und nur wenige Wochen vor dem Sieg in Europa. Pascha: ein bisschen schwach, ein bisschen faul vielleicht, mit wässrigen braunen Augen und einem Lächeln so feucht wie Kutteln. Für eine Weile sorgte er dafür, dass sie die schwarze Kiste nicht mehr sah. Er lächelte, und plötzlich schien es möglich, dass es irgendwann mal Lachen gegeben hatte. Und dass es bedeutet hatte, etwas war lustig, und nicht, jemand war verrückt. Wie Ballast kam er ihr vor, durch Pascha blieb sie mit beiden Beinen auf dem Boden, während die Welt bebte und um sie herum der Krieg zu Ende ging.
»Ach, so ein Pech, ich Tollpatsch«, murmelte Galia, als ihr das letzte wareniki aus den müden Fingern glitt und in einer kleinen Mehlwolke auf dem Boden landete. Boroda in ihrem Karton unter dem Tisch reckte leicht den Hals, um höflich anzudeuten, dass sie das heruntergefallene Häppchen gern beseitigen würde, wenn Galia es erlaubte.
»Nimm ruhig, lapotschka, du kannst es ruhig haben. Aber dann richtig, mach alles sauber, mein bärtiges Fräulein.« Borodas schmale rosa Zunge schleckte die Masse in Sekunden auf, und ihr Schwanz klopfte dabei sanft gegen eine Seite des Kartons.
»Nicht schlingen, hörst du – nicht einmal Straßenhunde müssen schlingen!«, neckte Galia sie. Boroda warf ihr einen dankbaren Blick zu und leckte weiter fein säuberlich den Boden ab. Die Hündin war genügsam: Sie ließ sich mit Brot, Kartoffeln, dann und wann ein paar Streifen Fett und Obststückchen füttern. Für gewöhnlich wäre sie nie auf die Idee gekommen, bei Tisch um Essen zu betteln, aber wenn es ihr vor die Pfoten fiel, war das ja etwas anderes. Galia ihrerseits wäre nie auf die Idee gekommen, ihr ein Halsband umzulegen. Sie waren gleichgestellt und aus freien Stücken in geselliger Stille zusammen. Es gab keinen Zwang und keinen Bedarf für neue Kunststückchen. Nachdem der kleine Küchenunfall beseitigt war, leckte sich Boroda die Lefzen und dann die Spitze ihres langen, dünnen Schwanzes und rollte sich zum Schlafen zusammen.
Bevor Galia wieder in ihre Tagträume abgleiten konnte, piepste plötzlich das Telefon, und sie ging schnaufend in den Flur. »Ach herrje!«, brummelte sie. »Bekommt man in dieser Welt denn gar keine Ruhe?« Dann rief sie: »Hallo! Ich höre!«
»Galina Petrowna, guten Tag! Hier ist Wassili Wolubtschik«, meldete sich eine selbstsichere, wenn auch etwas knarzende Stimme.
»Ja, ich weiß«, antwortete Galia seufzend, und weil sie befürchtete, dass sie unhöflich geklungen hatte, fuhr sie fort: »Was kann ich für Sie tun, Wassili Semjonowitsch?«
»Ich wollte nur hören, ob Sie heute Abend zum Treffen kommen, Galina Petrowna. Wir haben wirklich ein spannendes Programm: Die Lotterie und … ähm, oh, ähm, verflixt, was war es doch gleich? Das Aufregendste habe ich vergessen, ähm …«
»Ja, Wassili Semjonowitsch, ich komme. Es wird bestimmt sehr unterhaltsam. Auf Wiederhören!« Damit legte Galia auf und runzelte leicht die Stirn. Wenn Wassili Semjonowitsch Wolubtschik eines war, dann hartnäckig. Seit wenigstens drei Jahren rief er jeden Montag an, damit sie auch ja nicht vergaß, zum Altenklub zu kommen. Und jede Woche versprach er ihr etwas Aufregendes. Bisher war die aufregendste Veranstaltung im Altenklub ein Vortrag über Fellatio gewesen, von einem örtlichen Liebhaberverein. Oder war es Philatelie – den Unterschied konnte Galia sich einfach nicht merken. Und wirklich aufregend war es nicht gewesen – eine nette Zerstreuung, mehr nicht, fand sie.
In ihren weichen weißen Pantoffeln tapste sie den Flur hinunter, um sich das Gesicht und den Hals zu waschen. Sie hatte das Gefühl, der Abend würde langweilig werden. Als sie später daran zurückdachte, konnte sie kaum glauben, wie sehr sie sich geirrt hatte. Sie spürte nicht den Hauch einer Vorahnung davon, wie stark sich ihr Leben verändern würde. Das geht den Menschen oft so.
* * *
»Sträntsch laaf, sträntsch heis ent sträntsch loos, sträntsch laaf, sät’s hau mei laaf groos …«
Im östlichen Teil der Stadt, in einem quadratischen Verschlag von einem Zimmer mit orangefarbenen Wänden und einem glänzenden senfgelben Linoleumboden, intonierte ein noch recht junger Mann die Worte seiner geliebten Band Depeche Mode ohne erkennbare Melodie. Er trug eine Art Uniform, die tadellos sauber war, für jeden in seiner Nähe aber immer noch irgendwie unangenehm roch. Während die Sonne draußen unbemerkt unterging, war der Mann unter einer nackten Sechzig-Watt-Birne in gewissenhafte Vorbereitungen vertieft. Seine schwarze Nylonhose, faltenfrei und mit fest geschnürtem Gürtel, erzeugte auf seinen Oberschenkeln eine schwache Spannung, durch die sich bei jeder Bewegung die schwarzen Härchen auf seiner Haut aufstellten. Sein blaues Uniformhemd war ordentlich und gebügelt und rundherum fest in die Hose gesteckt. Wenn er die Arme hob, um sich zu kämmen, straffte sich der Stoff hörbar, was er irgendwie befriedigend fand. Er hatte sich sorgfältig rasiert, auch am Hals und dem Teil der Schultern, den er erreichen konnte, und hatte seine Nase geleert, indem er ins Waschbecken geschnäuzt hatte (den Flur runter links, nein, zweite links: Die erste Tür links gehörte zum Zimmer des gewalttätigen Alkoholikers – na ja, des einen gewalttätigen Alkoholikers). Seine Ohren hatte der Mann mit einem Streichholz gesäubert und das Streichholz dann sicher im Mülleimer entsorgt – nicht in der Toilette, wie es einmal aus Versehen passiert war; danach war das Streichholz tagelang in der gelblich braunen Brühe gedümpelt und hatte ihn derart beunruhigt, dass er am Ende nicht schlafen konnte. Übrigens war auch einmal ein Streichholz nachlässigerweise auf dem Nachtschränkchen liegen geblieben. Aber nur ein einziges Mal. Das Streichholzproblem war gelöst, und Mitja war der kleinen Holzstäbchen mit ihren rauen roten Köpfchen entschlossen Herr geworden. Jetzt landeten sie immer sofort im Mülleimer, und er konnte ruhig schlafen.
Diese Dinge machte er jeden Tag in einer festen Reihenfolge. Besser gesagt, jeden Abend. Er drehte die Kassette um – Depeche Mode, Music for the Masses –, wie immer um diese Zeit, und drückte mit dem Mittelfinger der rechten Hand auf Start. Als die Musik erklang, atmete er tief durch und schloss die Augen. Er stellte sich den Abend vor, der vor ihm lag, und schnaubte leise und zufrieden, nur für sich.
Mitja war gründlich. Er war stolz darauf, gründlich zu sein. Er hätte sogar Gründlich und Umsichtig heißen können, fand er, hätte sein zweiter Vorname nicht Boris gelautet. Stirnrunzelnd hielt er inne, die Schuhbürste einsatzbereit in der Hand. An seinen zweiten Vornamen zu denken verdarb ihm die Stimmung, so wie ein Bellen die Stille verdarb, und der Gedanke an Mutter warf einen Schatten auf ihn, dass er schauderte. Er nahm seiner Mutter so einiges übel, und sein zweiter Vorname gehörte dazu. Der Name eines Trinkers, ein einfallsloser Name: ein typisch russischer Name. Sein linkes Auge zuckte leicht, als er mit der Schuhbürste auf seine Mutter zielte, die er sich neben der Tür vorstellte, und langsam und bedächtig den imaginären Abzug drückte. Ihr grüngraues Hirn spritzte über die orangefarbene Wand, als Dave Gahan gerade einen schmissigen Refrain anstimmte. Ein Zittern lief von Mitjas Magen zu seiner Leiste. Das Leben war schön. Er hatte seine Ordnung, er hatte seine Arbeit, und in diesem Zimmer im Ostteil der Stadt konnte er über seine Sachen selbst bestimmen. Er war Herrscher über alles, so weit das Auge reichte.
Vom Flur drang ein gedämpftes Klicken in sein Zimmer, und Mitja erstarrte, denn er witterte Ärger. Er hatte sich nicht getäuscht: Plötzlich erbebten seine orangefarbenen Wände unter einem hämmernden Rhythmus, der den Ton seiner Kassette hinwegfegte wie ein Schneesturm eine Kerzenflamme. Mitja ließ die Schuhbürste sinken und biss sich auf die Lippe. Sein Nachbar, Andrei der Swolotsch, schmiss eine Party, schon wieder. Bald würden sich dort Mädchen mit zu viel Schminke tummeln, Mädchen mit zu viel Parfüm, Mädchen mit unmöglich kurzen Röcken und Strumpfhosen voller Laufmaschen, die sich mit Klauenfingern nach ihrem Unaussprechlichen streckten. Mädchen: Sein Nachbar hatte bei ihnen anscheinend Erfolg. Je jünger, desto besser, war Andreis Devise, obwohl Mitja immer versuchte, nicht hinzuhören, wenn sein Nachbar den hässlichen Mund voller Zahnlücken aufmachte. Mitja hielt überhaupt nichts von Andrei und seinen Mädchen. Er steckte den Kopf durch die Tür und bedachte sie mit finsteren Blicken, und wenn sie lachten, schloss er die Tür und sah ihnen mit finsterem Blick durch das Schlüsselloch zu. Wenn sie das Zimmer von Andrei dem Swolotsch verließen und zur stinkenden Gemeinschaftstoilette am Ende des Flurs gingen, beobachtete er sie manchmal auch mit finsterem Blick durch das Schlüsselloch der Toilettentür, nur um seinen Standpunkt klarzumachen, obwohl er sich danach immer mies fühlte. Er wusste selbst nicht, warum er das tat. Im Grunde interessierten sie ihn gar nicht. Im Grunde wollte er sie ja gar nicht sehen. Sie waren doch nur haarige Mädchen.
Mitjas Ansicht nach waren Mädchen und ganz allgemein Frauen – weibliche Personen, um es korrekt auszudrücken – eine Ablenkung. Männer sollten ihr Ziel im Blick und ihre fünf Sinne bei sich behalten. Mädchen hatten zu warten, bis der Kampf vorüber war. Oder fast vorüber, denn Mitjas Kampf würde nie ganz vorüber sein. Sollte es jemals zwischen ihm und einer Frau zu Körperkontakt kommen, würde er ihr vor dem eigentlichen Kontakt ihrer Körper erst einmal klarmachen, an welcher Stelle seiner Rangliste sie stand: Irgendwo weit unten, weit hinter Arbeit, Essen, Schlafen, Bier, dem Gang zur Toilette, Depeche Mode und Eishockey. Oh ja, er würde es ihr zeigen. Sie würde schon merken, dass sie von Glück sagen konnte, mit Mitja Körperkontakt zu haben. Eines Tages. Wenn er genug Zeit hatte. Wenn er die Richtige traf.
Mitja hielt die Schuhbürste immer noch einsatzbereit in der Hand, ein Kunstlederstiefel glänzte schon, der andere war noch ein wenig matt. Mitja sammelte sich, schob jeden Gedanken an Mädchen entschieden beiseite, sogar gänzlich aus seinem Kopf, und polierte den matten Stiefel mit so fieberhaften Strichen, dass seine Hand in der Bewegung verschwamm und sein ordentlich gekämmtes Haar vibrierte wie ein warmer Pudding auf einer Waschmaschine. Als er fertig war, glänzte der Stiefel, und kleine Schweißperlen glitzerten auf Mitjas Stirn. Er nahm ein Papiertuch, faltete es zwei Mal und tupfte sich die Tröpfchen ab. Sein Arm schmerzte ein wenig, und sein Herz schlug schneller.
Nachdem die Stiefel anständig geputzt an seinen Füßen saßen, steckte er sein Portemonnaie, seine Schlüssel und den Kamm ein und gestattete sich einen letzten Blick durch das Zimmer. Alles unter dem grellen Licht der einsamen Glühbirne befand sich an seinem Platz. Jetzt würde er aufbrechen, und es würde ein langer Abend werden. Er kam sich groß vor, und ihm gefiel, wie seine selbstsicheren Schritte über den Boden dröhnten. Er war ein Mann mit einer Mission, ein Mann mit einem Plan. Er war wichtig. Die einzige Wolke am Horizont, wenn man es so sagen konnte, war seine schmerzhaft gefüllte Blase.
Auf dem Flur lehnte Andrei der Swolotsch in seiner Tür, der Nachbar mit den scheußlich gefärbten Haaren. Er roch nach billigem Rasierwasser. In einer Hand hielt er eine Zigarette, mit der anderen rieb er über den Oberschenkel eines Mädchens, das aussah, als ginge es noch zur Schule.
»He, Mitja, willst du wieder den ganzen Abend arbeiten? Du bist echt scheißlangweilig, Alter! Trink doch einen mit uns. Komm schon – guck mal, was wir haben. Vielleicht willst du ja auch was.« Andrei schob der Kleinen eine Hand zwischen die Beine, und sie kreischte.
Mitja zuckte zusammen, trotzdem konnte er sich einen Blick in das blutrote Zimmer seines Nachbarn nicht verkneifen. Es war das Abbild der Hölle. Überall Frauen: hingegossen auf seinem Bettsofa, über den Fernseher gebeugt, breitbeinig auf dem Rennmauskäfig.
»Ich gehe zum Dienst, ich muss nur vorher kurz pissen«, grummelte er und stapfte weiter den Flur hinunter. Vor der Toilettentür gab er einem Impuls nach, drehte sich um und giftete: »Du musst das Klo sauber machen, Andrei. Du bist an der Reihe. Ich habe es jetzt vier Mal hintereinander geputzt. Ich mache das nicht noch mal!«
Andrei der Swolotsch lachte, dass seine vergilbten Stummelzähne zu sehen waren, schob das Mädchen in sein rotes Zimmer und schlug die Tür mit einem dumpfen Knall zu. Als Mitja fest gegen die Toilettentür drückte, stieß er sich die Nase an seinem Handrücken. Die Tür war schon wieder verschlossen.
»Verdammter Mist.«
Seine prall gefüllte Blase ließ sich nicht länger ignorieren. Weiter anzuhalten war so anstrengend, dass es ihm den Schweiß auf die glatte Oberlippe trieb. Seit über einer halben Stunde hatte er in regelmäßigen Abständen darauf gewartet, die verdreckte Toilette benutzen zu können, aber jedes Mal, wenn er aufgegeben hatte und wieder in sein Zimmer gegangen war, war der verdammte Mensch, der die Toilette besetzt hatte, herausgeschlurft und von einem anderen Inkontinenten abgelöst worden, bevor Mitja es über den Flur geschafft hatte. Also musste er jetzt warten; er lehnte sich neben der Tür des gewalttätigen Alkoholikers an die Wand, obwohl es riskant war, kniff die dünnen Beine fest zusammen und ballte immer wieder die Fäuste. Noch einmal hämmerte er gegen die Tür.
»Komm schon raus, du stinkender alter Penner! Ich rufe den skoraja – dann kommst du in die Ausnüchterungszelle!« Mitja musste wirklich dringend pinkeln.
Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit, und im schwindenden Dämmerlicht spähte zögerlich ein pfirsichweiches Gesicht hervor. Nach einem Moment schwang die Tür in den quietschenden Angeln weiter auf, und es kam nicht der stinkende alte Alkoholiker mit Erbrochenem auf dem Kinn heraus, sondern ein zur Erde herabgestiegener Engel. Mitja schnappte nach Luft; er spürte, wie sich Speichel in seinem Mundwinkel sammelte und ihm sanft über das Kinn sickerte. Ein so schönes und so vollkommenes Mädchen hatte er noch nie gesehen. Blonde Haare umrahmten ein zartes Gesicht mit Apfelbäckchen, einer kleinen Nase mit Sommersprossen und Augen, deren Blick eine Stelle tief in seinem Magen zu liebkosen schien. Und da stand das Mädchen nun vor der stinkenden Toilette, und an seinen perfekten pfirsichfarbenen Kunststoffballerinas hing ein verdrehter Streifen gelbes Toilettenpapier.
»Entschuldigung«, lispelte sie und schaute durch verklebte schwarze Wimpern zu ihm auf.
»Nein! Ähm …« Mitja wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Ich muss mich entschuldigen, ähm, kleine weibliche Person. Warte, ich halte auf.« Er hielt die kippelnde Tür fest, während das Mädchen unter seinem Arm hindurchschlüpfte. »Ich wusste nicht … Ich dachte, du wärst der alte Mann, der ein Stück den Flur hinunter wohnt. Er hockt … stundenlang … im kleinsten Raume.«
»Mein Gott, ein Wunder, dass er dann noch lebt«, scherzte der perfekte Engel mit einem Augenzwinkern.
Mitja spürte, wie tief in seinem Innern etwas sirrend zitterte, als hätte sich in seiner Seele ein Band gedehnt und wäre gerissen, ohne die Hoffnung, je wieder zusammenzuwachsen. Die junge Frau wandte sich ab und ging mit wiegenden Schritten den Flur hinunter, zierlich und überirdisch. Vor dem letzten Zimmer blieb sie zögernd stehen und sah zu ihm zurück.
»Wer bist du, du Schöne?«, platzte es aus Mitja heraus, obwohl er keinen Laut von sich geben wollte, obwohl er nicht gemerkt hatte, wie sich sein Mund öffnete, und er seiner Zunge gar nicht erlaubt hatte, Wörter zu formen.
»Katja«, antwortete sie, als läge das doch auf der Hand, und verschwand hinter der letzten Tür des Flurs. Das Klicken des Schlosses traf Mitja wie ein Schlag ins Gesicht, und er keuchte.
Während er lange und gemächlich pinkelte, durchfuhr ihn der Gedanke, dass der Engel noch vor einem Moment hier gesessen hatte. Er erschauerte. Unwillkürlich beugte er sich weiter vor und konnte eben noch zwischen all den unschönen Gerüchen einen Hauch von ihr wahrnehmen. Ihr Duft, der Moschushauch eines Engels, war subtil, aber mächtig. Ein Rütteln am Türgriff riss ihn aus seinen Tagträumen, holte ihn in die Gegenwart zurück und katapultierte ihn in die Realität des kleinsten Raumes. Er schob sich durch die Tür, vorbei an dem wackligen alten Mann, der ihm etwas Unverständliches, aber niederschmetternd Deprimierendes nachbrüllte, und lief nach unten zu seinem Lieferwagen.
Dass es so weit mit mir kommen musste, dachte er und trat schwungvoll nach einer getigerten Katze. Der Tritt ging kilometerweit daneben, Mitja verlor das Gleichgewicht, musste sich an einer Hecke festhalten und versuchte, das gedämpfte Lachen zu überhören, das von der Bank dahinter aufperlte: einer Bank, auf der sich lauter kleine Kinder und ältliche Weiber drängten – natürlich. »Frauen, Kinder, nichts als Ärger. Ich habe meine Arbeit«, brummte er und wischte sich das Laub von der Kleidung. Er wollte schon weitermarschieren, da trudelte aus den Tiefen der Hecke ein Schmetterling hervor und prallte gegen seine Nase. Mitja ruderte leicht mit den Armen. Wieder dieses scheußliche unterdrückte Lachen.
»Was soll das eigentlich, wieso hockt ihr hier und besetzt die Bank? Habt ihr nichts zu tun?«, brüllte er über die Hecke. Die babuschkas sahen die kleinen Kinder an, die kleinen Kinder sahen die babuschkas an, und dann fingen alle wieder an zu kichern, bis ihnen die Tränen über die Wangen liefen.
»Na, na, schon gut, Mitja, lauf du mal«, krächzte eine Frau mit sonnengebräuntem Gesicht und glänzenden Knopfaugen.
»Schwachköpfe. Greise und Schwachköpfe. Ihr seid nicht besser als Ratten, als lachende Ratten«, schimpfte Mitja, aber nicht so laut, dass sein Publikum ihn hätte hören können. Er drehte sich auf dem Absatz um, der untergehenden Sonne und seinem blitzblanken Lieferwagen entgegen, der im rosigen Licht glänzte. Der Abend war noch jung.
2 – Der Altenklub im Kulturhaus von Asow
Mit einem innig zufriedenen Lächeln beendete Galia ihren Weg den Flur hinunter, auf dem sie die dampfenden wareniki an ihre alten, zittrigen Nachbarn verteilt hatte. Die bucklige Xenia, die inmitten einer Galerie körniger Fotografien ihres Sohnes lebte, hatte das Essen nur zu gerne genommen. Wie es sich gehörte, hatte Galia den Sohn begrüßt und sich vor dem kleinen Schrein bekreuzigt, der hinter dem Fernseher in Xenias Wohnzimmer zu seinem Andenken aufgebaut war. Zwanzig Jahre waren vergangen, aber noch immer lagen die Schlüssel und die Schultasche des Sohnes auf dem Flurschrank, auf den er sie damals geworfen hatte, im Juli 1974, bevor er zum Fluss und zu Abenteuern aufgebrochen war.
Der Nächste war der arme Denis mit seiner riesigen Knollennase und den entstellten Blumenkohlohren, ein Junggeselle mit der Statur eines Bären. Er verschwand mit Galias Gabe in seiner Wohnung und kam dafür mit einer großen Traube fleckiger Weinbeeren zurück. Galia begutachtete die Beeren und überlegte, wie sie sich wohl am besten verwerten ließen: Sie wirkten ein wenig überreif, trotzdem nahm Galia das Obst höflich an. Als Baba Krjutschkowa sich das Essen geben ließ, grummelte sie ein wenig über Gorjun Tigranowitsch und wie egoistisch es doch von ihm sei zu verreisen, ohne ihr etwas zu sagen, und bei Gorjun Tigranowitsch selbst öffnete natürlich niemand. Der alte Armenier war ein Rätsel, und so gefiel es ihm. Es gab Gerüchte über Gold und Reisen ins Ausland und antike Ikonen und Grundstücksverkäufe in Fernost, aber im Grunde kannte niemand auf dem ganzen Flur Gorjun Tigranowitsch näher. Er teilte sein Gemüse mit den anderen und war stets nüchtern, höflich und sauber, aber mehr wusste niemand. Wieder überlegte Galia, ob es richtig gewesen war, Baba Krjutschkowa damit zu beruhigen, er sei verreist. Aber es war wirklich nicht das leiseste Maunzen dieser lächerlich flauschigen weißen Katzen durch die Tür gedrungen, und das wäre es mit Sicherheit, wären die Tiere ein, zwei Tage nicht gefüttert worden. Galia hatte einmal eine Fütterung mitangesehen, als sie vorbeigeschneit war, um etwas Knoblauch gegen eine Ananas zu tauschen, und es war kein schöner Anblick gewesen: Wenn es um Futter ging, wurden die weißen Katzen zu Bestien. Außerdem sollte man nicht herumschnüffeln. Der Nachbar würde schon wieder auftauchen, wenn es ihm passte, oder eben nicht.
Sie ging zurück in ihre Küche. Während Galia die Kunststoffarbeitsplatte abwischte und ihre Gerätschaften wegräumte, schnalzte sie mit der Zunge.
»Hundedame! Boroda! Willst du ein bisschen Fett haben? Komm her, kleine Dame, nimm ein Stückchen Fett, das ist gut für deine Augen.« Galia schnitt für die Hündin schmale Streifen von dem durchwachsenen Hammelspeck ab. Borodas Augen glänzten schon jetzt wie Sterne.
Galia legte das Messer aus der Hand, ließ sich für einen Moment auf ihren winzigen Schemel plumpsen und wischte sich mit einer Ecke ihrer Schürze über die Augen. Sie betrachtete das Messer, das vor ihr lag: Es war so oft geschliffen worden, dass die Klinge nur noch ein dünner Bogen war, so scharf wie eine Chilischote. An dem Tag, an dem Pascha das Messer kaufte, hatte er sich damit in den Daumen geschnitten; er hatte geschäumt vor Wut. Während sie die Wunde mit Jod gereinigt und mit Mull verbunden hatte, hatte er unablässig vor sich hin gebrummelt. Damals, kurz vor dem Ende, war er schon komisch geworden, er war krank und nicht mehr er selbst.
Träge und selbstvergessen schlug es zur halben Stunde, und Galia wuchtete sich von ihrem Schemel hoch. Es war Zeit für den Altenklub. Sie spähte durch ihre Fenster in den heißen Abend hinaus. Im Hof stieg Gelächter auf wie Blasen im Bier, sie hörte Kinder spielen. Das dicke junge Mädchen auf der Bank kreischte ab und an: Das nimmt kein gutes Ende, dachte Galia, während sie nach den Mücken schlug, die zum Sturzflug auf ihre Haare ansetzten. Boroda kam zu ihr und drückte sanft ihre Schnauze gegen die Kante von Galias offener Hand. Galia sah auf die Hündin hinab und lächelte.
In der kühlen Dunkelheit des Schlafzimmers ging sie an ihren Kleiderschrank und suchte das geblümte Kleid für heute Abend aus. Sie konnte zwischen vier Kleidern wählen, die unterschiedliche Farben kombinierten, aber sonst beinahe identisch aussahen. An diesem Abend würden es die blau-weißen Blumen werden, dazu die blauen Sandalen über hautfarbenen Kniestrümpfen. Und sie würde sich das weiße Kopftuch umbinden, um die Mücken von ihren Haaren fernzuhalten. Nichts konnte einen so sehr aus dem Konzept bringen wie zappelnde Mücken in den Haaren. Warum sind Mücken überhaupt erschaffen worden, überlegte sie, wenn sie allen anderen Wesen doch nur lästig fallen? Aber ihre Überlegungen währten nicht lange, es war so anstrengend, die Kniestrümpfe über die heißen, geschwollenen Knöchel zu ziehen, dass der Gedanke bald aus ihrem Kopf verschwand.
Boroda spürte, dass Galia gleich das Haus verlassen wollte, und stellte sich leise vor die Tür. Sie berührte sie gerade eben mit der Nase, hielt den Schwanz still und wartete, bis sie durchgelassen wurde. Dann balancierte sie munter auf ihren drei Beinen den Flur entlang, die Treppe hinunter und hinaus auf den Hof, wo sie sich kurz unter die Bank setzte und den Kindern beim Spielen auf dem weiten braunen Quadrat aus vertrocknetem Gras zusah.
»Peng! Peng! Peng! Du bist tot!«
Wachsam lief Boroda an den kleineren, eher unberechenbaren Kindern vorbei zu den struppigen Bäumen neben den Schaukeln auf der anderen Seite des Hofs. An einem schattigen Fleckchen legte sie den Kopf auf die Pfote und ließ ihre langen grauen Augenbrauen zucken. Manchmal versammelten sich die Kinder unter dem Baum zu einem zappeligen Kreis um sie herum und bastelten für sie aus den Blättern der Ölweide einen Kopfputz. Damit sah sie edel aus. Sie hoffte, die Kinder würden bald mit dem Schießen aufhören und eine Krone oder zwei für sie basteln.
* * *
Die Lampen des Altenklubs im Kulturhaus von Asow brannten hell – sofern Glühbirnen eingedreht waren. Das Gebäude selbst war typisch für die Stadt: Betonplatten, große Fenster, die hoch in den rissigen Wänden saßen und auf Parkettböden blickten, die sich ihrerseits allmählich aus der Verankerung rissen. Fünfundvierzig Frauen und zwei Männer, von denen einer nicht zu atmen schien, saßen oder standen an Tischen entlang der Wände des Hauptsaals. An einem Ende ergoss sich vom oberen Rand einer breiten Durchreiche ein Meer von Grünlilien. Mit ihren verschmierten Pflanzenfingern strichen sie über die Tabletts auf dem Tresen unter sich, auf denen vertrocknete Plätzchen, Cracker und Brezeln lagen. Das Gebäck hätte ohne Weiteres vom Mars stammen können. In der Mitte des Saals blätterte der Gastgeber, Vorsitzende und federführende Oberst Wassili Semjonowitsch Wolubtschik, Wasja für seine Freunde, in Unterlagen, ließ Stifte fallen und stempelte die hochwichtigen offiziellen Mitgliedskarten ab.
Galia betrachtete den Altenklub als ziemliche Zeitverschwendung. Trotzdem fühlte sie sich verpflichtet, ihn zu besuchen, schlicht, weil sie alt war. Es gab Kartenspiele und Tee, Schach und Diskussionen. Und vielleicht einen Vortrag über Astrologie oder gesunde Ernährung, als wüssten die anwesenden Alten nicht, was das Schicksal für sie bereithielt oder welches Essen sie umbrigen konnte. Galia gab ihre Karte zum Stempeln ab, wich Wasjas fragendem Blick aus, nickte ihrer alten Freundin Soja zu, deren Haare dieses Mal knallviolett leuchteten, und wollte sich einen Platz in der Ecke suchen.
»Einen Moment, Galina Petrowna, meine Liebe«, tönte Wasja wie eine alte gesprungene Glocke. Er sortierte Blätter, die ihm immer wieder aus den Händen glitten und sich in einem großen hoffnungslosen Schwung über den Boden verteilten. Unwillkürlich spitzte Galia die Lippen, ein leichtes Zucken befiel ihr linkes Auge.
»Hier, bitte, das ist das Programm für heute Abend. Ich dachte, Sie möchten vielleicht etwas über die Kleine Kohlfliege erzählen.«
»Wirklich, Wassili Semjonowitsch? Warum?«
»Wasja, nennen Sie mich Wasja – warum so förmlich? Wir sind alt, und die Zeit ist nicht unsere Freundin. Wir sind alt, also müssen wir die besten Freunde sein.«
Der abgenutzte und kein bisschen unterhaltsame Spruch brachte Galia zum Seufzen. »Schön und gut – Wasja –, aber ich weiß noch, dass ich im letzten Frühjahr schon einen Vortrag über die Kleine Kohlfliege gehalten habe.«
»Ja, ja, meine Schwester, das stimmt. Aber es lohnt sich doch immer, die Leute daran zu erinnern, wie man sich am besten vor dieser Plage schützt, finden Sie nicht? Und ich glaube, es sind seitdem einige Mitglieder dazugekommen und einige gegangen.«
Was neue Mitglieder betraf, war sich Galia nicht so sicher, aber es versetzte ihr einen schmerzlichen Stich zwischen die Rippen, als sie daran dachte, dass einige geschätzte Klubmitglieder sie tatsächlich verlassen hatten.
»Ja, Sie haben natürlich recht, Wassili Semjonowitsch.« Galia zermalmte den Gedanken, dass alle Anwesenden über die Kleine Kohlfliege wussten, was es nur zu wissen gab. Sie reckte das Kinn und deutete ein würdevolles Lächeln an. »Ich halte mit Vergnügen noch einmal einen Vortrag über die Kohlfliege.«
Tatsächlich bat Wasja sie häufig, über Gemüsekrankheiten zu sprechen, und obwohl sie es nie zugegeben hätte, fühlte sie sich insgeheim geschmeichelt. Wasja seinerseits glaubte, ihr Vortrag über den Maikäfer sei vielen in Asow als Höhepunkt des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts, im Gedächtnis geblieben. Bei ihm hatten ihre Worte jedenfalls tiefen Eindruck hinterlassen.
Als er ihr lächelnd ein Lutschbonbon in die Hand drückte, platzte eine kleine Speichelblase in seinem Mundwinkel. Galia zog die Hand jäh zurück, nickte knapp und marschierte auf ihren Platz zu. Durch die ewig geschlossenen Fenster hoch über ihrem Kopf fiel ihr Blick auf den blassen Mond im Blaubeerhimmel, und sie wünschte sich flüchtig, sie sei nicht hergekommen. Zu Hause wäre es viel schöner gewesen, mit ihren gemütlichen Schlappen, dem Radio, einer Schale dampfender wareniki und ihrer Boroda neben sich. Während sie ihr Bonbon lutschte, die Füße kreisen ließ und der uralten Frau auf dem Stuhl neben sich geistesabwesend zunickte, schlich sich eine Erinnerung in ihre Gedanken, die ebenso unerfreulich war wie eine Kakerlake unter dem Toilettensitz.
An einem mondhellen Abend vor langer Zeit hatte sie etwas sehr Untypisches getan. Pascha war gegangen, offenbar genau in dem Moment, in dem sie sich weggedreht hatte, um ihm Tee nachzuschenken. Da hatte sie dann gestanden, mitten in der Küche, die Teekanne in der Hand. Statt ihren und seinen Teller zu leeren, hatte sie die Teekanne auf die Plastiktischdecke gestellt, mit zitternden Händen ihre Strickjacke und die Schuhe angezogen und war ihm gefolgt. Sie hatte seine gleichmäßigen Schritte auf der Treppe gehört, den Gang entlang, über den Hof, dann flott die Gasse hinunter. So gut sie konnte, war sie ihm durch das alte Stadtzentrum nachgeschlichen. Sie war sich hinterhältig vorgekommen, aber sie konnte nicht stehen bleiben. In ihrem bauschigen Sommerkleid war sie über die Brücke getrippelt, vorbei an der Fabrik, weiter zu den Wohnhäusern am östlichen Stadtrand. Ein, zwei Mal hatte sie das Gefühl, ein Krümelchen seines Tabaks oder einen Hauch seiner Haarcreme an den warmen Fassaden der Geschäfte zu spüren, an denen sie entlanglief: Lebensmittelgeschäft Nr. 5, Milchprodukte, Schuhgeschäft Nr. 1 … Es war keine andere Seele in der Nähe. Damals endeten die Abende in Asow recht früh.
Sie dachte schon, sie habe ihn verloren, er müsse bei der Fabrik abgebogen sein und sei nur schnell zurück zur Arbeit gegangen, weil ihm etwas Wichtiges eingefallen war, vielleicht etwas Wichtiges über eine der Frauen dort, die Hosen trugen und Zigaretten rauchten, als ihr ein Stück weiter vorne rechts etwas auffiel. Sie hatte den Stadtrand erreicht und raschelte stoisch weiter. Die letzte halbherzige Straßenlaterne hatte sie schon vor zweihundert Schritten passiert, nur der Mond beschien ihren Weg. Rechts von sich konnte sie vage die Umrisse eines Gebäudes erkennen, große, wuchtige Betonplatten, die wie riesige Spielkarten aufeinanderstanden. Zu ihrer Linken sah sie tote Felder, brachliegend, hügelig, leer. Der Wind trug ein paar Wortfetzen zu ihr, und sie duckte sich hinter einen dunklen Stapel Röhren.
Plötzlich bewegte sich mitten im Stapel etwas, sie schnappte erschrocken nach Luft und zuckte zurück. Ihr Puls hämmerte ihr in den Ohren wie Schritte von wuchtigen Stiefeln im Schnee, während sie in ihren dünnen Leinenschuhen vorsichtig weiterschlich. Als sie noch ein paar Wörter aufschnappte, erkannte sie den Sprecher: Es war Pascha, und jemand antwortete ihm. War das eine Frau? Galia war nicht dortgeblieben, um es herauszufinden. Sie war nach Hause gelaufen, weil sie vor lauter Angst nicht sehen wollte, was an diesem Sommerabend dort draußen war. Die Erinnerung trieb Galia einen Schauder über den Rücken bis hinauf zu ihren Augen, die vor Tränen brannten.
»So, Galina Petrowna, möchten Sie uns jetzt erzählen, was es Neues über die Kohlfliege gibt?«, fragte Wasja Wolubtschik. Galia saß nur da und starrte mit offenem Mund und glasigem Blick den Mond an. Sekundenlang wallte Stille so dicht wie Nebel durch die Menge. Sie wurde nur von einem leisen Schlürfen am Ende des Saals durchbrochen. Wasja befürchtete schon einen Schlaganfall. »Galina Petrowna … Galia!« Sein ernsthafter Ton drang schließlich in Galias Tagträume vor. Das Bild von Pascha und der Baustelle schmolz in sich zusammen und löste sich in den Gesichtern von Dutzenden ihrer Mitsenioren auf, die sie hellwach anstarrten. Zwischen ihren wulstigen Gaumen lutschten sie eine bunte Auswahl an Bonbons zu zungenzerschneidenden Scherben – und warteten. Galia erwiderte die Blicke und schluckte. »Ja, Wassili Semjonowitsch!«
»Brauchen Sie ein Glas Wasser?«
»Nein, vielen Dank, es ist alles in Ordnung. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich habe heute gearbeitet.«
»Und der Mond soll auf Damen ja eine seltsame Wirkung ausüben, nicht wahr?«
Mit einem Zucken um die Lippen sammelte Galia ihre fünf Sinne zusammen. Sie begann ihren Vortrag, ein wenig holperig anfangs, aber nach und nach zeichnete sie ihren dahindösenden Zuhörern ein komplettes Bild. Wasja rückte mit seinem Stuhl näher und starrte sie aus anderthalb Metern Entfernung an: Seine Taubheit bescherte ihm täglich eine große Nähe zu den Damen, und das schätzte und respektierte er.
Doch Wasja machte sich Sorgen: Galia wirkte blass und weniger robust als sonst. Wie so oft ging ihm der Gedanke durch den Kopf, sie brauche einen Mann, der sich um sie kümmerte. Einen guten, alten Mann, etwa einen pensionierten Schulrektor, der einen eigenen Gemüsegarten besaß, vier Enkelkinder, die über siebzig Kilometer entfernt wohnten, ein Motorrad, und zwar ein prächtiges Ural-Gespann (ein Klassiker von 1975), das lief wie neu, drei Paar gute Schuhe, keine schlechten Angewohnheiten, einen reizenden Kater namens Wasik und mindestens fünf eigene Zähne. Wasja hätte nur allzu gern bestätigt, dass er all diese Kriterien erfüllte.
Aber er konnte so nah an Galina Petrowna heranrücken, wie er wollte, sie schien ihn nicht zu bemerken. Sie fütterte ihn mit Fitzelchen an Aufmerksamkeit, gönnte ihm aber kaum einen direkten Blick. Sie widerstand all seinen Avancen. Die Blumen, die er ihr vor die Tür gelegt hatte, blieben dort tagelang unangetastet liegen. Wollte er ihre Hand nehmen, um ihr auf den Bürgersteig zu helfen, wenn sie sich in der Stadt über den Weg liefen (er kannte ihre Gewohnheiten recht gut und schaffte es häufig, am gleichen Tag am gleichen Ort zu sein), lächelte sie zwar, runzelte aber auch die Stirn und wies ihn mit einem leisen, aber bestimmten Zungenschnalzer zurück. Ein oder zwei Mal hatte er sie richtig böse gemacht, obwohl er nicht genau wusste, womit. Ihre Wangen hatten sich gerötet, und mit leicht bebender Stimme hatte sie ihn verscheucht, als wäre er ein Kater, der mitten in ihren Saubohnen sein Geschäft verrichten wollte. Dabei hatte er ihr nur bei ihrer schweren Arbeit helfen wollen. Aber er konnte einfach nicht beleidigt sein, und er konnte nicht aufgeben.
Er hatte eingesehen, dass er das Gefühl brauchte, eine Frau zu umsorgen, und seit seine Maria nicht mehr bei ihm war, wusste er nicht, was er mit sich anstellen sollte. Natürlich konnte er sich durch die Leitung des Altenklubs im Kulturhaus bei der Damenwelt nützlich machen. Und viele Frauen dort waren reizend dankbar. Er bekam Schalen voller Obst und kleine Küchlein und musste nie selbst seine Hose flicken. Doch die Frauen, die für ihn Lippenstift auflegten und im Sommer sogar manchmal Sandalen trugen, konnten ihn in Liebesdingen nicht reizen. Sie waren für ihn wie Schwestern oder Mütter oder sogar wie Töchter. Er wusste nicht, warum. Das war eines der Geheimnisse des Lebens, genau wie die Frage, warum Wodka ganz wunderbar mit eingelegten Gurken, aber nicht mit Kresse schmeckte und warum im Fluss keine Fische mehr schwammen, nicht einmal kleine. Ein Rätsel, und ein gutes dazu. Seufzend stützte Wasja das Kinn auf seinen Gehstock und genoss das Kribbeln seiner weißen Bartstoppeln auf dem alten Plastikgriff ebenso wie die Nähe der unberührbaren Galia.
Mit einem hörbaren Knirschen stand die älteste alte Frau auf, öffnete das braune Mosaikgesicht einen Spaltbreit und ließ eine Stimme ertönen, die aus ihrem Bauch heraufgrummelte oder vielleicht auch aus ihren Stiefeln, die aus dem gleichen Stoff waren wie ihr Gesicht. »Und, Bürgerin, wann ist die Dürre vorüber?«
Galia blinzelte zwei Mal langsam, bevor sie antwortete.
»Babuschka, das weiß ich nicht. Aber wenn ich etwas erfahre, sage ich es Ihnen sofort.«
»Dieser, dieser bourgeoise Kapitalismus! Nur seinetwegen haben wir eine Dürre!«
Galia blickte auf die Blätter Papier in ihrer Hand und dann zu Wasja, der sie mit einem sanften, etwas schiefen Lächeln anstarrte. Ein Schlaganfall, dachte Galia.
»Unsinn, Sie Schrulle!«
Ein Rascheln ging durch den Raum, als sich fünfundvierzig Köpfe langsam, aber sicher nach der Sprecherin umwandten.
»Die Dürre ist eine Strafe für die langen Jahre der Gottlosigkeit!«, erwiderte die zweitälteste alte Frau und stand ebenfalls knirschend auf. Ihre Stimme war so hoch, dünn und durchdringend wie eine vergammelte Geige in einem Eimer voller Essig. Die gerade noch dösende Mehrheit seufzte kollektiv auf und setzte sich zurecht, weil sie spürte, dass sich ihre gemütliche halbe Stunde dem Ende zuneigte.
»Bürgerinnen …«, setzte Galia an.
»Unter Breschnew gab es keine Dürre, Sie Miststück!«
»Aber meine Damen!« Wasja stemmte sich hoch und klopfte mit seinem Stock auf den Parkettboden, um die Ordnung wiederherzustellen. Allerdings hörte niemand das Geräusch. Die Gummikappe seines Stocks dämpfte Wasjas Bemühungen, ebenso wie das im Laufe der gemeinsamen Jahre ausgehärtete Ohrenschmalz und das Kreischen und Grummeln der aufgescheuchten Meute. »Nicht doch, meine Damen! Allgemeine Themen stehen nicht auf dem Programm. Wir müssen noch die Lotterieziehung machen!«
Stühle scharrten über den Boden, als eine Frau nach der anderen aufstand, um sich besser mit ihrer Nachbarin zanken zu können. Sie schüttelten ihre knubbeligen Finger vor den uralten Gesichtern neben sich, und ihre Zungen, die vor fünf Minuten noch schläfrig und schwer gewesen waren, regten sich zu einem ausgewachsenen Kriegsgeschrei und Mordsspektakel. Wasja wurde von dem Ansturm verschlungen und verschwand mit rudernden Armen in einem Gedränge aus wogendem Fleisch in Blümchenstoff und grauen Haaren. Seufzend ließ sich Galia auf ihren Stuhl sinken und sah durch das Fenster hoch über ihrem Kopf. Der Himmel war jetzt tiefschwarz und der Mond scharf und kalt wie die gebogene Silberklinge ihres Schälmessers. Sie wünschte, sie wäre nicht hergekommen.
3 – Mitja der Exterminator
Mitja mochte seine Arbeit nicht. Nein, das wäre ihr nicht gerecht geworden. Man mochte vielleicht ein Eis oder etwas ähnlich Belangloses, bei dem das Gefühl bald wieder abklingt und vor allem etwas mit dem Bauch oder einem anderen schnell befriedigten Bedürfnis zu tun hat. Am Ende hat man klebrige Finger und ein vollgekleckertes Kinn, spürt aber höchst selten so etwas wie Erfüllung. Nein. Mitja lebte für seinen Beruf. Genau genommen war es kein Beruf. Wie sein Chef einmal mit einem, wie Mitja fand, falschen Lächeln gesagt hatte, war es eine Berufung.
Manche folgten dem Ruf der Kirche, um das Wort Gottes zu verbreiten, den Kranken Trost zu spenden, die Sünder auf den rechten Pfad zu führen und die Gastfreundschaft von alten Damen zu genießen, vor allem von solchen, die gute Marmelade machten. Andere waren zum Mediziner berufen, heilten die Kranken, spendeten den Unheilbaren Trost und bekamen Geschenke von dankbaren Verwandten, wenn jemand für Untersuchungen, Ergebnisse und Behandlung anderen Wartenden vorgezogen wurde. Und manche Bürger waren dazu berufen, zur Waffe zu greifen. Mitja sah sich in dieser letzten Gruppe. Er hatte nach der Schule bereitwillig seinen Wehrdienst abgeleistet, ihn aber wie so viele andere sowjetische Kinder nicht besonders gemocht. An der Disziplin hatte es nicht gelegen: Mitja mochte Disziplin und Uniformen, egal, wie schlecht sie saßen oder verarbeitet waren. Auch das Essen war für ihn kein Problem gewesen: Er aß gerne einfach. Die Schikanen und die Kälte hatten ihm nichts anhaben können, und wahrscheinlich hatte ihm der Militärzahnarzt einen Gefallen getan, als er ihm die vielen Zähne gezogen hatte. Aber mit der offenkundigen Sinnlosigkeit des Wehrdienstes hatte er ein Problem gehabt. Als er nicht nach Afghanistan kam, waren er und seine Mutter enttäuscht gewesen. Er hatte seinem Divisionskommandeur geschrieben und ihn gefragt, warum seine Einheit nicht dorthin geschickt wurde, aber keine Antwort erhalten. Und so waren sie für zwei Jahre mitten in der platten russischen Steppe stationiert worden, wo die betrunkenen Bauern der Gegend und riesige Mückenwolken, die das Land von Mai bis September beherrschten, ihre einzigen Feinde waren.
Das Militär war also nichts für ihn. Er brauchte etwas Direkteres, eine Möglichkeit, vor Ort etwas zu leisten, mit sofort sichtbaren Ergebnissen, und es sollte die Straßen von Fremdkörpern und Seuchen frei halten. Und so wurde er zu einem Bollwerk gegen die Tyrannei der Tiere, einem Kämpfer gegen Krankheit und Belästigung durch flohverseuchte, klapperdürre Köter: Mitja war ein Krieger im Kampf gegen unerwünschte Hundeplagen. Er konnte Hunde nicht ausstehen. Sobald er einen Hund sah, irgendeinen Hund, wurde Mitja übel. Die bittere Galle stieg ihm dann die Kehle hinauf bis zu den Mandeln und brachte ihn zum Würgen. Aber ein Streuner – bei Streunern wurde er wirklich wütend. Streuner waren Staatsfeinde, Feinde der Zivilisation: persönliche Feinde Mitjas. Durch seine Arbeit kanalisierte er seine Abscheu, und er nutzte seinen Hass gut. Streuner in Asow sollten sich besser vorsehen: Mitja zeigte kein Mitgefühl.
Und als die große Sowjetunion schließlich zerbrochen war und von einem Flickenteppich aus Republiken und autonomen Regionen ersetzt wurde, unter denen ordentliches Gerempel herrschte, merkte Mitja, dass er selbstständiger arbeiten und stärker selbst entscheiden konnte, wie er vorgehen wollte. Zwar hätte er den Schwarzmarkt mit seinem zerstörerischen Einfluss nie gutgeheißen, doch er bot Möglichkeiten, sich mit Ausrüstung und Überzeugungen einzudecken, die früher für einen Hundefänger nicht infrage gekommen wären. Und so verbrachte Mitja, bewaffnet mit Fangstange, Wurfnetz und Taser (der genau genommen nicht zur Standardausrüstung gehörte, in seinen Augen aber eine absolut gerechtfertigte Ergänzung war), sechs von sieben Abenden mit seinem Tierkontrollwagen oder TKW auf Patrouille in seinem Dienstbezirk. Mitja war der beste Hundefänger diesseits von Charkow. Und die Stadt Asow brauchte ihn, um die vierbeinigen Parasiten in Schach zu halten, auch wenn sie es nicht wusste.
An diesem Abend, an dem es so warm und süßlich duftete wie nur in einer Industriestadt an einem Fluss im August, nahm Mitja sich den westlichen Teil der Stadt vor, das alte Viertel, immer ein gutes Jagdrevier mit vielen wichtigen Zwischenstopps. Gemächlich glitt sein Wagen an den Plätzen vorbei, die bei den Streunern besonders beliebt waren: an den Büdchen, die Bücher, Kaugummi, Pornohefte, Trockenfisch, Wodka und Spieluhren verkauften; an der Rückseite des Markts, wo riesige Mülltonnen voll fauliger Pampe Hunde anzogen wie die Fliegen und Fliegen so groß wie Bären die zuckenden offenen Wunden der Hunde umschwirrten; am Brachland bei der verfallenen Kirche, das übersät war von alten Bettlerinnen und Knochen. Gutmenschen hatten sie dort hingeworfen für die Hunde, die zwischen den Greisinnen herumstreiften und manchmal hinterlistig einen Bissen aus ihnen herausrissen, wenn Gott nicht hinsah.
An diesem Abend fing Mitja bei den Büdchen an und arbeitete sich im Uhrzeigersinn weiter. Er war flink mit seiner Stange, ein talentierter Fänger. Er nahm es nie mit einem ganzen Rudel auf. Zuerst beobachtete er eine Gruppe Hunde aus der Ferne, dann schnappte er sich ein schwächeres Exemplar nach dem anderen, wenn es abgelenkt wurde und sich von der Gruppe trennte. Für ein ganzes Rudel hätte man eine Blendgranate oder Giftgas gebraucht, aber zu Mitjas Leidwesen genehmigte der Staat den Hundefängern beides nicht. Der Abend war warm, und unter seiner engen Hose und dem Uniformhemd wurde Mitjas Haut feucht und säuerlich. Er hielt den Wagen am Straßenrand an und holte ein Feuchttuch aus seiner schwarzen kunstledernen Gürteltasche. Es war wichtig, sauber und frisch zu bleiben. Mitja ahnte nicht einmal, wie sehr er nach Hund roch. Der Einzige, der ihm das sagte, war Andrei der Swolotsch, wahrscheinlich, weil Andrei der Swolotsch der Einzige war, mit dem er regelmäßig etwas zu tun hatte.
Als schon vier verfilzte Köter in den Käfigen im Laderaum jaulten, entdeckte Mitja einen einzelnen Hund, dünn und schmächtig, auf einem Platz gleich neben der Engelsstraße, wo sie den Karl-Marx-Prospekt kreuzte. Einzelgänger verhießen nichts Gutes: Nicht einmal ihre eigenen Artgenossen konnten sie ausstehen. In der Nähe spielten Kinder. Ein Zittern fuhr durch Mitjas Magen: Dieser dreckige Hund sabberte, hechelte wie eine Bestie, machte sich bereit, hier und jetzt eines der unschuldigen Kinder anzufallen. Es war Mitjas Pflicht, das Kind zu schützen und den Hund seiner gerechten Strafe zuzuführen.
»Master and servant«, flüsterte Mitja, während er das benutzte Feuchttuch in die Plastiktüte fallen ließ, die einzig zu diesem Zweck im Wagen lag. Dann sprang er leise auf den Bürgersteig. Er ging ein paar Schritte auf den Hof, versteckte sich hinter einigen Mülltonnen und stützte sein Minifernglas auf den Rand des nächsten Containers, damit er seine Beute besser beobachten konnte. Als er sah, wie sich der Hund die Vorderpfote leckte, blinzelte er überrascht: Das Tier schien nur drei Beine zu haben.