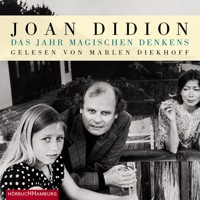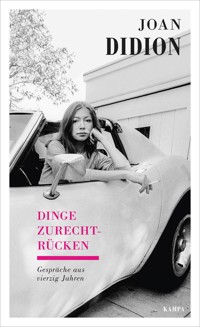
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Dieser Band versammelt die besten Gespräche der »Schriftstellerin und Ikone« (The New Yorker) aus vier Jahrzehnten. Joan Didion erzählt von ihrer Kindheit in Sacramento, ihrer Studienzeit in Berkeley, den Jahren in New York und Los Angeles. Sie denkt nach über ihre Ehe mit dem Schriftsteller John Gregory Dunne, seinen unerwarteten Tod und den ihrer Tochter Quintana, nur zwei Jahre später - Schicksalsschläge, die sie in ihren Erinnerungsbüchern Das Jahr magischen Denkens und Blaue Stunden verarbeitete, die schon jetzt als Meilensteine des Genres gelten.Aber natürlich geht es in diesen Gesprächen auch um Literatur, um das Schreiben von Romanen, das dem nicht-fiktionaler Texte so gar nicht gleicht, um das Schreiben als Akt der Notwehr, um Politik und Engagement, Sonnenuntergänge an der kalifornischen Küste, lange Spaziergänge durch New York und vieles mehr. Ein reiches Leben ist hier zu besichtigen und das Werk einer Frau, deren Stil wegweisend war, so wie ihr Erscheinungsbild: Noch im Alter von über achtzig Jahren wirkte Didion in einer Anzeige der Modemarke Céline als Testimonial. »Didion still glitters«, schrieb die New York Times.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joan Didion
Dinge zurechtrücken
Gespräche aus vierzig Jahren
Zusammengestellt von Ann Kathrin Doerig
Aus dem amerikanischen Englisch von Georg Deggerich
Kampa
Hätt ich des Himmels reichbestickte Tücher,
bestickt aus Golden- und aus Silberlicht,
die dunklen, die blauen und die hellen Tücher,
aus Nacht, aus Tag und aus der Dämmerung,
legt ich die Tücher dir zu Füßen.
Doch ich bin arm und habe nichts als Träume,
so leg ich meine Träume dir zu Füßen.
Tritt leise, denn du trittst auf meine Träume.
William Butler Yeats
Freedom’s just another word for nothing left to lose. Janis Joplin
You have to pick the places you don’t walk away from. Joan Didion
Ich liebe Hotels.
Antworten auf den Proust-Fragebogen, 2003
Wovor fürchten Sie sich am meisten?
Ich habe eine irrationale Angst vor Schlangen. Als mein Mann und ich in eine Gegend des Los Angeles County zogen, wo es viele Klapperschlangen gibt, versuchte ich mich dagegen zu desensibilisieren, indem ich jeden Tag zur Hermosa Reptilienfarm fuhr und mich zwang, die Anakondas zu betrachten. Es schien zu funktionieren, aber vor einigen Jahren, als wir in Malibu lebten, fiel eine Königsnatter – eine harmlose, ungiftige Schlange, nicht zu vergleichen mit einer Anakonda – von der Garagendecke in meine Corvette. Meine damals vierjährige Tochter brachte sie mir. Ich muss beschämt gestehen, dass ich wegrannte. Noch heute denke ich darüber nach, was geschehen wäre, wenn ich zum Einkaufen auf dem Pacific Coast Highway unterwegs gewesen wäre und die Schlange auf dem Beifahrersitz entdeckt hätte.
Welchen Charakterzug an sich bedauern Sie am meisten?
Ich schiebe Dinge vor mir her. Ich spiele Solitär am Computer. Ich verfalle in dumpfe Trägheit. Es gefällt mir nicht, aber so ist es nun mal.
Welche Tugend halten Sie für besonders überschätzt?
Unbedingte Aufrichtigkeit halte ich für reichlich überschätzt, weil es in der Regel darauf hinausläuft, dass der Sprecher sich auf Kosten seines Gegenübers in ein günstiges Licht rückt.
Wie reisen Sie am liebsten?
Vor langer Zeit, als im Flugzeug noch keine Filme gezeigt wurden und man nicht die Blenden schließen musste, liebte ich es, auf Flügen in den Westen zu sehen, wie das Land sich öffnete und das Schachbrettmuster der Farmen im Mittleren Westen langsam in endlose Leere überging. Ich mochte es auch, bei Tag von Europa über den Pol nach Los Angeles zu fliegen und zu sehen, wie die Eisschollen und Inseln im Meer sich beinahe unmerklich in Seen auf dem Festland verwandelten. Diesen Wechsel in der Wahrnehmung empfand ich als faszinierend.
In welchen Situationen lügen Sie?
Ich lüge vermutlich ständig, wenn dazu auch das Verschweigen der Wahrheit gehört, um Konflikte zu vermeiden und andere Leute nicht vor den Kopf zu stoßen. Meine Mutter war gänzlich unfähig zu lügen. Ich erinnere mich, dass sie einmal bei einem furchtbaren Unwetter mit dem Wagen losfuhr, um bei einer Wahl des Tierschutzvereins für eine Bekannte zu stimmen. »Ich habe es Dorothy versprochen«, sagte sie, als ich es ihr auszureden versuchte. »Aber Dorothy wird nie davon erfahren.« – »Darum geht es nicht«, erwiderte meine Mutter. Ich muss gestehen, dass ich das sehr befremdlich fand.
Was missfällt Ihnen an Ihrem Aussehen am meisten?
Eine Zeit lang haderte ich mit meiner geringen Größe, aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Was nicht bedeutet, dass ich nicht lieber 1,78 Meter groß wäre und Designer-Mode gratis nach Hause geschickt bekommen würde.
Welche Wörter oder Ausdrücke benutzen Sie übertrieben häufig?
Fast alle, die schreiben, neigen zum übermäßigen Gebrauch bestimmter Wörter oder Phrasen – was einmal funktioniert, wird schnell zur Gewohnheit –, und ein Großteil des Geschäfts besteht darin, sie wieder zu streichen.
»Ich liebte es, auf Flügen zu sehen, wie das Land sich öffnete und das Schachbrettmuster der Farmen im Mittleren Westen langsam in endlose Leere überging.«
Wann und wo waren Sie am glücklichsten?
In meinem Roman Demokratie stellt sich die Protagonistin Inez Victor genau diese Frage, auf die sie keine Antwort weiß. Sie trinkt ihren Kaffee, sie raucht eine Zigarette, sie denkt darüber nach, und dann schließlich heißt es: »Im Rückblick schien sie am glücklichsten in den ihnen zur Verfügung gestellten Häusern und beim Mittagessen gewesen zu sein. Sie entsann sich, über die Maßen glücklich gewesen zu sein, als sie einmal allein in einem Hotelzimmer in Chicago zu Mittag gegessen hatte, während Schnee über die Fenstersimse trieb. Es gab ein Mittagessen in Paris, an das sie sich in allen Einzelheiten erinnerte: ein verspätetes Mittagessen mit Harry und den Zwillingen bei Regen im Pré Catelan.« Diese Mittagessen und die zur Verfügung gestellten Häuser kamen nicht von ungefähr.
Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Ich würde gern eine andere Sprache außer Englisch fließend sprechen. Ich habe mich damit abgefunden, dass es wohl nie dazu kommen wird. Viele Dinge schieben sich dazwischen, nicht zuletzt die hartnäckige Furcht, mein einziges echtes Talent seit Kindheitstagen zu verlieren – die Fähigkeit, englische Sätze zu bilden.
»Elend bedeutet für mich, sich einem geliebten Menschen entfremdet zu fühlen. Elend heißt auch, nicht zu arbeiten.«
Welche eine Sache würden Sie gern an sich ändern?
Ich fürchte, diese »eine Sache« würde automatisch zur nächsten führen. Deswegen würde wohl nur ein Masochist diese Frage beantworten.
Was ist Ihr wertvollster Besitz?
Alles, was meine Tochter mir geschenkt hat, zum Beispiel – das fällt mir spontan ein, weil es immer auf meinem Schreibtisch liegt – ein Bilderbuch mit dem Titel Tierkinder mit ihren Müttern.
Was betrachten Sie als das größte Elend?
Elend bedeutet für mich, sich einem geliebten Menschen entfremdet zu fühlen. Elend heißt auch, nicht zu arbeiten. Beides scheint zusammenzugehören.
Wo möchten Sie leben?
Jeden Monat woanders. Momentan wäre ich gern am Kailua Beach, auf der Luvseite von O‘ahu. Im November wäre es vermutlich Paris, vorzugsweise das Hotel Bristol. Ich liebe Hotels. Als wir in verschiedenen Häusern in Los Angeles lebten, versuchte ich mit allerlei Berechnungen zu beweisen, dass wir Geld sparen könnten, wenn wir einen der Bungalows des Bel-Air mieteten, aber mein Mann wollte nichts davon wissen.
Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Ich koche gern Gumbo. Ich mag Gartenarbeit. Ich schreibe gern, zumindest wenn es gut läuft, vielleicht weil es die Form von Handarbeit ist, die der Zubereitung von Gumbo oder der Gartenarbeit am nächsten kommt.
Was ist Ihr bezeichnendstes Merkmal?
Nach dem Urteil der anderen meine zarte Gestalt. Ich selbst würde eher eine gewisse Verschlossenheit nennen. Ich bin oft abwesend.
Wer ist Ihr liebster Romanheld?
Ich war immer von Axel Heyst in Joseph Conrads Sieg fasziniert. Wie er auf dem Kai steht, ich glaube, es war in Sumatra – vielleicht irre ich mich. Mein Gedächtnis ist schlecht. Sein großes Projekt, die Tropical Belt Coal Company, liegt in Trümmern. Doch dann begeht er eine beispiellos heldenhafte Tat, zu der er nur deshalb den Mut findet, weil er alle Sorge um die eigene Person hinter sich lässt.
Der Schriftsteller versucht immer, den Leser zum Zuhörer seines Traums zu machen.
Im Gespräch mit Linda Kuehl, 1978
Sie haben einmal gesagt, Schreiben sei ein feindseliger Akt. Warum?
Feindselig in der Weise, dass man jemandem seine Sicht der Dinge aufzuzwingen versucht. Es ist ein feindseliger Akt, das Denken eines Menschen in dieser Weise zu manipulieren. Häufig möchte man jemandem seinen Traum oder auch seinen Albtraum erzählen. Allerdings möchte niemand den Traum eines anderen hören, sei er nun schön oder schlimm; niemand möchte sich darauf einlassen. Der Schriftsteller versucht immer, den Leser zum Zuhörer seines Traums zu machen.
Sind Sie sich beim Schreiben des Lesers bewusst? Hören Sie beim Schreiben dem Leser zu, der Ihnen zuhört?
Offensichtlich höre ich einem Leser zu, aber der einzige Leser, den ich höre, bin ich selbst. Ich schreibe immer für mich selbst. Sehr wahrscheinlich begehe ich also einen aggressiven, feindseligen Akt gegen mich selbst.
Die Frage in vielen Ihrer nicht-fiktionalen Texte: »Haben Sie verstanden?«, ist also an Sie selbst gerichtet?
Ja. Als ich mit dem Schreiben anfing, habe ich gelegentlich versucht, für einen anderen Leser als mich selbst zu schreiben. Ich bin immer gescheitert. Jedes Mal bin ich erstarrt.
Wann wussten Sie, dass Sie schreiben wollten?
Ich habe schon als kleines Mädchen Geschichten geschrieben, aber ich wollte nicht Schriftstellerin werden, sondern Schauspielerin. Damals wusste ich noch nicht, dass beides dem gleichen Impuls entspringt. Es geht um Vorspiegelung. Um eine Aufführung. Der einzige Unterschied ist der, dass der Schriftsteller unabhängig ist. Das ging mir schlagartig auf, als eine Freundin, eine Schauspielerin, mit einigen Schriftstellerkollegen vor ein paar Jahren bei uns zum Essen war. Plötzlich wurde mir bewusst, dass sie die einzige Person im Raum war, die ihren Auftritt nicht planen konnte. Sie musste darauf warten, dass jemand anderes sie darum bat. Ein seltsames Leben.
»Die Sätze in meinen nicht-fiktionalen Texten sind viel komplizierter als in meinen Romanen. Wenn ich einen Roman schreibe, scheine ich viel weniger Nebensätze zu hören.«
Gab es jemanden, der Ihnen das Schreiben beigebracht hat?
Mark Schorer lehrte in Berkeley, als ich dort studierte, und er unterstützte mich. Ich meine damit nicht, dass er einzelne Sätze oder Passagen mit mir diskutierte – niemand hat die Zeit, die Arbeiten seiner Studenten so genau zu korrigieren. Aber er vermittelte mir ein Gefühl dafür, worum es beim Schreiben geht, wozu es gut ist.
Hat irgendein Autor Sie in besonderer Weise beeinflusst?
Ich sage immer Hemingway, weil er mir gezeigt hat, wie Sätze funktionieren. Als ich fünfzehn oder sechzehn war, tippte ich seine Erzählungen ab, um herauszufinden, wie diese Sätze funktionieren. So brachte ich mir gleichzeitig bei, mit der Maschine zu schreiben. Vor ein paar Jahren, als ich in Berkeley unterrichtete, las ich noch einmal In einem andern Land, und sofort waren diese Sätze wieder da. Es sind wirklich perfekte Sätze. Sehr direkt, sanfte Flüsse, klares Wasser über Granit, keine Untiefen.
Sie haben auch Henry James genannt …
James schrieb ebenfalls perfekte Sätze, allerdings sehr indirekte, sehr komplizierte Sätze. Sätze mit Untiefen. Man kann in ihnen ertrinken. Ich würde es nicht wagen, solche Sätze zu schreiben. Ich bin nicht mal sicher, ob ich es wagen würde, James noch einmal zu lesen. Ich liebte seine Romane so sehr, dass sie mich lange Zeit lähmten. Diese unendliche Fülle von Möglichkeiten. Dieser vollkommen durchdachte Stil. Das schüchterte mich so sehr ein, dass ich fürchtete, gar nichts mehr zu Papier zu bringen.
Ich frage mich, ob einige Ihrer nicht-fiktionalen Texte nicht wie ein einziger Satz von Henry James aufgebaut sind.
Das wäre ideal, nicht wahr? Ein ganzer Text – acht, zehn, zwanzig Seiten in einem einzigen Satz. Übrigens sind die Sätze in meinen nicht-fiktionalen Texten viel komplizierter als in meinen Romanen. Viel mehr Nebensätze. Mehr Semikolons. Wenn ich einen Roman schreibe, scheine ich viel weniger Nebensätze zu hören.
Sie haben gesagt, mit dem ersten Satz stehe der gesamte Text. Genau das hat Hemingway auch gesagt. Alles, was er brauchte, war der erste Satz, dann hatte er die ganze Geschichte.
Schwierig am ersten Satz ist, dass man daran hängen bleibt. Alles andere folgt daraus wie von selbst. Und wenn man die ersten beiden Sätze geschrieben hat, sind sämtliche Optionen dahin.
Der erste Satz ist eine Geste, der zweite eine Verpflichtung.
Ja, und der letzte Satz eines Textes ist ein neues Abenteuer. Er sollte einen Text öffnen. Er sollte den Leser dazu bringen, zurückzublättern und noch einmal von vorn anzufangen. So sollte es sein, aber das funktioniert nicht immer. Ich stelle mir das Schreiben immer als einen Hochseilakt vor. In dem Augenblick, in dem man Wörter zu Papier bringt, schließt man Möglichkeiten aus. Es sei denn, man ist Henry James.
Ich frage mich, ob Ihre Arbeitsmoral – was Sie Ihre »strenge protestantische Ethik« nennen – Ihnen nicht Türen verschließt, Sie daran hindert, sich alle Möglichkeiten offenzuhalten.
Vermutlich ist das ein Teil der Dynamik. Wenn ich ein Buch beginne, strebe ich nach Perfektion, es soll alle erdenklichen Farben, die ganze Welt enthalten. Schon nach zehn Seiten habe ich es vermasselt, habe es beschränkt, festgezurrt und verhunzt. Das ist sehr entmutigend. In diesem Moment hasse ich das Buch. Nach einer Weile finde ich einen Kompromiss: Nun, es ist nicht das ideale Werk, das mir vorschwebte, aber vielleicht – wenn ich dies nur erst einmal zu Ende bringe – gelingt es mir beim nächsten Mal. Vielleicht bekomme ich noch eine Chance.
Gibt es Autorinnen, die Sie in besonderer Weise beeinflusst haben?
Am ehesten als Modelle für einen Lebensentwurf, nicht für eine Schreibweise. Vermutlich haben die Brontës mich in meiner eigenen Vorstellung von Theatralik bestärkt. Irgendetwas an George Eliot hat mich stark angezogen. Ich glaube, sowohl Jane Austen als auch Virginia Woolf passten vom Temperament her nicht zu mir.
Welche Nachteile, so es sie denn gibt, bestehen für weibliche Autoren?
Als ich anfing zu schreiben – Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger –, gab es eine gewisse gesellschaftliche Tradition, in der männliche Romanciers sich bewegen konnten. Säufer mit kaputter Leber, Frauen, Kriege, große Fische, Afrika, Paris, keine zweiten Chancen. Ein Mann, der Romane schrieb, nahm eine bestimmte Rolle in der Welt ein, und dann konnte er alles tun, was er wollte. Eine Romanautorin hatte keine solche Rolle. Frauen, die Romane schrieben, wurden oft als krank betrachtet. Carson McCullers, Jane Bowles. Nicht zu vergessen Flannery O’Connor. Romane von Frauen wurden selbst von ihren Verlegern als »empfindsam« beschrieben. Ich weiß nicht, ob das heute noch zutrifft, aber damals war es zweifellos so, und es gefiel mir nicht. Ich ging damit so um wie mit allem anderen. Ich kümmerte mich nicht weiter darum, reagierte, wie ich glaube, ziemlich schlau. Ich ließ nicht viele Menschen wissen, was ich so tat.
Vorteile?
Die Vorteile sind wohl identisch mit den Nachteilen. Ein gewisser Widerstand ist immer gut. Man bleibt wachsam.
Können Sie am Stil eines Textes erkennen, ob es sich um eine Autorin handelt?
Nun, wenn Stil und Charakter eins sind – wovon ich überzeugt bin –, offenbart der Stil unweigerlich auch das Geschlecht. Ich möchte nicht zwischen Stil und Sensibilität differenzieren. Noch einmal, der Stil eines Autors ist seine Sensibilität. Aber die Frage der sexuellen Identität ist überaus kompliziert. Würde ich etwa mit nüchternem Blick etwas von Anaïs Nin lesen, ich würde vermutlich sagen, es sei von einem Mann geschrieben, der wie eine Frau zu schreiben versucht. Genauso würde es mir bei Colette ergehen, und doch werden beide Autorinnen allgemein als dezidiert »feminine« Schriftstellerinnen betrachtet. Ich erkenne das Feminine nicht. Auf der anderen Seite erscheint mir Sieg von Joseph Conrad als ein ausgesprochen femininer Roman. Genau wie Nostromo oder Der Geheimagent.
Fällt es Ihnen leicht, männliche Figuren darzustellen?
Menschen am Fluss ist teilweise aus der Perspektive eines Mannes erzählt. Everett McClellan. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Teile schwieriger gewesen wären als die anderen. Dennoch empfanden viele Leute Everett als schemenhaft. Für mich ist er die prägnanteste Figur im ganzen Buch. Ich mochte ihn sehr. Ich mochte Lily und Martha, aber Everett liebte ich.
»Tagsüber arbeitete ich für Vogue, nachts schrieb ich Szenen für einen Roman. Wenn ich eine Szene fertig hatte, klebte ich die Seiten aneinander und hängte sie in langen Streifen an die Wand meines Apartments.«
War Menschen am Fluss wirklich Ihr erster Roman? Er wirkt für ein Debüt so vollendet, dass ich das Gefühl hatte, Sie hätten einige frühere Versuche in der Schublade.
Ich habe einige nicht-fiktionale Texte zur Seite gelegt, aber nie einen Roman. Es kann passieren, dass ich vierzig Seiten rauswerfe und vierzig neue Seiten schreibe, aber sie gehören alle zum selben Buch. Ich habe Menschen am Fluss nachts über einen Zeitraum von mehreren Jahren geschrieben. Tagsüber arbeitete ich für Vogue, und nachts schrieb ich Szenen für einen Roman. Ohne über die Chronologie nachzudenken. Wenn ich eine Szene fertig hatte, klebte ich die Seiten aneinander und hängte sie in langen Streifen an die Wand meines Apartments. Manchmal rührte ich sie ein oder zwei Monate lang nicht an, und dann nahm ich eine Szene von der Wand und überarbeitete sie. Nachdem ich etwa hundertfünfzig Seiten hatte, ging ich damit zu zwölf Verlagen. Alle lehnten ab. Der dreizehnte, Ivan Obolensky, gab mir einen Vorschuss, und mit diesen zweitausend Dollar, oder wie viel auch immer es war, nahm ich eine zweimonatige Auszeit und schrieb die zweite Hälfte des Buchs. Deshalb ist die zweite Hälfte auch besser als die erste. Ich versuchte, auch die erste Hälfte umzuschreiben, aber sie sperrte sich beharrlich. Es war nicht daran zu rütteln. Ich hatte zu viele Jahre in verschiedenen Stimmungen daran gearbeitet. Nicht, dass die zweite Hälfte perfekt wäre. Sie ist runder und flüssiger, aber sie enthält ebenfalls zahlreiche ungelöste Probleme. Ursprünglich sollte Menschen am Fluss einer komplizierten Chronologie folgen, in der Vergangenheit und Gegenwart gleichzeitig stattfinden, aber ich war technisch noch nicht so weit. Jeder, der das Manuskript las, sagte, es funktioniere so nicht. Also entwirrte ich. Gegenwart und Rückblenden wechselten einander ab. Sehr schematisch. Ich hatte keine andere Wahl, weil ich nicht wusste, wie ich es hätte anders machen können. Ich war einfach nicht gut genug.
Haben Sie oder der Verleger Jonathan Cape das Komma im englischen Originaltitel Run River eingefügt?
Ich glaube, Cape hat das Komma eingefügt, und Obolensky hat es weggelassen, aber mir war das eigentlich egal, weil ich den Titel so oder so nicht mochte. Der Arbeitstitel lautete In the Night Season, was Obolensky nicht gefiel. Tatsächlich lautete der Arbeitstitel der ersten Hälfte zunächst Harvest Home, was von allen Seiten als unverkäuflich abgelehnt wurde, obwohl es später ein kommerziell sehr erfolgreiches Buch mit genau diesem Titel von Thomas Tryon gab. Aber auch hier war ich viel zu unsicher, sonst hätte ich auf dem Titel bestanden.
Ist das Buch autobiografisch? Ich frage das aus dem einfachen Grund, weil Erstlingsromane oft autobiografisch sind.
Nein, bis auf die Tatsache, dass er in Sacramento spielt. Viele Leute glaubten damals, ich hätte sie und ihre Familien verleumdet, dabei war es eine rein fiktive Geschichte. Das zentrale Ereignis stammte aus einer Kurzmeldung in der New York Times über einen Mordprozess in den Carolinas. Jemand stand wegen der Ermordung eines Vorarbeiters auf seiner Farm vor Gericht, das war alles. Ich habe Sacramento als Schauplatz gewählt, weil ich Heimweh hatte. Ich wollte mich an das Wetter und die Flüsse erinnern.
Die Hitze über dem Wasser?
Die Hitze. Ich glaube, damit fing alles an. Die vielen Landschaftsbeschreibungen hätte es nicht gegeben, wenn ich kein Heimweh gehabt hätte. Wenn ich mich nicht hätte erinnern wollen. Der Anstoß war Nostalgie. Kein ungewöhnlicher Impuls für einen Schriftsteller. Das ging mir auf, als ich in Honolulu Verdammt in alle Ewigkeit las, kurz nachdem James Jones gestorben war. Mir schwebte genau diese Art von Nostalgie vor, diese Sehnsucht nach einem Ort, die alle anderen erzählerischen Absichten in den Hintergrund drängt. Diese unglaublich ausführlichen Beschreibungen. Als Prewitt von dem Stadtteil, in dem er verwundet wurde, unterwegs zu Almas Haus ist, wird jeder einzelne Straßenname genannt. Jede Straße wird genau beschrieben. Man könnte anhand dieses Abschnitts eine Straßenkarte von Honolulu anfertigen. Keine dieser Beschreibungen hat irgendeine erzählerische Bedeutung. Es ist reines Erinnern. Obsessives Erinnern. Ich verstand genau, woher das kam.
Aber bedingt Nostalgie nicht zugleich die Sprachgewalt von Menschen am Fluss?
Der Roman enthält jede Menge Schludrigkeiten. Irrelevantes Zeug. Wörter, die nicht funktionieren. Peinlichkeiten. Szenen, die stärker hätten herausgearbeitet werden müssen, und andere, die weniger dominant hätten sein sollen. Andererseits hat auch Spiel dein Spiel zahlreiche Schwachstellen. Ich habe Wie die Vögel unter dem Himmel nicht wieder gelesen, aber ich bin sicher, da ist es auch nicht anders.
Wie sind Sie in Spiel dein Spiel zu Ihrer Erzählperspektive gelangt? Haben Sie zwischenzeitlich Ihre Entscheidung angezweifelt, den Roman gleichzeitig in der ersten und dritten Person zu erzählen?
Ursprünglich sollte es ausschließlich einen Ich-Erzähler geben. Aber es gelang mir nicht, das durchzuhalten. Da gibt es Kniffe, die ich noch nicht kannte. Also probierte ich es mit einem sehr eingeschränkten Er-Erzähler, bloß um weiterzukommen. Mit einem »eingeschränkten Er-Erzähler« meine ich einen Erzähler, der eng mit der Sicht eines Charakters verbunden, also nicht allwissend ist. Eines Abends bemerkte ich dann, dass ich zwei Erzähler hatte, einen Ich-Erzähler und einen Er-Erzähler, und dass ich mit beiden weitermachen oder das Buch aufgeben musste. Das machte mir Angst. Im Nachhinein bin ich aber mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Die Gegenüberstellung von Ich-Erzähler und Er-Erzähler erwies sich insbesondere zum Ende hin als sehr hilfreich, als ich die ganze Sache beschleunigen wollte. Ich würde es wohl nicht noch einmal so machen, aber in diesem Fall war es eine brauchbare Lösung. Man gelangt an einen Punkt, an dem man mit dem weitermacht, was da ist. Oder man gibt auf.
»Ich habe die Dinge zurechtgerückt.«
Wie lange haben Sie insgesamt an Spiel dein Spiel geschrieben?
Ich habe über mehrere Jahre Notizen gemacht und kürzere Abschnitte geschrieben, aber das eigentliche Schreiben – sich an die Schreibmaschine zu setzen und jeden Tag zu arbeiten, bis das Buch fertig ist – fand zwischen Januar und November 1969 statt. Danach musste ich es natürlich noch überarbeiten. Ich weiß nie so genau, was ich tue, wenn ich einen Roman schreibe, und die eigentliche Konstruktion zeigt sich erst kurz vor dem Ende. Bevor ich das Manuskript ein zweites Mal redigierte, zeigte ich es John, meinem Mann, und danach schickte ich es an Henry Robbins, meinen Lektor bei Farrar, Straus und Giroux. Der Text war noch lange nicht fertig, und es gab Stellen, die mit »Kapitel einfügen« markiert waren. Henry zeigte sich wenig beunruhigt über meine Arbeitsweise, und er und John und ich setzten uns eines Tages in New York zusammen, eine Stunde vor dem Abendessen, und besprachen, was noch zu tun war. Wir alle wussten, was fehlte. Wir waren uns einig. Danach habe ich das Manuskript noch mal ein paar Wochen lang überarbeitet – ich habe die Dinge zurechtgerückt.
Was genau meinen Sie mit »die Dinge zurechtrücken«?
Ich wusste beispielsweise erst wenige Wochen vor der Fertigstellung, dass BZ eine wichtige Figur in Spiel dein Spiel war. Die Stellen, die ich mit »Kapitel einfügen« markiert hatte, waren größtenteils solche, an denen ich BZ übler zusetzte und so das Ende vorbereitete.
»Ich habe keine klare Vorstellung von meinen Figuren, bis sie zu sprechen beginnen. Dann fange ich an, sie zu lieben. Am Ende des Buchs liebe ich sie so sehr, dass ich sie nie wieder gehen lassen möchte.«
Wie dachten Sie über BZs Selbstmord am Schluss?
Erst als ich das Buch fertiggestellt hatte, bemerkte ich, dass es im Grunde das gleiche Ende war wie in Menschen am Fluss. Die Frauen lassen die Männer Selbstmord begehen.
Ich habe gelesen, die Idee zu Spiel dein Spiel kam Ihnen, als Sie in der Lobby des Riviera Hotel in Las Vegas saßen und ein Mädchen vorbeigehen sahen.
In meiner Vorstellung lebte Maria in New York. Vielleicht als Model. Sie stand kurz vor der Scheidung und litt. Und als ich diese Schauspielerin im Riviera Hotel sah, dachte ich, Maria könnte ebenfalls Schauspielerin sein. In Kalifornien.
Hieß sie von Anfang an Maria Wyeth?
Sie hatte nicht mal einen Namen. Manchmal habe ich bereits fünfzig, sechzig Seiten einer Geschichte geschrieben und bezeichne eine bestimmte Figur immer noch mit »X«. Ich habe keine klare Vorstellung von meinen Figuren, bis sie zu sprechen beginnen. Dann fange ich an, sie zu lieben. Am Ende des Buchs liebe ich sie so sehr, dass ich bei ihnen bleiben möchte. Ich will sie nie wieder gehen lassen.
Reden Ihre Figuren mit Ihnen?
Nach einiger Zeit … in gewisser Weise. Als ich mit Wie die Vögel unter dem Himmel begann, wusste ich von Charlotte nicht mehr, als dass sie beim Reden nervös war und Geschichten ohne Sinn und Zusammenhang erzählte. Eine Art verstörte Stimme. Eines Tages dann schrieb ich die Szene mit der Weihnachtsfeier in der amerikanischen Botschaft und ließ Charlotte all diese bizarren, witzlosen Anekdoten erzählen, während Victor Strasser-Mendana herauszufinden versucht, wer sie ist, was sie in Boca Grande macht, wer ihr Ehemann ist und was er macht. Und plötzlich sagt Charlotte: »Er schmuggelt Waffen. Ich wünschte, es gäbe Kaviar.« Als ich Charlotte das sagen hörte, hatte ich eine sehr klare Vorstellung von ihr. Ich nahm mir noch einmal den Anfang vor und schrieb einige Sachen neu.
Haben Sie vieles umgestellt, und wenn ja, wie? Haben Sie Heftzwecken oder Klebeband benutzt?
Zu Beginn eines Romans schreibe ich viele Passagen, die mich nirgendwohin führen. Ich lege sie dann zur Seite und hefte sie an eine Tafel, mit der Absicht, später darauf zurückzukommen. Ziemlich zu Anfang von Wie die Vögel unter dem Himmel