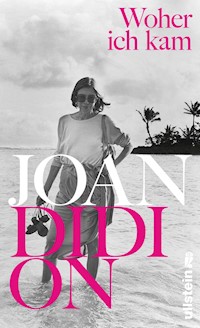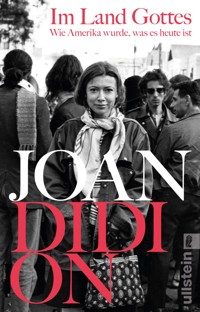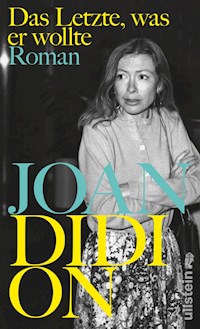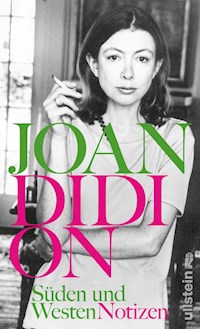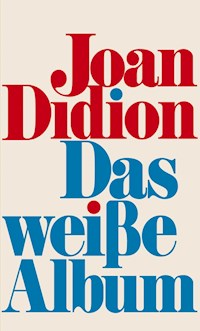
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Diese Sammlung kritischer Reportagen über die späten Sechzigerjahre in ihrem Heimatstaat Kalifornien, machte Didion zum Star des New Journalism.« Süddeutsche Zeitung Das weiße Album ist ein essenzielles Werk und ein Klassiker der amerikanischen Autobiografie. In ihren Essays untersucht Joan Didion mit der ihr eigenen Klarsicht Akteure, Schlüsselereignisse, Bewegungen und Trends der Sechzigerjahre – darunter Charles Manson, die Black Panther und Shopping Malls. Aus einer intellektuellen Verstörung heraus schreibt sie über den American Dream, einen Traum, der auch im Scheitern nichts von seiner Faszinationskraft eingebüßt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das weiße Album
Die Autorin
JOAN DIDION, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für verschiedene amerikanische Zeitungen und war Mitherausgeberin der Vogue. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen der amerikanischenLiteratur, die mit ihren fünf Romanen und zahlreichen Essaybänden das intellektuelle Leben der USA prägte. Joan Didion starb im Dezember 2021.ANTJE RÁVIK STRUBEL lebt als Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Für ihre Romane erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Deutschen Buchpreis 2021 für Blaue Frau. Sie übersetzt aus dem Englischen und Schwedischen, u. a. Virginia Woolf und Lucia Berlin.
Das Buch
»Didions Essays zeugen nicht nur von Intelligenz, sondern auch von einem Gespür für Details, die im Gedächtnis weiter pulsieren. Dazu kommt ihr verletzliches Selbstbild und das Ergebnis ist eine Stimme, die im zeitgenössischenJournalismus ihresgleichen sucht.«The New York Times Book Review
Joan Didion
Das weiße Album
Aus dem Amerikanischen von Antje Rávik Strubel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 1979 unter dem Titel The White Album bei Weidenfeld & Nicolson, London.Der Ullstein Verlag dankt allen Rechteinhabern für die Erlaubnis, aus den folgenden Werken zu zitieren:F. Scott Fitzgerald: Der große Gatsby. Aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell. Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay. © 2013 Diogenes, Zürich.F. Scott Fitzgerald: Die Liebe des letzten Tycoon: Ein Western. Aus dem Amerikanischen von Renate Orth-Guttmann. © 2006 Diogenes, Zürich.Gabriel García Márquez: Hundert Jahre Einsamkeit. Neuübersetzt von Dagmar Ploetz. © 2017 Kiepenheuer & Witsch, Köln.James Jones: Verdammt in alle Ewigkeit. Übersetzt von Otto Schrag. © 2016 Fischer, Frankfurt a. M.Robert Lowell: Notebook 1967–1968. © 1967, 1968, 1969, 1970 by Robert Lowell. Farrar, Straus and Giroux, Inc., New York.Karl Shapiro: Collected Poems 1940–1978. © 1957 by Karl Shapiro. Wieser & Wieser, Inc., New York.Trotz intensiver Bemühungen war es nicht möglich, alle Rechteinhaber zu ermitteln. Wir bitten diese, sich gegebenenfalls an Verlag zu wenden.ISBN 978-3-8437-2784-6© 1979 by Joan Didion© der deutschsprachigen Ausgabe:2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: © zero-media.net, München, nach dem Cover der Originalausgabe von Robert AnthonyAutorinnenfoto: © Brigitte LacombeE-Book-Konvertierung powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
Das weiße Album
Das weiße Album
2
Republik Kalifornien
James Pike, Amerikaner
Heiliges Wasser
Viele Villen
Das Getty
Bürokraten
Brave Bürger
Anmerkungen zu einer Traumpolitik
3
Frauen
Die Frauenbewegung
Doris Lessing
Georgia O’Keeffe
4
Reisen
Auf den Inseln
In Hollywood
Im Bett
Unterwegs
Im Einkaufszentrum
In Bogotá
Auf dem Damm
5
Am Morgen nach den Sechzigerjahren
Am Morgen nach den Sechzigerjahren
Stille Tage in Malibu
Anhang
Dank
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
1 Das weiße Album
Widmung
Für Earl McGrathund für Lois Wallace
1 Das weiße Album
Das weiße Album
1
Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Die Prinzessin ist im Turm eingesperrt. Der Mann mit den Bonbons wird die Kinder ins Meer locken. Die nackte Frau auf dem Fenstersims im sechzehnten Stock ist ein Opfer der Trägheit, oder die nackte Frau ist eine Exhibitionistin, und es wäre »interessant« zu wissen, was von beidem stimmt. Wir reden uns ein, es wäre ein Unterschied, ob die nackte Frau kurz davor ist, eine Todsünde zu begehen, oder ob sie einen politischen Protest äußern will oder ob sie, die aristophanische Sicht, vom Feuerwehrmann in Priesterkleidung, der hinter ihr am Fenster gerade noch sichtbar ist und ins Teleobjektiv lächelt, ins menschliche Dasein zurückgerissen wird. Wir suchen nach der im Selbstmord enthaltenen Predigt, nach der sozialen oder moralischen Lehre im fünffachen Mord. Wir interpretieren, was wir sehen, wir wählen unter den vielfältigen Möglichkeiten die brauchbarste aus. Besonders als Schriftsteller leben wir völlig davon, die ungleichen Bilder auf einen Erzählfaden zu spannen, wir leben von den »Ideen«, mit denen wir gelernt haben, die wechselnden Phantasmagorien einzufrieren, die unsere eigentliche Erfahrung sind.
Jedenfalls machen wir das für eine Weile so. Ich spreche hier von einer Zeit, in der ich an den Voraussetzungen all der Geschichten zu zweifeln begann, die ich mir je erzählt hatte, kein ungewöhnlicher Vorgang, aber einer, der mir Sorgen machte. Ich vermute, diese Phase begann irgendwann 1966 und dauerte bis 1971. Äußerlich war ich während dieser fünf Jahre ein vollwertiges Mitglied der einen oder anderen Gemeinschaft, unterzeichnete Verträge, buchte Flüge und war eine ganz normale Bürgerin: Mehrmals im Monat schrieb ich für die eine oder andere Zeitschrift, ich veröffentlichte zwei Bücher, arbeitete an verschiedenen Kinofilmen; ich hatte mit der Paranoia jener Zeit zu tun, mit der Erziehung eines kleinen Kindes und der Versorgung einer großen Anzahl von Menschen, die zu Besuch kamen; ich nähte karierte Vorhänge für Gästezimmer, dachte daran, Agenten zu fragen, ob eine Reduzierung von Gewinnanteilen mit dem finanzierenden Studio pari passu ginge, weichte am Samstagabend Linsen ein für die Linsensuppe am Sonntag, bezahlte vierteljährlich meine Steuern und ließ pünktlich meinen Führerschein erneuern, wobei ich in der schriftlichen Prüfung einzig bei der Frage nach der finanziellen Verantwortung kalifornischer Autofahrer danebenlag. Es war eine Zeit in meinem Leben, in der ich häufig zu etwas »ernannt« wurde. Ich wurde zur Patin von Kindern ernannt. Ich wurde zur Dozentin und Diskussionsteilnehmerin ernannt und zur Teilnehmerin an Kolloquien und Konferenzen. Ich wurde sogar zur »Frau des Jahres« der Los Angeles Times 1968 ernannt, gemeinsam mit Mrs Ronald Reagan, mit der Olympiasiegerin im Schwimmen, Debbie Meyer, und zehn anderen kalifornischen Frauen, die auf dem Laufenden zu sein schienen und gute Taten vollbrachten. Ich hatte keine guten Taten vollbracht, aber ich versuchte, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich war verantwortungsbewusst. Ich erkannte meinen Namen, wenn ich ihn sah. Hin und wieder beantwortete ich sogar an mich adressierte Briefe, nicht unbedingt sofort nach Erhalt, aber schließlich doch und besonders dann, wenn es Briefe von Fremden waren. »Da ich die letzten achtzehn Monate außer Landes war«, begannen solche Antwortbriefe.
Als Improvisation war meine Darstellung ausreichend. Das Problem bestand nur darin, dass während meiner gesamten Erziehung, bei allem, was man mir oder was ich mir selbst beigebracht hatte, nie die Rede davon gewesen war, dass dieser Film als eine Improvisation gedacht war: Ich sollte eigentlich ein Skript haben und hatte es verlegt. Ich sollte eigentlich Stichworte hören und hörte sie nicht mehr. Ich sollte die Handlung kennen, aber ich erkannte nur, was ich sah: aufblitzende Bilder in wechselnder Folge, Bilder, deren »Bedeutung« nicht über ihre zeitweilige Anordnung hinausreichte; es war kein Film, sondern eine Erfahrung aus dem Schneideraum. Zu einer Zeit, die wahrscheinlich die Mitte meines Lebens gewesen sein wird, wollte ich immer noch an das Erzählte und an die Verständlichkeit des Erzählten glauben, aber zu wissen, dass der Sinn der Bilder mit jedem Schnitt zu ändern war, hieß, diese Erfahrung immer stärker als eine der Elektrik denn eine der Ethik wahrzunehmen.
Während dieser Jahre verbrachte ich so viel Zeit wie damals für mich üblich in Los Angeles, New York und Sacramento. In Honolulu blieb ich häufig so lange, dass es vielen, die ich kannte, exzentrisch vorkam. Mir aber verlieh es die Illusion, ich könnte jederzeit eine neue Version meiner eigenen Geschichte beim Zimmerservice bestellen, verziert mit einer roten Vanda-Orchidee. Auf einer Veranda des Royal Hawaiian Hotel in Honolulu sah ich Robert Kennedys Beerdigung im Fernsehen und die ersten Berichte über das Massaker von My Lai. Am Strand des Royal Hawaiian Hotel las ich den gesamten George Orwell noch einmal, und in einer der Zeitungen, die mit einem Tag Verspätung vom Festland herüberkamen, las ich die Geschichte von Betty Lansdown Fouquet, einer sechsundzwanzigjährigen Frau mit gebleichten blonden Haaren, die ihre fünfjährige Tochter auf dem Mittelstreifen der Interstate 5, einige Meilen südlich der letzten Abfahrt nach Bakersfield, zum Sterben ausgesetzt hatte. Das Mädchen, dessen verkrallte Finger vom Maschendrahtzaun gelöst werden mussten, als die kalifornische Polizei es zwölf Stunden später rettete, berichtete, dass die Kleine dem Auto, in dem ihre Mutter, ihr Stiefvater, ihr Bruder und ihre Schwester davongefahren waren, »sehr lange« hinterhergelaufen sei. Einige dieser Bilder passten in keine der Erzählungen, die ich kannte.
Ein anderes aufblitzendes Bild:
»Im Juni dieses Jahres erlitt die Patientin einen Anfall von Schwindel, Übelkeit und dem Gefühl, jeden Moment bewusstlos zu werden. Eine ausführliche medizinische Untersuchung ergab keine positiven Befunde, und sie wurde auf Elavil 3-mal täglich, 20 mg gesetzt …
Die Interpretation des Rorschachtests lässt auf eine Persönlichkeit schließen, die sich in einem Zustand der Auflösung befindet, mit Anzeichen versagender Abwehrmechanismen und einer zunehmenden Unfähigkeit des Egos, sich auf die reale Welt zu beziehen und normalen Stress zu verarbeiten … Emotional hat sich die Patientin von der Welt anderer Menschen fast vollständig entfremdet. Ihre Fantasie scheint von primitiven, regressiven libidinösen Zwangsvorstellungen beherrscht zu werden, von denen viele verzerrt und bizarr sind … Rein technisch scheinen die grundlegenden affektiven Steuerungen zu funktionieren, aber offenbar werden sie von einer Vielzahl von Abwehrmechanismen nur schwach und unzureichend aufrechterhalten, zu denen Intellektualisierung, obsessiv-zwanghafte Handlungen, Projektion, Reaktionsbildung und Somatisierung gehören, wobei diese Mechanismen der Aufgabe, zugrunde liegende psychotische Vorgänge zu steuern oder zu unterdrücken, nicht länger gerecht zu werden scheinen und sich in einem Zustand des Zerfalls befinden. Die Reaktionen der Patientin zeigen hoch unkonventionelle und bizarre Inhalte voller sexueller und anatomischer Zwangsvorstellungen, und der grundlegende Kontakt zur Realität ist zeitweise auffällig und schwerwiegend gestört. In Bezug auf Qualität und Niveau sind die Reaktionen der Patientin charakteristisch für Individuen mit hoher oder überdurchschnittlicher Intelligenz, momentan jedoch ist ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und entspricht kaum dem Durchschnitt. Die Ergebnisse der Patientin im Thematischen Apperzeptionstest verdeutlichen ihre fundamental pessimistische, fatalistische und depressive Sicht auf die sie umgebende Welt. Sie scheint zutiefst von dem Gefühl ergriffen, dass jedes menschliche Bemühen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, eine Überzeugung, die sie immer weiter in eine abhängige, passive Zurückgezogenheit von der Welt zu drängen scheint. Ihrer Ansicht nach lebt sie in einer Welt, in der Menschen von seltsamen, widersprüchlichen, schwer durchschaubaren und vor allem abwegigen Motivationen getrieben werden, die sie unvermeidlich in Konflikte geraten und ins Verderben stürzen lassen …«
Die Patientin, von der in diesem psychiatrischen Gutachten die Rede ist, bin ich. Die erwähnten Untersuchungen – der Rorschachtest, der Thematische Apperzeptionstest, der Satzvervollständigungstest und das Minnesota-Multiphasen-Persönlichkeitsinventar – wurden 1968 privat in der ambulanten Psychiatrischen Klinik des St. John’s Hospital in Santa Monica durchgeführt, kurz nachdem ich den »Anfall von Schwindel und Übelkeit« erlitten hatte, der im ersten Satz erwähnt wird, und kurz bevor ich von der Los Angeles Times zur »Frau des Jahres« ernannt wurde. Ich kann dazu nur sagen, dass es mir heute nicht unangemessen erscheint, mit einem Anfall von Schwindel und Übelkeit auf den Sommer des Jahres 1968 zu reagieren.
2
In den Jahren, von denen ich spreche, wohnte ich in einem großen Haus in einem Viertel von Hollywood, das einst teuer gewesen war und von dem ein Bekannter jetzt sagte, es sei ein »Viertel für sinnloses Blutvergießen«. Das Haus in der Franklin Avenue hatten wir gemietet. Innen und außen blätterte die Farbe ab, Rohre brachen, Fensterrahmen zerfielen, und der Tennisplatz war seit 1933 nicht gewalzt worden, aber es gab viele Zimmer mit hohen Decken, und während der fünf Jahre, die ich dort wohnte, schien die düstere Trägheit der gesamten Nachbarschaft darauf hinzudeuten, dass ich ewig hier wohnen sollte.
Das ging allerdings nicht, weil die Eigentümer nur darauf warteten, dass der Wert der Gegend wieder stieg und sie das Haus abreißen und durch ein mehrstöckiges Wohnhaus ersetzen konnten, und diese Erwartung einer zwar nicht unmittelbar bevorstehenden, aber doch drohenden Zerstörung machte den Charakter der Nachbarschaft aus. Das Haus gegenüber hatte eine der Talmadge-Schwestern bauen lassen, 1941 war es das Japanische Konsulat gewesen, und jetzt wohnten hinter den mit Brettern vernagelten Fenstern ein paar nicht miteinander verwandte Erwachsene, die eine Art Therapiegruppe zu bilden schienen. Das Haus nebenan gehörte der Suchthilfe Synanon. Ich erinnere mich, mir ein Haus um die Ecke angesehen zu haben, an dem »Zu vermieten« stand: Dieses Haus war früher das Kanadische Konsulat gewesen, es hatte 28 große Zimmer, zwei Kühlräume für Pelze und wurde, ganz dem Geist dieser Gegend entsprechend, nur von Monat zu Monat vermietet, unmöbliert. Da das Bedürfnis, ein unmöbliertes Haus mit 28 Zimmern für einen oder zwei Monate zu mieten, ausgesprochen speziell ist, war unser Viertel hauptsächlich von Rock-’n’-Roll-Bands und Therapiegruppen bevölkert, von sehr alten Frauen, die von Krankenpflegerinnen in schmutzigen Uniformen über die Straße geschoben wurden, und von meinem Mann, meiner Tochter und mir.
Frage: Und was ist noch passiert, falls überhaupt was passiert ist …Antwort: Er sagte, dass er dachte, ich könnte ein Star werden, na ja, ein junger Burt Lancaster oder so, irgendwas in dieser Richtung.Frage: Hat er einen bestimmten Namen genannt?Antwort: Ja, Sir.Frage: Welchen Namen hat er denn genannt?Antwort: Er hat eine Menge Namen genannt. Er sagte Burt Lancaster. Er sagte Clint Eastwood. Er sagte Fess Parker. Er erwähnte eine Menge Namen …Frage: Haben Sie nach dem Essen miteinander gesprochen?Antwort: Während des Essens, nach dem Essen. Mr Novarro hat uns die Karten gelegt, und er hat uns aus der Hand gelesen.Frage: Hat er Ihnen vorhergesagt, dass Sie glücklich sein werden oder dass Sie Pech haben werden, oder was ist passiert?Antwort: Er war kein guter Handleser.
Das sind Auszüge aus den Gerichtsaussagen der Brüder Paul Robert Ferguson und Thomas Scott Ferguson, zweiundzwanzig und siebzehn Jahre alt; angeklagt wegen Mordes an Ramon Novarro, neunundsechzig Jahre alt, verübt in der Nacht des 30. Oktober 1968 in seinem Haus im Laurel Canyon, nicht weit von meinem Haus in Hollywood entfernt. Ich verfolgte die Verhandlungen ziemlich aufmerksam, sammelte Zeitungsberichte und besorgte mir später von einem der Verteidiger eine Abschrift der Prozessakten. Der jüngere Bruder, »Tommy Scott« Ferguson, dessen Freundin unter Eid aussagte, dass sie ihn seit »etwa zwei Wochen nach dem Großen Geschworenengericht« nicht mehr liebe, erklärte, von Mr Novarros Karriere als Stummfilmschauspieler nichts gewusst zu haben, bis ihm am Abend des Mordes ein Foto seiner Geisel als Ben Hur gezeigt wurde. Der ältere Bruder, Paul Ferguson, der mit zwölf angefangen hatte, Geld auf Volksfesten zu verdienen, und mit zweiundzwanzig von sich sagte, »ein schnelles und gutes Leben« gehabt zu haben, beschrieb der Jury auf Nachfrage seine Vorstellung von einem Gauner: »Ein Gauner ist einer, der reden kann – nicht nur mit Männern, auch mit Frauen. Der kochen kann. Der gesellig sein kann. Ein Auto waschen kann. Ein Gauner muss alles Mögliche können. Es gibt ’ne Menge einsame Leute in dieser Stadt, Mann.« Im Laufe der Verhandlungen beschuldigte jeder der Brüder den anderen des Mordes. Beide wurden verurteilt. Ich las die Akte mehrmals und versuchte, das Bild in einer Weise scharf zu stellen, die nicht nahelegte, dass ich, wie mein psychiatrischer Befund es formulierte, »in einer Welt lebte, in der Menschen von seltsamen, widersprüchlichen, schwer durchschaubaren und vor allem abwegigen Motivationen getrieben werden«; den Ferguson-Brüdern bin ich nie begegnet.
Stattdessen lernte ich während jener Jahre in Los Angeles eine der Hauptpersonen in einem anderen Mordprozess kennen: Linda Kasabian, Hauptzeugin der Anklage in dem als Manson-Prozess bezeichneten Verfahren. Einmal fragte ich Linda, was sie von der scheinbar zufälligen Abfolge von Ereignissen hielt, die sie erst auf die Spahn Movie Ranch und dann ins Sybil-Brand-Frauengefängnis geführt hatte, unter der Anklage, Sharon Tate Polanski, Abigail Folger, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Steven Parent und Rosemary und Leno LaBianca ermordet zu haben; eine Anklage, die später fallen gelassen wurde.
»All das sollte mich etwas lehren«, sagte Linda. Linda glaubte nicht, dass dem Zufall kein Muster zugrunde lag. Linda hielt sich an das, was ich später als die Würfeltheorie erkennen sollte, und während der Jahre, von denen ich rede, tat ich das auch.
Vielleicht verdeutlicht es die Stimmung jener Jahre, wenn ich Ihnen sage, dass ich damals jedes Mal, wenn ich meine Schwiegermutter besuchte, bewusst an einem gerahmten Vers vorbeisah, einem »Haussegen«, der im Flur ihres Hauses in West Hartford in Connecticut hing.
Gott segne die Ecken in diesem Hausund segne Balken und Treppen –und segne den Herd und segne den Schrankund segne alle Betten –und segne das klare Fensterglas, durch das die Sterne scheinen,und segne jede Tür, die offen ist dem Fremdenund dem Deinen.
Dieser Vers ließ mich frösteln, weil er genau das »ironische« Detail zu sein schien, auf das sich die Journalisten stürzen würden, sobald am Morgen die Leichen gefunden wurden. In meinem Viertel in Kalifornien hätten wir die Tür, die dem Fremden und dem Deinen offen war, sicherlich nicht gesegnet. Paul und Tommy Scott Ferguson waren die Fremden an Ramon Novarros Tür gewesen, oben im Laurel Canyon. Charles Manson war der Fremde an Rosemarys und Leno LaBiancas Tür, drüben in Los Feliz. Einige dieser Fremden klopften an und dachten sich einen Grund aus, um eingelassen zu werden: vielleicht einen Anruf beim Abschleppdienst wegen eines Autos, das nirgends zu sehen war. Andere machten die Tür einfach auf und kamen herein, und ich lief ihnen dann in der Eingangshalle über den Weg. Ich erinnere mich daran, einen dieser Fremden in der Eingangshalle gefragt zu haben, was er wolle. Wir sahen uns an, wie es schien, ziemlich lange, und dann bemerkte er meinen Mann auf dem Treppenabsatz. »Tiefkühlhühnchen«, sagte er schließlich, aber wir hatten kein Tiefkühlhühnchen bestellt, und er hatte auch keines dabei. Ich notierte mir das Nummernschild seines Lieferwagens. Heute kommt es mir vor, als hätte ich mir in jenen Jahren ständig Nummernschilder von Lieferwagen notiert, Lieferwagen, die um den Häuserblock fuhren, Lieferwagen, die auf der anderen Straßenseite parkten, Lieferwagen, die an der Kreuzung standen. Ich legte die Zettel mit den Nummernschildern in die Schublade eines Ankleidetisches, wo die Polizei sie finden würde, wenn es so weit war.
Dass es so weit kommen würde, bezweifelte ich nie, jedenfalls nicht in den unzugänglichen Regionen des Bewusstseins, in denen ich mehr und mehr zu leben schien. Den Begegnungen in jenen Jahren fehlte häufig jede Logik mit Ausnahme der des Traums. In dem großen Haus auf der Franklin Avenue schienen die Leute zu kommen und zu gehen, ohne dass es in einer Beziehung zu dem stand, was ich tat. Ich wusste, wo die Laken und die Handtücher aufbewahrt wurden, aber nicht immer, wer in den Betten schlief. Ich hatte die Schlüssel, aber nicht den Schlüssel. Ich erinnere mich an einen Ostersonntag, an dem ich eine 25 mg starke Beruhigungstablette nahm und ein großes und aufwendiges Mittagessen für mehrere Leute zubereitete, von denen viele auch am Montag noch da waren. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Tag barfuß über den abgenutzten Holzfußboden lief, und an »Do You Wanna Dance« auf dem Plattenspieler, »Do You Wanna Dance« und »Visions of Johanna« und an ein Lied mit dem Titel »Midnight Confessions«. Ich erinnere mich, dass mir eine Babysitterin sagte, sie würde in meiner Aura den Tod sehen. Ich erinnere mich, dass ich mich mit ihr darüber unterhielt, woran das liegen könnte, sie dann bezahlte, alle Fenster öffnete und mich im Wohnzimmer schlafen legte.
Es war nicht einfach, mich in jenen Jahren in Erstaunen zu versetzen. Es war nicht einfach, auch nur meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich war mit meiner Intellektualisierung beschäftigt, mit meinen obsessiv-zwanghaften Handlungen, meiner Projektion, meiner Reaktionsbildung und Somatisierung und mit der Akte des Ferguson-Prozesses. Ein Musiker, den ich ein paar Jahre zuvor kennengelernt hatte, rief mich aus einem Ramada Inn in Tuscaloosa an, um mir zu erklären, wie ich mich mithilfe von Scientology selbst retten könne. Ich war ihm erst einmal begegnet, hatte mit ihm vielleicht eine halbe Stunde über Naturreis und die Hitliste geredet, und jetzt erzählte er mir von Alabama aus etwas von E-Metern und wie ich den reinigenden Weg zum »Clear« beschreiten könne. Ein Fremder rief mich aus Montreal an, offenbar um mich für ein Drogengeschäft anzuwerben.
»Geht das klar, hier am Telefon zu reden?«, fragte er mehrmals. »Big Brother hört nicht mit?«
Ich sagte, ich glaubte nicht, obwohl ich es immer häufiger glaubte.
»Weil das, worum es hier geht, im Grunde die Anwendung der Zen-Philosophie auf Geld und Geschäfte ist, klar? Und wenn ich sage, wir werden den Untergrund finanzieren, und wenn ich vom ganz großen Geld rede, dann weißt du, wovon ich spreche, weil du weißt, was abgehen wird, richtig?«
Vielleicht sprach er gar nicht von Drogen. Vielleicht sprach er davon, wie man aus M1-Gewehren Profit schlagen konnte: Ich suchte bei solchen Anrufen schon nicht mehr nach einer Logik. Eine Frau, mit der ich in Sacramento zur Schule gegangen war und die ich zuletzt 1952 gesehen hatte, tauchte 1968 in meinem Haus in Hollywood als Privatdetektivin von West Covina auf, sie war eine der wenigen Privatdetektivinnen, die eine Zulassung in Kalifornien hatten. »Sie nennen uns ›Dickless Tracy‹, Dick Tracy ohne Schwanz«, sagte sie, während sie gedankenlos, aber systematisch die Post auf dem Tisch in der Halle durchging. »Ich habe eine Menge Freunde beim Strafvollzug«, sagte sie dann. »Du solltest sie kennenlernen.« Wir versprachen, in Kontakt zu bleiben, sahen uns aber nie wieder: nicht untypisch für jene Zeit. Die Sechzigerjahre waren vorbei, ehe mir klar wurde, dass ihr Besuch nicht ausschließlich freundschaftlich gewesen sein könnte.
3
Es war sechs oder sieben Uhr an einem Frühlingsabend 1968, und ich saß auf dem kalten Linoleumboden eines Tonstudios am Sunset Boulevard und sah einer Band mit dem Namen The Doors dabei zu, wie sie eine Schlagzeugeinspielung aufnahm. Im Großen und Ganzen erregten die Dinge, mit denen sich Rock-’n’-Roll-Bands beschäftigten, nur geringfügig meine Aufmerksamkeit (von LSD als Mittel zur Transzendenz hatte ich bereits gehört und vom Maharishi und universeller Liebe, und nach einer Weile klang das für mich alles wie marmalade skies der Beatles), aber die Doors waren anders, die Doors interessierten mich. Die Doors schienen nicht davon überzeugt, dass Liebe Brüderlichkeit war und das Kamasutra. Ihre Musik bestand darauf, dass Liebe Sex war und Sex der Tod und dass darin die Erlösung liege. Die Doors waren die Norman Mailers der Top 40, Missionare des apokalyptischen Sex. »Break on through« drängten ihre Texte und »Light my Fire« und
Come on baby, gonna take a little rideGoin’ down by the ocean sideGonna get real closeGet real tightBaby gonna drown tonight –Goin’ down, down, down.
An diesem Abend 1968 hatten sie sich in unbehaglicher Symbiose zusammengefunden, um ihr drittes Album aufzunehmen, und das Studio war zu kalt, und das Licht war zu grell, und überall lagen Unmengen von Kabeln und Schaltungen dieser bedrohlich blinkenden elektronischen Ausrüstung, mit der Musiker so spielend leben. Drei der vier Doors waren da. Ein Bassist war da, der von einer Band mit dem Namen Clear Light ausgeliehen war. Der Produzent war da und der Tontechniker, der Tourmanager, eine Handvoll Mädchen und ein Sibirischer Husky namens Nikki mit einem grauen und einem goldenen Auge. Es gab halb volle Papiertüten mit hart gekochten Eiern, Geflügelleber und Cheeseburgern, und es gab leere Apfelsaftflaschen und Flaschen, in denen kalifornischer Roséwein gewesen war. Alles und jeder, den die Doors brauchten, um ihr drittes Album fertigzustellen, war da, alle bis auf einen: den vierten der Doors, den Sänger Jim Morrison, einen vierundzwanzigjährigen Absolventen der Universität Los Angeles, der schwarze Lackhosen ohne Unterwäsche trug und einen Raum des Möglichen zu verheißen schien, der über einen Selbstmordpakt noch hinausging. Morrison war es, der die Doors als »erotische Politiker« bezeichnet hatte. Morrison war es, der das Interesse der Band beschrieben hatte als ein Interesse an »allem, was mit Revolte, Unordnung, Chaos zu tun hat, und an allem, was sinnlos ist«. Morrison war es, der im Dezember 1967 in Miami wegen eines »unsittlichen« Auftritts verhaftet worden war. Morrison war es, der die meisten Doors-Texte schrieb, deren Besonderheit darin bestand, dass sie entweder von einer unbestimmten Paranoia oder ziemlich bestimmt von der Behauptung handelten, dass der Liebestod der ultimative Rausch sei. Und Morrison war es, der fehlte. Ray Manzarek und Robby Krieger und John Densmore waren es, die dafür sorgten, dass die Doors wie die Doors klangen, und vielleicht hatten Manzarek, Krieger und Densmore dafür gesorgt, dass siebzehn von zwanzig Befragten bei American Bandstand die Doorsallen anderen Bands vorzogen, aber Morrison war es, der in seinen schwarzen Lackhosen ohne Unterwäsche auf die Bühne ging und die Idee rüberbrachte, und Morrison war es, auf den sie jetzt warteten.
»Hört mal«, sagte der Tontechniker. »Als ich herkam, habe ich einen Radiosender gehört, der drei Doors-Lieder gespielt hat, zuerst ›Back Door Man‹, dann ›Love Me Two Times‹ und ›Light My Fire‹.«
»Hab ich gehört«, murmelte Densmore. »Hab ich gehört.«
»Ja und? Was ist daran so schlimm, wenn sie drei deiner Songs spielen?«
»Dieser Typ hat sie seiner Familie gewidmet.«
»Echt? Seiner Familie?«
»Ja. Echt krass.«
Ray Manzarek beugte sich über ein Gibson-Keyboard. »Meint ihr, Morrison kommt noch mal wieder?«, fragte er in die Runde.
Niemand reagierte.
»Damit wir ein bisschen Text aufnehmen können?«
Der Produzent war mit der Schlagzeugeinspielung beschäftigt, die sie gerade aufgenommen hatten. »Das will ich hoffen«, sagte er, ohne aufzusehen.
»Ja«, sagte Manzarek. »Ich auch.«
Mein Bein war eingeschlafen, aber ich stand nicht auf; eine seltsame Anspannung schien jeden im Raum katatonisch zu machen. Der Produzent spulte das Band zurück. Der Tontechniker sagte, er würde jetzt gern seine Atemübungen machen. Manzarek aß ein hart gekochtes Ei. »Tennyson hat seinen Namen in ein Mantra verwandelt«, sagte er zum Tontechniker. »Keine Ahnung, ob er ›Tennyson Tennyson Tennyson‹ gesagt hat oder ›Alfred Alfred Alfred‹ oder ›Alfred Lord Tennyson‹, aber er hat’s jedenfalls gemacht. Vielleicht hat er auch nur ›Lord Lord Lord‹ gesagt.«