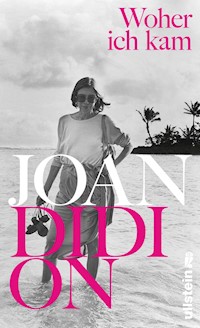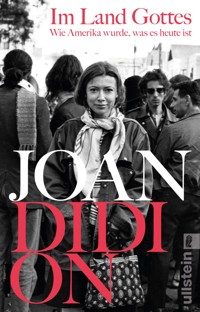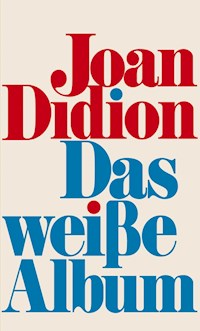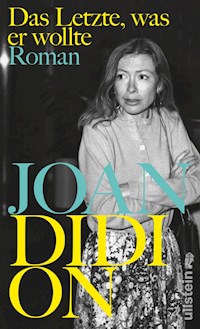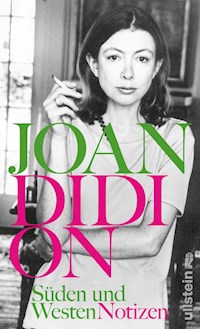13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Joan Didion erzählt von den Leitfiguren des American Dream wie Howard Hughes, Joan Baez oder John Wayne, vom Glanz Hollywoods und der Einsamkeit von Alcatraz, von der Aufbruchsstimmung der sechziger Jahre und der Ernüchterung, die ihr folgte. Dabei gelingt es ihr, die amerikanische Wirklichkeit in unvergessliche Bilder zu fassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Schonungslos seziert Joan Didion den Mythos des American Dream, ein Traum, der auch im Scheitern nichts von seiner Faszinationskraft eingebüßt hat. Der vorliegende Essayband versammelt einige ihrer besten Texte, darunter Auszüge aus Stunde der Bestie und Das weiße Album, die 1968 und 1979 in den USA erschienen sind und zu Klassikern wurden. Antje Rávik Strubel hat sie neu übersetzt und mit einem Vorwort versehen.
Die Autorin
Joan Didion, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für große amerikanische Zeitungen und war Mitherausgeberin der Vogue. Heute gilt sie als eine der wichtigsten Stimmen der amerikanischen Literatur, die mit ihren fünf Romanen und zahlreichen Essaybänden das intellektuelle Leben der USA im 20. Jahrhundert entscheidend prägte.
Die Übersetzerin
Antje Rávik Strubel lebt und arbeitet als Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Zuletzt erschienen von ihr In den Wäldern des menschlichen Herzens sowie Übersetzungen der Werke von Karolina Ramqvist und Lucia Berlin.
In unserem Hause sind von Joan Didion bereits erschienen:
Blaue Stunden · Das Jahr magischen Denkens · Im Land Gottes · Menschen am Fluss ·Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben ·Sentimentale Reisen · Süden und Westen ·Woher ich kam · Das Letzte, was er wollte
Joan Didion
Wir erzählen uns Geschichten,um zu leben
Aus dem Amerikanischen übersetztund mit einem Vorwort versehenvon Antje Rávik Strubel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1130-2
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juni 2021
© der deutschsprachigen Neuausgabe in dieser Zusammenstellung
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008, claassen Verlag
© 1961/1979 by Joan Didion
Die Originaltexte erschienen in den beiden Bänden The White Album (1979 im Verlag Simon & Schuster) und Slouching Towards Bethlehem (1968 im Verlag Farrar, Straus und Giroux).
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Titelabbildung: © Brigitte Lacombe
Inhalt
Vorwort. Von Antje Rávik Strubel
EINS
Das Spiel ist aus
Aus dem Vorwort zu Stunde der Bestie
Stunde der Bestie
Wo die Küsse niemals enden
Vom Sinn, ein Notizbuch zu besitzen
Über Selbstachtung
Über Moral
Vom Nachhausekommen
Notizen einer Tochter des Landes
John Wayne: Ein Liebeslied
7000 Romaine, Los Angeles 38
Mir will dieses Monster nicht aus dem Kopf
Fels der Zeit
ZWEI
Am Morgen nach den sechziger Jahren
Das weiße Album
Brave Bürger
Die Frauenbewegung
Georgia O’Keeffe
Doris Lessing
In Hollywood
Stille Tage in Malibu
Vorwort
Von Antje Rávik Strubel
Es ist bemerkenswert: Seit Joan Didion mit Anfang der achtziger Jahre auch in Deutschland gelesen werden kann, wird sie von der öffentlichen Aufmerksamkeit immer nur gestreift. Ihre Bücher tauchten in deutscher Übersetzung zwar auf, aber sie verschwanden auch rasch wieder. In wechselnden Verlagen wurden sie erneut aufgelegt und waren abermals schnell vergriffen. Gelegentlich blitzte das scharfe Denken Didions auch in unsere geistige Landschaft und ebenso gelegentlich traf man den einen oder den anderen aus jener ausgesuchten Gruppe an Verehrern wieder, die Didion seit dem Beginn ihrer Karriere als Schriftstellerin und Essayistin treu sind und die für sie glühen. Sie blieb ein Geheimtip. Als ich während des Übersetzens ahnungslosen Freunden Didions Essays zu lesen gab, brachten sie mir die Texte mit einem verschwörerischen Lächeln zurück, als hätten sie etwas Außergewöhnliches erfahren und seien jetzt aufgenommen in den exklusiven Kreis der Erhellten.
Didions großes, persönliches Trauerbuch Das Jahr magischen Denkens von 2006, in dem sie ihren tiefen Schmerz über den plötzlichen Verlust ihres Mannes John Gregory Dunne bis an die Grenzen des Denkvermögens auslotet, hat sie zwar am Ende doch noch auf eine deutsche Bestsellerliste gebracht. Aber die Didion, die sich mit den Essays des vorliegenden Buches in den sechziger und Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts als scharfsichtige, gesellschaftskritische Stimme in die Weltöffentlichkeit und in die amerikanische Denker-Elite schrieb, ist in Deutschland bestenfalls einem kleinen Kreis bekannt. Das Renommee einer Susan Sontag hat Joan Didion hierzulande nie erreicht. Das mag daran liegen, daß ihren Texten die Schlagkraft des Eindeutigen fehlt. Es mag daran liegen, daß Didion keine fixen Antworten hat, keine ehernen Meinungen vertritt, die medial verwertbar wären, daß sie eben keine moralische, sondern eine analytische Denkerin ist und sich selten persönlich in der Öffentlichkeit äußert. Vielleicht liegt es auch daran, daß es offenbar noch immer schwierig ist, sich vorzustellen, auf dem Terrain der gesellschaftlichen Debatten könne es mehr als eine große, brillante Denkerin geben, obwohl sich viele mittelgroße Männer da ganz unbeschwert gemeinsam tummeln.
Vielleicht aber hat die mangelnde Prominenz dieses Denkens noch einen ganz anderen Grund; man möchte das private Leseglück nicht durch öffentliche Anpreisungen verwässern, die sich notwendigerweise unter das Niveau des Gepriesenen begäben.
Wann immer ich auf Lesungen über Joan Didion spreche und dann in meistens ratlose Gesichter im Publikum sehe, würde ich gern das Podium verlassen, nach draußen gehen, auf den Horizont zu und mich mit nichts mehr beschäftigen als den Gezeiten.
Wann immer mir jemand fragend entgegenblickt, weil der Name dieser Autorin ihm fremd ist und ich den Namen buchstabiere, als sei sie eine Debütantin und nicht schon lange eine der großen Zeitgeister, der überragenden Köpfe der amerikanischen Kultur- und Literaturgeschichte, wann immer ich daran denke, daß ich selbst vor wenigen Jahren mit dem Namen Didion noch nichts habe verbinden können, fällt mir ein, was sie in einem Interview zum Schreiben ihrer Essays sagte: »Man ist verpflichtet, Dinge zu tun, die man für sinnlos hält. Es ist wie leben.«
Das nimmt der Enttäuschung über die ungerechte Verteilung der Aufmerksamkeit sofort die Schwere. Was sie da sagte, könnte von der Sorge um Bekanntheitsgrad und Ruhm nicht ferner sein und trifft vielleicht am genauesten den Kern der seltsamen Verschwiegenheit: Im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit ist das Schreiben am Ende so vergeblich wie alles andere auch. – Hier wird eine Erinnerung ans Wesentliche ausgesprochen, für die unsere Zeit nicht besonders gut gemacht scheint, aber vielleicht ist keine Zeit dafür gemacht.
Die, die Didion lesen und nicht mehr loskommen von ihrer schwindelerregend nüchternen Klarsicht, sind fasziniert von der doppelten Bewegung in ihren Texten: Die Essays machen den Gedanken der Vergänglichkeit, den sie aufwerfen, gleichzeitig erträglich; es kann Beruhigung, sogar Komik darin liegen, die Dinge von ihrem Ende her zu betrachten. Und sie zeigen, wie angesichts einer letztlichen Sinnlosigkeit gerade die Offenlegung eines unsauberen Denkens zur moralischen Pflicht wird.
Was Didion im Visier hat, sind unsere sprachlichen Rettungsversuche, sind die Illusionen, die hohlen Idealisierungen, die Lügen, die verlogene Moral, die bürokratischen und medialen Verrenkungen, die politischen und sozialen Euphemismen, mit denen wir uns einreden, unser Leben folge einem höheren Plan, strebe auf Ruhm und Glück zu, unterliege einer Gesetzmäßigkeit, ergäbe Sinn.
Didion interessiert, wie sich unsere Sprache in unterschiedlichen historischen Phasen den gesellschaftlichen Zweckmäßigkeiten anschmiegt, wie sie ge- und mißbraucht wird und wie sich das, wofür sie gebraucht wird, durch die Sprache verändert. Sie legt den Selbst- und den Fremdbetrug in unseren Reden bloß, sie macht die pädagogischen Versuche, die psychologischen Kniffe und all die eitlen Tricks sichtbar, die die grundsätzliche Unzulänglichkeit des menschlichen Daseins kaschieren helfen, und sie zeigt, wie daraus Geschichten entstehen, die wir nötig haben, um zu leben. Diese Geschichten ändern sich laufend. Wir färben sie unserer Situation, unserem Glauben, unserer Weltauffassung entsprechend ein. Ihre wesentliche Funktion ist jedoch von jener zeitlosen Gültigkeit, wie sie Didion ansonsten nur noch den Abläufen der Geologie zubilligt, der Unausweichlichkeit, mit der sich Erdbeben ereignen, tektonische Platten verschieben, Berge erodieren. Wir brauchen diese Geschichten als fabelhaftes, buntbebildertes Vergessen des uns bedrängenden Wissens: In diesem Leben sind wir von Anfang an tot.
Trotziges Aufbegehren oder der Glaube an menschlichen Fortschritt sind nicht Sache einer Autorin, die von sich sagt, sie sei »mit der Überzeugung aufgewachsen, daß das Herz der Finsternis nicht in einem Fehler der gesellschaftlichen Ordnung, sondern dem Menschen im Blut« liege. »Wenn es den Menschen bestimmt ist, Fehler zu machen, dann ist notwendigerweise jede gesellschaftliche Ordnung fehlerhaft.«
Auch diese Überzeugung, geschmiedet aus Joseph Conrads Novelle Herz der Finsternis, unterliegt für Didion den tektonischen Verschiebungen der Zeit; eine Fußnote der Geschichte, die bestenfalls noch Auskunft gibt über das intellektuelle Leben in Berkeley oder Harvard während der fünfziger Jahre, historisch aber irrelevant ist. Diese Fußnote hat Didions Weltsicht allerdings entscheidend geprägt. Die fünfziger Jahre in den USA sind der Horizont, vor dem sie den gesellschaftlichen Wandel der sechziger und siebziger Jahre betrachtet. Die radikale »Black-Power«-Bewegung, die sich als Reaktion auf die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Malcolm X entwickelte, die Studentenunruhen, die Frauenbewegung, die Vietnam-Proteste, die militanten Auseinandersetzungen der Neuen Linken; all das sieht sie unter der Prämisse der Unzulänglichkeit des Menschen. Das ist ein Glück. Denn hier schreibt eine Autorin, die sich nicht korrumpieren läßt von sprachlichen Floskeln, geistigen Moden oder ideologischen Formeln, mit denen sich die Protestbewegungen ihrer selbst versichert und erst in eine trunkene Erregtheit, später in »einen Kater« hineingeredet haben. In der aufgepeitschten, hitzigen Phase der Studentenrevolten, die 1964 in Berkeley ihren Anfang nahm, der Hippie-Bewegung mit ihrer sexuellen und spirituellen Selbstbefreiungswut, der Sit-Ins, Beatniks, Anti-Kriegsdemonstrationen und Friedensmärsche; im Tumult einer gesellschaftlichen Umwälzung behält Didion ihre Distanz. Obwohl sie mitten im Geschehen ist (sie war die erste Journalistin, die sich ernsthaft für die »Blumenkinder« in San Francisco interessierte), bleibt sie eine ruhige Beobachterin. Ihr desillusionierter Blick zeigt jedes dieser Ereignisse als sprachliche Aufführung, als Show, die in einer bestimmten Epoche das Fehlerhafte der menschlichen Existenz vergessen macht. Ihre Essays, entkernt von emotionalem Ballast, wirken auf mich so, als seien sie außerhalb der Zeit oder doch mit großem zeitlichem Abstand zum geschilderten Gegenstand geschrieben worden. Ich erfahre viel über die Eruptionen, die das heutige geistige Leben der USA formten, gespalten zwischen fundamentalreligiösem Konservatismus und Kriegstreiberei auf der einen und wegweisenden Gender- und Anti-Rassismusdebatten und einer einflußreichen Kunst- und Musikszene auf der anderen Seite. Ich erfahre viel über amerikanische Mentalität und amerikanische Mythen und bekomme in Nahaufnahme zu sehen, was sich aus oft idealisierendem Weitwinkel seit fünfzig Jahren auch ins deutsche Bewußtsein geprägt hat.
Jenes Erkenntnisfeuer jedoch, das die Essays in mir zünden und das auch im verschwörerischen Blick meiner Freunde aufzuglühen schien, hat eine andere Ursache. Da Didion vom Ende her denkt, da sie von einem Handeln vor der Vergeblichkeit allen Handelns ausgeht, betrachtet sie immer auch den Einzelnen in seiner Verlorenheit. Ganz gleich also, wie verschieden die tagespolitischen Zusammenhänge, die zeitgeschichtlichen Umstände sein mögen, in denen der Einzelne lebt; aufs Persönliche bezogen, ähneln sich die Verhaltensweisen, mit denen Menschen mit bestimmten Anfechtungen klarzukommen versuchen. Und das ist es, was die Entzündung verursacht: Die Essays machen mir meine eigenen gedanklichen Flickenteppiche, meine Tricks und Taktiken begreiflich, mit denen ich mich behelfe, um mich in meiner eigenen Zeit zu orientieren.
Bei der Lektüre ergeben sich Parallelen zwischen Zeiten und Ländern wie von ungefähr.
Die »schweigende Generation« der fünfziger Jahre in den USA könnte so auch in der deutschen Nachkriegszeit geschwiegen haben, gleichzeitig erinnert mich die Beschreibung der Jaycees, geleckte Jungunternehmer mit Fünfziger-Jahre-Touch, an die studierenden Karriereautomaten von heute, die das Gefühl vermitteln, würde man sie knacken, fielen tatsächlich nichts als Münzen heraus. Didions Kritik an der Frauenbewegung, die in ihrer dogmatischen Erstarrung und Trivialisierung nicht in ein wirklich radikales Denken gefunden habe, dürfte angesichts der Forderung nach einem neuen feministischen Ansatz, der jetzt zuweilen laut wird, immer noch für Diskussion sorgen.
Besonders interessant für mich, die nach der Wende begriffen hat, daß mit ’68 nicht der Prager Frühling, sondern eine Studentenbewegung aus Frankfurt/Main gemeint ist, die bis heute im gesamtdeutschen Selbstverständnis den Ton vorgibt, ist Didions Beschreibung der Studentenrevolte am San Francisco State College. Unter all der Aufregung auf dem Campus findet sie ein ferienlagerhaftes Gemeinschaftsgefühl; ein Resultat dessen, wie gelangweilte Mittelschichtskinder sich Revolution vorstellen.
Und der Hollywood-Essay »Mir will dieses Monster nicht aus dem Kopf« läßt sich locker auf das heutige deutsche Fernsehdilemma beziehen; die Programm-Misere scheint weniger an der gern bemühten Einschaltquote zu liegen, als an jener »fehlenden Einbildungskraft und Schlamperei im Denken« der Fernsehmacher, die Didion den Regisseuren und Drehbuchautoren Hollywoods in den siebziger Jahren knallhart attestiert.
Ihre Analysen eines utopischen Moments, in dem sich eine Gesellschaft vor einer grundlegenden Erneuerung glaubt, haben nichts an Strahlkraft eingebüßt. Das zeigt sich vor dem Hintergrund des diesjährigen amerikanischen Wahlkampfs, in dem zur Stärkung eines Präsidentschaftskandidaten sehnsüchtig der Vergleich mit John F. Kennedy heraufbeschworen wird. Hier bedient sich eine junge Generation einer ähnlich aufgeblasenen euphorischen Rhetorik, wie sie Didion schon vor mehreren Jahrzehnten auf spitzer Feder hat zerplatzen lassen.
In ihren gesellschaftskritischen Essays wird eines immer wieder deutlich: Mit Didion kann man nicht auf die Barrikaden gehen. Sie ist eine Wirklichkeitsseziererin ohne Hoffnung. Ohne Plädoyers. Sie macht dem Vertrauen darauf, daß die Welt sich bessert, kein einziges Zugeständnis. Stattdessen erschüttert sie das Fundament und läßt uns dann zurück inmitten eingestürzter Bauten. Sie sagt es so: »Wenn ich daran glauben könnte, daß es das Schicksal der Menschen auch nur im geringsten beeinflussen würde, auf die Barrikaden zu gehen, dann würde ich auf diese Barrikaden gehen, und häufig wünsche ich mir, ich könnte daran glauben, aber es wäre nicht ganz ehrlich zu behaupten, ich verspräche mir davon ein Happy-End.«
Dieses Konstatieren einer Fruchtlosigkeit jeglichen gesellschaftlichen Engagements ist melancholisch und nicht folgenlos. Im Porträt der Malerin Georgia O’Keeffe wird aus der Melancholie Bewunderung und eine mitreißende Liebeserklärung an den kämpferischen Eigensinn einer einzelnen.
Didions Anti-Illusionismus reicht so tief, daß er dort, wo Ironie und sarkastische Zuspitzung ihn nicht mehr abfedern, tatsächlich schmerzt, und es ist unwahrscheinlich, daß der Kreis ihrer Verehrer sich bald wesentlich vergrößern wird. Momentan sicher nicht. Denn wer will sich schon in dieser von Terror, wirtschaftlicher Not und sozialen Grabenkämpfen aufgeriebenen Zeit noch zusätzlich verunsichern lassen? Wer will schon mit ständigem Einspruch aufgehalten werden, wo man sich gerade im Kampf um schwindende Arbeitsplätze zu einer neuen Gehorsamkeit erzieht? Wer will sich beim marktgerechten Verbiegen der Persönlichkeit so genau beobachtet wissen, wer bei der anstrengenden Selbstsuggestion stören lassen, daß das alles schon irgendwie sinnvoll und richtig sei?
Möglich, daß die Voraussetzungen, unter denen Didion zu schreiben begann, bessere waren. Möglich, daß gesichertere Lebensumstände eine skeptische Haltung begünstigen.
Ihre Studienjahre fielen in eine wohlstandsgesättigte Zeit, in eine Zeit der Vorort-Familien-Idyllen mit großen Autos und Farbfernsehern, in eine Zeit des höchsten Lebensstandards, den die USA je erreicht haben und der die Erfüllung des amerikanischen Traums in greifbare Nähe rückte. Nach Jahren der wirtschaftlichen Depression blühte das Land. Der Aufschwung in den fünfziger Jahren machte es möglich, sich wieder unbekümmert zu vermehren, und McCarthys schwarze Listen ließen es ratsam erscheinen, sich ins Private zurückzuziehen, wo Elvis Presley auf dem Plattenteller lag und weder die Echos der ersten Nukleartests noch der wachsende Unmut der bedrängten nichtweißen Minderheiten zu hören waren. Und an den Universitäten wurde der Rückzug ins Private als Erforschung des persönlichen Seelenlebens betrieben. Der auf Konsum und Privatvergnügen ausgerichtete Lebensstil lähmte allerdings und verlangte, zumindest bei den Jüngeren, nach Abwechslung.
Während die Scheinzufriedenheit die einen zu Rebellen oder Idealisten machte, scheint sich für Didion mit Joseph Conrad und seiner Reise ins Dunkel der menschlichen Psyche eine andere Denkrichtung eröffnet zu haben, die in der aufpolierten, Jukebox-Schlager-seligen Öffentlichkeit nur als unterströmendes Unbehagen spürbar gewesen sein wird: Die Seelenforschung endet im Leeren. Der Mensch ist isoliert. Die Frage nach seinem Sinn bleibt unbeantwortet oder verliert sich im Wahn. »Schwarze Gestalten kauerten, lagen, saßen ringsumher zwischen den Bäumen, an die Stämme gelehnt, sich an die Erde klammernd, halb sich abzeichnend in dem trüben Licht, halb davon verwischt, in allen Stellungen des Schmerzes, der Preisgegebenheit, der Verzweiflung«, schreibt Conrad über seine Entdeckungen an einem Ort, an dem der Zivilisationslack blättert und nichts als Gier, Gewalt und Grausamkeit hervortreten läßt; als letzte brutale Abwehrversuche einer endgültigen Ohnmacht.
An dieser soliden kulturpessimistischen Haltung Conrads hat Didion zweifellos ihre Beobachtungsgabe geschliffen. Aber im Unterschied zu dem durch die Kolonialgebiete getriebenen Schriftsteller machte sie diese Haltung nicht zum Thema, sondern zum Ausgangspunkt ihres Schreibens.
Im Essay »Am Morgen nach den sechziger Jahren« sagt sie, daß sie beim Lesen von Conrads Herz der Finsternis vor allem eines begriffen habe: wie Sprache funktioniere. Sie habe es begriffen, als sie begriff, daß der wichtigste Satz, gleichsam die Quintessenz des Buches, in einem Postskriptum stehe. Das Wesentliche wird verschwiegen, nachträglich und beiläufig kommt es eventuell ans Licht. Diese Erkenntnis macht Didion zu einer Sprachskeptikerin. Für sie ist Sprache beherrscht von dem, was sie verbirgt. Da die Bedeutung eines Wortes sich mit jedem Gebrauch verändert, muß jedes Sprechen über eine Sache die Sache verfälschen, verschleiern. Unsere Selbsttäuschungen sind also bereits im Wesen der Sprache begründet.
Auf ihre Sprachskepsis kommt Didion in vielen Interviews zu sprechen, und die Skepsis ist vielleicht der Grund, weshalb sie in diesen Interviews gewöhnlich nicht viel sagt. Im Jahr magischen Denkens äußert sie sich so: »Sogar schon als Kind und lange bevor das, was ich schrieb, überhaupt veröffentlicht wurde, entwickelte ich ein Gefühl dafür, daß der eigentliche Sinn bereits im Rhythmus der Worte und Sätze und Abschnitte angelegt ist; eine Technik, um genau das zu verschweigen, was sich, wie ich vermutete, hinter einer immer undurchdringlicheren Fassade befand.«
Man hat sie mutig genannt, ihren Röntgenblick furchtbar, ihre Kritik scharfzüngig, ihren Verstand kristallklar, und ein Grund dafür mag sein, daß sie nicht wie andere den Inhalt der Worte kritisiert, sondern bereits bei der sprachlichen Form ansetzt. Und doch liegt über einigen ihrer Essays ein überraschend weiches Licht. Sobald sie von Kalifornien spricht, von Sacramento, von den Rettungsschwimmern an den Stränden des Pazifik oder vom Leben in Malibu, schwingt Traurigkeit mit. Es scheint, als betrauere sie den Verlust einer stimmigen, verstehbaren, sinnhaften Welt. Als hätte es diese Welt einmal gegeben. Das verwundert bei einer sonst so gnadenlosen Autorin, deren Gnadenlosigkeit sich auch gegen sie selbst richtet und der sicher nicht unterstellt werden kann, sie glaube, »früher war die Zukunft auch besser«; oder allerhöchstens in Form dieses ironischen Saltos von Karl Valentin.
Wann immer bei Didion leise Traurigkeit spürbar wird, geht es um ihre Wurzeln, um ihre Herkunft aus dem westlichsten Westen Amerikas. Ihre Kindheit verbrachte sie in der ehemaligen Goldgräberstadt Sacramento am Rand endloser Obstplantagen. Als Conrads Novelle 1899 zum erstenmal veröffentlicht wurde, hatte Kalifornien gerade eine seiner größten Zuwanderungswellen erlebt. Ab den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatten sich immer mehr weiße Siedler in Richtung Westküste durchgeschlagen, sie drangen zum Pazifik vor und drängten die Eingeborenen zurück. Didions Familie gehörte zu denen, die sich 1850 in Sacramento niederließen, sie selbst zur vierten Generation. Vielleicht las sie Herz der Finsternis wie einen Referenztext auf das Erleben der Vorfahren. Die Reise des Helden ins Unerschlossene, Fremde mit allen idealistischen Überhöhungen und Ängsten und der Enthüllung einer entsetzlichen Brutalität findet leicht eine Entsprechung in der Besiedelung des amerikanischen Westens. Es sind die ersten Siedler mit ihrer Härte, ihrem Pragmatismus und dem schieren Überlebenswillen, die Didions Vorstellungskraft ebenso fesseln wie der mit der Besiedelung entstehende Mythos. Über die harte Realität legte sich das Bild eines vor Reichtum strotzenden, von sozialen Schranken und Hierarchien befreiten, selbstbestimmten Lebens. Didion kennt die Verlockungen dieses Frontier-Mythos, der bis heute das amerikanische Selbstverständnis prägt und immer wieder für die Behauptung einer politischen Großmachtstellung in Anspruch genommen wird. Der Held dieses Mythos, der amerikanische Adam, hat einen strahlenden Platz im kollektiven Gedächtnis. Dieser nur auf seine eigene Stärke vertrauende Mann, dessen Durchsetzungsvermögen von Charakterstärke kündet und der mit klarem Blick zwischen gut und böse unterscheidet, dieser freie Gegenspieler einer überzivilisierten Gesellschaft, findet in Didions Eloge auf John Wayne einen träumerischen Niederschlag.
Die Ureinwohner sind auf Didions essayistischer Landkarte nicht verortet. Die brutale Ausrottung der Indianer kommt in der ganzen Siedler-Thematik an keiner Stelle vor. Und wenn plötzlich doch drei noch lebende Indianer den Essay »Über Selbstachtung« betreten, ist man beinahe erschrocken …
Der weiße Westen ist das, was Didion interessiert, und was sie schildert, ist der Sturz dieses Westens von der Höhe seiner Idealisierung und hemmungslosen wirtschaftlichen Ausbeutung in die Tiefen einer staubigen Leere. Die Reise ins »Eden« wandelt sich zu einer Reise in ein ökonomisches und metaphysisches Vakuum, das die Menschen hier am äußersten Ende der westlichen Welt umgibt und das mich merkwürdig an ein Vakuum in den östlichen Regionen Deutschlands erinnert, das seit dem Fall der Mauer spürbar ist. Didions Sinnbilder dieses Vakuums sind die irr machende, schnurgerade Endlosigkeit eines Highways, die Verlassenheit ehemals aufbruchseliger Städte im Sacramento Valley, eine in ewiger Rückwärtsgewandtheit kreisende Tageszeitung oder die ausgebrannte Ödnis einer Orchideenzucht. Aber die Menschen, die immer noch da sind und ihre Wohnwagen wie Markierungspfeiler an die Orte stellen, von denen die Dinge verschwunden sind, sind Menschen, die es genauso auch in Ostdeutschland geben könnte. Es ist verlockend, diese so kalifornischen Essays als Referenz auf das Verschwinden einer ganzen deutschen Gesellschaft zu lesen, von der nicht einmal mehr die Straßen übriggeblieben sind.
Aber es ist ja gar nicht das Verschwinden einer Welt, nicht der langsame Untergang eines »alten«, besseren, potenten Amerika, was Didion betrauert. Ihre Traurigkeit gilt dem Verlust des unschuldigen Blicks, eines Blicks, der die Welt immer besser aussehen läßt, als sie ist. Denn schließlich ist es dieser Blick, dieses naive, kindliche Gucken, das all die tröstenden Geschichten, die wir uns erzählen, glaubhaft sein läßt.
Es scheint allerdings nicht so, als sei ihr dieser Blick jemals geglückt. Es ist unwahrscheinlich für jemanden, die als Fünfjährige ihr erstes Notizbuch mit dem Eintrag über eine Frau eröffnet, »die glaubt, sie würde in der Arktischen Nacht erfrieren, bei Tagesanbruch jedoch feststellen muß, daß sie in die Sahara geraten ist, wo sie noch vor Mittag an der Hitze zugrunde gehen wird.« – Es gibt wohl nicht viel, was stärker zu bedauern wäre als der Verlust eines Glücks, an dem man nicht teilhatte.
Vielleicht ist ihr deshalb mit der romantischen Feier John Waynes ein so großer Abgesang auf jenen Kinderblick gelungen, der für Didion im amerikanischen Traum seinen deutlichsten Ausdruck findet und der in dem Moment verlorengeht, in dem man wirklich sieht. Daß dieses Sehen nicht rückgängig zu machen ist, davon erzählen alle ihre Texte.
EINS
Das Spiel ist aus
How many miles to Babylon?Three score miles and ten – Can I get there by candlelight?Yes, and back again – If your feet are nimble and lightYou can get there by candlelight.
Es ist leicht, den Anfang der Dinge zu sehen, schwieriger ihr Ende. Ich kann mich gut und mit einer Klarheit, bei der sich mir die Muskeln im Nacken versteifen, daran erinnern, wie meine Zeit in New York begann, aber ich kann nicht genau sagen, wann diese Zeit zu Ende war, ich kann durch die Unklarheiten, die Neuanfänge, die uneingelösten Versprechen nicht zu der Stelle auf der Seite vordringen, an der die Heldin nicht länger die Optimistin ist, die sie einmal war. Als ich New York zum erstenmal sah, war ich zwanzig, und es war Sommer, und ich stieg im alten Behelfsterminal von Idlewild in einem neuen Kleid aus einer DC 7. Das Kleid schien in Sacramento ziemlich schick gewesen zu sein, aber schon in diesem alten Behelfsterminal von Idlewild schien es nicht mehr so schick, und die warme Luft roch nach Moder, und eine instinktive Eingebung, gesteuert von all den Filmen, die ich gesehen und all den Liedern, die ich gehört und all den Geschichten, die ich über New York gelesen hatte, sagte mir, daß es nie wieder so sein würde wie zuvor. Und es ist nie wieder so gewesen. Wenig später lief in allen Jukeboxen der Upper East Side ein Lied, in dem es hieß: »aber wo ist die Schülerin, die ich einst gewesen bin«, und nachts, wenn es sehr spät war, fragte ich mich das auch. Ich weiß jetzt, daß sich das fast jeder früher oder später einmal fragt, egal, was aus ihm oder ihr geworden ist, aber zum zweifelhaften Segen der Jugend von zwanzig, einundzwanzig oder auch dreiundzwanzig gehört die Überzeugung, daß das, was man erlebt, allen Gegenbeweisen zum Trotz noch nie zuvor irgend jemand erlebt hat.
Natürlich hätte es eine andere Stadt sein können, wären die Umstände andere gewesen, wäre die Zeit eine andere gewesen und wäre ich eine andere gewesen, es hätte Paris oder Chicago oder San Francisco sein können, aber weil ich von mir spreche, spreche ich von New York. In jener ersten Nacht öffnete ich das Fenster im Bus, der mich in die Stadt brachte, und hielt Ausschau nach der Skyline, aber alles, was ich sah, waren die Brachen von Queens und große Schilder mit der Aufschrift: MIDTOWN-TUNNEL DIESE SPUR, und dann die Sturzflut eines Sommerregens (schon das schien bemerkenswert und exotisch, da ich aus dem Westen kam, wo es keinen Sommerregen gab), und die nächsten drei Tage saß ich in Decken gewickelt in einem Hotelzimmer, in dem die Klimaanlage auf 2 Grad gestellt war, und versuchte, eine schlimme Erkältung mit hohem Fieber auszusitzen. Ich kam nicht auf die Idee, einen Arzt zu rufen, denn ich kannte keinen, und obwohl ich auf die Idee kam, die Rezeption anzurufen und darum zu bitten, die Klimaanlage auszuschalten, rief ich nicht an, denn ich wußte nicht, wieviel Trinkgeld ich der Person, die dann hochkommen würde, geben sollte – war jemals jemand so jung? Ich werde Ihnen davon erzählen, daß jemand tatsächlich so jung gewesen ist. Alles, was ich in diesen drei Tagen tun konnte, war, in Ferngesprächen mit dem Jungen zu reden, von dem ich schon wußte, daß ich ihn im Frühling nicht heiraten würde. Ich würde in New York bleiben, sagte ich ihm, nur sechs Monate, und von meinem Fenster könnte ich die Brooklyn Bridge sehen. Wie sich herausstellte, war es die Triborough Bridge, und ich blieb acht Jahre.
Rückblickend scheint es mir, als seien die Tage, bevor ich die Namen all der Brücken kannte, glücklicher gewesen als die, die danach kamen, aber vielleicht werden Sie das im Laufe der Zeit selbst bemerken. Ich möchte Ihnen unter anderem erzählen, wie es ist, in New York jung zu sein, wie aus sechs Monaten acht Jahre werden können und zwar mit der trügerischen Leichtigkeit einer filmischen Überblendung, denn genau auf diese Weise tauchen die Jahre jetzt wieder vor mir auf, eine lange Abfolge sentimentaler Überblendungen und altmodischer Trickaufnahmen – die Fontänen vor dem Seagram-Gebäude werden zu Schneeflocken, ich gehe mit zwanzig in eine Drehtür und komme ein ganzes Stück älter und an einer anderen Straße wieder heraus. Aber vor allem möchte ich Ihnen, und damit vielleicht auch mir, erklären, warum ich nicht mehr in New York lebe. Oft heißt es, daß New York eine Stadt für sehr Reiche oder für sehr Arme sei, weniger oft heißt es, daß New York auch, wenigstens für die unter uns, die nicht von dort kommen, eine Stadt ausschließlich für die ganz Jungen ist.
Ich erinnere mich, wie ich an einem klaren, kalten Dezemberabend einem New Yorker Freund, der sich darüber beschwerte, daß er schon zu lange in der Stadt war, vorschlug, mit mir auf eine Party zu gehen, wo es, wie ich ihm mit der einfallsreichen Aufgewecktheit von dreiundzwanzig versicherte, »neue Gesichter« geben würde. Er lachte, bis er keine Luft mehr bekam und ich das Taxifenster herunterkurbeln und ihm auf den Rücken klopfen mußte.
»Neue Gesichter«, sagte er dann, »erzähl mir nichts von neuen Gesichtern.« Auf der letzten Party, für die ihm »neue Gesichter« versprochen worden waren, hatte es offenbar fünfzehn Gäste gegeben, und mit fünf der Frauen hatte er bereits geschlafen und allen Männern, bis auf zwei, schuldete er Geld. Ich lachte mit ihm, aber der erste Schnee war gerade gefallen, die großen Weihnachtsbäume auf der Park Avenue glitzerten gelb und weiß, soweit ich sehen konnte, und ich trug ein neues Kleid, und es würde noch eine Weile dauern, ehe ich den tieferen Sinn dieser Geschichte verstand.
Es würde einfach deshalb eine Weile dauern, weil ich New York liebte. Ich meine mit »liebte« nicht irgendeine Floskel, ich meine, daß ich New York liebte, wie man die erste Person liebt, die einen je berührt, und wie man niemand anderen jemals mehr liebt. Ich erinnere mich, wie ich einmal in diesem ersten Frühling bei Dämmerung die zweiundsechzigste Straße überquerte oder auch im darauffolgenden Frühling, für eine Weile waren sie alle gleich. Ich kam schon zu spät zu meiner Verabredung, kaufte aber trotzdem einen Pfirsich auf der Lexington Avenue, blieb an einer Ecke stehen, um ihn zu essen, und wußte, daß ich aus dem Westen gekommen war und eine Fata Morgana erreicht hatte. Ich schmeckte den Pfirsich und spürte den weichen Wind an meinen Beinen, der aus einem U-Bahngitter kam, ich roch Flieder und Abfall und teures Parfüm, und ich wußte, daß das früher oder später seinen Preis haben würde – denn ich gehörte nicht hierher, ich kam nicht von hier –, aber wenn Sie zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig sind, denken Sie sich, daß Sie später eine große emotionale Stabilität besitzen und in der Lage sein werden, den Preis zu zahlen, koste es, was es wolle. Ich glaubte damals noch an Möglichkeiten, hatte noch dieses für New York so wesentliche Gefühl, daß jede Minute etwas Außergewöhnliches passieren könnte, jeden Tag, jeden Monat. Ich verdiente nur 65 oder 70 Dollar die Woche (»Begib dich in die Hände von Hattie Carnegie«, riet mir ein Redakteur der Zeitschrift, für die ich arbeitete, ohne eine Spur von Ironie), das war so wenig, daß ich in manchen Wochen, um überhaupt etwas zu essen, in der Lebensmittelabteilung von Bloomingdale’s anschreiben ließ, was in den Briefen, die ich nach Kalifornien schrieb, unerwähnt blieb. Ich sagte meinem Vater nie, daß ich Geld brauchte, denn dann hätte er welches geschickt, und ich hätte nie herausfinden können, ob ich es allein schaffte. Auf eigenen Füßen zu stehen, schien mir zu dieser Zeit wie ein Spiel, ein Spiel mit willkürlichen, aber ziemlich starren Regeln. Und mit Ausnahme bestimmter Winterabende – um halb sieben auf Höhe der Siebziger Straßen, sagen wir mal, wenn es dunkel war und ein eisiger Wind vom Fluß hoch fegte und ich zu einer Bushaltestelle hastete und hinter den erleuchteten Fenstern der Backsteinhäuser Köche in sauberen Küchen sah und mir vorstellte, wie eine Etage höher Frauen Kerzen anzündeten und wieder eine Etage höher hübsche Kinder gebadet wurden – mit Ausnahme solcher Nächte fühlte ich mich nie arm; ich hatte das Gefühl, mir Geld besorgen zu können, wann immer ich welches brauchte. Ich konnte für mehrere Zeitschriften eine Kolumne für Teenager unter dem Namen »Debbi Lynn« schreiben, oder ich konnte Gold nach Indien schmuggeln, oder ich konnte mich als 100-Dollar-Callgirl verdingen, und nichts davon spielte eine Rolle.
Nichts war unwiderruflich, und alles war erreichbar. Hinter jeder nächsten Ecke gab es irgend etwas Besonderes, etwas Interessantes, etwas, das ich nie zuvor gesehen, getan oder gekannt hatte. Ich konnte auf eine Party gehen und jemanden kennenlernen, der sich Mr. Emotional Appeal nannte und das Emotional Appeal Institute leitete, oder Tina Onassis Blandford oder einen Proleten aus Florida, der ein Stammgast der »Big C« war, wie er es nannte, der Nachtclubs der Southampton-El Morocco-Tourneeroute (»Ich habe gute Kontakte zu den Big C, Schätzchen«, sagte er zu mir bei Kohlgemüse auf seiner riesigen geborgten Terrasse), oder ich konnte die Witwe des Selleriekönigs vom Harlemer Markt kennenlernen oder einen Klavierhändler aus Bonne Terre in Missouri, oder einen, der schon zweimal ein Vermögen in Midland, Texas, gemacht und wieder verloren hatte. Ich konnte mir und anderen Versprechen geben und hatte alle Zeit der Welt, sie zu halten. Ich konnte die ganze Nacht wach bleiben und Dummheiten machen, und nichts davon würde zählen.
Sehen Sie, ich war in New York in einer seltsamen Lage: Mir kam nie der Gedanke, daß ich ein wirkliches Leben lebte. In meiner Vorstellung war ich immer nur noch für ein paar Monate da, nur noch bis Weihnachten oder bis Ostern oder bis zum ersten warmen Tag im Mai. Deshalb fühlte ich mich in Begleitung von Leuten aus dem Süden am wohlsten. Sie schienen auf dieselbe Weise in New York zu sein wie ich, auf unbestimmte Zeit fern von dort, wo sie eigentlich hingehörten, ohne an die Zukunft denken zu wollen, Exilanten auf Widerruf, die immer wußten, wann die Flüge nach New Orleans, Memphis, Richmond oder, in meinem Fall, nach Kalifornien gingen. Wer mit einem Flugplan in der Schublade lebt, lebt mit einem etwas anderen Kalender. Weihnachten beispielsweise war immer eine schwierige Zeit. Andere wurden spielend damit fertig, sie fuhren nach Stowe, ins Ausland oder für einen Tag zu ihren Müttern nach Connecticut; aber diejenigen von uns, die glaubten, sie würden eigentlich woanders leben, verbrachten diese Zeit mit dem Buchen und Stornieren von Flügen und warteten auf günstige Witterungsverhältnisse, als ginge es darum, den letzten Flug zu erwischen, der 1940 aus Lissabon hinausging. Und schließlich trösteten wir, die wir noch übrig waren, uns gegenseitig mit Orangen und Erinnerungen und den geräucherten Auster-Füllungen unserer Kindheit, eng beieinander, Gestrandete in einer fernen Kolonie.
Genau das waren wir. Ich bin nicht sicher, ob jemand, der an der Ostküste groß wurde, vollständig ermessen kann, was New York, die Idee New Yorks, für jene von uns bedeutet, die aus dem Westen und dem Süden kamen. Für ein Kind von der Ostküste, besonders für eines, das immer einen Onkel an der Wall Street hatte und hunderte von Samstagen zuerst zwischen den Spielwaren von F. A. O. Schwarz verbrachte, später mit dem Anprobieren neuer Schuhe bei Best’s und schließlich damit, sich unter der Biltmore-Uhr zu verabreden und zu Lester Lanin zu tanzen, für dieses Kind ist New York einfach eine Stadt, wenn nicht die Stadt, der perfekte Ort zu leben. Aber für jene von uns, die aus Gegenden kamen, wo noch niemand von Lester Lanin gehört hatte und wo Grand Central Station eine Samstagsendung im Radio war und Wall Street, Fifth Avenue und Madison Avenue noch nicht mal Orte, sondern bloße Abstraktionen (»Geld«, »Haute Couture« und »Werbung«), war New York nicht bloß eine Stadt. Es war eine unendlich romantische Idee, die geheimnisvolle Verflechtung von Liebe, Geld und Macht, der glänzende, vergängliche Traum schlechthin. Zu denken, man würde dort »wohnen«, hätte bedeutet, das Wunderbare auf das Profane zu reduzieren; man »wohnt« nicht in Xanadu.
Es war extrem schwierig für mich, diese jungen Frauen zu verstehen, für die New York nicht einfach ein ephemeres Estoril, sondern ein konkreter Ort war, Mädchen, die Toaster kauften und neue Schränke in ihren Wohnungen aufstellten und sich einer sinnvollen Zukunft verpflichtet fühlten. Ich kaufte kein einziges Möbelstück in New York. Etwa ein Jahr lang lebte ich in den Wohnungen anderer Leute; danach wohnte ich auf Höhe der Neunziger Straßen in einer Wohnung, die komplett mit Sachen aus dem Lager eines Freundes ausgestattet war, dessen Frau weggezogen war. Und als ich aus dieser Wohnung auszog (als ich alles hinter mir ließ, als alles auseinanderfiel), ließ ich alles zurück, sogar meine Winterkleidung und die Karte von Sacramento County, die ich an die Wand meines Schlafzimmers gehängt hatte, um nicht zu vergessen, wer ich war, und zog in eine klösterliche Vierzimmerwohnung über eine gesamte Etage in der fünfundsiebzigsten Straße.
»Klösterlich« ist hier vielleicht irreführend, da es den Eindruck erlesener Strenge erweckt; dabei gab es, bis ich verheiratet war und mein Mann ein paar Möbel mitbrachte, dort nichts, nur eine billige Doppelmatratze und einen Lattenrost, den ich an dem Tag, an dem ich beschlossen hatte, umzuziehen, per Telefon bestellte, und zwei französische Gartenstühle, die mir ein Freund geliehen hatte, der sie importierte. (Jetzt fällt mir auf, daß alle meine Bekannten in New York merkwürdigen und völlig sinnlosen Nebenbeschäftigungen nachgingen. Sie importierten Gartenstühle, die bei Hammacher Schlemmer nicht besonders gut liefen, oder sie boten Haarglätter in Harlem an oder verdingten sich als Ghostwriter für die Sonntagsbeilagen und verfaßten Enthüllungsberichte über das organisierte Verbrechen. Ich denke, daß es uns allen nicht besonders ernst damit war, engagé nur, was unser Privatleben betraf.)
Alles, was ich in dieser Wohnung je gemacht habe, war, fünfzig Meter gelbe Theaterseide vor die Schlafzimmerfenster zu hängen, weil ich mir einbildete, daß mir das goldene Licht guttun würde, aber ich machte mir nicht die Mühe, die Vorhänge richtig zu gewichten, und den ganzen Sommer über wehten die langen Bahnen durchscheinender goldener Seide zum Fenster hinaus und verhedderten sich und wurden von den nachmittäglichen Gewittern durchnäßt. Das war das Jahr, mein achtundzwanzigstes, als ich entdeckte, daß nicht alle Versprechen eingelöst werden würden, daß einiges tatsächlich unwiderruflich war und daß am Ende doch alles gezählt hatte, jede Ausflucht, jedes Zögern, jede Dummheit, jedes Wort, alles.
Und das ist es doch, worum sich alles dreht, oder? Versprechen? Wenn New York mich jetzt wieder einholt, geschieht das in halluzinatorischen, blitzartigen Momenten, so klinisch detailgetreu, daß ich mir manchmal wünsche, die Erinnerung würde jene Verzerrung tatsächlich bewirken, die ihr gewöhnlich nachgesagt wird. Die meiste Zeit, die ich in New York war, benutzte ich ein Parfüm, das sich Fleurs de Rocaille nannte, und ein weiteres mit dem Namen L’Air du Temps, und nur der geringste Hauch von einem von beiden kann jetzt meine Verbindung mit damals für den Rest des Tages kurzschließen. Auch Jasminseife von Henri Bendel kann ich nicht riechen, ohne in die Vergangenheit zurückzufallen, oder die besondere Mischung von Gewürzen, die zum Kochen von Krebsen verwendet wird. In einem tschechischen Laden in den Achtziger Straßen, wo ich einmal eingekauft habe, gab es fässerweise gekochte Krebse. Gerüche sind natürlich altbekannte Stimulanzen der Erinnerung, aber es gibt andere Dinge, die dieselbe Wirkung auf mich haben. Blauweiß gestreifte Bettwäsche. Wermut-Cassis. Ausgeblichene Nachthemden, die 1959 oder 1960 einmal neu gewesen sein mögen, und Chiffonschals, die ich etwa zur selben Zeit kaufte.
Ich vermute, daß viele von uns, die in New York jung waren, dieselben Szenen vor sich sehen. Ich erinnere mich an eine Menge von Wohnungen, in denen ich morgens um fünf mit leichten Kopfschmerzen saß. Ich hatte einen Freund, der nicht schlafen konnte, und er kannte ein paar andere, die dasselbe Problem hatten, und wir sahen zu, wie der Himmel hell wurde, und tranken einen letzten Drink ohne Eis, und im ersten Tageslicht gingen wir nach Hause, die Straßen waren sauber und naß (hatte es in der Nacht geregnet? wir wußten es nie), und die wenigen vorbeitreibenden Taxis hatten noch ihre Scheinwerfer an, und die einzigen Farben waren das Rot und Grün der Ampeln. Die White Rose Bars öffneten sehr früh am Morgen; ich erinnere mich, wie ich in einer von ihnen darauf wartete, einen Astronauten ins All hinaustreten zu sehen, wie ich so lange wartete, daß ich im Moment, in dem es passierte, gerade nicht zum Fernseher sah, sondern zu einer Kakerlake auf den Fliesen. Ich mochte die kahlen Äste im Morgendämmer am Washington Square und die monochrome Flächigkeit der Second Avenue, vor der die Feuerleitern und die vergitterten Geschäfte fremd und leer wirkten.