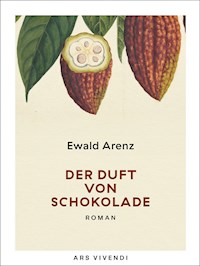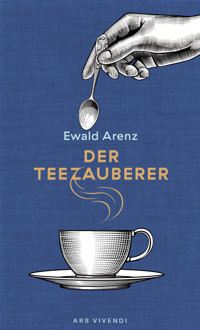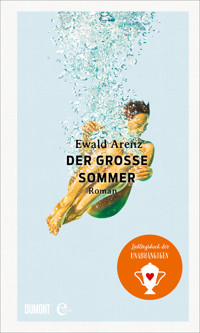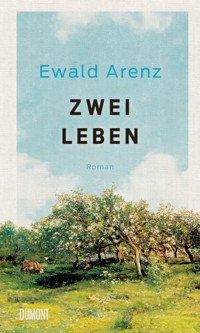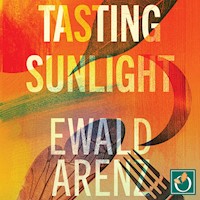Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Don Fernando, Sohn von Christoph Kolumbus, hat bei einem Einkaufsbummel in Nürnberg im Jahre 1512 die Urkunde des kastilischen Königs liegen lassen, in der ihm zehn Prozent Amerikas zugesprochen werden. Solche Dinge kommen vor, und nach so langer Zeit ist sowieso alles vergessen. Außer natürlich, wenn einer der Beteiligten versehentlich Unsterblichkeit erlangt und nach fünfhundert Jahren vergeblicher Suche entnervt den Nürnberger Bürgermeister mitten im Wahlkampf entführt, um endlich an seine Urkunde zu kommen. Und damit geht der Ärger erst los, denn die USA ziehen lieber in den Krieg gegen Franken, als den Erben auszubezahlen. Zum Glück findet Don Fernando einige Mitstreiter - Wikinger, aztekische Wissenschaftler, Außerirdische und ein paar Rockmusiker -, die Amerika und dem Rest der Welt mit anarchistischem Humor die Stirn bieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ewald Arenz
Don Fernando
erbt Amerika
Fantastischer Roman
ars vivendi
Die Originalausgabe erschien 1996 im G&S Verlag, Zirndorf
Überarbeitete und behutsam korrigierte Neuausgabe im ars vivendi verlag
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage August 2012)
© 2012 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: Philipp Starke, Hamburg unter Verwendung eines Bildes von akg-images
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-188-7
Obgleich Nürnberg im Allgemeinen für eine schöne Stadt gehalten wird, so sind sich doch die Bewohner der richtigen deutschen Großstädte darin einig, dass es eine Strafe ist, in Nürnberg zu wohnen.
Die wenigsten bedenken dabei, wie schlimm es erst sein muss, über siebenhundert Jahre lang in Nürnberg leben zu müssen.
Noch schlimmer allerdings erscheint es, in Nürnberg tot zu sein.
1
»… und wenn wir erst bedenken, meine Damen und Herren, liebe Russen«, sagte der Bürgermeister soeben zu der russischen Delegation, machte eine kleine Pause für den Dolmetscher und sprach weiter: »dass aus Nürnberg seit jeher Waren in alle Welt gehen; nicht umsonst heißt es: ›Nürnberger Tand geht in alle Land‹, wie wir unten am Hauptmarkt auf der Apotheke sehr schön gemalt lesen können; wenn wir das erst bedenken …«
Er verstrickte sich in seiner eigenen Diktion und stockte.
Der Dolmetscher grinste verstohlen. Dieser Spruch mit dem Tand hatte ihm schwer zu schaffen gemacht.
»Hau mi nauf«, flüsterte der Bürgermeister und suchte in seinen Papieren. Die russische Delegation gähnte. Sie hatte am Abend zuvor mit Vertretern der Nürnberger Industrie- und Handelskammer essen müssen. Und weil immer alle glauben, der Russe an sich schütte jeden Abend Unmengen an Wodka in sich hinein, hatten Igor Jenewgij, Pawel Chruschtschow (er konnte nichts für seinen Namen und war die ständigen Anspielungen schon seit Jahren leid) und Pjeta Weiß eben Unmengen an Wodka in sich hineinschütten müssen. Nun stellten alle drei bedauernd fest, dass sie offensichtlich keine Russen an sich waren, denn sie konnten sich kaum noch auf den Beinen halten. Der Bürgermeister hingegen war auf der Höhe seiner Leistungskraft und suchte energisch in seinen Papieren nach der Klimax – seiner Rede, versteht sich.
Kathrin Gottsched hingegen stand an eine Säule gelehnt und hatte ihren Block dankbar sinken lassen. Sie arbeitete mittlerweile seit über drei Jahren bei der Zeitung und musste immer noch diese miesen Jobs machen, weil alle ihre Kollegen sich vor dem Bürgermeister drückten. Ihre körperliche Verfassung bewegte sich in etwa auf dem gleichen Niveau wie die der russischen Delegation. Sie hatte zwar nicht getrunken, aber den halben Abend mit ihrem Freund – jetzt Exfreund – Christoph diskutiert. Genauer gesagt, hatte sie diskutiert und er getrunken. Kathrin mochte Christoph, das stand außer Frage. Was sie definitiv nicht mochte, war seine Art zu leben. Christoph hatte vor einem halben Jahr zum Doktor der Physik promoviert. Selbstverständlich hatte er keinen Job bekommen – die Stellenaussichten für Physiker entsprachen im Augenblick denen von Fünfjährigen auf die Kanzlerschaft. Christoph war nicht unglücklich darüber, hatte ein schäbiges Büro gemietet und an dessen Tür ein Schild gehängt, auf dem »Braintrust – Problemlösungen jeder Art« stand, und behauptete seitdem, sein Beruf sei »Ideenhändler«. Das Problem war nur, dass technische Probleme, die ein arbeitsloser Physiker lösen kann, meistens von den Physikern gelöst werden, die Arbeit haben. Aber das ignorierte Christoph und behauptete, seine Lösungen seien kosmischer Art. Er fand, dass die meisten Lösungen zehn weitere Schwierigkeiten nach sich zögen, und verwies auf die Erfindung von Sex als Lösung des Fortpflanzungsproblems, auf die Atomkraft als Lösung des Energieproblems und generell auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs. Wenn er nur einmal einen Auftrag bekäme, würde er Kathrin zeigen, dass seine Problemlösungen echte Lösungen wären. Danach wäre alles gut. Wenn er nur ein Problem bekommen würde.
Na gut, dachte Kathrin, das hatte er jetzt. Gestern Abend hatten sie sich getrennt. Und dann war sie nach Hause gegangen, hatte sich Tee gemacht und blöderweise auch noch geheult. Und natürlich hatte sie nicht schlafen können und dann musste sie auch schon wieder zu diesem Termin. Ein absolut mieser Anfang eines miesen Tages. Sie fühlte sich zerschlagen und widmete sich der Pflege ihrer gut genährten Abneigung gegen den Bürgermeister, dessen Reden sie seit Jahren mitstenografierte, nur um in der Redaktion resigniert festzustellen, dass sich ihre Notizen wie ein Ei dem anderen glichen und sich ihre Artikel in den Schubladen stapelten, weil sie sowieso nie gedruckt wurden. Gedruckt wurden die Fotos. Eigentlich hätte sie zu Hause bleiben können. ›Warum erschießen ihn eigentlich die Russen nicht einfach?‹, überlegte sie. ›Es wäre ganz leicht. Da drüben, der Lange mit dem Mantel, er zieht seine Kalaschnikow und – bamm bamm bamm bamm – legt ihn einfach um. Und ich bin mit meinem Bericht auf der Titelseite.‹
»Hau mi nauf!«, sagte der Bürgermeister wieder, diesmal jedoch lauter und überraschter. Denn die Doppeltüren des Saales waren soeben aufgesprengt worden. Ein Mann mit strengem Kinnbart blickte suchend in den Saal, entdeckte den Bürgermeister, stieß die Türen ganz auf und ging hinein. Der Mann klirrte ungewöhnlich laut. Das kam von der Rüstung, die er anhatte, dem Schwert, das an seiner Seite hing, und dem Visier, das offensichtlich dazu neigte, immer wieder herunterzuklappen. Zehn bis zwölf ziemlich große Ritter folgten ihm, ebenso klirrend, sie sagten zu ihrem Anführer irgendetwas, das sich für Kathrins Ohren nur entfernt wie Deutsch anhörte, der erste Ritter nickte und zeigte auf den Bürgermeister. Darauf traten zwei von ihnen vor, nahmen den Bürgermeister in die Mitte und schleppten ihn aus dem Saal. Der Anführer machte eine etwas steife Verbeugung vor Kathrin, winkte den Russen zu und folgte seinen Leuten, die den strampelnden Bürgermeister eben die Treppe hinunterschafften – und zwar, wenn man dem rhythmischen Bumm Bumm Bumm trauen konnte, mit dem Kopf nach unten. Die russische Delegation klatschte begeistert, Kathrin schoss ein Foto nach dem anderen und der Dolmetscher hob beide Daumen, um seine Anerkennung auszudrücken, als er durch das offene Fenster sah, wie man den Bürgermeister an den Schweif eines der wartenden Pferde band. Kathrin freute sich. Nun hatte die Stadt sich ausnahmsweise etwas einfallen lassen, und ihr Artikel würde bestimmt erscheinen, wenn auch nur auf der Lokalseite. Zufrieden schaltete sie die Kamera aus und kam mit Igor ins Gespräch, als sie zusammen mit der Delegation den Raum verließ. Die Russen verstanden alle ziemlich gut Deutsch, weswegen der Dolmetscher zunächst beleidigt war, sich aber wieder aufheitern ließ, da sich alle über das gelungene Ende des Empfangs freuten und Igor den Dolmetscher und Kathrin zum Frühstück einlud. ›Doch kein so mieser Tag‹, dachte sie erheitert, als sie in die kalte Januarluft hinaustrat und auf die Stadt hinabsah.
2
Das Adjektiv, das Christoph beim Aufwachen bei noch geschlossenen Augen durch den Kopf schwirrte, war »grauenvoll«. Interessanterweise sah er es gedruckt vor seinem inneren Auge, samt Ausrufezeichen. Das Wort war offensichtlich auf der Suche nach einem Hauptwort. Christoph wollte es nicht aufhalten – er wollte schlafen. Aber es schien, als ob das »grauenvoll« beim Durchsuchen seines Kopfes einen ziemlichen Lärm machte. Es zischte unzufrieden, als es die Worte »Nacht«, »Besäufnis«, »Musik«, »Kneipe« und »körperlicher Zustand« auf ihre Tauglichkeit prüfte. Dann klapperte es mit dem Ausrufezeichen an irgendwelchen Eisenstäben entlang, was einen schrecklichen Lärm ergab. Christoph wollte dem Wort helfen und bot geistesgegenwärtig »Lärm« an. Der Erfolg war, dass sich das »grauenvoll« wütend im Kreis zu drehen begann und Christoph schlecht wurde.
Ziemlich schlecht.
Nahezu – aber nicht ganz – grauenvoll schlecht.
Christoph riss die Augen auf, stand vom Boden auf, wo er offenbar geschlafen hatte, und tastete sich über Bébé hinweg, der auch auf dem Boden lag, zum Klo. Als er es nicht fand, merkte er, dass er nicht in seiner eigenen Wohnung war. Er drückte eine Tür auf und sah eine Frau, die eben Eier und Kaffee kochte und mit einem Schneebesen auf den Töpfen Schlagzeug spielte.
Sie sah Christoph, grinste ihn an und sagte fröhlich: »Guten Morgen! Na, wieder fit?«
Christoph sah sie blicklos an, probierte kurz, ob die Wörter »fit« oder »Morgen« zu »grauenvoll« passten, kam zu einem schmerzhaft negativen Ergebnis und krächzte: »Klo?«
»Hier lang, Junge«, sagte die Frau fröhlich und öffnete die Tür gegenüber. Christoph wankte in ein rosafarbenes Bad, das keine heilende Wirkung auf seine Übelkeit hatte, erwog kurz, sich zu übergeben, entschied sich dagegen und begann, viel Wasser zu trinken. Das schien zu helfen. Als allerdings die Übelkeit nachließ, drängte sich die Erinnerung an den vergangenen Abend in sein Gedächtnis, weigerte sich jedoch beleidigt, ihn darüber aufzuklären, in wessen Wohnung er sich befand und wer die junge Frau in der Küche war. Das sah alles gar nicht gut aus. Dieser Tag begann nicht schön. Christoph sah in den Spiegel und konnte förmlich spüren, wie sich das Wort »grauenvoll« mit befriedigtem Klicken an das Wort »Tag« anhängte. Das sollte offensichtlich eine dauerhafte Beziehung werden.
Und dann übergab er sich doch.
Auf dem Hauptmarkt war der Betrieb zu dieser Vormittagsstunde eher mäßig. Im Januar lassen die Touristenströme immer stark nach – und der Obstmarkt ist nicht von so berauschender Anziehungskraft, dass um zehn Uhr morgens kein Durchkommen mehr wäre. Dennoch fand die kleine Gruppe Ritter zu Pferde einige Aufmerksamkeit, als sie, von der Burg herabkommend, beim Schönen Brunnen auf den Hauptmarkt einbog. Das lag zum einen an den prächtigen Rüstungen, die sie trugen und die sich in der tiefstehenden Januarsonne sehr hübsch ausnahmen – wenngleich hie und da jemand kritisch bemerkte, dass echte Rüstungen nie so silbern glänzen würden –, zum anderen jedoch daran, dass der Bürgermeister an den Schwanz des letzten Pferdes gebunden war und hinterhergeschleift wurde, wobei er jämmerlich um Hilfe schrie.
»Schade«, bemerkte einer der Marktleute, »sie hätten ihm auch was Altes anziehen sollen. So ist es irgendwie unecht. Aber eine schöne Idee!«
Der Anführer der Gruppe war im Vergleich zu seinen Kollegen eher klein gewachsen, aber dafür trug er eine schäbige Pfauenfeder am Helm. Auch hier waren sich Hausfrauen und Marktleute einig, dass man sich mit den Kostümen etwas mehr Mühe hätte geben können. Der Trupp bahnte sich einen Weg am Rathaus entlang, kümmerte sich nicht um die Hochzeitsgesellschaft, die eben vor dem Tor des Rathauses fotografiert werden sollte und ziemlich ungehalten Platz machte, bog an der Frauenkirche ab und zog stadtaufwärts gen Lorenzkirche. Der Bürgermeister im Schlepptau schrie jämmerlich. Einige Punks, die am Eingang zur U-Bahn herumhingen, machten abfällige Bemerkungen über die Wahlkampfstrategien der CSU, aber sie schlossen sich trotzdem an. Unter Protest natürlich.
Als der kleine Trupp mit dem mittlerweile langen Tross auf dem großen freien Platz vor den imposanten Türmen der Lorenzkirche angekommen war, stiegen alle Ritter, bis auf den Anführer, ab. Die Menge hatte den üblichen Kreis gebildet und hie und da flogen auch schon Münzen in einen der achtlos beiseitegestellten Helme. Die Ritter nahmen mit geübten Griffen einige Holzstangen und -klötze aus den Packtaschen und hatten sie im Nu zu Pranger und Richtblock zusammengebaut, die nun genau in der Mitte des Platzes standen. Der Bürgermeister hing in seinen Fesseln und kreischte mit rotem Kopf: »So helft doch, helft doch!« und erhielt einen kleinen Extraapplaus. Einer der Ritter setzte ein Horn an und blies ein Signal. Daraufhin entrollte der Anführer ein Pergament und verlas in einer unverständlichen Sprache einige Sätze. Dann zog er seinen Degen und hielt ihn hoch in die Luft. Ein Raunen ging durch die Menge und es wurde einen Augenblick still. Es war ein außerordentlich schöner Degen – er sah aus, als würde er leuchten. Augenblicklich zerrten zwei Ritter den Bürgermeister zum Richtblock und zwangen seinen Kopf in den Pranger. Die Menge brüllte vor Lachen, weil das Gesicht des Bürgermeisters so komisch aussah. Der Ritter ließ den Degen in einer komplizierten Figur singend durch die Luft kreisen und dann genau vor dem Gesicht des Bürgermeisters in das Pflaster sinken, wo der Degen schwankend steckenblieb.
Erst klatschte die Menge, aber als der Bürgermeister blau anlief und offenbar einen Herzinfarkt vortäuschte, fanden sie diese Art Wahlkampf nicht mehr lustig, gingen einfach auseinander, taten so, als hätten sie nichts gesehen, und fuhren fort, ihre Einkäufe zu erledigen. Währenddessen packten die Ritter wieder zusammen, hoben den strampelnden und vor Wut kreischenden Bürgermeister auf ein Pferd und verschwanden schnell und leise, wobei einer der Ritter fluchend seinen Helm noch einmal abnahm und diverse Münzen ausschüttete, die darin lagen. Nur die Punks fanden den Auftritt cool und einer von ihnen beschloss sogar, von nun an konservativ zu wählen.
Sie hätten den Auftritt unter Umständen noch cooler gefunden, wenn sie gesehen hätten, dass die Ritter direkt hinter der Kirche von ihren Pferden stiegen, ihnen die Sättel und den Bürgermeister abnahmen und in einen Kleinbus wechselten, der in der Einfahrt zur Parkgarage der Deutschen Bank stand.
Die Pferde – nunmehr im wahrsten Sinne des Wortes ungebunden – begaben sich zu Karstadt und fanden die Feinkostabteilung. Im Gegensatz zum Bürgermeister war der Tag für sie ein voller Erfolg.
Christoph war – für sich betrachtet – nicht das, was ein unbeteiligter Beobachter für den Durchschnitt der menschlichen Rasse gehalten hätte. Zum einen war er dafür zu intelligent und zum anderen teilte er die Verachtung einzelner Individuen für den Rest der Menschheit nicht im gleichen Maße. Er neigte dazu, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Durch eine ungewöhnliche Kindheit, in der viele Bücher, eigenwillige Geschwister, ein abgelegenes Juradorf und etwas sonderbare Eltern eine tragende Rolle gespielt hatten, war er zu einem Mann geworden, der weder sich selbst noch die Umwelt wirklich ernst nahm. Er konnte durchaus hervorragend vorgeben, vernünftig und erwachsen und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein, aber innerlich amüsierte er sich dabei. Das Problem war: Er sah immer noch einen Sinn im Leben, glaubte, das Ganze würde doch noch zu irgendeinem Ziel führen und hielt die meisten Menschen im Innersten für gut.
Nachdem das aber weder in unserem Jahrhundert noch in überhaupt irgendeinem Zeitraum der bekannten Historie en vogue ist und war (die meisten Leute, die diesen Modetrend zu etablieren versuchten, endeten entweder am Kreuz oder auf dem Scheiterhaufen) und Christoph zudem – wie schon oben angemerkt – intelligent war, sagte er vorsichtshalber das, woran er glaubte, als sei es nicht ernst gemeint. Was ihm den Ruf eines brillanten Zynikers einbrachte.
Im Augenblick allerdings war er sich nicht sicher, ob sich eine dreißig Jahre alte, gut fundierte Weltsicht gegen einen Kater durchsetzen konnte, der gerade erst zehn Minuten alt war. Er verschob dieses Problem auf später. Zuerst musste er herausfinden, wo er war. Das Bad war kein echter Anhaltspunkt, außerdem waren die rosafarbenen Kacheln nicht gut für seinen Magen. Er öffnete das Dachfenster, stellte sich auf die Toilette, wobei ihm gerade noch rechtzeitig einfiel, den Deckel zu schließen, und sah hinaus. Die kalte Luft war ein Schock. Aber sie öffnete ihm wenigstens vollständig die Augen. Über den Rand des Daches hinweg konnte er auf die Straße hinuntersehen. Offensichtlich war er im dritten Stock eines Hauses am Burgberg. ›Aha‹, dachte er, ›Nürnberg. Immerhin.‹
Dann musste links oben die Burg sein. Er verdrehte den Kopf, um nach oben zu sehen. Keine gute Idee, fand sein Magen, aber er kämpfte die Übelkeit nieder. Von unten klangen Hufschläge herauf. Er sah einen Trupp Ritter den Berg hinabreiten. Na toll! Wenn heute irgendein Fest in der Stadt war, wurde ihm garantiert das Auto abgeschleppt.
Wenn er mit dem Auto gefahren war.
Vielleicht waren sie ja mit Bébés Auto gekommen. Wenn er nur wüsste, wer diese Frau war und ob sie nun Bébé oder ihn abgeschleppt und den jeweils anderen nur in Kauf genommen hatte. In moralischer Hinsicht war das irgendwie wichtig. Denn er war ja nun seit gestern solo, Bébé hingegen …
Christoph wusch sich mit kaltem Wasser, kramte nach Handtüchern und einer Zahnbürste, fand keine neue und benutzte kaltblütig eine der gebrauchten. Diesen schalen Alkoholgeschmack loszuwerden, war ein gewisses Infektionsrisiko wert. Dann verließ er das Bad und ging zurück in das Zimmer, in dem er sich vorhin gefunden hatte. Bébé und die junge Frau saßen beim Frühstück – Bébé mehr am Kaffee, obwohl er ein Hörnchen auf dem Teller hatte. Ein kurzer Augenkontakt genügte und Christoph wusste, dass Bébé genauso wenig ahnte, wie sie hierhergekommen waren. Das konnte ein wirklich fantastisches Frühstück werden!
Christoph setzte sich, goss sich Kaffee ein und lächelte die junge Frau unsicher an: »Äh, sag mal, wann sind wir eigentlich heimgekommen?«
»Ungefähr gegen fünf, würd’ ich mal sagen.«
Bébé schaltete sich ein: »Und von wo?«
Die junge Frau lachte ungläubig: »Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch vergessen, wie ich heiße, ja?«
»Nö, kein Gedanke …«, beeilte sich Bébé zu antworten und Christoph sagte: »Nie im Leben! Nach so einer Nacht …«
»Eben«, sagte ihre Gastgeberin und lächelte breit.
Christoph hätte sich ohrfeigen können. Da war die Chance gewesen und er hatte sie nicht wahrgenommen. Unter dem Tisch trat er Bébé, gerade, als der ihn auch treten wollte. Als Physiker, der er war, hätte Christoph genau erklären können, nach welchen Gesetzen zwei Körper im Normalraum nicht zur selben Zeit am selben Platz sein können, weshalb ihrer beider Knie nach oben schießen mussten und den Tisch plötzlich gewaltig beschleunigten. Die Tischkante traf die Frau am Kinn und ließ sie in ihrem Stuhl hintüber kippen. Kaffee und Orangensaft gewannen gegen den Tisch das Rennen, wer zuerst auf der jungen Frau landen würde, die Brötchen flogen in den Gang und der Tee kam zwischen Christoph und Bébé herunter, wobei sich die Designerglaskanne verabschiedete. Das Tischtuch segelte irgendwie verspätet herab und landete elegant auf dem Gastgeberhaufen. Christoph machte einen schwachen Versuch, den Tee aus dem CD-Player zu entfernen, auf dem er zu sitzen gekommen war, schloss ihn dann jedoch einfach. Bébé war in die Marmelade getreten und benutzte einen Stofffetzen zum Säubern, der sich jedoch bedauerlicherweise als Teil einer Seidenbluse erwies. Erschwerend kam hinzu, dass die Frau eben diese Seidenbluse anhatte und ein kurzes, aber erbittertes Ringen um den Stoff einsetzte. Bébé war noch nicht ausreichend nüchtern, um sämtliche Kausalzusammenhänge zu erkennen, aber schon wieder gefestigt genug, um als Sieger im Kampf um die Bluse hervorzugehen. Ein reißendes Geräusch begleitete die teilweise Entkleidung der halb unter dem Tisch begrabenen Frau. Außerdem waren die Spiegeleier in die Bügelwäsche gefallen. Bébé stieß den Korb schnell unter das Sofa. Christoph hob bewundernd den rechten Daumen, was Bébé mit einer bescheidenen Geste zurückwies.
»Sorry«, sagte er dann mit belegter Stimme nach einer kurzen Pause in Richtung des Tisches, der kläglich seine Stahlrohrbeine in die Luft streckte.
»Würdet ihr bitte den Tisch von mir nehmen«, kam eine eisige Stimme vom Boden. Man hatte nicht den Eindruck, als müsse die Besitzerin dieser Stimme ein breites Grinsen unverfälschten Glücks unterdrücken. Um genau zu sein, wäre kein freundschaftliches Gefühl je auf den Gedanken gekommen, sich von dieser Stimme zu jemandem tragen zu lassen. Es wäre vielmehr weinend davongehuscht, hätte sich in einer Ecke verkrochen und beschlossen, sich niemals wieder einer Stimme anzuvertrauen.
»Klar, Gisela«, sagte Christoph, der mittlerweile auf den Namen und die Beine gekommen war, und reichte ihr eine Hand. Gisela stand auf und kämpfte nicht nur um ihr körperliches Gleichgewicht. Sie sah auf Bébé und Christoph, dann wieder auf den Rest des Frühstücks und die zerstörte Wohnung und sagte dann frostig: »Nicola! Der Name ist Nicola!«
Bébé sah Christoph an. Christoph sah Bébé an. Das war peinlich. Keinem von beiden fiel auf die Schnelle ein geistreicher Spruch ein. Nicola schien aber auf so etwas zu warten. Bébé stieß Christoph heimlich an.
»Ääääh …«, sagte Christoph.
»Vielleicht geht ihr jetzt besser«, sagte Nicola.
Christoph und Bébé rafften ihre restlichen Klamotten zusammen und flohen. Erst, als sie unten auf der Straße standen und sich ansahen, mussten sie lachen.
»Fängt klasse an, der Tag«, sagte Bébé.
»Mhm«, antwortete Christoph, »hat was, der Tag. Ich habe nämlich meinen Tabaksbeutel bei Gisela vergessen. Gehst du noch mal hoch?«
»Ohne Frage, Alter«, sagte Bébé, »ich hoffe nur, dass ich zu besoffen war und nichts mit Gisela angefangen habe.«
»Besser, du kannst dich nicht erinnern. Macht sicher keinen Spaß mit der Frau, wenn ihr schon ein Tisch zu schwer ist.«
Bébé grinste: »Gehen wir Kaffeetrinken, Alter?«
»Immer!«, antwortete Christoph und versuchte auch ein Grinsen. Es klappte ganz gut. War wohl doch kein so grauenvoller Tag.
3
Einer der Gründe, warum die Entdeckung Amerikas durch Erik den Roten kein voller Erfolg war, lag daran, dass in dem Augenblick, als Erik aus seinem Boot sprang und gerade sagen wollte: »Das hier für mich, der Rest für euch!«, ein Raumschiff mittlerer Größe mit einem grauenvollen Kreischen in die Atmosphäre eintrat und über Eriks Kopf hinweg nach Süden schoss. Die Druckwelle zerfetzte den Wikingern die Segel von Emma, wie Erik sein Schiff in sentimentaler Erinnerung an seine Jugendliebe getauft hatte. Außerdem wurde Erik mit dem Gesicht in den Strand gepresst, und die Westküste Labradors ist nicht für ihren feinen weißen Sand berühmt. Als Erik sein Gesicht aus der toten Robbe nahm, fragte sein Bruder Leif, der Barde, vom Bugrand herunter:
»Äh, Erik … Vielleicht möchte Thor nicht, dass wir in dieses Land kommen?«, woraufhin Erik wütend zurückbrüllte:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!