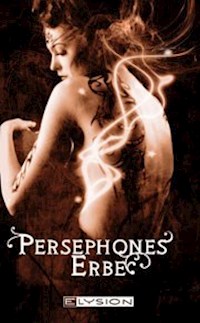3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Drache und Phönix
- Sprache: Deutsch
„Jan stutzte. Der Gefangene mit der Nummer 163 lehnte am Gitter und grinste ihn an. Seine Augen schimmerten merkwürdig gelb. Doch bevor Jan reagieren konnte, bekam er vom Wärter einen brutalen Tritt, der ihn von der Pritsche hart auf den Boden warf.“ Krieg, Vernichtung, neue Bündnisse – das 20. Jahrhundert beginnt! Jan Stolnik, der Drache in Menschengestalt, soll im Auftrag des neugegründeten „Büros für Okkulte Angelegenheiten“ gegen eine Bedrohung kämpfen, die seit den Schrecken des Ersten Weltkriegs ganze Landstriche beherrscht: Werwölfe. Doch sind wirklich alle von ihnen skrupellose Killer? Während Jan versucht, die Grenze zwischen Recht und Unrecht nicht zu überschreiten, wirft der Wahnsinn des Tausendjährigen Reiches seine blutroten Schatten über Europa. In dieser Zeit, die dunkler nicht sein könnte, gibt Jan nur eines Hoffnung: Das Wissen, dass irgendwo dort draußen seine große Liebe, die Phönixdame La Fiametta, zu neuem Leben erwacht ist – und er sie finden wird! Der fünfte Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend. Jetzt als eBook kaufen und genießen: „DRACHE UND PHÖNIX – Fünfter Roman: Goldene Jagd“ von Angelika Monkberg. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch:
Krieg, Vernichtung, neue Bündnisse – das 20. Jahrhundert beginnt! Jan Stolnik, der Drache in Menschengestalt, soll im Auftrag des neugegründeten „Büros für Okkulte Angelegenheiten“ gegen eine Bedrohung kämpfen, die seit den Schrecken des Ersten Weltkriegs ganze Landstriche beherrscht: Werwölfe. Doch sind wirklich alle von ihnen skrupellose Killer? Während Jan versucht, die Grenze zwischen Recht und Unrecht nicht zu überschreiten, wirft der Wahnsinn des Tausendjährigen Reiches seine blutroten Schatten über Europa. In dieser Zeit, die dunkler nicht sein könnte, gibt Jan nur eines Hoffnung: Das Wissen, dass irgendwo dort draußen seine große Liebe, die Phönixdame La Fiametta, zu neuem Leben erwacht ist – und er sie finden wird!
Der fünfte Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend.
Über die Autorin:
Angelika Monkberg, geboren 1955, lebt in Franken. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst. Daneben schreibt sie Kurzgeschichten und Romane – wenn sie nicht zeichnet oder malt. In beiden Bereichen gilt ihr Interesse vor allem dem Phantastischen.
Angelika Monkberg im Internet: www.facebook.com/1AngelikaMonkberg
Die historische Fantasy-Saga DRACHE UND PHÖNIX umfasst folgende Bände:
Erster Roman: Goldene Federn
Zweiter Roman: Goldene Kuppeln
Dritter Roman: Goldene Spuren
Vierter Roman: Goldene Asche
Fünfter Roman: Goldene Jagd
Sechster Roman: Goldene Lichter
Siebter Roman: Goldene Ewigkeit
***
Originalausgabe August 2014
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von © emai / shutterstock.com
ISBN 978-3-95520-624-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort DRACHE UND PHÖNIX 5 an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
Angelika Monkberg
DRACHE UND PHÖNIX:
Goldene Jagd
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Caen, in der Ruine des Donjon auf der Nordseite der Festungsmauern des Château; irgendwann.
Die ersten Jahre waren die schlimmsten – bis er aufhörte, sie zu zählen. Es fiel ihm überraschend leicht, ja, er fragte sich sogar, warum er bisher fast manisch an Tag und Datum festgehalten hatte.
Eine leise Stimme flüsterte ihm zu: Die Zeit ist bedeutungslos.
Ganz verlor er ihr Vergehen natürlich trotzdem nicht aus den Augen, dafür sorgte schon der Wechsel der Jahreszeiten. Im Sommer erschien die schwache Helligkeit früher, die hoch über dem finsteren Loch seines Gefängnisses den Tag verkündete, und sie schwand später. Manchmal ahnte er sogar Sonnenschein. Aber dann folgten wieder graue Tage, die immer kürzer wurden; die unerträgliche Finsternis der Nächte dauerte länger, und zuletzt kroch manchmal Frost in die dicken Mauern des Donjon. Dann legte sich hoch über ihm Rauhreif auf den Steinkranz der Brunnenöffnung, durch die sie ihn in sein Verlies hinuntergestoßen hatten. Sechs, acht Meter in tiefe Dunkelheit, ein grauenhafter Sturz. Er konnte es noch hören, das Herunterkrachen des Eisengitters und seine panischen Flügelschläge. Der Platz reichte gerade zum Ausbreiten seiner Schwingen, sie hatten ihn gerettet; er hätte sich sonst damals bestimmt alle Knochen gebrochen.
Doch er war unverletzt gelandet, zum Missvergnügen der Inquisitoren, die seine Einschließung verfügt hatten. Er wusste – schließlich kannte er ihre Gedanken –, dass ihnen seine sogenannte Begnadigung zu lebenslanger Haft einen bösen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Er war von ihnen zuerst nach Suresnes gebracht worden, aber die Festung auf dem Mont Valerien nahe Paris stand unter direkter Aufsicht des Justizministeriums, und deshalb hatte man ihn schon wenige Tage später schwer bewacht nach Caen weitertransportiert. Er erinnerte sich nur undeutlich an den nächtlichen Weg vom Bahnhof zum Château. Im Kastenwagen eingeschlossen, hatte er sich auf die Augen und Ohren seiner Wächter verlassen müssen und nur ungenau verfolgen können, wie sie die Orne auf einer Brücke überquert hatten, einen Quai entlanggefahren waren und über eine Rampe durch ein Torhaus hinauf in das Château. Dort erinnerte er sich an eine Vielzahl elender, niedriger Bauten, eine Kaserne, hastig errichtet im letzten deutsch-französischen Krieg. Aber sein Gefängnis befand sich nicht dort. Ganz am Ende des Mauerrings, an der Nordseite und in den Ruinen des Donjon, den jedermann für zerstört und aufgegeben hielt, schienen den Hunden Gottes die Voraussetzungen günstiger, dass ihn einfach die Haftbedingungen umbrachten.
Sein Verlies war vollständig leer, und wenn er sitzen oder liegen wollte, musste er mit dem festgestampften Erdboden vorliebnehmen. Doch die Leere besaß den einen Vorteil, dass seine Schreie hallten. Nach drei Tagen Durst und Hunger hatte er ein Heidenspektakel veranstaltet, so lange geflucht und getobt, bis die Wärter nach dem Abt des Klosters Saint Étienne unten in der Stadt geschickt hatten. Seitdem wusste er, dass seine Henker jegliche Aufmerksamkeit noch mehr fürchteten als ihn selbst.
„Brot und Wasser, einmal jede Woche“, hatte der Abt gesagt, ein Benediktiner, doch genauso erbarmungslos wie die Dominikaner. „Und es ist dir verboten, zu sprechen. Ein Wort zu den Wachmännern, und ich lasse den Schacht zumauern.“
Was blieb ihm anderes übrig?
Der Abt hatte mit dem Rücken zu dem Loch über ihm gestanden, sorgfältig darauf bedacht, dass er sein Gesicht nicht sehen konnte. Er hätte ihn natürlich trotzdem jederzeit wiedererkannt, am Muster seiner Gedanken. Jan wusste aber, dass er den Mann getrost vergessen konnte. Bis er aus seinem Loch wieder freikam, waren wahrscheinlich schon dessen Enkel gestorben. Er hatte einen Fehler begangen – den vielleicht größten seines Lebens –, dass er nicht schon in Paris versucht hatte zu fliehen. Aber er hatte zu lange gezögert. Was ihm seine Schwester vor hundert Jahren vorgeworfen hatte, stimmte: Er war zu weich. Sie, die Kandake von Meroë, hätte ihre Wärter in der gleichen Situation skrupellos getötet. Er fand nur immer noch, dass er schon zu viele Menschen auf dem Gewissen hatte.
Zuerst Nanni, dem er das Genick gebrochen hatte, damals auf seinem Schloss in Freital, dafür, dass der Venezianer seiner geliebten Hexe Barberina brutal das Ungeborene aus dem Leib getreten hatte. Mutter und Kind waren daran gestorben. Später, in Aserbeidschan, war er zum Henker eines Parsen geworden, damit diesem nicht der eigene Sohn den Kopf abschlagen musste. Auf der Rückreise nach Europa hatte er dann den Arzt des englischen Linienschiffs Elizabeth St. Martin ermordet. Eine Kurzschlussreaktion, denn der Arzt hatte in Gedanken beschlossen, ihn in Ketten legen zu lassen und als Jahrmarktattraktion zu verkaufen. Die vielen Soldaten, die später seinen Kanonenschüssen im Spanischen Bürgerkrieg zum Opfer gefallen waren, rechnete er schon gar nicht mehr mit. Doch kurz darauf war dem zweiten Nanni, dem Sohn Barberinas, in Wien seinetwegen die Kehle durchgeschnitten worden; und er vergaß auch den Selbstmord Pascals nicht. Der Junge, Sohn seiner ersten Ehefrau Mary, ein hochbegabter Magier, hatte versucht, seine Mutter und seine Schwester aus dem Tod zurückzuholen und sie dadurch in Zombies verwandelt. Jan hatte die Leichen für Pascal verbrannt, doch es hatte nichts genutzt. Sie hatten beide zu spät begriffen, dass sein Ziehsohn Mary und Rose nicht anders als durch den eigenen Tod aus ihrem Zustand als Untote erlösen konnte.
Du warst ein lausiger Vater, flüsterte eine gemeine Stimme in der Dunkelheit, und ein noch lausigerer Ehemann.
Das stimmte. Die Ehe mit Mary war der Versuch gewesen, sich die Maske eines normalen Familienvaters überzustülpen; doch dieses Vorhaben wäre wahrscheinlich sogar ohne die Cholera gescheitert, an der seine Frau und ihre Tochter gestorben waren. Mit seiner zweiten Ehefrau Isobel Descalot hatte er traute Zweisamkeit dann gar nicht mehr versucht. Er hatte sie sowieso nur aus Berechnung geheiratet, weil er als Einziger in der Lage gewesen war, den Dämon im Zaum zu halten, von dem sie besessen gewesen war. Doch es hatte in Mord und Gewalt geendet, damit, dass der unreine Geist aus Isobel Descalot heraus und in deren Krankenwärterin Mademoiselle Marguerite gefahren war. Sie hatte seine Frau erstochen und war zum Bahnhof geflüchtet, wo er mit ihr gekämpft und beinahe verloren hatte. Letztlich hatte ihn ihr Dämon wahrscheinlich nur deshalb nicht überwältigt, weil Mademoiselle unter eine heranstampfende Lokomotive geraten war und samt dem unreinen Geist das Leben gelassen hatte.
Und? Was hast du davon gehabt?
Nichts. Die ganze unselige Geschichte lastete bis heute auf seiner Seele.
Keine deiner Frauen hat ein friedliches Ende gefunden, nicht einmal deine Halbschwester.
Sie waren beide nach Persien gereist, ohne voneinander zu wissen; er aus Europa, Amanischacheto, die Kandake von Meroë, aus ihrem Königreich Sudan. Jan hatte in den Türmen des Schweigens nach einer Antwort gesucht, warum La Fiametta den Feuertod dem Leben vorgezogen hatte, und der Kandake war von einem Orakel in Persien ein Sohn von einem Prinzen geweissagt worden. Auf diese Weise, Zufall oder Fügung, hatten sie sich getroffen, beide Kinder des gleichen Vaters, Zelta Pukis, des Goldenen, eines Drachen. Sie regierte den Sudan aus dem Recht ihrer Mutter heraus, aber auch er war ein Prinz, Sohn einer Königin, wenn auch ohne Rang und Namen. Dschinns, Geister der Wüste, hatten sie beide durch List getäuscht, so dass er das Kind seiner Halbschwester gezeugt hatte, ohne ihr jemals beigewohnt zu haben, und sie hatte ihm Karim al-Tinnin geboren, den einzigen Sohn, den er jemals haben würde, denn er konnte mit einer Menschenfrau keine Kinder zeugen.
Drei Jahre waren ihm mit dem Kleinen geblieben, doch dann hatte ihn seine Schwester mit einem Bluteid gezwungen, alle Ansprüche auf seinen Sohn aufzugeben. Er hatte beide in Port Sudan verlassen, nachdem er sie durch die ganze arabische Halbinsel begleitet hatte. In der Hafenstadt am Roten Meer hatten sich ihre Wege getrennt. Wenig später hatte er erfahren, dass der Kandake bei einem Aufstand in Khartum eine Kanonenkugel den Kopf abgerissen hatte. Das Letzte, was er von seinem Sohn Karim al-Tinnin wusste, war, dass sein bester Freund Daoud mit dem Kleinen nach Eritrea fliehen wollte. Danach hatte er nie mehr etwas von ihnen gehört.
Nach hundert Jahren ist es für Reue reichlich spät. Was hast du dich auch darauf eingelassen? Du hättest dein Fleisch und Blut niemals verlassen dürfen. Selbst wenn dein Sohn heute noch leben sollte, wird er sich kaum voll Freude an dich erinnern. Du bringst allen den Tod, sogar Feen.
Das war übertrieben, er hatte nur einer Fee den Tod gebracht: Frau Josefa. Er glaubte nicht, dass das ihr wahrer Name war, sie war eine Peri Banu gewesen, und sie hatte ihn in Wien mit dem Rest ihrer schwindenden magischen Kräfte von den Folgen eines Pistolenschusses geheilt. Seine zerfetzte Lunge war unter ihrer Berührung wieder zusammengewachsen, aber die Fee war danach erloschen wie ein Licht.
Und? Entschuldigt es dich, dass du bisher nur eine einzige Fee getroffen hast? Sie hätte Menschen noch lange helfen können. An dir hat sie sich verbraucht. Dass du das zugelassen hast, war eine Sünde!
Er sah es ja ein. Die einzige Sünde, die man ihm nicht vorwerfen konnte, war ausgerechnet die, die ihn in dieses Verlies gebracht hatte: Der Brand des Bazar de la Charité war ohne sein Zutun entstanden. Es stimmte, er spielte leidenschaftlich gerne mit dem Feuer, er war süchtig danach, doch er kannte seine Macht und ging verantwortungsbewusst mit dem wilden Element um. Er konnte im Grunde noch nicht einmal etwas für La Fiamettas Wiedergeburt aus den Flammen.
Ach, meinst du? Und wer hat die Duchesse so lange bekniet, bis sie bereit war, dir die Urne beim Basar zu verkaufen? Das Gefäß könnte heute noch unversehrt in der Hauskapelle der d’Alençons stehen. Aber nein, du konntest natürlich nicht ruhen, bis die Dame Phönix aus ihrem langen Schlaf erwachte! Und hat sie es dir gedankt? Liebt sie dich jetzt dafür? Wo ist sie dann? Ich sehe sie nicht hier bei dir!
Ein zarter Luftzug und das Quietschen schlecht geölter Scharniere verrieten ihm, dass weit entfernt über ihm die schwere Eisentür geöffnet wurde, die die Ruinen des Donjon gegen Unbefugte sicherte. Der Fleck dämonischer Dunkelheit zog sich vor ihm in die Mauern zurück. Es dauerte nach dem Aufschließen der Außentür immer eine ganze Weile, bis sich Schritte der Brunnenöffnung näherten. Die Wärter versahen den Gang zu ihm nicht gern, sie zogen Lose, wer seine Ration durch das Eisengitter nach unten werfen musste. Es war immer die gleiche Menge, drei Laibe stark kleiehaltiges Sauerteigbrot, so hart, dass er einen ganzen Abend an einem Stück zu kauen hatte. Er fing es auch heute wieder aus der Luft und verstaute es hastig unter seinem Hemd, zwischen den Flügeln. Die ledrigen Häute hielten seine Wochenration einigermaßen trocken. Denn nach dem Brot kam das Wasser.
Den Eimer hatten sie damals in der Nacht nach dem Besuch des Abts hinuntergeworfen, in der irrigen Annahme, dass er schlief. Doch selbst ein Toter hätte das Quietschen des Brunnengitters gehört, denn sie mussten es wenigstens so weit heben, dass der verbeulte Blecheimer zwischen Mauerkranz und Gitter durchgeschoben werden konnte. Dass sie gleichzeitig sechs Bajonette in den Spalt gestoßen hatten, für den unwahrscheinlichen Fall, er könnte so hoch springen, verriet ihre Furcht. Leider war sie unbegründet. Seine Flügel ließen ihn hier unten im Stich. Es war schon ein Wunder, dass sie ihn wenigstens während seines Kampfs mit den Dämonen getragen hatten, bei La Fiamettas Wiedergeburt.
Mach dir nichts vor. Das war Glück. Eine volle Schar von uns hättest du nie bezwungen.
Uns?Damit habt ihr euch verraten.
Vielstimmiges Gelächter ertönte überall um ihn.
Du hast das immer gewusst, und wer antwortet, hat schon halb verloren. Bald gehörst du uns!
Nein.
Er blendete den bösartigen Fleck Dunkelheit in seinem Kopf aus und hielt den Blecheimer hoch. Um ihn zu vernichten, brauchte es keine Dämonen, es reichte schon ganz normale menschliche Bosheit. Ob und wie viel Wasser er von dem Schwall auffing, den der Wärter durch das Gitter kippte, blieb sein Problem. Er war inzwischen Meister darin, obwohl er unweigerlich auch dieses Mal eine kalte Dusche abbekam. Er wischte sich eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht. Am Anfang, als er noch nicht so daran gewöhnt war, sich das Wasser einzuteilen, war sein Durst vor dem nächsten Versorgungstag oft bis ins schier Unerträgliche angewachsen. Einige Male hatte er in seiner Verzweiflung zuletzt den eigenen Urin gesammelt und getrunken.
Aber der Körper gewöhnte sich an alles. Inzwischen reichten ihm die drei Laibe grobes Brot und herzlich wenig Wasser – dafür bekamen die Wärter seinen Gestank in die Nasen. Das Verlies besaß natürlich keinen Abtritt, und sauber halten konnte er sich auch nicht. Er besaß nicht einmal Schuhe, nur noch das Hemd und die Drillichhosen, die ihm die Schergen der Inquisition gegeben hatten, damals in Paris, nach dem Brand des Bazar de la Charité.
Sie haben dir nicht einmal erlaubt, dich in Frieden gesund zu schlafen, diese Schweine. Das schreit doch nach Rache!
Er seufzte und suchte in seinem Gedächtnis nach den Exorzismusgebeten, die Erzbischof Sibour damals gesprochen hatte. Sancte Michaele Arcangelo … Er durfte die Worte nicht laut sprechen, denn er wusste nicht, ob ihn nicht doch jemand hörte, und er konnte nicht riskieren, sein Schweigeversprechen zu brechen. Aber er konnte die Gebete im Geist wiederholen und erlebte mit Genugtuung, wie die Stimmen in seinem Kopf leiser wurden. Genau wie über ihm die Schritte. Die Wärter entfernten sich mit dem Eimer, der Drahthenkel klapperte und quietschte.
Die Stille der ersten Minuten danach war immer gnadenlos. Jan wog den Eimer in der Hand, fast randvoll. Der Wächter von heute hatte sich Mühe gegeben, das Wasser sorgfältig in einem langen Strahl in die Tiefe geschüttet und auch den Eimer nicht geschwenkt. Andere waren weniger rücksichtsvoll. Er hob den Eimer an die Lippen. Der erste Schluck schmeckte immer köstlich. Als er getrunken hatte, kratzte er sich ausgiebig. Flöhe und Wanzen bissen ihn höchstens aus Versehen, sein Blut schmeckte keinem Insekt. Doch Dreck juckte mit der Zeit genauso, und Kratzen, bis das Blut kam, war die einzige Möglichkeit, dass wenigstens seine Haut brannte. Was hätte er für Feuer, ein bisschen Glut, gegeben!
Über ihm raschelte leise eine Ratte. Sie gingen ihm auf die Nerven, es wagten sich ständig welche durch den Brunnenschacht herunter, und wenn sie sich darauf beschränkt hätten, seinen Kot zu fressen, hätte er sich sogar mit ihrem Rascheln und Pfeifen angefreundet. Aber sie rochen das Brot, und wenn er nicht aufpasste, kletterten einzelne Tiere sogar seine Hosenbeine hoch. Die meisten erwischte er allerdings schon in der Wand. Seine Finger schossen blind vor, er packte die Ratte beim Schwanz und erschlug sie blitzschnell an den Steinen. Danach schleuderte er den Kadaver durch das Gitter nach oben in die Brunnenstube über dem Verlies. Die Mauerreste des Donjon standen dem Himmel und den Vögeln offen, nur ausgerechnet über dem Brunnenschacht, seinem Verlies, stand ein primitives Schutzdach gegen den Regen. Er kam nicht an zusätzliches Wasser, doch Eulen fanden offenbar die toten Ratten oder ab und zu eine Katze. Wenigstens erklärte er sich so das Laufen weicher Pfoten, das er manchmal über sich hörte.
Er selbst lief auch, jeden Tag viele Stunden, immer unter dem Auge des Brunnenschachts, immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Bewegung war das einzige Mittel, er wäre sonst über den Einflüsterungen der Dämonen wahnsinnig geworden.
Warum? Wir sagen nur die Wahrheit!
Die Exorzismusgebete vertrieben die Dunkelheit in seinem Herzen nie für sehr lange. Er musste sich bewegen! Jan klemmte das Brot zwischen seinen Flügeln fest und begann zu tanzen, die Schritte des Menuetts. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Position, die Grundstellungen des Balletts waren die gleichen, die die Fechtmeister lehrten. Er mochte keine Blankwaffen, weder Degen noch Florett, trotzdem focht er mit Ausdauer gegen unsichtbare Gegner, hieb mit Armstößen und Fußtritten um sich. Im Kampf blieb nicht derjenige Sieger, der die korrekte Riposte kannte, sondern der, der die Finte beherrschte und ohne Bedenken einen Regelverstoß beging. Jeder Kampf war Irrsinn, man musste irre sein, um sich auf einen Kampf einzulassen. Aber seine Scheingefechte vertrieben die flüsternden Stimmen der Dämonen wenigstens eine Zeitlang.
Warum schließt du nicht endlich einen Pakt mit uns! Du könntest unter uns ein Fürst sein.
Ja, der Hölle!
Er trat gegen die Wand, und der Schmerz klärte seinen Kopf. Er schüttelte den Fuß. Seine nackten Zehen kannten mittlerweile jeden Zentimeter Grund, jede noch so geringe Unebenheit im festgestampften Erdreich. Der wöchentliche Guss von oben, was von der Wasserration danebenging, durchfeuchtete den Bereich direkt unter dem Brunnenauge. Er konnte mit den Zehennägeln darin graben, Rillen ziehen, und plötzlich spürte er unter seinem rechten Fuß einen Kieselstein. Endlich ein Werkzeug!
Die Dämonen flohen vor dem Stückchen Quarz. Er verbrachte die Nächte von da an mit harter Arbeit. Zuerst galt es, mit dem Kiesel einen Stein in der Mauer locker zu kratzen. Festgesinterter Kalkmörtel widersetzte sich ihm viele Tage, aber das schadete nicht, er hatte ja sonst nichts zu tun. Die Mauer bestand nicht nur aus einer Lage Steine, dahinter ertastete er in der Dunkelheit eine zweite. Das hatte er sich aber schon vorher gedacht. Auf alle Fälle hielt er zuletzt einen handlangen Kalkbruchstein in der Hand. Er musste damit vorsichtig umgehen, ein Feuerstein oder noch ein Kiesel, nur größer, wäre besser zum Graben geeignet gewesen. Außerdem stieß er unter dem festgestampften Fußboden leider nur allzu bald auf gewachsenen Fels. Dieses erste Loch benutzte er von da an als Latrine. Er hatte seine Notdurft bisher immer in der gleichen Ecke verrichtet, und dort stank es bestialisch. Doch nun konnte er Erde auf die Exkremente werfen und eine kleine Sickergrube graben. Das dämmte den Gestank wenigstens ein bisschen ein.
Außerdem entdeckte er, dass sein Verlies früher einmal die Unterstube eines Tiefbrunnens gewesen war. Er grub direkt unter dem vergitterten Mauerkranz die Überreste eines zweiten aus. Der Schacht war jedoch vollständig mit Geröll aufgefüllt. Die alte Geschichte, genau wie damals auf dem Turm des Schweigens in Persien; er brauchte gar nicht erst zu versuchen, den Schacht auszuräumen. Es wäre ohne Planken, die er über die Öffnung legen konnte, auch zu gefährlich gewesen. Ihm wurde allein bei der Vorstellung schon schlecht, er müsste auf einem einzigen dünnen Brett balancieren, unter sich einen Schacht von zehn, zwanzig, vielleicht sogar dreißig Metern Tiefe, während seine Wärter von oben Wasser auf ihn heruntergossen.
Jan putzte die erdverkrusteten Finger an der Hose ab und ging durch die vollständige Finsternis ein weiteres Mal in dieser Nacht zu seinem Wasservorrat. Er stellte den Blecheimer immer an die gleiche Stelle der Mauer, er fand ihn längst blind, trotzdem musste er sich zwanghaft immer wieder vergewissern, dass der Eimer noch an Ort und Stelle stand. Dass sein Wasser sicher stand, dass keine Ratte darin schwamm. Dass der Eimer noch genug Wasser enthielt. Der Pegel erreichte schon wieder gerade seinen Handrücken. Er warf den Zopf über die Schulter nach hinten und verschnaufte einen Augenblick. Das Haar konnte er schon lange wieder flechten, so stark war es gewachsen.
Das ständige Umgraben im Verlies war anstrengend, und noch dazu führte es zu nichts. Noch einmal: Selbst wenn es ihm gelungen wäre, die Steine aus dem zweiten Brunnenschacht zu räumen, hätte er ein Seil gebraucht, um sich in die Tiefe herabzulassen.
Und dann? Glaubst du, du findest dort unten einen Geheimgang? Das Château steht auf einem verfluchten Felsplateau! Außerdem – vor der Stadt liegt das Meer.
Leises Kratzen von Pfoten verriet ihm die Ankunft einer neuen Ratte. Er griff blitzschnell zu und tötete sie. Danach stand er, den pendelnden Kadaver zwischen zwei Fingern, lange still. Die schmale Kante des Kieselsteins, den er zum Loskratzen des Kalksteins benutzt hatte, war davon scharf geworden wie ein Rasiermesser. Er hatte ihn sogar tatsächlich schon zu diesem Zweck benutzt, aus Langeweile. Was, wenn er die tote Ratte ausweidete, häutete und aß? Gedacht, getan. Er schluckte hastig, bevor er schmeckte, was er im Mund hatte. Die nächste würde er braten, vielleicht auf seinem Stein. Er war ein Drache, er konnte Feuer speien, und Brennmaterial lieferte das Rattenfell. Auch wenn ein Feuer aus Tierhaaren stank.
Aber er konnte den Pelz auch auf der Haut lassen und ihn mit seinem Urin gerben. Getrockneter, verdrillter Darm eignete sich zu einem Nähfaden, und eine Nähnadel konnte er aus einem Rattenknochen herstellen. Ratten gab es genug. Jetzt, da er ein neues Ziel gefunden hatte, träumte er von einer Felljacke.
Aha! Und womit willst du das Nadelöhr in den Knochen bohren? Außerdem bräuchtest du einen Schrank oder besser eine Blechkiste. Wie willst du die gegerbten Rattenfelle sonst aufbewahren, damit sie nicht von den eigenen Artgenossen gefressen werden? Ein schöner Plan, aber undurchführbar!
Nein, er würde es versuchen.
***
Unzählige Ratten später waren die Lumpen, die er am Köper trug, so brüchig geworden, dass er Hemd und Hose jedes Mal auszog, sobald der Rauhreif am Brunnenkranz verschwunden war, vorsichtig faltete und unter dem Wassereimer verstaute. Ausdauerndes Gegeneinanderschlagen von Kieseln, die er beim Graben von weiteren Latrinen nach und nach gefunden hatte, gab ihm endlich doch einen feinen Splitter in die Hand, mit dem er ein Öhr in einen Rattenknochen drillen konnte. Es war Puzzlearbeit, doch seine Augen waren inzwischen so gut an den schwachen Rest Tageslicht angepasst, der um die Mittagszeit bis zu ihm hinunterfand, dass er sich gerne hinsetzte und Rattenfell für Rattenfell aneinandernähte. Die friedliche Tätigkeit entspannte ihn.
Seine Gedanken schweiften dabei ab, in eine Vergangenheit, in der die flüsternden Stimmen der Dämonen keine Macht über ihn besessen hatten. Er konnte nicht träumen, weil er niemals schlief, doch er hing Erinnerungen nach. An seine Kindheit in Sachsen unter der Obhut des Fräuleins von Gottersdorf, deren Nichte die Schande auf sich genommen hatte, sich als seine Mutter auszugeben. Obwohl er in Wirklichkeit nicht ein Bastard des Kurprinzen war, sondern im ehelichen Bett der Maria Antonia von Österreich zur Welt gekommen, damals noch Kurprinzessin, später Königin von Sachsen. Sie hatte ihn 1723 zusammen mit seiner toten Zwillingsschwester geboren, neun Monate nachdem sie eingewilligt hatte, Zelta Pukis, einem Drachen, ihre Gunst zu gewähren, gegen die Tilgung der Staatsschulden. Seine arme Mutter! Maria Antonia hatte den Anblick des Buckels unter seinem Rock nie ertragen. Für sie war er immer eine Missgestalt geblieben, ein Ungeheuer mit verkrüppelten Flügeln. Trotzdem war es ein gutes Leben als Jan Stolnik, Graf von Burgk und Freital, gewesen. Er hatte zuerst seine jüngeren Halbbrüder, später seine Herren Neffen als Kammerherr und Reisemarschall auf der Grand Tour durch halb Europa begleitet. Zuletzt 1774 Anton, der ihm der liebste von allen Prinzen gewesen war und viele Jahre später Sachsen als König regiert hatte. Auf dieser letzten Reise hatte er in Venedig La Fiametta kennengelernt, die Dame Phönix.
Jan faltete die Rattenfelle zusammen, legte sie neben sich auf den Boden und bedeckte sie mit den Steinen, die er zu diesem Zweck aus der Mauerkrone des Brunnenrands in seinem Verlies gebrochen hatte. Anschließend gönnte er sich einen Schluck Wasser, den vierten heute, mehr als zehn erlaubte er sich zwischen einem und dem nächsten Morgenrot nie. Er aß auch jeden Tag höchstens ein halbes Brot und fastete den siebten Tag. Mit dieser Einteilung konnte er Durst und Hunger ertragen.
Jedoch fraß der Hunger nach der Liebe seines Lebens weiter an ihm. Er hätte die Erinnerung an La Fiametta vermeiden müssen. Sich ihre sonnenglänzenden Federspiegel vorzustellen tat ihm nicht gut. Sie bedeckten bei ihr beide Schulterblätter, und ein weiterer Fleck Phönixgefieder wuchs genau über der Spalte ihres schönen, fleischigen Hinterns. Ach, und der zarte goldene Flaum ihres Schoßes erst, ihr berauschender Geruch! Sie roch nach Sonne, Wind und Federn. Er hätte alles für sie aufgegeben, und wenn er es genau betrachtete, hatte er das ja auch. Er war wegen ihr zu Fuß von Freital in Sachsen bis nach Isfahan in Persien und zurück gereist, nur um dort zu erfahren, dass er sich diese Mühe hätte sparen können. Doch selbst wenn er schon in Venedig gewusst hätte, dass sie nach jedem Feuertod mit dem ersten Morgenlicht aus ihrer goldenen Asche wiedergeboren wurde – was hätte es ihm genutzt? Was nutzte es ihm jetzt? Sie hätte ihn niemals geliebt, selbst wenn sie 1897 nach ihrem Jungfernflug in Paris zur Erde zurückgekehrt wäre. Die Dame Phönix interessierte sich nur für sich selbst. Sie war die Quelle seines Unglücks, mit ihr hatte alles begonnen. Dass er sich nach ihr verzehrte, hatte alle seine Beziehungen zu anderen Frauen vergiftet und ihn schon damals in Venedig beim Brand des Teatro di San Benedetto fast das Leben gekostet.
Doch, nein, das stimmte nicht. Man konnte ihn nicht umbringen. Er war unsterblich. Pater Giuliano, der ihm damals den Schädel eingeschlagen hatte, hatte es ihm praktisch bewiesen. Jeder andere wäre an dieser schweren Verletzung gestorben, doch er war innerhalb weniger Tage genesen, genau wie von den vielfachen Knochenbrüchen, die er sich als Kind bei einem Sprung von einem Turm zugezogen hatte, von Säbelhieben und Messerstichen, von Pistolenschüssen. Er konnte sogar ziemlich unbeschadet durchs Feuer gehen.
Gott, wie er das vermisste!
Wenn ihm seine Gefängniswärter wenigstens ein Strohlager gegeben hätten, hätte er es anzünden, sich in den Flammen wälzen und sich dadurch Lust verschaffen können. Er drosch mit der Faust gegen die Steine seines Gefängnisses. Jeder zu lebenslänglicher Haft verurteilte Dieb und Mörder starb irgendwann und hatte es damit hinter sich. Doch er saß hier wahrscheinlich ewig fest.
Wir können dir heraushelfen! Was nützt dir hier unten dein hübsches Gesicht? Vergiss La Fiametta, du kannst jede Frau haben, die dir gefällt.
Er wollte aber die Dame Phönix. Nur sie. Sie war wunderschön, reif, voll zur Frau erblüht, betörend sinnlich. Doch sie hatte sich damals für alt und welk gehalten und sich auf offener Bühne verbrannt, um jung aus der eigenen goldenen Asche wiedergeboren zu werden. Nur war er leider vorher hilflos aus Venedig fortgebracht worden, und die Hunde Gottes, die Dominikaner, hatten La Fiamettas Vorhaben vereitelt und ihre Überreste noch in der Brandnacht in einer Urne gesammelt. Darin hatte sie über hundert Jahre geschlafen, bis sie der Brand des Bazar de la Charité 1897 geweckt hatte. Sie durchtanzte und durchsang nun irgendwo auf der Welt die Nächte, lebte von Sonnenschein und Liebe und schlief mit jedem Mann, der sie begehrte.
Während du hier im Finsteren sitzt und dich selbst melken darfst.
Gottverdammt!
Jan erhob sich hastig, drehte Runde um Runde unter dem hellen Gitterloch des Brunnenkranzes, bis er wieder ruhiger wurde. Er konnte es sich nicht leisten, zu lange untätig herumzusitzen. Er wurde wahnsinnig, wenn er nicht in Bewegung blieb.
***
Tage, Monate, Jahre, viel, viel später.
Der Rücken der Rattenfelljacke sah ziemlich zerrupft aus, aber die Vorderteile hatte er schon geschickter zusammengenäht, und die Hose war ein echter Segen. Jetzt knüpfte er an einer Schnur. Er wusste noch nicht, wozu er sie brauchen konnte, aber es wäre doch schade, die Haare, die ihm jeden Tag beim Zopfflechten an den Fingern hängen blieben, einfach in den Boden zu treten.
Sein Magen knurrte. Brot und Wasser waren all die Jahre immer pünktlich auf ihn heruntergefallen, aber heute ließen sie sich mit der Ration Zeit. Er lauschte. Es war jetzt wieder Frühling, in der hellen Jahreszeit plagten ihn die Dämonen weniger, und er nahm mehr von dem wahr, was sich fern von ihm im Château tat. Etwas ging dort vor sich, es war, als habe sich über der fernen Masse der Gedanken von Gefangenen und Wärtern eine dunkle Wolke gehoben. Veränderungen kamen in Gang, doch sie mussten nichts Gutes bedeuten, nicht für ihn.
Was, wenn jetzt niemand mehr weiß, dass du hier unten eingekerkert bist?
Unsinn! Selbst wenn neue Verantwortliche kamen, gingen doch nicht alle alten Wärter gleichzeitig in Pension. Jemand musste noch davon wissen, dass im Donjon ein letzter Gefangener saß.
Fragt sich nur, ob sie nachsehen kommen, bevor du verdurstet bist.
Auf einmal überkam ihn die Wut. Er schüttelte den Kopf und nahm die üblichen Runden durch sein Gefängnis wieder auf. Er würde sich nicht verrückt machen lassen.
Der Tag verging mit der üblichen Routine. Laufen, Scheinfechten, eine vorbeihuschende Ratte erschlagen. Er schlitzte dem Tier mit der scharfen Kante des Kieselsteins den Bauch auf, zog ihm das Fell ab und verspeiste Fleisch, Gedärme und Karkasse. Damit, sie zimperlich auszuweiden, hielt er sich schon lange nicht mehr auf. Jan dachte an den Dschinn Chamsin, damals in Napoleons Schlafzimmer in den Tuilerien. Der Geist der Wüste hatte sich seiner Lust bedient, um sich aus dem Bann zu befreien, den die Mutter Rustams über ihn verhängt hatte, ohne dass der Leibdiener Napoleons überhaupt gewusst hätte, dass Chamsin über ihn wachen musste. Weil der Dschinn durch Jan seine Freiheit wiedergewonnen hatte, hatte er ihm versprochen, dass er ihm einmal zu Hilfe eilen würde, in höchster Not. Wenn alle Stricke rissen, konnte er den Dschinn rufen.
Wozu die Umstände? Diesen Dienst können wir dir genauso tun!
Nur mit dem feinen Unterschied, dass der Dschinn ihm verpflichtet war, während es sich mit den Dämonen genau umgekehrt verhielt.
Ein geringer Preis. Danach bist du einer von uns.
Die Versuchung, Chamsin zu rufen, war groß, zumal sein Wasservorrat zur Neige ging. Jan beschloss, trotzdem noch einen Tag auszuhalten.
Der verging bis in die Nacht hinein, aber dann – er glaubte schon fast selbst nicht mehr daran – hörte er auf einmal doch die vertrauten Geräusche der Wärter. Er sah einen Lichtschein aus der Finsternis auftauchen, wahrscheinlich eine Sicherheitslaterne, er roch das Petroleum. Dieses Mal kamen alle Wächter in die Brunnenstube über seinem Verlies, vier, nein, sogar fünf Männer. Der Widerhall so vieler Schritte irritierte ihn. Das heiß ersehnte leise Wasserschwappen in einem Eimer begleitete sie aber leider nicht. Dafür rieb oben unter dem Schutzdach Metall gegen Metall, wahrscheinlich Gewehrläufe und Bajonette. Jan fand aber keinen Anhaltspunkt in ihren Gedanken, dass sie ihn exekutieren kamen.
Endlich, das wurde aber auch Zeit!
Der muss doch schon ewig da unten hocken!
Er war mit einem Schlag hellwach.
Der alte Gefängnisdirektor war in Pension gegangen, und der neue hatte Befehl, mit weniger Wärtern auszukommen und ihre Runden kurz zu halten. Colonel Bellefleurs erste Sparmaßnahme bestand darin, mit dem Unsinn zweier Haftanstalten Schluss zu machen. Der letzte Gefangene im Donjon wurde zu den anderen in die Baracken verlegt. Dennoch erschrak Jan furchtbar, als das Eisengitter über ihm kreischend wegklappte, eine Strickleiter durch die Brunnenöffnung purzelte und knapp über ihm auspendelte. Ein Mann beugte sich über den gemauerten Steinkranz, das Gesicht unkenntlich gegen den blendenden Laternenschein.
Mein Gott! Dass der nicht schon am eigenen Gestank erstickt ist!
„He, du da unten! Komm rauf!“
Kapitel 2
Caen, im Mauerring des Château; Donnerstag, der 27. Mai 1915; elf Uhr nachts.
Achtzehn Jahre waren seit seiner Einkerkerung vergangen. Achtzehn! Jan stakste unsicher den beiden Wärtern hinterher, die auf dem Trampelpfad die Vorhut bildeten. Rechts ragte dunkel das langgestreckte Gebäude der Normannischen Festhalle auf, die Soldaten benutzten sie jetzt als Heustadel. Kurzes Gras kitzelte seine Füße. Er hatte ganz vergessen, wie sich das anfühlte, und es war nicht die einzige Schwierigkeit auf dem unebenen Boden. Er hatte vom ewigen Im-Kreis-Gehen im Verlies offenbar einen starken Linksdrall entwickelt und musste ständig aufpassen, dass er nicht den Mann neben sich anrempelte. Unglaublich viele Eindrücke stürmten auf ihn ein. Weit voraus lag die Porte Saint Pierre, linker Hand die Gebäude der Kaserne. Sie sah immer noch nicht besser aus als damals, im Grunde waren vor allem die Mannschaftsquartiere ein Provisorium. Aber es war Mai, Frühling, und die Luft roch nach Meer. Die Männer, die ihn nach oben gezogen hatten, fanden die Nacht mild, doch ihm war kalt. Er war sehr durstig und hungrig, und er fror beim leisesten Windstoß.
Dass sie ihn herausgeholt hatten, verdankte er einem neuen Krieg. Welche Ironie, offenbar war die gesamte Inquisition inzwischen zur Armee eingezogen worden, er konnte sich die plötzliche Amnestie nicht anders erklären. Frankreich schien jeden Mann zu brauchen, egal ob einfacher Soldat, Offizier oder Priester. Es ging gegen das Deutsche Reich. Jans Wärter hielten Kaiser Wilhelm II. für den Haupt-Kriegstreiber. Er stocherte und polkte mal im Gedächtnis des einen, dann des anderen, bis er davon Kopfschmerzen bekam. Aber der eigentliche Anlass für die Kriegserklärung blieb blass.
Was ist das mit dem österreichischen Thronfolger? Wieso Karl? Zuletzt war es doch Franz Ferdinand. Ach – ermordet. Mit seiner Gattin, ein Attentat durch einen Serben. Und deshalb führt Frankreich jetzt Krieg gegen Deutschland?
Er kam nicht dahinter, außerdem beschäftigten seine Begleiter die letzten Ereignisse viel mehr. Bei Ypern hatte erst vor wenigen Tagen eine Schlacht geendet, die mehrere Wochen gedauert hatte. Mehrere Wochen? Er fing weitere Begriffe auf. Materialschlacht, Grabenkrieg, Hunderttausende Tote. Die Deutschen warfen Granaten, die bei der Explosion giftiges Gas freisetzten. Es war schwerer als Luft, die Soldaten in den Gräben hatten keine Chance. Falls es einer doch herausschafft, bleibt er oft genugblind. Viele plagen sich zusätzlich mit einer kaputten Lunge herum.
Manche Informationen, die in den Köpfen der Wärter herumgeisterten, waren sicherlich übertrieben. Keiner von ihnen war je an der Front gewesen, aber das giftige Gas schien eine Tatsache zu sein. Welcher Dämon trieb einen General dazu, gegnerische und, wenn der Wind drehte, oft genug die eigenen Männer ätzendem Nebel auszusetzen, in dem sie erblindeten und erstickten? Was war das überhaupt, ein Grabenkrieg? Jan kannte nur die offene Feldschlacht, begriff aber trotz seiner mörderischen Kopfschmerzen, dass Soldaten jetzt offenbar ganze Systeme von Schützengräben aushoben, aus denen beide Seiten aufeinander schossen. Er schwankte wie betrunken weiter voran. Die vielen Neuigkeiten, die auf ihn einstürmten, dazu der nach Salz riechende Nachtwind, der grelle Laternenschein, alles zusammen war kaum zu ertragen.
Dass der sich überhaupt noch auf den Beinen halten kann!
Sah er wirklich so schlimm aus? Die Männer hatten ein Gespenst aus dem Donjon gezogen, eine bucklige, zum Skelett abgemagerte Elendsgestalt.
Heult natürlich Rotz und Wasser.
Aber seine Tränen strömten nicht aus Erleichterung oder gar Dankbarkeit. Es waren nur die Jahre fast völliger Dunkelheit, die ihren Tribut forderten. Nein, es waren beinahe Jahrzehnte (er konnte immer noch nicht ganz glauben, dass wirklich so viel Zeit vergangen war). Aber Jahre oder Jahrzehnte, das Licht der Blendlaterne stach ihm grausam in die Augen. Es war objektiv betrachtet vermutlich gar nicht so hell, den Männern kam der Schein jedenfalls schwach vor. Doch er stolperte halbblind zwischen ihnen vorwärts, und es kam prompt, wie es kommen musste: Er geriet dem linken Wärter in die Bahn.