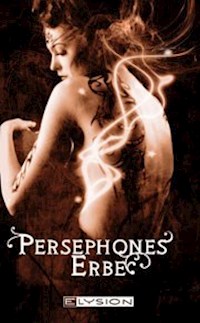3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Drache und Phönix
- Sprache: Deutsch
„Sie war eine Hexe, und sie wusste, wer da vor ihr stand. – ‚Ich bin nur der Sohn eines Drachen‘, dachte Jan. Sie las seine Gedanken und antwortet auf die gleiche Weise: ‚Ich hoffe, du kannst mir trotzdem helfen, Jan Stolnik, Sohn einer Königin.‘“ Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten empfängt Jan Stolnik mit offenen Armen – denn CIA und FBI haben größtes Interesse daran, den Drachen in Menschengestalt zu ihrer neuen Geheimwaffe im Kampf gegen dunkle Mächte zu machen. Schneller, als es Jan lieb ist, bekommt er ist mit Geisterfürsten und Dämonenbeschwörern zu tun. Er ist bereit, sich jedem Kampf zu stellen – weiß er doch, dass er in den Weiten Amerikas seine große Liebe, die Phönixdame La Fiametta, wiederfinden wird. Doch auch damit wird das Abenteuer, das ihn seit Jahrhunderten immer wieder in tödliche Gefahr bringt, noch lange nicht zu Ende sein … Der sechste Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend. Jetzt als eBook kaufen und genießen: „DRACHE UND PHÖNIX – Sechster Roman: Goldene Lichter“ von Angelika Monkberg. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten empfängt Jan Stolnik mit offenen Armen – denn CIA und FBI haben größtes Interesse daran, den Drachen in Menschengestalt zu ihrer neuen Geheimwaffe im Kampf gegen dunkle Mächte zu machen. Schneller, als es Jan lieb ist, bekommt er ist mit Geisterfürsten und Dämonenbeschwörern zu tun. Er ist bereit, sich jedem Kampf zu stellen – weiß er doch, dass er in den Weiten Amerikas seine große Liebe, die Phönixdame La Fiametta, wiederfinden wird. Doch auch damit wird das Abenteuer, das ihn seit Jahrhunderten immer wieder in tödliche Gefahr bringt, noch lange nicht zu Ende sein …
Der sechste Band der historischen Fantasysaga, die Jahrhunderte überspannt und von der unsterblichen Liebe des Drachensohnes Jan Stolnik erzählt: spannend, abenteuerlich, faszinierend.
Über die Autorin:
Angelika Monkberg, geboren 1955, lebt in Franken. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst. Daneben schreibt sie Kurzgeschichten und Romane – wenn sie nicht zeichnet oder malt. In beiden Bereichen gilt ihr Interesse vor allem dem Phantastischen.
Angelika Monkberg im Internet: www.facebook.com/1AngelikaMonkberg
Die historische Fantasy-Saga DRACHE UND PHÖNIX umfasst folgende Bände:
Erster Roman: Goldene Federn
Zweiter Roman: Goldene Kuppeln
Dritter Roman: Goldene Spuren
Vierter Roman: Goldene Asche
Fünfter Roman: Goldene Jagd
Sechster Roman: Goldene Lichter
Siebter Roman: Goldene Ewigkeit
***
Originalausgabe September 2014
Copyright © 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von © toniflap / shutterstock.com
ISBN 978-3-95520-704-5
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort DRACHE UND PHÖNIX 6 an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
Angelika Monkberg
DRACHE UND PHÖNIX:
Goldene Lichter
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Auf dem Rollfeld des Flughafens Paris-Orly, an Bord einer Douglas DC-4a der United Airlines mit Ziel New York; Mittwoch, der 20. Juli 1949; 8:15 Uhr MEZ, wolkenlos, schon sehr warm.
Jan zweifelte immer noch, ob es eine gute Idee gewesen war, sich in ein Flugzeug zu setzen. Aber die Reise dauerte nicht so lange wie mit dem Schiff, und im Übrigen ließen ihm seine neuen Arbeitgeber kaum die Wahl. Sie wollten ihn am liebsten schon vorgestern, und von Cherbourg oder Le Havre aus hätte er mindestens acht Tage gebraucht, während er mit der DC-4a bereits an diesem Abend in New York ankommen würde. Durch die Zeitverschiebung wäre das natürlich der Nachmittag: Sie flogen nach Osten und holten unterwegs mehrere Stunden auf.
Aber der Abgrund, der währenddessen unter ihm liegen würde, gefiel ihm immer noch nicht. Er verstaute seine langen Beine in dem schmalen Fußraum vor sich.
Gut, er beklagte sich nicht, die CIA zahlte das Ticket, und er saß hier halbwegs komfortabel. United Airlines baute nur zweiundfünfzig Sitzplätze in eine Douglas DC-4a, während andere Fluggesellschaften achtzig Passagiere darin verstauten. Er fragte sich wirklich, wie. Obwohl sie ja alle schon wieder verwöhnt waren, denn der Vorgängertyp dieses Flugzeugs hatte der Army während des Zweiten Weltkriegs als Truppentransporter gedient, und damals war es an Bord sicher noch beengter zugegangen.
Er stellte sich das schrecklich vor, eingepfercht mit Dutzenden von Männern, und vielleicht noch ein Nachtflug, so dass man überhaupt nicht wusste, wo man landete. In dieser Hinsicht hatte er es heute besser, sein Flug ging tagsüber, und es blieb auch hell, einen ganzen, sehr langen Nachmittag lang. Er würde genau sehen, wo er ankam. Außerdem bekam er sogar eine Verschnaufpause. Die DC-4a musste in Gander, Neufundland, aufgetankt werden, denn ein Flug mit der neuen Constellation von Lockheed, die durch ihre Tragflächentanks über sagenhafte 6400 Kilometer Reichweite verfügte und nonstop in die USA flog, war der CIA doch zu teuer gewesen. Für Jan Stolnik, staatenlos, designierter Dämonenjäger, Sohn eines Drachen, tat es auch ein normaler Flug.
Er warf an seinem linken Sitznachbarn vorbei einen Blick durch das Bullauge auf die Tragfläche der DC-4a. Die Maschine verfügte über vier Propellertriebwerke, deren Flügel sich inzwischen so schnell drehten, dass selbst er sie nur noch als undeutliche graue Scheibe wahrnahm. Die Motoren dröhnten laut, er sah, wie das Terminal zurückfiel, und dann fuhren sie plötzlich neben einer Wiese auf einer grauen Betonpiste. Stöße wie in einem schlecht gefederten Eisenbahnwaggon verrieten, dass sie sich auf die eigentliche Startbahn zubewegten.
„Schließen Sie bitte die Sicherheitsgurte, und stellen Sie das Rauchen ein.“ Eine Stewardess im adretten dunklen Kostüm mit Schiffchen im Blondhaar ging durch die Sitzreihen und vergewisserte sich, dass jedermann an Bord ihren Anweisungen folgte. „Sie bitte auch, Sir“, sagte sie zu Jans Nachbar.
Der Mann drückte seine Zigarette mit einem Augenrollen aus und reichte Jan gleichzeitig seine Visitenkarte. „Frank D. Kapitzky, Tibouchina Cosmetics. Unser Markenzeichen ist die blaue Prinzessinnenblume. Ich habe in Grasse Parfüm für die Firma eingekauft. Also, wenn die Frau Gemahlin einen Duft möchte, den ihre Freundinnen noch nicht kennen – Sie wissen jetzt, an wen Sie sich wenden müssen.“ Und was treibt dich hierher, Sportsfreund?
Jan beantwortete die unausgesprochene Frage und stellte sich ebenfalls vor: „Jan Stolnik, Zivilangestellter der US Army.“
„So? Dann sind wir ja fast Kollegen“, sagte der Priester, der, getrennt durch den Mittelgang, rechts von ihm saß. „O’Shaughnessy. Ich war in der Normandie dabei. Omaha Beach.“
„Ich war in Caen.“
„Da war es auch heftig. Danken wir dem Herrgott, dass es vorbei ist.“
„Amen“, sagte Kapitzky.
Nahezu alle Reisenden an Bord waren Geschäftsleute, nur weiter vorn saß eine einzelne ältere Dame und zwei Reihen weiter hinten ein Ehepaar, das seine Tochter in einem Pariser Institut für junge Damen abgeliefert hatte. Nancy sollte Französisch lernen, wie sie der Stewardess anvertrauten. „Damit sie später mal einen Akademiker als Schwiegersohn bringt.“
O’Shaughnessy verzog die Lippen zu einem amüsierten Schmunzeln. Der Pater besaß weit mehr Gottvertrauen als seinerzeit Prinz Antons Beichtvater Wilfert, Jan sah bei ihm keinen Rosenkranz, und er schickte auch nur ein stummes Gebet zum Himmel. Gib, dass diese Reise gut verläuft, o Herr. Aber Dein Wille geschehe! Amen. Und als die Stewardess auf dem Rückweg zum Cockpit zwischen ihnen durchging, starrte er ihr mit unverhohlenem Wohlgefallen auf den Hintern.
Jan lächelte. Er staunte, wie sicher sie ihren Platz in der Bordpantry erreichte, denn die DC-4a raste nun mit aufbrüllenden Motoren die Startbahn entlang, die Geschwindigkeit presste seine Stummelflügel unangenehm in den Sitz, und auf einmal hob es ihn und die ganze Kabine in die Schräglage und stetig höher. Das Flugzeug war in der Luft, das Rattern der Reifen verwandelte sich in ein Sausen und Pfeifen, und die DC-4a stieg unaufhaltsam. Plötzlich lag Paris wie auf einer Landkarte unter ihm, doch mit lebhafteren Farben, grün, ziegelrot und dunstgrau, viele winzige Häuser, durchzogen vom Silberband der Seine. Der Anblick kam so überraschend, dass er die Höhe zuerst gar nicht empfand. Dafür dröhnten die Propellertriebwerke jetzt überlaut, Druck legte sich auf seine Ohren, und er schluckte mehrmals, bis das unangenehme Gefühl nachließ. Sein Sitznachbar Kapitzky kaute Kaugummi. „Auch einen? Das hilft.“
„Sobald wir unsere Reiseflughöhe von rund viertausend Metern erreicht haben, dürfen Sie sich abschnallen.“ Die blonde Stewardess kehrte lächelnd zurück. Leichte Stöße schüttelten die Maschine. „Das sind nur Turbulenzen, Sir. Winde.“
Sie hätte die Höhe nicht erwähnen sollen. Er wandte die Augen vom Bullauge ab.
Kapitzky grinste ihn an. „Ist großartig, die Aussicht nach unten, was?“ Er nahm den Kaugummi aus dem Mund und zündete sich eine neue Zigarette an. „Die neue Constellation soll angeblich sogar noch höher aufsteigen können, ihre Passagierkabine ist druckdicht. Mir macht das hier aber nichts aus. Ist doch ’ne feine Sache, die Luft soll hier zwar dünn sein wie auf dem Matterhorn, aber dafür brauchen wir keine Bergtour zu machen, wir kriegen die gesunde Höhenluft umsonst. Waren Sie mal in der Schweiz?“
„Nein.“ Zumindest nicht, um das Matterhorn zu besteigen, niemand hätte damals im Traum daran gedacht. Wenn er einen seiner Prinzen-Halbbrüder auf der Grand Tour begleitet hatte, hatten sie immer Städte und dem Kurhaus Sachsen in Freundschaft verbundene Fürstenhöfe besucht, und die Wege über die Alpenpässe waren jedes Mal mit Gefahren verbunden gewesen, von denen Räuber noch die geringsten waren, aber das gehörte nicht hierher und hätte Kapitzky höchstens verwirrt. Jan sah, dass die Stewardess der älteren Dame drei Reihen vor ihm eine Sauerstoffmaske zeigte. „Wirklich, Madam, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es ist völlig sicher.“
Kapitzky dauerte das zu lange. Er hob den Arm und schnippte mit den Fingern. „Miss? Wie wäre es mit Martinis für uns zwei Hübschen?“
„Kommt sofort, Sir.“ Ihr Blick streifte Jan. Sein Gesicht gefiel ihr und der militärisch kurze Haarschnitt erst recht. Aber sie war mit ihren knapp vierundzwanzig Jahren schon ein alter Hase in ihrem Metier und sah ihm an, wie unwohl er sich fühlte.
Er zwang sich zu einem Lächeln. Nein, sie brauchte keine Angst zu haben, dass er sich übergab. Das Rütteln und die Stöße des Flugs störten ihn nicht weiter, da hatte er während seines langen Lebens in Kutschen und auf See viel Schlimmeres erlebt. Ihm war nur leider sehr bewusst, dass die Maschine frei in der Luft schwebte. Ringsum war nichts, es gab noch nicht einmal Wolken. Die Hitzewelle hatte den Himmel über halb Europa wie blank geputzt, Jan schätzte, dass das Thermometer heute Mittag in Paris wieder auf über dreißig Grad klettern würde.
Kapitzky dachte offenbar das Gleiche. „Wenigstens schwitzt man hier nicht.“ Er lockerte seine Krawatte und lächelte die Stewardess an. „Hör mal, Mädchen, verwendet ihr hier an Bord Gin oder Wodka für den Martini?“
„Gin, natürlich, Sir. United Airlines serviert keine kommunistischen Getränke.“
„Das ist gut. Aber tu bloß keine Olive hinein! Und schwenk die Wermutflasche höchstens kurz am Gin vorbei. Ein anständiger Drink muss steif sein. Wie ich.“ Er nahm das volle Glas in die Linke und machte Anstalten, nach ihrer Rechten zu greifen. Jan war nicht überrascht, dass sie Hand und Flasche sofort zurückzog. „Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Sir?“
„Ja, dass du heute Abend mit mir ausgehst, Süße. Wie heißt du eigentlich?“
„Carol. Aber ich fürchte, Sir, das geht nicht. Wir starten um zweiundzwanzig Uhr.“
„Na, vielleicht hat ja eine deiner Kolleginnen Zeit. Du bist sicher so nett und reichst meine Adresse weiter. Ich steige in New York immer im Plaza ab.“ Kapitzky – Bungalow in Boston, Massachusetts, verheiratet, vier Kinder – leerte sein Glas in einem Zug und beugte sich an Jan vorbei, um der Stewardess seine Visitenkarte zuzustecken. Sie ließ sie routiniert in ihrem Blusenausschnitt verschwinden. „Sir, es ist uns verboten, mit Passagieren auszugehen.“
„Ich gebe einem Mädchen immer mindestens einen Fünfziger, wenn sie sich mal die Nase pudern will.“ Wenn du richtig nett zu mir bist, bin ich gerne großzügiger. Er winkte mit den Augenbrauen. Dass sie aus dem Job flog, wenn das herauskam, interessierte ihn nicht. Ein Mädchen, das nicht wusste, wie es zu etwas Spaß im Bett kam, war eine dumme Pute. Er öffnete den Mund, um Jan genau das zuzuraunen: „Also von Mann zu …“
„Prost!“ Jan hob sein eigenes, noch volles Glas, drehte den Kopf und sah ihm hart in die Augen. Halt die Klappe, Kapitzky!
Der Mann von Tibouchina Cosmetics erschrak, bekreuzigte sich und griff sich danach in den Schritt, wo es in Erwartung des Rendezvous, an dem er nicht zweifelte, ziemlich eng war – und beim Anblick der Stewardess, die sich jetzt eine Sitzreihe weiter vorn zu einem anderen Passagier herabbeugte, was ihr den Rock hübsch um den Hintern spannte, noch enger wurde. „Auch einen Martini, Sir?“ Eine scharfe Braut!
Das stimmte, Pater O’Shaughnessy fand das auch. Für einen Priester besaß er eine erstaunlich flexible Einstellung zur Sünde. Wenn Gott uns Augen gegeben hat, zu sehen, dürfen wir auch sehen, was uns diese Augen zeigen.
Jan selbst schloss seine, drehte Kapitzky halb den Rücken zu und lehnte sich mit der rechten Schulter gegen das Rückenpolster des Sessels. Seinem Nebenmann stockte der Atem – Jan wusste, dass ihm der Buckel vorher nicht aufgefallen war –, aber Kapitzky kämpfte seinen Schauder tapfer mit drei Martinis nieder, die ihm Carol nach und nach umsichtig an Jans Schulter vorbeireichte.
Die Stewardess war absolut keine dumme Pute; sie lächelte Kapitzky vielmehr süß an und überlegte dabei, ob sie ihm während ihres kurzen Aufenthalts in New York nicht tatsächlich einen Fünfzigdollarschein aus der Nase ziehen konnte, ohne dabei allzu viele Federn zu lassen, das hieß, nicht bis hinunter zu Höschen und Büstenhalter. Jan gefiel ihr trotz des Buckels besser, sie hielt ihn aber für nicht reich genug (was auch stimmte).
Außerdem, wie soll man mit einem Mann flirten, der schläft?
Leider konnte er nur so tun als ob, bis hin zum gleichmäßigen Atem. Schlaf war ihm von Natur aus nicht gegeben, und es gab auch kein einziges Medikament, keine Droge, die sein Wachbewusstsein ausschaltete. Die Agenten der CIA, die in ganz Europa Hexen und Magier anwarben, hatten natürlich auch ihm beim Eignungstest einen netten Cocktail aus Barbituraten untergejubelt. Nur war ihre Annahme falsch, dass er das nicht merkte, und der zweite Irrtum galt sogar für Menschen, die nicht wie er einen Drachen zum Vater hatten: Das Zeug zwang niemanden, immer nur die Wahrheit zu sagen. Ein geschickter Lügner konnte Experten auch unter Drogeneinfluss in die Irre führen, und für ihn hatte die einzige Schwierigkeit darin bestanden, den Herren eine gewisse Beeinflussung durch die Substanzen vorzuspielen. Er traute der CIA nicht, sie brauchten nicht zu wissen, dass das Einzige, was ihn für eine Weile auf die Matte schickte, schwere Verletzungen waren. Knochenbrüche, Brandwunden, nach der Bombardierung von Caen war er tatsächlich eine Weile außer Gefecht gewesen. Die totale Zerstörung der Stadt hatte aber den einen Vorteil gehabt – wenigstens für ihn –, dass ihm die Sieger den Verlust aller seiner Papiere sofort geglaubt hatten.
Sie waren allerdings nicht im Feuersturm der Stadt verbrannt, wie er behauptet hatte, sondern 1897 von der Inquisition vernichtet worden. Aber, und in dieser Beziehung gab Jan nachträglich dem Werwolf Bellefleur recht, der das wahre Ausmaß seiner Fähigkeiten zuerst sogar ihm verschwiegen hatte: Wer Magie in sich trug, konnte keinem Menschen wirklich trauen. Die Agenten der CIA waren zu professionell neugierig und gleichzeitig erschreckend blauäugig. An ihrer Stelle hätte Jan zumindest versucht herauszufinden, warum die Patrouille der US Army im Juli 1944 nach dem D-Day ihn auf einer Mauer des Logis de Gouverneur im Château Caen sitzend gefunden hatte – als einzigen Überlebenden eines Gefängnisses, in dem neben Hexen und Magiern zuletzt auch über achtzig Mitglieder der Resistance von den Nazis ermordet worden waren. Umgekehrt hatte aber natürlich genau das seine Befreier auf die falsche Spur gelenkt.
Sie glaubten ihm das Geburtsdatum, das er angegeben hatte: 1916. Er sah auch aus wie ungefähr dreißig. Aber in Wirklichkeit war er 1723 geboren und hatte über diese zweieinviertel Jahrhunderte viele Identitäten benutzt. Der einzige Unterschied zu dieser, seiner neuesten, bestand (für ihn) darin, dass es früher viel weniger Mühe gemacht hatte, neue Papiere zu fälschen. In einem Fall, um 1830 herum, war er nach dem Tod seines Sohnes Jean-Pascal – vielmehr: des Sohnes seiner ersten Ehefrau Mary – einfach in dessen Rolle geschlüpft. Vorher, 1816, hatte Prinz Anton die Liebenswürdigkeit besessen, die Rolle seines Vaters zu übernehmen, damit er sich nach den Napoleonischen Kriegen in Frankreich wieder eine Existenz aufbauen konnte. Und noch davor, 1790 in Persien, als er noch geglaubt hatte, er würde dort einen Hinweis auf die Dame Phönix finden, war er als Sir John Stolworth aufgetreten. Der Engländer war in Constanza am Schwarzen Meer höchst passend verstorben.
Doch er meinte das nicht zynisch. Sie hatten sich zwar nicht sonderlich nahegestanden – er war Sir Johns Diener gewesen –, aber aus dem Abstand von beinahe hundertsiebzig Jahren dachte er freundlicher über Stolworth, der gerne als großer Forschungsreisender in die Annalen der Royal Society eingegangen wäre und an den Umständen gescheitert war. Er vermisste ihn nur nicht, im Gegensatz zu anderen, um die er bis heute trauerte. Prinz Anton zum Beispiel, dieser liebenswürdigste seiner jungen Neffen, war neunzehn gewesen, als sie 1774 in Venedig La Fiametta zum ersten Mal hatten singen hören. Ihre Stimme hatte Jan verzaubert, regelrecht in ihren Bann gezogen. Die Erinnerung an sie brachte sein Herz selbst jetzt, nach all den Jahren, immer noch aus dem gleichmäßigen Takt.
Inzwischen bestand wieder eine hauchdünne Chance, dass er sie vielleicht tatsächlich wiederfand. Er hatte sie erst vor wenigen Jahren in einer französischen Wochenschau als Mitglied des amerikanischen Zirkus Barnum’s gesehen. Aber ihm war nur zu bewusst, auf welch dünnes Eis er sich begab, wenn er wieder Kontakt mit ihr suchte. Die Dame Phönix war schön, begehrenswert, wild, unersättlich – vor allem im Bett. In dieser Beziehung war sie alles, was sich ein Mann nur wünschen konnte. Aber sie war auch ein Biest, launisch, herrisch, verschwenderisch und unendlich selbstsüchtig. Sogar grausam, er hatte nicht vergessen, wie sie mit ihren Dienerinnen und auch mit ihm umgesprungen war. Gemessen daran, hatte er mit seiner guten weißen Hexe Barberina viel mehr verloren. Sie hatte ihm in den ersten Jahren nach La Fiamettas Feuertod den Haushalt geführt, bis ihr eifersüchtiger Ehemann Nanni sie und ihrer beider ungeborene Tochter ermordet hatte. So harmonisch und gut versorgt wie von Barberina hatte er danach nie mehr gelebt. Auch nicht mit Mary, seiner ersten Ehefrau, fast ein Jahrhundert später. Er hatte versucht, ihren beiden Kindern ein guter Vater zu sein, denn eigene Nachkommen konnte er mit einer Menschenfrau nicht zeugen. Leider. Und dass die Dame Phönix Mutterfreuden wünschte, bezweifelte er doch stark. Er fragte sich durchaus, gerade hier im Krach und dem Rütteln der DC-4a, warum er sich das antat und immer noch nach ihr suchte.
Vielleicht wäre es längst vorbei und entschieden gewesen, wenn sie die Umstände ihrer Wiederauferstehung 1897 beim Brand des Bazar de la Charité in Paris nicht erneut auseinandergerissen hätten. Sie war in dem Feuer aus ihrer eigenen Asche neu entstanden und als Phönix bis in die Stratosphäre aufgeflogen, irgendwohin – während ihn die Inquisition angeklagt hatte, ein Weltentor geöffnet zu haben, das Scharen der Hölle in die Welt der Menschen entlassen hatte. In Wahrheit aber hatte er gegen die Dämonen gekämpft und etliche in ihr Reich zurückgeschlagen. Dennoch hatte man ihn in Paris dafür gehenkt. Er hatte den Galgen nur überlebt, weil er der Sohn eines Drachen war. Man konnte ihn nicht bis zum Tod am Hals aufhängen. Erstens war er unsterblich, zweitens hatten sich seine Flügel dabei entfaltet, wie immer in höchster Not, und er hatte sich vom Seil losgerissen. Er spürte das riesige, unsichtbare Paar normalerweise nicht, nur die verkrüppelten Stummel, die seinen Rücken bucklig erscheinen ließen, und während der ersten, sehr sorglosen fünfzig Jahre seines Lebens war ihm absolut nicht bewusst gewesen, dass er diese Schwingen besaß. Sie hatten sich zum ersten Mal entfaltet, als er La Fiametta besessen hatte. Aber er hatte immer noch keine rechte Gewalt darüber. Sie halfen ihm anscheinend nur in verzweifelten Situationen.
Er war zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass er sogar einen Absturz der DC-4a überleben würde. Falls dieser unwahrscheinliche Fall eintrat. Sein einziges Manko war, dass er Abgründe fürchtete. Seit er als Kind von einem der Türme des Stadtschlosses in Dresden gesprungen war und sich dabei alle Knochen gebrochen hatte, drehte ihm schon der bloße Anblick von Tiefe den Magen um. Hier im Flugzeug ging es, weil Kapitzky am Fenster saß und einen Teil der Aussicht mit seinem Körper verdeckte. Aber damals, als er im Kaukasus gezwungen gewesen war, Pfade am Rand tiefer Schluchten zu gehen, hatte ihn Daoud vorwärts zerren müssen. Er konnte solche Wege nicht einmal mit verbundenen Augen gehen, weil er mit der Drachengabe durch fremde Augen sehen konnte, was vor ihm lag. Obwohl er das bei Freunden normalerweise nicht tat.
Daoud: noch ein guter Freund, der lange tot war, und vielleicht der beste, den er je besessen hatte. Der Armenier war Ende des achtzehnten Jahrhunderts bei dem Kleinen geblieben, seinem einzigen Sohn, Karim al-Tinnin, den zu verlassen ihn ein Bluteid gezwungen hatte, den er Amanischacheto, der Kandake von Meroë, in Isfahan geschworen hatte. Sie, seine Halbschwester und die Mutter seines Sohnes, hatte damit verhindert, dass er jemals Anspruch auf ihn erheben konnte. Doch Amanischacheto war kurz danach bei einem Aufstand im Sudan ums Leben gekommen, und seitdem waren Daoud und Karim al-Tinnin verschollen. Er hatte erst in Kairo davon erfahren und keine Möglichkeit gehabt, nach ihnen zu forschen. Dass er nichts von seinem Sohn wusste – ob er wie er unsterblich oder tot war –, schmerzte ihn bis heute.
Die DC-4a gierte wieder einmal, und dem Rütteln und Sacken nach hätte man glauben können, sie pflügten durch schweren Seegang. Die ältere Dame weiter vorne schrie auf. Jan öffnete die Augen und sah, dass Carol bei ihr stand. „Kein Grund zur Besorgnis, Madam. Das war ein sogenanntes Luftloch. Sehen Sie, jetzt fliegen wir schon wieder hübsch geradeaus. Möchten Sie einen Cognac auf den Schreck?“
„Nein, lieber einen Whiskey, wenn Sie den an Bord haben!“
Jans gute Ohren verrieten ihm, dass die ältere Dame ihrem Akzent nach aus Schottland kam. Aber Carol konnte nur amerikanischen Bourbon anbieten, und er las erheitert aus den Gedanken der schottischen Lady, dass man diesen Whiskey, der hauptsächlich aus Mais gebrannt wurde, tatsächlich trinken konnte. Er machte sich bei Carol bemerkbar und ließ sich auch einen geben. Es hatte keinen Sinn, er wurde niemals betrunken, aber er mochte den leicht rauchigen Geschmack, und mit dem Glas zu spielen lenkte ihn von der Untätigkeit ab. Er hätte ein Buch mitnehmen sollen. Kapitzky schlief jetzt auch.
Irgendwann später erreichten sie dann Neufundland. Als sie in Gander landeten und hart aufsetzten, quoll nicht nur der Aschenbecher neben ihm von Kippen über, die Luft in der Kabine war zum Schneiden und blau vom Zigarettenrauch.
„Es ist gut, dass wir beide diesem Laster nicht frönen“, sagte Pater O’Shaughnessy. Er beschloss, sitzen zu bleiben und im Brevier zu lesen; Auftanken und Wartung dauerten nur rund neunzig Minuten. „Und wenn die Schotten offen stehen, wird die Luft automatisch besser. Aber gehen Sie nur, John!“
Jan war tatsächlich mehr als froh, der geflügelten Blechkiste wenigstens kurz zu entrinnen. Er blinzelte gegen das helle Morgenlicht und schnupperte. In der Küche des Flughafenrestaurants brutzelte Frühstücksspeck, sehr wahrscheinlich konnte er dort aber auch ein Mittagessen oder Abendbrot bekommen, die Gäste kamen aus aller Herren Länder und vielen unterschiedlichen Zeitzonen. Gander war das weltweit größte Drehkreuz des internationalen Flugverkehrs, die Great Circle Road von Europa nach Amerika transportierte jährlich eine Viertelmillion Passagiere quer über den Nordatlantik.
„Ist beeindruckend, was? Lust, einen Happen mitzuessen, John?“ Kapitzky hatte sich so weit an seinen Buckel gewöhnt, dass er neugierig wurde. „Stolnik, ist das polnisch? Sind Sie auf Verwandtenbesuch hier?“
„Nein, ich werde hier für die Army arbeiten.“
„Das ist großartig! Hören Sie, wenn Sie dazu keine Lust mehr haben, hätte ich vielleicht was für Sie.“ Durch Kapitzkys Kopf geisterte die Idee, dass Tibouchina Cosmetics Jan vielleicht als Fahrer einstellen konnte, oder im Versand. Obwohl, gutaussehend ist er schon. Wenn er den Kunden nicht gerade den Rücken zudreht, wäre er vielleicht sogar ein guter Handelsvertreter. Der Anzug ist elegant genug. Hat vor dem Krieg bestimmt bessere Zeiten gehabt. „Waren Sie auf dem College, John? Oder der Universität?“
„Ich bin Übersetzer, Französisch, Italienisch und Deutsch.“
„Gleich drei so schwierige Sprachen! Wow!“ Den könnten wir wirklich brauchen! „Komm mit, ich lade dich ein.”
Sie nahmen ein Frühstück, und das war üppig: Rührei mit Speck, Pfannkuchen mit Ahornsirup, viel frisch gebrühter Kaffee, der allerdings zum größten Teil aus geröstetem Getreide bestand. „Du bist wahrscheinlich echten Bohnenkaffee gewöhnt, John.“
„Ich habe im Spanischen Krieg schlimmeren getrunken.“
Kapitzky lachte herzlich, zündete sich eine Zigarette an und merkte überhaupt nicht, dass Jan nicht von dem Bürgerkrieg gegen General Franco gesprochen hatte, sondern von dem gegen Napoleon, 1812. Er war unter Wellington Kanonier gewesen, und sie hatten mit altmodischen Geschützen aus Bronze geschossen, die damals zum Teil schon ehrwürdige zweihundert Jahre alt gewesen waren. Man musste den Lauf nach jedem Schuss putzen, und bis die Kanone wieder feuerbereit gewesen war, waren Minuten vergangen.
Über Jans Kopf läutete ein Gong.
„Passagiere der DC-4a der United Airlines nach New York: bitte in die Maschine.“
***
Der neue New York International Airport Anderson Field war erst im letzten Jahr eröffnet worden. Das Gelände lag südöstlich von Brooklyn an einer Atlantikbucht und war viel größer als der alte Flughafen LaGuardia, der im Krieg der Air Force als Trainingsgelände gedient hatte.
„Die Zivilluftfahrt musste bis nach New Jersey ausweichen.“ Der Taxifahrer und Kapitzky, der darauf bestanden hatte, ihn nach Manhattan mitzunehmen, fütterten ihn unterwegs mit Details. Es war wohl so, dass auf dem Gelände vorher ein Golfplatz gelegen hatte, Idlewild. „Und jetzt, im zweiten Jahr, haben wir schon über fünfzigtausend Starts und Landungen, Sir!“
Häuserzeile auf Häuserzeile glitt am Taxi vorbei. Jan hielt die Strecke für einen Highway, bis ihm eine Bemerkung des Taxifahrers verriet, dass es nur eine Stadtautobahn war. „Der Expressway bringt uns durch Queens zum East River. Der fließt östlich von Manhattan, wie der Name schon sagt. Westlich fließt der Hudson. Wir fahren jetzt aber zum Queens Midtown Tunnel. Der ist erst neun Jahre alt und mautpflichtig, aber spart eine Menge Zeit und macht die Fahrt für euch billiger.“
New York war eine riesige Stadt. Es dauerte gute zwanzig Minuten, bis sie die Mautstation auf dieser Seite des Tunnels überhaupt erreichten, und danach brauchte der Taxifahrer noch einmal eine Viertelstunde über den Frank Delano Roosevelt Drive die ganze Ostseite von Manhattan hinunter zu ihrer südlichen Spitze. Doch obwohl Jan überzeugt gewesen war, die Straßen von Queens hätten ihn auf den Anblick der Halbinsel vorbereitet, musste er sich eingestehen, dass dem nicht so war. Er kannte Wolkenkratzer, aber die, die er zuletzt in den Banlieues von Paris gesehen hatte, waren viel niedriger. Die Glas- und Betontürme von Manhattan, vor allem ihre Anzahl und Höhe, die tiefen Straßenschluchten machten ihn erst einmal sprachlos.
Kapitzky grinste breit. „Das habt ihr nicht in Europa, John.“
Das Manhattan New York City Field Office of Immigration lag Nummer 26, Federal Plaza, Lower Manhattan am Broadway, zwischen Duane und Worth Street. Der Taxifahrer hielt auf dem Broadway an und ließ ihn aussteigen.
„Viel Erfolg, John!“ Er musste Kapitzky versprechen, am Abend auf einen Drink in der Champagne Bar des Plaza vorbeizuschauen. „Hier.“ Kapitzky gab ihm einen Zehndollarschein. „Nimm nachher ein Taxi, zu Fuß läufst du eine Stunde, wenn nicht mehr.“
Er nahm das Geld, er brauchte es nicht, aber er spürte, dass er Kapitzky durch eine Ablehnung beleidigt hätte. Gleichzeitig gab ihm das Intermezzo Zeit, den Rest der Route, die er zurücklegen musste, aus dem Ortsgedächtnis des Taxifahrers zu saugen. Er brauchte eigentlich nur die Worth Street nach links zu gehen bis zur Kreuzung Church Street, und dann einfach die Sixth Avenue hoch bis zur 58. Straße. Dann ein paar Meter rechts und er stand auf der Fifth Avenue. Das Plaza Hotel lag an der Grand Army Plaza, die schon dem Vorgängerbau den Namen gegeben hatte.
Die Stunde Fußweg (mindestens) war realistisch, doch er hatte den ganzen Nachmittag Zeit, wenn er bei der Einwanderungsbehörde fertig war. Er hatte in der DC-4a lange genug gesessen und wollte sich sehr gerne ein wenig die Beine vertreten. Außerdem, was waren schon sechzig Straßen?
Er wandte sich zum Eingang des Hochhauses, in dem das Office of Immigration seine Büros hatte, und rechnete nicht damit, dass er dort lange brauchen würde; er besaß ein Sechsmonats-Visum, eine im Rathaus von Caen beglaubigte (falsche) Geburtsurkunde und einen Arbeitsvertrag für die USA. Offiziell würde er weiterhin als Übersetzer arbeiten. Es war ein wenig misslich, dass er als staatenlos galt, doch wenn er seine verschiedenen Identitäten im 19. Jahrhundert als seine Vorfahren angegeben hätte, wäre vielleicht das Büro für Okkulte Angelegenheiten in Paris oder dessen Nachfolgeorganisation wieder auf ihn aufmerksam geworden. Er war nach wie vor schlecht auf sie zu sprechen, denn sie hatten sich an keine einzige Vereinbarung gehalten.
Dabei hatte die Zusammenarbeit zuerst richtig gut begonnen. Bellefleur hatte ihn aus dem Verlies geholt, in dem er nach dem Inquisitionsprozess und seiner sogenannten Begnadigung zu lebenslanger Haft fast zwanzig Jahre vegetiert hatte. So hatten sie sich kennengelernt. Dann war Bellefleur im Ersten Weltkrieg von einem Werwolf gebissen worden und selbst zu einem geworden, und das Büro für Okkulte Angelegenheiten hatte sie beide dazu benutzen wollen, andere Werwölfe zu jagen. Im Nachhinein betrachtet, hatte das nicht gutgehen können, und tatsächlich hatte Bellefleur sowohl ihn als auch das Büro für Okkulte Angelegenheiten getäuscht und heimlich ein eigenes Rudel aufgebaut. Doch die Feen der Fagne Tirifaye hatten den Werwolf und seine Leute nach Siebenbürgen verbannt, und er, Jan, war wieder im Château Caen gelandet, im Irrenhaus. Dort hatte er in der Schlussphase, als die Beamten des Büros für Okkulte Angelegenheiten zu Erfüllungsgehilfen der Nazis verkommen waren, als Fluchthelfer agiert. Kurz vor dem Angriff der Alliierten hatte er ein letztes Mal einigen Hexen und Magiern über die Festungsmauern geholfen, doch für ihn war dann kein Entkommen mehr gewesen.
In der Lobby des Hochhauses hing eine riesige Informationstafel mit den Adressen sämtlicher Firmen und Behörden, die hier ihren Sitz hatten. Zum Office of Immigration musste er Gott sei Dank nur hinauf in den vierten Stock, was die Gefahr verringerte, dass ihm schwindelig und speiübel wurde, sollte er gezwungen sein, aus dem Fenster zu sehen. Doch er stellte fest, dass er es sich sparen konnte, nach einem Lift zu suchen. Die Öffnungszeiten lauteten auf sieben Uhr morgens bis nachmittags halb vier, und jetzt war es fünf nach halb vier. Er hatte aber keine Lust, sich irgendwo ein billiges Hotelzimmer zu suchen und morgen den ganzen Weg noch einmal zu machen. Außerdem war die Situation nur ein weiterer Eignungstest, und er konnte genauso gut zugeben, dass er das erkannt hatte. Er schritt auf den Mann zu, der in der Halle hinter einer eindrucksvoll geschwungenen Rezeption saß, und sagte freundlich: „Sir, ich glaube, Sie haben etwas für mich.“
„Bist du sicher, Junge?“, fragte der grauhaarige Portier, der natürlich zur CIA gehörte und nur heute hier saß und darauf wartete, dass er ihn ansprach. Jan nickte und zückte seinen Reisepass. Das Dokument trug den Vermerk vorläufig, berechtigt nicht zum dauerhaften Aufenthalt des Inhabers in Frankreich oder seinen Territorien in Übersee. Für die Beamten der jungen fünften Republik galt er als durch den Krieg in Frankreich gestrandeter Ausländer, dem man jede Hilfe zur Rückkehr in sein Heimatland anbieten musste. Frankreich propagierte eine strenge Repatriierungspolitik; sie waren nur zu froh gewesen, ihn so billig an die Amerikaner loszuwerden.
„In Ordnung, John“, sagte der Portier, nachdem er das Visum, die Impfbescheinigung und zu guter Letzt auch noch das Arbeitszeugnis der US Army gelesen hatte. Die drei Sprachen beeindruckten auch ihn. „Scheint in Ordnung zu sein. Okay! John, du bist hier aufgrund des Alien Registration Act von 1940, der Einwanderung und Naturalisierung regelt. Das ...“, der CIA-Mann tippte auf eine schlichte hellgrüne Karte aus etwas steiferem Karton, „… heißt offiziell Alien Registration Receipt Card. Du bekommst den Status I-100a für Ausländer, die eine gewisse Zeit in den Staaten arbeiten. Später kann das auf I-151 für ständig hier lebende Ausländer erhöht werden.“
Jan ergänzte für sich: Wenn ihr herausgefunden habt, ob ich für euch tatsächlich so nützlich bin, wie ihr jetzt hofft.
„Die dritte Stufe wäre dann in etwa zehn Jahren die Einbürgerung.“ Eine Zwanzigdollarnote wanderte über die Rezeption zu ihm. „Spesen, für heute Abend. Gib nicht gleich alles aus. Morgen früh neun Uhr dreißig meldest du dich bei dieser Adresse.“
Er erhielt eine Visitenkarte: Armed Forces Recruiting Station. Deren Büros lagen am Times Square. Jan nahm die Karte, etwas befremdet.
„Nicht, was du erwartet hast? Keine Sorge, da bleibst du nicht hängen. Ist nur Camouflage.“
Fünf Minuten später hielt er völlig unzeremoniell seine Green Card in den Händen, die offizielle Arbeitserlaubnis für die USA, und damit war er für heute entlassen.
Kapitel 2
Central Park, New York; Mittwoch, 20. Juli 1949; Aussichtsbalkon des Belvedere Castle am Turtle Pond, circa 19 Uhr.
Allmählich färbte sich der Himmel doch abendlich. Jan fühlte sich nach beinahe fünfzehn Stunden ununterbrochenen Tageslichts ein bisschen … merkwürdig. Nicht müde, eher im Gegenteil, aber es wurde ihm allmählich alles etwas zu viel. Auch wenn er nie schlief, zog er sich doch nach Sonnenuntergang gern zurück, las ein Buch, hörte Radio oder lief eine Weile durch die Nacht. Das war in Caen natürlich ziemlich einfach möglich gewesen, dort kannte er jeden, und jeder kannte ihn. Aber hier in New York, das merkte er jetzt schon, waren ihm einfach zu viele Menschen unterwegs, auch im Central Park. Im Augenblick allerdings nicht gerade auf dem Aussichtsbalkon dieses putzigen neugotischen Schlösschens, das hatte er für sich allein.
Sein Blick schweifte über die Wasseroberfläche zu der Busch- und Baumreihe am jenseitigen Ufer. Die Aussicht vom Belvedere war schön, aber ein bisschen vernachlässigt, auf dem kleinen See trieben Algenteppiche, und der Uferstreifen wirkte wie Gemüse. Zu wenige Gärtner, zweifellos eine Kriegsfolge. Man ahnte gerade noch das Dach des Metropolitan Museum of Art hinter dem dichten Grüngürtel. Aber wenigstens spendete der See an diesem immer noch brutwarmen Abend etwas Kühle. Er konnte sich das wenigstens einbilden. Jan bewegte seine Zehen in den Schnürschuhen.