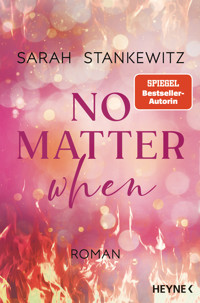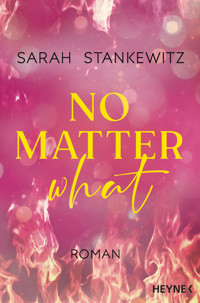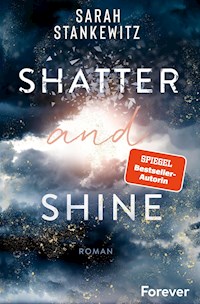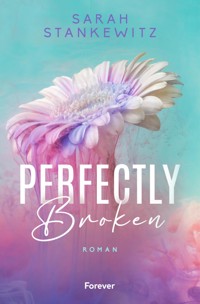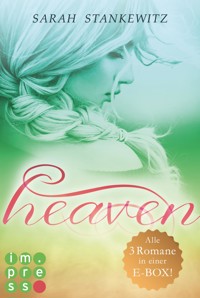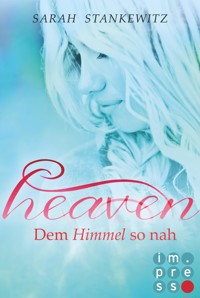Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Faith-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn die Angst dir die Sprache verschlägt, musst du dein Herz singen lassen Isaacs Band erobert die Charts und die Frauen liegen ihm zu Füßen. Doch als sich die Presse auf seine Schwester stürzt und sie zur Zielscheibe wird, zerbricht etwas in ihm. Er verliert seine Leidenschaft, seine Kreativität und allen voran seine Stimme. Die Band steckt deshalb tief in der Krise, und alle sind froh, als eine außergewöhnlich talentierte Straßenmusikerin zu ihnen ins Studio kommt – alle, bis auf Isaac. Er fühlt sich ersetzt und will Hope um jeden Preis wieder loswerden. Auch Hope ist der Rockstar zuwider, aber die Chance auf ein besseres Leben für sich und ihren Bruder will sie sich nicht nehmen lassen. Also willigt sie ein, einen Sommer bei der Band zu bleiben – einen Sommer, der alles verändert … Die berührende Faith-Reihe 1) Rise and Fall: Wenn du den Boden unter den Füßen verlierst, musst du nach den Sternen greifen. 2) Shatter and Shine: Wenn in einer lauten Welt plötzlich alles verstummt, kannst du nur noch auf dein Herz hören. 3) Dream and Dare: Wenn die Angst dir die Sprache verschlägt, musst du dein Herz singen lassen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dream and Dare
Die Autorin
SARAH STANKEWITZ, 1994 in Wittstock geboren, lebt als Autorin in Brandenburg. Sie begeistert ihre Fans mit Geschichten, die sie selbst gerne liest, voller Leidenschaft, Drama und mit einer Prise Humor. Musik, Kerzen und ein bequemer Arbeitsplatz dürfen im Hause der Autorin ebenso wenig fehlen wie eine Tasse leckerer [email protected]@sarahschreibt
Sarah Stankewitz
Dream and Dare
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin1. Auflage April 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenAutorinnenfoto: © Patrick Thomas/Klick. AugenblickE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2774-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Content Note
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Epilog
Nachwort & Danksagung
Content Note
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Content Note
Widmung
Für Nina.Weil du Isaac schon geliebt hast, als er es am meisten gebraucht hat. Danke für alles.
Content Note
Liebe Lesende,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deswegen findet ihr auf Seite 415 eine Triggerwarnung. Wir möchten, dass ihr das bestmögliche Leseerlebnis habt.
Eure Sarah Stankewitz & das Forever-Team
Prolog
Isaac
Vergangenheit
»Happy Birthday, mein Hase.« Mom setzt sich neben mich aufs Bett und legt ein riesiges Geschenk zwischen uns auf die durchgelegene Matratze. Stirnrunzelnd sehe ich es an.
»Aber ich habe doch mein Geschenk schon bekommen!« Aufregung macht sich in mir breit, denn wenn ich ehrlich bin, gefällt mir mein anderes Geschenk nicht sonderlich gut. Dad hat einem seiner Saufkumpel, mit denen er sich jeden Abend in der Kneipe um die Ecke trifft, eine gebrauchte Spielkonsole abgekauft. Das Teil ist schon so alt, dass auf dem Controller zwei Tasten fehlen. Dad weiß eigentlich, dass ich nicht gerne zocke, aber das wäre ihm als Freizeitbeschäftigung lieber als das, was ich sonst den ganzen Tag tue. Was mir am meisten Spaß macht, hasst er aus irgendwelchen Gründen ganz besonders.
»Du bist heute zehn geworden, Isaac. Da kannst du ruhig zwei Geschenke bekommen.« Mom wuschelt mir durch das braune Haar und deutet anschließend auf das Paket, das immer noch zwischen uns liegt und endlich von mir ausgepackt werden will. »Jetzt mach es schon auf. Es wird dir gefallen.«
Daran zweifle ich nicht. Mom kennt mich. Sie weiß, was ich mag und worin ich gut bin.
Ich beiße mir auf die Unterlippe und ziehe das Geschenk auf meinen Schoß. Ich reiße das hellblaue Papier ab, knülle es zu einer riesigen Kugel zusammen und werfe sie durch den Raum. Der Karton, der darunter zum Vorschein kommt, sieht teuer aus. Definitiv zu teuer, schließlich weiß ich, dass meine Eltern immer knapp bei Kasse sind.
»Jetzt spann mich nicht so lange auf die Folter!« Moms Augen strahlen, als wäre sie diejenige, die heute beschenkt wird. Sogar doppelt. Mit einem Grinsen hebe ich den Deckel an. Sofort klappt mir die Kinnlade herunter, und ich starre auf den Inhalt des Kartons. Oh mein Gott!
»Mom!« Ich sehe zwischen ihr und der Gitarre auf meinem Schoß hin und her. Träume ich nur? Schon seit zwei Jahren wünsche ich mir eine Gitarre, aber bis jetzt hat Dad immer dafür gesorgt, dass ich keine bekomme.
»Dad hat doch gesagt …«
Mom legt mir einen Finger vor die Lippen und bringt mich damit zum Schweigen.
»Dad ist nicht hier, oder? Das hier muss unser kleines Geheimnis bleiben, hörst du?« In ihren Augen glitzert es, als würde sie gleich weinen. Vor Freude? Oder aus Angst vor Dad, weil er ausrastet, wenn er von der Gitarre erfährt? Ich weiß nicht, warum er sich so sehr dagegen sträubt, dass ich Musik mache, aber sobald ich anfange, von meinen Songs zu sprechen, schnalzt er nur mit der Zunge und sagt, dass ich mir diesen Unsinn aus dem Kopf schlagen soll. Aber so richtig funktioniert hat es nie. Seit ich zum ersten Mal ein Instrument in der Hand gehalten habe, bin ich wie verzaubert.
»Deine Musiklehrerin hat mir beim Elternsprechtag gesagt, wie begabt du bist, Isaac. Dass du ein Ass im Notenlesen bist und ein Verständnis für Töne hast, das sonst kein Kind in deiner Klasse besitzt.«
Ich versuche, mein Grinsen zu verbergen, nehme die hellbraune Gitarre aus dem Karton und drücke das Instrument fest an mich. In den letzten Jahren habe ich mich immer, wenn Dad nicht da war, mit Musik beschäftigt. Wenn ich nicht gerade an eigenen Songtexten geschrieben habe, sprudelten die unterschiedlichsten Melodien aus mir heraus. Aber ein eigenes Instrument hatte ich nie.
»Danke, Mom!« Ich schmiege mich an sie und schließe glücklich die Augen.
»Versprichst du mir, dass du nur übst, wenn dein Vater außer Haus ist?«
Ich nicke und blicke zu ihr auf. »Indianerehrenwort!« Ich halte Mom meinen kleinen Finger hin, woraufhin sie ihren mit meinem kreuzt. Noch immer glänzen ihre blauen Augen, unter denen sie tiefe Ringe hat. Mom schläft nicht viel. Ich höre oft, wie sie nachts in die Küche tapst und weint, während Dad im Schlafzimmer seinen Rausch ausschläft. Dass sie nicht glücklich ist, weiß ich. Und ich fühle mich schlecht, weil ich es an manchen Tagen nicht schaffe, sie zum Lächeln zu bringen. Vor allem nicht, wenn er im Haus ist.
»Und jetzt spiel etwas für mich, okay? Darauf warte ich schon so lange!«
Ich werde von einer Welle des Glücks erfasst, als ich die Gitarre auf meinen Schoß drücke und meinen liebsten Akkord greife. G-Dur. Meine Musiklehrerin Miss Sullivan hat mir erklärt, dass Durakkorde oft hell und klar klingen. Vielleicht mag ich sie deshalb lieber als die eher dunklen Mollakkorde. Hier zu Hause ist die Stimmung viel zu oft düster. Außer wenn Mom und ich allein sind, so wie jetzt.
Ich schlage die Saiten zum ersten Mal an und höre sofort, dass die Gitarre verstimmt ist, aber das ist mir egal. Auf keinen Fall kann ich noch länger mit dem Spielen warten.
Meine Finger zittern, während ich das Lied »Lemon Tree« von Fools Garden anspiele. Es ist das erste Lied, das mir meine Musiklehrerin beigebracht hat, und es ist relativ einfach. Etwas zu einfach für mich, wenn ich ehrlich bin, aber meine Mutter liebt diesen Song.
Ihr warmer Blick ruht auf mir, und aus dem Augenwinkel kann ich sehen, dass sie sich die Tränen von den Wangen wischt. Mit jedem Akkord und jedem Anschlag der Saiten fällt mir das Spielen leichter, und das Grinsen auf meinem Gesicht wird immer breiter. Ich bin mir sicher, dass ich nie wieder etwas anderes in meinem Leben machen will als das hier. Auf meinem Bett sitzen und Musik machen. Nichts anderes macht mich so froh, so glücklich.
Gerade als ich die letzten Töne spiele, poltert es im Flur, direkt vor meiner Zimmertür. Sofort erstarre ich zu Eis.
»Dein Vater ist zurück!« Mom springt wie von einer Wespe gestochen vom Bett auf. »Versteck die Gitarre, Isaac!« Sie spricht leise, damit er uns im Flur nicht hören kann, aber ich bin mir sicher, dass er sowieso zu betrunken ist. Meistens kommt er erst nach Hause, wenn er kaum noch geradeaus gehen kann. Heute ist das ziemlich früh der Fall. Viel zu früh! Ich suche verzweifelt nach einem Versteck für meine Gitarre. Da sie nicht unter mein Bett passt, fällt mir nur mein Kleiderschrank ein. Ich stürze zu ihm hinüber, und gerade, als ich ihn öffnen will, poltert Dad ins Zimmer. Er schwankt. Nur mit Mühe kann er sich an der Tür festhalten. Als er die Gitarre in meiner Hand erblickt, entsteht eine Zornesfalte auf seiner Stirn. Im Grunde ist sie immer da, aber jetzt wird sie noch tiefer und Angst einflößender. Er ist nicht nur wütend, er ist rasend.
»Was soll das?«, blafft er. »Wieso hat der Junge eine verdammte Gitarre, Joyce?«
Mom steht immer noch vor meinem Bett und bekommt kein Wort raus, die blanke Angst ist ihr ins Gesicht geschrieben. Dad stapft auf mich zu und packt mich grob am Arm. Mit der anderen Hand entreißt er mir das Instrument, woraufhin ich mich umgehend leer fühle. Ich hatte nur einen Song mit ihr. Einen Song, mehr nicht. Meine Augen füllen sich mit Tränen.
»Woher hast du die, Isaac? Hat dir deine beschissene Lehrerin die gegeben?« In seinen glasigen Augen brodelt der Hass. Weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, schürze ich nur die Lippen. Ich habe Angst vor ihm. Das habe ich schon lange. Aber gerade steht für mich alles auf dem Spiel.
»Antworte mir!«, brüllt er und schüttelt mich so fest, dass sich eine Träne aus meinen Wimpern löst.
»Hör auf, Michael!« Mom tritt hinter mich, legt ihre Hände schützend auf meine Schultern und zieht mich an sich. »Es ist nicht seine Schuld! Ich habe sie ihm gekauft!«
Nein, nein, nein. Ich weiß, was jetzt passiert. Weil ich diesen Ausdruck in Dads Augen kenne.
»Du kleine Hure!«, knurrt er wie ein wild gewordenes Tier. Noch immer hält er meine neue Gitarre in der Hand. So fest, dass die Knöchel seiner schmutzigen Finger weiß hervortreten. »Wir hatten eine Abmachung. Unser Sohn wird kein verweichlichtes Weib, das Musik macht, nur weil seine inkompetente Lehrerin sagt, dass er gut darin ist!« Mein Vater zieht mich harsch von Mom weg und schiebt mich zur Seite. Er will freie Bahn haben.
»Dad, bitte«, wispere ich.
»Halt die Klappe!« Er sieht mich nicht einmal an. »Musik ist etwas für Weicheier. Für Schwächlinge. Unser Sohn wird nicht auf diesem Drecksteil herumklimpern und über seine Gefühle singen, hast du das verstanden, Joyce?« Ich sehe zu Mom, die genau wie ich am ganzen Leib zittert.
»Ob du das verstanden hast?« Mein Vater stürzt sich auf meine Mutter, und sie stolpert zurück. »Geh aus dem Zimmer, Isaac!«, flüstert sie. Aber ich kann nicht. Ich kann mich nicht vom Fleck rühren, und ich will es auch nicht, ich will sie nicht mit ihm allein lassen.
Mein Vater holt mit der nagelneuen Gitarre aus und donnert sie so fest gegen die Tür meines Kleiderschranks, dass der Hals bricht. Der Krach, der dabei entsteht, lässt mich zusammenfahren. Ich schlinge die Arme um meinen Oberkörper, schließe die Augen und versuche, einen Plan zu machen. Ich muss seine Wut auf mich umlenken, damit er Mom in Ruhe lässt. Immerhin ist das hier meine Schuld. Nur weil ich mir eine Gitarre gewünscht und nie aufgehört habe, darüber zu reden, hat Mom sich Dad widersetzt. Er tut ihr meinetwegen weh.
Als ich höre, wie er ihr eine Ohrfeige verpasst, reiße ich die Augen auf und fasse einen Entschluss.
»Hör auf!«, schreie ich und will zwischen die beiden stürmen, damit er sie nicht mehr schlägt. Mein Vater fährt herum, und Sekunden später trifft mich etwas Scharfes unter dem rechten Ohr. Mir entweicht ein Schmerzenslaut. Die Gitarre ist am Hals gesplittert und hat meine Haut aufgekratzt.
»Michael!« Meine Mutter heult den Namen meines Vaters. »Du hast ihn verletzt!« Meine Finger tasten nach der schmerzenden Stelle, und als ich sie wieder herunternehme, sehe ich, dass ich blute. Aber das ist mir egal, solange er Mom in Ruhe lässt!
Mein Vater baut sich wie ein gigantischer Schatten vor mir auf. In seiner Hand die kaputte Gitarre und meine zerstörten Träume, während er die andere zur Faust ballt. Ich halte seinem Blick stand, auch wenn es mich alles kostet.
»Willst du mir etwas sagen, Sohn?« Das letzte Wort spuckt er nahezu aus. »Oder soll ich lieber Tochter zu dir sagen, hm?« Für ihn ist Musik etwas, das nur Frauen lieben dürfen. Ich öffne den Mund, will ihm meine Meinung sagen, weil ich zu oft geschwiegen habe. Aber ich bekomme keinen Ton heraus. Alles, was meinen Mund verlässt, ist mein rasselnder Atem. Im Hintergrund höre ich Moms Schluchzen, aber ich kann sie nicht ansehen. Ich kann gar nichts tun, weil mein Vater mir solche Angst macht. Die Worte stecken in meiner Kehle fest wie ein Tennisball, und ein Gefühl der Ohnmacht überkommt mich.
»Siehst du?« Er lacht überheblich, und das Lallen in seiner Stimme ist nicht zu überhören. »Kriegst den Mund nicht mal auf, wenn dich dein alter Herr dazu auffordert. Wusste nicht, dass ich so einen Schlappschwanz großgezogen habe.« Er schnalzt erneut mit der Zunge und lässt das Instrument auf den Boden fallen. Anschließend packt er Mom bei der Hand. »Und wir zwei reden noch«, zischt er, zerrt sie aus meinem Zimmer und schmeißt die Tür hinter sich zu.
Ich stoße scharf die Luft aus und falle vor der Gitarre auf die Knie. Schniefend ziehe ich das Instrument auf meinen Schoß. Blut klebt an einem der Holzsplitter.
Mein Blut.
Und während ich im Hintergrund den Streit meiner Eltern höre, presse ich die Gitarre an mein Herz und weine so sehr, wie niemand an seinem Geburtstag weinen sollte.
Kapitel 1
Isaac
Früher fand ich die Vorstellung, in einer ausgebuchten Halle zu spielen, immer überwältigend. Vor allem, wenn über zwanzigtausend Menschen in diese Halle passen und nur darauf warten, dass du zurück auf die Bühne kommst. Die Wahrheit ist: Im Grunde genommen fühlt es sich jedes Mal gleich an, wenn wir auftreten. Der Adrenalinspiegel steigt nicht exponentiell mit der Größe der Crowd an. Zumindest nicht bei mir.
Nach dem fünften Song habe ich mein Shirt ausgezogen und in die Menge geschmissen, wie jedes Mal, wenn wir auftreten. Das Kreischen der jungen Frau, die es aufgefangen hat, übertönte selbst den Sound meiner E-Gitarre. Entweder wird sie das Teil für verdammt viel Kohle auf eBay verscherbeln oder jeden Abend damit ins Bett gehen und daran riechen. Ihrer Euphorie nach zu urteilen eher Letzteres. Sie stand in der ersten Reihe und hat jeden einzelnen Song aus voller Kehle mitgesungen, als wäre sie bei einer Audition und müsste ihr Können unter Beweis stellen. Sie ist süß und entspricht mit ihren blonden Locken, den vollen Wangen und den sinnlichen Lippen vollkommen meinem Beuteschema. Vielleicht habe ich Glück und sehe sie nach dem Konzert auf der Aftershowparty. Mein letzter One-Night-Stand ist schon ziemlich lange her, weil die vergangenen Wochen ein einziges Gehetze waren. Wir sind gerade von unserer zwanzigtägigen Englandtour nach Hause gekommen, und das ist der vorletzte Gig vor unserer Pause. Und wie könnte man eine epische Reise besser beenden als in der Stadt, in der alles angefangen hat? London hat uns groß gemacht.
Unser Bandmanager Robert tritt aus dem Backstagebereich auf uns zu und reicht jedem ein schwarzes Handtuch. Dankbar nehme ich es entgegen, wische mir damit den Schweiß aus dem Nacken und werfe es achtlos auf den Boden. Anschließend schnappe ich mir eine Bierflasche aus dem Kasten neben der Treppe, öffne sie mit den Zähnen und spucke den Kronkorken zur Seite. Der herbe Geschmack von Hopfen verteilt sich auf meiner Zunge. Normalerweise trinke ich nicht vor oder während eines Gigs, aber die Show ist so gut wie vorbei, und ich bin in Feierstimmung. Ein Bier wird schon nicht schaden.
»Der Gig war unglaublich, Jungs. Aber jetzt solltet ihr wirklich noch mal hoch für eine zweite Zugabe. Die Leute weigern sich partout, den Saal zu verlassen, und die Veranstalter scharren schon mit den Hufen. Die Fans werden erst Ruhe geben, wenn ihr ihren Lieblingssong gespielt habt.« Die braunen Augen unseres Managers strahlen hinter seinen Brillengläsern mit den Scheinwerfern um die Wette. Robert Hall sieht in seinem geschniegelten Anzug auf den ersten Blick aus wie ein Büroheini, der anderen Leuten Kredite und unnötige Fonds aufs Auge drückt, aber in ihm schlägt das Herz eines Rockstars. Wie in jedem von uns. Durch unsere Venen fließt Musik, seit wir denken können, und zusammen bringen wir seit Jahren die Bühnen der Welt zum Brennen. Heute ist es besonders krass. Wie ein Erdbeben, das von Sekunde zu Sekunde stärker wird.
»Wir gehen zuerst raus«, antwortet Connor unserem Manager. Er ist nicht nur der beste Drummer, den man sich vorstellen kann – und damit meine ich, dass er sogar mit Travis fucking Barker mithalten kann –, er ist auch mein bester Kumpel seit der Kindheit. Seine schwarzen Haare hängen ihm schweißnass in die Stirn, und er dreht den Drumstick in seiner Hand permanent hin und her. Man sieht, dass es ihn in den Fingern juckt und er dringend ein weiteres Mal raus will.
Ich verstehe ihn. Da oben zählt nur die Musik, sonst nichts. Die Bühnenshow ist zwar auch ganz gut, aber sie ist mehr ein nettes Accessoire. In unserem Alltag müssen wir uns viel zu oft mit nervigen Dingen beschäftigen, für die wir nie unterschrieben haben. Interviewtermine, Benefizgalas, irgendwelche Revealpartys von anderen Künstlern, die wir nicht mal richtig kennen. Aber auf der Bühne können wir einfach nur Musiker sein, mit Herz und Seele. Klingt kitschig und ist auch kitschig. Mein Vater würde ausflippen, wenn er meine Gedanken lesen könnte.
»Dann raus mit euch!«, scheucht Robert die anderen auf die Bühne. Louis, unser Bassist, salutiert wie ein abgerichteter Soldat und schenkt mir anschließend ein bekifftes Lachen. Während sich andere erst nach einer erfolgreichen Show die Birne zuknallen, steht er darauf, schon vorher Gas zu geben. Er behauptet, auf Pot besser spielen zu können, und weil er bis jetzt noch nie Probleme gemacht hat, lassen wir ihn gewähren.
Ich gebe erst Connor, dann Louis einen Fistbump, bevor ich David, unserem Keyboarder, auf die Schulter klopfe. Er feiert die ganze Aufmerksamkeit am allerwenigsten. Das Rampenlicht hasst er, dafür liebt er die Musik umso mehr. David ist introvertierter als eine scheue Maus, und wir müssen ständig darauf achten, dass es ihm nicht zu viel wird. Manchmal lassen wir uns eine Ausrede einfallen, wieso er zu Terminen nicht erscheint, damit er sich und seine sozialen Akkus aufladen kann.
Meine Bandkollegen rennen die eiserne Treppe hoch, die zur Bühne des frisch gebauten Starfall-Konzertsaals führt, und sofort rasten die Leute vollkommen aus. Keine Ahnung, ob ich es mir nur einbilde, aber der Boden unter meinen schwarzen Boots scheint wirklich zu vibrieren. Die Crowd ist hungrig, und fuck, ich bin es auch.
Wir werden einen letzten Song spielen: unseren ersten Hit »November Nights«, mit dem wir unseren großen Durchbruch hatten. Vor vier Jahren hatten wir gerade eintausend monatliche Hörer auf Spotify und sind nur in kleineren Clubs und Bars in und um London aufgetreten. Inzwischen folgen uns auf Spotify über drei Millionen Menschen, und wir dürfen Hallen wie diese einweihen. Das Starfall wurde erst vor zwei Wochen offiziell fertiggestellt, und wir sind die erste Band, die diese Bühne betreten durfte. Und trotzdem bleibt die Überwältigung, die ich darüber spüren sollte, aus. Scheiße, ich sollte wirklich dankbarer sein, oder? Aber Dankbarkeit auf Knopfdruck liegt mir nicht. Zu Beginn unserer Karriere war ich dazu noch in der Lage, aber inzwischen bin ich abgestumpft.
Ich checke meine Ohrstöpsel und schließe kurz die Augen. Dort oben, hinter der Leinwand mit unserem Logo, wird die Meute immer lauter und ungeduldiger. Ich liebe es, sie ein bisschen zappeln zu lassen.
Connor schenkt mir am Schlagzeug einen Trommelwirbel, woraufhin meine Mundwinkel leicht zucken. Der Scheißkerl weiß, wie sehr ich einen großen Auftritt liebe. Nachdem ich einen letzten Schluck von meinem Bier genommen habe, renne ich ebenfalls die Treppe hinauf und betrete die Bühne. Nebel wabert über den Boden und hüllt mich innerhalb von Sekunden komplett ein. Mein Auftauchen lässt die Menge noch mehr ausflippen, und als ich ans Mikrofon trete, höre ich, wie die Leute meinen Namen rufen.
Isaac. Isaac. Isaac.
Es klingt wie eine gesprungene Schallplatte. Sollte ich jemals einen so krassen Absturz haben, dass ich meinen eigenen Namen nicht mehr kenne, gibt es da draußen Tausende Menschen, die mich an ihn erinnern werden. Es hat definitiv seine Vorteile, berühmt zu sein.
»Hey, London!«, raune ich ins Mikrofon. »Habt ihr immer noch nicht genug?«
Als Antwort erhalte ich tosenden Applaus. Im selben Moment fangen meine Jungs an, das Intro von »November Nights« zu spielen, woraufhin die Stimmung endgültig überkocht.
»Wir haben noch einen letzten Song für euch dabei!« Mein Blick zieht über das Publikum. Die Scheinwerfer im Saal verwandeln die Meute in einen Pulk aus blauen Männchen, die alle zu uns aufblicken. Zu mir aufblicken. Auch wenn ich mich nie als Frontmann von Crashing December gesehen habe, bin ich es im Laufe der Jahre geworden. Wir alle sind gleich wichtig für unsere Musik. Jeder von uns ist ein Puzzleteil, das die anderen perfekt ergänzt. Aber für die Leute da unten ist es anders. Unsere Fans lieben Con, David und Louis, aber mich vergöttern sie. Ihre Worte, nicht meine. Auch nach all den Jahren weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Meistens genieße ich diese Aufmerksamkeit, aber manchmal wächst sie mir über den Kopf.
Ich schnappe mir meine Gitarre vom Boden, lege den Gurt um und schließe die Augen. Ab jetzt blende ich alles um mich herum aus. Die Leute sind immer noch da unten, aber für mich zählt während eines Songs nur das, was hier oben auf der Bühne abgeht. Connor hämmert wie ein Irrer auf sein Schlagzeug ein, und die anderen begleiten ihn in perfekter Harmonie. Shit, sie sind gut. Richtig gut. Jetzt liegt es an mir, mit ihnen mitzuhalten. Jeder Einzelne von uns hat es drauf, aber erst zusammen werden wir phänomenal.
Meine Augen halte ich geschlossen, während ich näher ans Mikro trete, den ersten Akkord auf meiner Gitarre greife und auf meinen Einsatz warte. Dann gerate ich in einen Rausch. Meine Finger tanzen über die Saiten, während ich die erste Zeile unseres Nummer-eins-Hits ins Mikrofon schmettere. Der Saal bebt, während ich in jede Note mein ganzes Gefühl lege. Diese Lieder, diese Musik, all das ist inzwischen Teil meiner DNA.
Der Schweiß rinnt mir über den nackten Oberkörper, während ich nach dem zweiten Chorus ein Gitarrensolo hinlege. Meine Finger werden eins mit der Gitarre, meine Sinne schärfen sich. Ich rieche eine Mischung aus Schweiß, Aftershave, Bier und Gummi. Ich fühle den Boden unter meinen Füßen und das kühle Material meiner Gibson. Ich schmecke das Bier auf meiner Zunge und sehe zu meinen Jungs, die ebenfalls voll in ihrem Element sind.
Connor wirft mir ein Grinsen zu, während David am Keyboard alles gibt und Louis mit dem Bass alles zusammenführt. Ich liebe diese Kerle, mehr, als ich jemals zugeben würde. Ich drehe der Crowd meinen Rücken zu, lasse die Gitarre am Gurt hängen und beginne, über dem Kopf in die Hände zu klatschen. Sekunden später steigt das Publikum mit ein.
Der Song wird ruhiger, mein Herz poltert schneller denn je.
»Singt noch ein letztes Mal den Refrain für uns, London!« Mit dieser Aufforderung drehe ich mich um und lasse das Bild auf mich wirken. Zwanzigtausend Menschen stehen zu unseren Füßen, klatschen über den Köpfen in die Hände und singen Zeilen, die ich vor Jahren mitten in der Nacht in mein Notizbuch geschrieben habe. In »November Nights« geht es um einen Kerl, der in einer kalten Londoner Novembernacht eine einsame Frau auf der Straße trifft und ihr mit seiner Musik das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Aber in Wahrheit ist nicht sie einsam, sondern er. Zumindest ist es das, was zwischen den Zeilen steht. Leider erkennen nur die wenigsten die Message dahinter. Der Song neigt sich dem Ende zu, und der Adrenalinspiegel in meinem Körper sinkt umgehend in den Keller. Zwanzig Minuten auf der Bühne sind anstrengender als eine Stunde im Gym, das steht fest.
Der letzte Ton erklingt, und unsere Fans rasten ein weiteres Mal für uns aus, bevor das Licht der Scheinwerfer erlischt und die Bühne in Dunkelheit hüllt. Ich lasse das Mikrofon auf den Boden fallen, lege die Gitarre ab und werfe einen finalen Blick in die dunkle Menge.
Zwanzigtausend Menschen, die uns lieben.
Die mich lieben.
Zwanzigtausend Menschen, die feiern, was wir tun.
Die feiern, was ich tue.
Und in mir drängt sich eine Frage an die Oberfläche, die meine Euphorie im Keim erstickt und den Zauber der letzten Stunden mit sich nimmt. Wieso fühle ich mich trotz allem so verflucht leer?
Kapitel 2
Hope
Es gibt Menschen, für die läuft Musik immer nur im Hintergrund ab. Leute, die tatsächlich auf eine Party gehen, um sich mit anderen zu unterhalten, und für die die Musik nur zweitrangig ist. Die das Radio auf dem Weg in den Strandurlaub in dem rostigen Familienwagen leiser stellen, damit sie sich besser verstehen können.
Ich bin das genaue Gegenteil davon. Wenn ich auf eine Party gehe, dann nur, weil auf Partys normalerweise Musik spielt. Wenn ich einen guten Song im Radio höre, kann ich nicht anders, als ihn laut zu stellen und aus voller Kehle mitzusingen.
Musik stand für mich schon immer im Vordergrund, egal, wo ich bin. Und der Grund ist so simpel und tragisch zugleich: weil mir die Musik das Leben gerettet hat. Weil meine Mutter die Leidenschaft zur Musik in mein Leben gebracht hat, bevor sie mir auf brutalste Weise entrissen wurde. Jetzt ist die Musik alles, was mir von ihr geblieben ist, zusammen mit verblassenden Kindheitserinnerungen. Für mich war schon seit ihrem Tod vor sechzehn Jahren klar, dass ich eines Tages mit meiner Gitarre und meiner Stimme Geld verdienen möchte, so wie Mom es getan hat.
Was mir nicht klar war: wie schwer es ist, gesehen zu werden. Unter Tausenden Künstlern geht man so leicht unter wie eine Münze im berühmten Trevi-Brunnen, den ich nur von Instagram kenne. Aber auch wenn ich kein Fan davon bin, an falschen Idealen und Zielen festzuhalten, werde ich die Musik niemals aufgeben. Dafür bedeutet sie mir zu viel. Weil Mom und Musik für immer miteinander verflochten sein werden.
Aus diesem Grund – und weil ich dringend Geld brauche, um den Kühlschrank zu füllen – will ich heute Abend zum ersten Mal vor der frisch eingeweihten Starfall-Halle spielen. Normalerweise trete ich immer im Hyde Park oder auf der Brompton Road auf, aber heute ist es Zeit für einen Tapetenwechsel. Außerdem habe ich mir die Location nicht rein zufällig ausgesucht. In dem neuen Konzertsaal spielt heute die wohl angesagteste Band unserer Zeit: Crashing December.
Das Konzert geht bald los, und vor der Halle hat sich bereits eine gigantische Fan-Schlange gebildet, die bis in die Innenstadt reicht. Manche Mädels saßen sicher schon heute Morgen im Regen vor dem Eingang, damit sie auf jeden Fall in die erste Reihe kommen und Isaac Walker aus der Nähe anschmachten können. Wir haben Anfang Juli, und der Wetterbericht sagt einen extrem regnerischen Sommer voraus, aber das hält die Groupies scheinbar nicht vom Konzert-Campen ab. Verrückt, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Mit der Band, die heute spielt, kann ich nicht sonderlich viel anfangen. Ich weiß, dass die Jungs gut in ihrem Job sind, aber irgendwie werde ich mit ihrer Musik nicht so richtig warm. Sie ist rockig, tiefgründig und müsste mein Herz eigentlich zum Donnern bringen, aber irgendetwas fehlt mir. Die Stimme des Sängers ist unverkennbar und technisch erstklassig, aber sie ist nicht echt. Zumindest nicht in meinen Ohren. Aber das behalte ich hier lieber für mich, wenn ich nicht will, dass mich die Leute gleich mit fauligen Tomaten beschmeißen.
Ganz im Gegensatz zu den Tausenden Menschen, die auf den Einlass in die Halle warten und sicher verdammt viel Geld für ein Ticket hingeblättert haben, bin ich also kein Fan dieser Band. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihren Ruhm nicht für mich nutzen kann. Wenn ich Pech habe, ruft jemand die Cops, weil ich keine Genehmigung habe, hier zu spielen, aber wenn nicht, könnte ich das Geld für einen kompletten Wocheneinkauf verdienen.
Ich breite meine Decke auf dem feuchten Boden aus, lege meinen schwarzen Gitarrenkoffer ab und klopfe mit der flachen Hand auf das nun geschützte Fleckchen Erde. Pumpkin gibt ein aufgeregtes Bellen von sich und nimmt auf der karierten Decke Platz. Der Schäferhundmischling gehört meinem engen Freund William, und ich passe hin und wieder auf die Fellnase auf, wenn er mich darum bittet. Irgendwie ist es inzwischen zu einer Art Tradition geworden, dass mich Pumpkin zu meinen Straßengigs begleitet. Während ich singe, legt er sich meistens einfach neben mich und schläft, und auch jetzt fallen ihm die Augen innerhalb von Sekunden zu. Als würden ihn diese Minuten genauso erden wie mich. Wenn es so etwas wie eine Seelenverbindung zwischen Mensch und Tier gibt, dann habe ich sie mit diesem wundervollen Wesen gefunden. Es gibt keinen Hund, der treuer und liebesbedürftiger ist als Pumpkin. Außerdem bin ich mir sicher, dass einige Leute nur Geld in meinen Koffer werfen, weil sie ihn so süß finden. Aber das ist okay für mich. Den Hundebonus staube ich gern ab, solange es Pumpkin dabei gut geht. Und da er während meiner Straßenauftritte Leckerchen und Streicheleinheiten bekommt, beschwert er sich nicht.
Nachdem ich meine Gitarre aus dem Koffer geholt habe, baue ich den Rest meines kleinen Sets auf. Als Letztes stelle ich mein Stativ auf und klemme mein Handy in die entsprechende Halterung. Seit einiger Zeit übertrage ich meine Auftritte immer live auf Instagram, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Mir folgen zwar erst fünfhundert Menschen, aber es ist mir ohnehin wichtiger, die richtigen Leute zu erreichen, als dass mir irgendwelche Profile aus den falschen Gründen folgen. Ich will mit meiner Musik bewegen, will Menschen zum Tanzen bringen und mich gleichzeitig ein bisschen selbst heilen.
Sobald das Smartphone steckt, öffne ich meinen Instagramkanal und bereite alles vor. Anschließend stimme ich meine Gitarre und spiele mich ein paar Sekunden lang warm, bevor ich die Liveübertragung starte. Sobald sich die Verbindung aufgebaut hat, grinse ich breit in meine Frontkamera und schlüpfe in die Rolle der quirligen und leicht rebellischen Hope von dem Profil @singwithhope.
»Heeeeey, Hopies! Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein bisschen Disneyzauber.« Mit diesem Intro starten fast all meine Videos. Seit ich denken kann, covere ich meine liebsten Disneysongs und kreiere dabei meinen ganz eigenen Stil. Schon als kleines Mädchen war ich von Disneyfilmen nahezu besessen, und diese Obsession hat sich bis heute wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen.
»Ich spiele heute zum ersten Mal vor der neuen Starfall-Konzerthalle. Pumpkin ist natürlich auch am Start.« Wie auf Knopfdruck gibt der Mischling mit dem braunschwarzen Fell ein Bellen von sich und schleckt mir über die Hand. Ich greife in die Tasche meiner Jacke und fische zwei Brocken seiner liebsten Leberwurst-Leckerchen heraus. Sobald er sie verputzt hat, legt er seinen Kopf schnaufend am Boden ab und schläft weiter. Fünf Leute haben sich inzwischen dazugeschaltet, und auch wenn ich mir an einem Samstagabend mehr Zuschauer erhofft hätte, verdränge ich die Enttäuschung in die hinterste Ecke meines Kopfes.
Es ist egal, wie viele Leute zuhören, solange es die richtigen sind.
Fünf echte Fans sind wertvoller als einhundert falsche.
Moms Worte erwischen mich mit voller Wucht, und ich spüre, wie mir Tränen in die Augen steigen. Rasch wische ich mir die Augenwinkel trocken und lächle erneut in die Kamera. Ich habe kein Problem damit, meine Emotionen zu zeigen, aber ich bin schließlich nicht hier, um vor laufender Kamera zu heulen, sondern um zu singen.
»Wir fangen heute mit ›Can You Feel The Love Tonight‹ von Elton John an.« Den Song habe ich schon als kleiner Knirps geliebt, und bis heute löst er in mir dieses warme Gefühl von Liebe aus. Die meisten Songs singe ich als ruhige Akustikversion, nur manchmal werden meine Interpretationen etwas rockiger. Da die Leute um mich herum auf ein Konzert von Crashing December gehen, entscheide ich mich heute für Letzteres.
Ich schließe meine Augen, schlage die ersten Töne an und versinke in einer Welt, in der es nur mich, Pumpkin und meine Musik gibt. Der Disneyzauber breitet sich umgehend aus und umgibt mich wie eine Wolke aus Magie. Während des gesamten Songs halte ich die Augen geschlossen, weil ich mich besser auf meine Stimme konzentrieren kann, wenn ich ihr meine volle Aufmerksamkeit schenke. Ich atme tief in den Bauch, um die Töne besonders lang und stabil halten zu können, und mache meinen Gaumen ganz weich. So, wie Mom es mir beigebracht hat, als ich gerade vier Jahre alt war.
Meine Stimmbänder vibrieren, als ich den Refrain singe und gleichzeitig das Beste aus meinem mittelklassigen Instrument heraushole. Sobald der Song vorbei ist, höre ich das zögerliche Klatschen vereinzelter Leute. Ich schlage die Lider auf, werfe einen Blick in meinen offenen Gitarrenkoffer und stelle enttäuscht fest, dass er immer noch leer ist.
Ich sehe aus dem Augenwinkel, wie ein paar Leute zu tuscheln beginnen, während sie mich mustern. Und ich weiß auch genau, wieso sie mich so anstarren. Mein Kleidungsstil ist … speziell. Ich trage ein knielanges rotes Kleid, auf dem sich zwei Dobermänner mit Heiligenscheinen umarmen. Was soll ich sagen? Ich liebe Hunde und ausgefallene Kleidung, weshalb ich ständig Sachen trage, auf denen Hunde oder Hundepfoten zu sehen sind. Meine schwarze Jeansjacke habe ich offen gelassen. Meine Beine stecken in einer durchsichtigen Strumpfhose und meine Füße in abgetretenen roten Chucks, die vorne ein Loch haben, durch das ich meinen großen Zeh schieben kann. Während ich sanft über die Saiten meiner Gitarre fahre, um mich mental auf den nächsten Song vorzubereiten, fällt mir ein Typ rechts neben dem Eingang der Konzerthalle auf.
Ich weiß nicht, wieso er meine Aufmerksamkeit wie ein Magnet auf sich zieht. Vielleicht liegt es daran, dass er mich, während seines scheinbar wichtigen Telefonates, nicht aus den Augen lässt. Der Typ könnte vom Alter her mein Vater sein, trägt einen so geschniegelten Anzug, dass ich die Nase rümpfe. Man sieht, dass wir aus völlig unterschiedlichen Welten stammen. Warum glotzt der Kerl so aufdringlich? Gehört er zum Starfall-Personal und verpfeift mich gerade als illegale Straßenkünstlerin an die Cops? Doch anstatt auf mich zuzukommen und mir die Leviten zu lesen, verschwindet er im Inneren der Halle, nachdem er mir einen letzten langen Blick zugeworfen hat.
Kopfschüttelnd widme ich mich wieder meiner Gitarre und greife den ersten Akkord von »The Scientist«.
»Falsches Genre, Prinzessin«, ruft ein Mann in der Schlange und schenkt mir ein überhebliches Arschlochgrinsen. »Zum Märchenwald geht’s da lang, hier hören wir nur richtige Musik.« Er deutet zum Eingang der Halle und schiebt sich eine Kippe zwischen die Lippen.
Ich lächle ihn süß an und präsentiere ihm vor versammelter Mannschaft meinen Mittelfinger. Ein Raunen geht durch die Menge, gefolgt von dem Klatschen einer Frau weiter vorn in der Schlange. »Mach weiter, Mädchen! Deine Musik ist gut, lass dir nichts anderes einreden.« Sie löst sich aus der Schlange, öffnet ihre Handtasche und fischt ihr Portemonnaie heraus. Vor mir bleibt sie stehen und wirft zwei Scheine in meinen Koffer. Die Frau ist schon etwas älter und könnte meine Mom sein. Mit einem Knicks bedanke ich mich bei ihr. In meiner Brust breitet sich eine wohlige Wärme aus, die bis in meine Zehenspitzen zieht.
Anschließend widme ich mich wieder dem ungehobelten Kerl mit der Kippe, der seine Manieren scheinbar beim letzten Klogang mit runtergespült hat.
»Weißt du was, Arschloch?« Er verengt die Augen zu Schlitzen. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich ihm noch mal Beachtung schenke. »Das nächste Lied ist nur für dich!« Zwinkernd greife ich den ersten Akkord von »Do You Want To Build A Snowman« und fange lächelnd an zu singen. Wirklich jeder kann ein bisschen Disneyzauber vertragen. Und vor allem Arschlöcher wie dieses.
Das Konzert ist bereits in vollem Gange, und ich spiele trotzdem weiter meine Musik vor der Halle. Inzwischen schauen mir siebzig Leute auf Instagram live beim Singen zu. Es beflügelt mich, wenn ich all die Herzen sehe, die mir im Chat geschickt werden. Und all die Komplimente, die mir zwischen den einzelnen Songs gemacht werden.
Plötzlich fängt es wieder an zu regnen, weshalb ich schweren Herzens für heute Abend Schluss machen muss. Ich bedanke mich bei all meinen Zuschauern, schalte den Livestream aus und grinse in mich hinein, als ich sehe, dass mir zwanzig neue Leute folgen. Anschließend stopfe ich das Handy in meine Tasche, baue mein komplettes Set ab und gehe in die Knie, um Pumpkins Ohren zu streicheln.
»Wir bringen dich gleich zu Herrchen, ich zähle nur schnell mein Geld, okay?« Ich forme meine Hand zu einer Schale und sammle die Scheine und Münzen darin. Doch wenn ich dachte, dass mir dieser Auftritt den nächsten Wocheneinkauf finanzieren könnte, habe ich mich getäuscht. Die Zuhörer waren heute Abend verdammt geizig.
Neben dem Singen jobbe ich hin und wieder in Bars und Cafés, aber eine Festanstellung ist leider nicht in Sicht, weshalb ich mein Portemonnaie mit Straßenauftritten wie diesem fülle. Um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, mit dem ich für mich und meinen kleinen Bruder Noah Essen auf den Tisch bringen und unsere längst überfällige Stromrechnung bezahlen kann.
Der Stromanbieter sitzt uns schon seit Wochen im Nacken, und bis jetzt habe ich es noch geschafft, ihn zu vertrösten.
Die wenigen Scheine in meiner Hand führen mir vor Augen, wie groß die Schere zwischen Arm und Reich in dieser Stadt ist. Es gibt Kerle wie diesen seltsamen Anzugträger, und dann gibt es Leute wie mich. Während ein Teil der Londoner wie die Prinzessin auf der Erbse schläft, haben andere nicht mal ein richtiges Bett. Davon könnte ich definitiv ein Lied singen. Oder ein ganzes Album. Mehr als einmal habe ich meine Erfahrungen auf der Straße in meine Lyrics einfließen lassen, aber vorgespielt habe ich sie noch niemandem. Nicht einmal Noah, obwohl mein kleiner Bruder sonst all meine Songs kennt.
Ich lasse das Geld lose in meinen Rucksack fallen, während ich in der anderen Hand Pumpkins Leine halte. Mir entweicht ein lautes Quieken, als sich der Schäferhund mit einem lauten Bellen von mir losreißt und davonstürzt, als wäre der Teufel hinter ihm her.
»Pumpkin!« Sofort springe ich auf, um ihm zu folgen. Die Fellnase steuert den großen Zaun neben dem Eingang des gläsernen Gebäudes an, und ich bin mir sicher, dass hier gerade eine Straßenkatze langgerannt ist, so versessen, wie er einer unsichtbaren Spur am Boden folgt. Meine Lungenflügel brennen, als ich den Zaun erreiche und fluchend feststelle, dass sich der sechzig Pfund schwere Hund durch ein ziemlich kleines Loch in der Hecke neben dem Zaun gequetscht hat.
»Das ist doch jetzt nicht dein Ernst!«, schimpfe ich und beginne, nervös an meinen Nägeln zu kauen.
»Pumpkin, komm zurück!«, rufe ich, packe mit meinen Händen die Stäbe des Zauns und suche den Bereich dahinter nach Williams Hund ab. Ich rüttle an den Stäben, aber da keiner von ihnen nachgibt, bin ich am Arsch. Sollte ich den Hund verlieren, werde ich meinem Freund nie wieder unter die Augen treten können. Pumpkin ist seit Jahren sein Ein und Alles, und es ist ohnehin schon ein riesiger Vertrauensbeweis, dass er ihn in meine Obhut gibt. Weit entfernt höre ich Pumpkins tiefes Bellen, und Erleichterung durchflutet mich. Ich muss auf die andere Seite des Zauns kommen, und zwar schnell!
Über meine Schulter sehe ich zu meinen Sachen, die immer noch an Ort und Stelle liegen, aber ich muss mich schnell entscheiden. Mit der Gitarre werde ich es niemals über den Zaun schaffen. Lieber lasse ich meine Sachen zurück und bringe Pumpkin unversehrt zu William, als dass ich Pumpkin verliere und er vor ein Auto läuft. Mein Hab und Gut ist mir heilig, aber Pumpkin ist mir heiliger.
»So ein Mist!« Der Regen wird immer heftiger, weshalb ich mir die Kapuze der Jacke über den Kopf ziehe. Ich mustere den Zaun und stelle meinen Fuß auf eine Querstrebe. Ächzend hieve ich mich hoch, schwinge mein Bein über den Zaun und springe auf der anderen Seite runter. Das Kleingeld in meinem Rucksack klappert bei jedem Schritt, während ich das weitläufige Grundstück der Starfall-Halle nach dem Hund absuche.
»Mmmh, Pumpkin. Schau mal, was ich hier habe. Deine liebsten Leckerchen!« Aber er zeigt sich nicht. Das Gebäude hier hinten scheint komplett eingezäunt zu sein, er kann also nicht weit sein. Es ist inzwischen dunkel draußen, und das einzige Licht kommt von den Bewegungsmeldern, die an der Glasfassade der Halle angebracht sind. Wenn hier draußen Kameras hängen, werde ich mächtig Ärger bekommen. Mit meinem schwarzen Mantel, dem Rucksack und der Kapuze sehe ich sicher aus wie ein Schwerverbrecher.
»Pumpkin, hiiiiier!«, rufe ich und merke, wie sich wieder diese alles verzehrende Verzweiflung in mir breitmacht. Scheiße, das hat mir heute echt noch gefehlt! Als hätte es nicht gereicht, dass ich inzwischen pitschnass bin und mir dumme Sprüche von überheblichen Kerlen mit zu dicken Eiern anhören musste, nur um läppische zwanzig Pfund zu verdienen.
Ich biege um die Ecke und bleibe abrupt stehen, als ich hinter der Halle einen Bus entdecke. Es ist nicht irgendein Bus, sondern ein Tourbus. Die Tür steht offen, und ein Licht brennt. Es liegt auf der Hand, zu welcher Band dieses riesige, monströse Gefährt gehört. Ich stehe tatsächlich vor dem Tourbus von Crashing December. Wenn mich hier jemand erwischt, werde ich sicher für einen Groupie gehalten, der die Privatsphäre der Stars nicht wahren kann.
Dabei will ich doch nur Pumpkin finden! Weil ich die Fellnase immer noch nicht entdecke und der Regen langsam monsunartig wird, bleibt mir nichts anderes übrig, als um Hilfe zu bitten. Vielleicht hat ein Mitarbeiter des Teams den Hund gesehen. Entschlossen marschiere ich auf den schwarzen Bus zu, steige ein und werde sofort von diesem typischen Rockstar-Geruch empfangen: Alkohol, kalter Rauch und sicher schweineteures Parfum. Naserümpfend gehe ich tiefer in den Bus hinein und stoße ein erleichtertes Seufzen aus, als ich Pumpkins flauschigen Hundepo in dem schmalen Gang zwischen den Kojen entdecke.
»Da bist du ja!« Ich ziehe mir die Kapuze vom Kopf und gehe in die Knie, um zu sehen, was Pumpkin so in Ekstase versetzt, denn sein Schwanz gleitet freudig von links nach rechts. Als er mich aus seinen treuen braunen Augen ansieht, entdecke ich eine Tüte Kartoffelchips auf dem Boden. Einige Krümel kleben an seiner braunen Schnauze, und das Bild lässt mich trotz nasser Kleidung, stechender Lunge und schmerzenden Gliedern laut auflachen.
»Echt jetzt? Während ich Tomb-Raider-mäßig über den Zaun springe, gönnst du dir ein paar Kartoffelchips? Wer weiß, wie lange die Tüte da schon liegt.« Ich klopfe auf meinen Oberschenkel, woraufhin Pumpkin schwanzwedelnd zu mir gelaufen kommt. Ich lehne meine Stirn gegen seine und streichle seine weichen Ohren. »Tu mir das nie wieder an, hörst du? Wenn du Chips willst, kaufe ich dir welche. Aber hau nie wieder ab!« Als Antwort schleckt er mir einmal quer über das Gesicht, woraufhin ich die Miene verziehe. Er stinkt nach Hundeatem gepaart mit Paprikapulver. Ergo: ziemlich eklig.
»Und jetzt lass uns hier abhauen, bevor die Starsecurity kommt und uns einbuchtet.« Es wäre nicht das erste Mal, dass ich mit dem Gesetz in Konflikt gerate, und ich habe mir geschworen, es nie wieder so weit kommen zu lassen.
Ich stehe auf, wickle Pumpkins schwarze Leine einmal um meine Hand und sehe mich beim Hinausgehen kurz im Bus um. Früher habe ich mir immer gewünscht, eines Tages in einem Tourbus zu schlafen und Menschen im ganzen Land mit meiner Musik zu begeistern. Jetzt stehe ich zwischen Kojen, in denen echte Rockstars schlafen – und vermutlich ziemlich oft onanieren –, und könnte kaum angewiderter über diesen Wohlstand sein.
Manche Menschen haben nicht einmal ein Dach über dem Kopf, und andere werden von einem Chauffeur quer durchs Land kutschiert. Mein Blick fällt auf die High-End-Ausstattung mit Minibar, Beamer und all diesem Kram, den eigentlich niemand braucht. Andere Menschen in meinem Alter würden vermutlich ausflippen, weil sie auf demselben Boden stehen, auf dem Crashing December gestanden haben, aber in mir löst dieser Fakt nur das Gefühl von Ungerechtigkeit aus. Und ein kleines bisschen Neid, den ich sofort wieder herunterschlucke und von meiner Magensäure zerfressen lasse. Neid fühlt sich beschissen an, aber hin und wieder kommt er trotzdem hervorgekrochen.
Ich fahre mit den Fingern über die schwarzen Vorhänge, die die Kojen abdunkeln sollen, und merke, dass Pumpkin ungeduldig wird. »Ist schon gut, Kleiner. Wir verschwinden hier.« Ich marschiere wieder zurück zur Fahrerkabine, hinter der sich ein kleiner Ausklapptisch befindet. Darauf liegen mehrere Zettel verteilt, zwei Zigarettenschachteln, eine Bierflasche und zwei Paar Kopfhörer der Marke Beats.
Meine Finger zucken in Richtung der Kopfhörer, und als ich das Logo der Firma nachzeichne, stehe ich kurz davor, sie einfach mitgehen zu lassen. Diese Kerle schwimmen schließlich in Geld und bekommen diesen Scheiß sicher hinterhergeschmissen, während sich mein Bruder schon seit Jahren bessere Kopfhörer zum Geburtstag wünscht. Bis jetzt hatte ich jedoch nie genug Geld, um ihm gute zu kaufen. Stattdessen hat es immer nur für die Billigteile aus dem Supermarkt gereicht, die alle paar Monate kaputtgehen.
Prüfend sehe ich mich um, entdecke draußen vor dem Bus aber niemanden. Scheiß drauf! Ich nehme den Rucksack ab, klemme mir Pumpkins Leine zwischen die Oberschenkel und öffne den Reißverschluss der vorderen Tasche. Auf einmal höre ich Schritte in den Pfützen vor dem Bus, schiebe die Kopfhörer eilig in meine Tasche und springe wieder auf die Beine. Fuck, ich bin am Arsch. So richtig. Erst verschwindet Pumpkin, und dann werde ich auch noch beim Klauen erwischt. Grandios, Hope. Wirklich grandios. Willst du vielleicht noch etwas tiefer sinken? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich eine anständige Bürgerin sein will?
Die Schritte kommen näher, und noch bevor ich auf die dumme Idee kommen kann, mich hier im Bus zu verstecken – was mit einem Sechzig-Pfund-Hund ohnehin unmöglich ist –, höre ich bereits ein amüsiertes Räuspern. Ich schließe kurz die Augen, um mich zu sammeln. Ruhig bleiben, Hope.
»Und was wird das hier?« Himmelherrgott. Geht es noch schlimmer? Als würde es nicht reichen, dass ich vollkommen durchnässt beim Klauen erwischt werde, muss ich auch noch von ihm erwischt werden. Isaac Walker lehnt an der Tür des Busses, hat die Hände tief in den Taschen seiner dunklen, zerrissenen Jeans vergraben und mustert mich. Danke, lieber Gott, für das wohl größte Fettnäpfchen meines Lebens. Auch wenn ich mich nicht für die Band interessiere, erkenne ich den Kerl sofort, immerhin lächelt mir sein Schönlingsgesicht in der halben Stadt von Plakaten entgegen. Mehr als einmal habe ich ihm mit einem Edding einen Schnauzbart verpasst.
»Ich …« Moment mal, ich fange jetzt nicht an zu stottern, oder? Dieser Möchtegernstar wird mich nicht in eines dieser kleinen Mäuschen verwandeln. Er wirkt nicht, als hätte er mich beim Klauen erwischt, viel eher wirkt er amüsiert. Also straffe ich meine Schultern, hebe mein Kinn und wickle mir wieder die Leine um die Hand. »Mein Hund hat sich in euren Bus verlaufen. Kommt davon, wenn man das Teil einfach offen stehen lässt.«
Ich klinge bissig, dabei hat der Typ gar nichts Schlimmes gesagt. Aber allein die Art und Weise, wie er mich mustert, geht mir mächtig gegen den Strich. Als wäre ich nur eine arme Schnorrerin, während er in goldene Klos scheißt und sich den Hintern mit Seide abwischt. In meiner Vorstellung jedenfalls.
»Aber da ich ihn jetzt gefunden habe …« Ich halte demonstrativ die Leine hoch. » … kann ich jetzt ja wieder gehen.« Mit Mühe kriege ich ein Lächeln zustande. »Schönen Abend noch.«
Isaac rührt sich nicht von der Stelle, und da er mit seinen breiten Schultern den kompletten Eingang des Busses blockiert, komme ich nicht an ihm vorbei. Dafür, dass er gerade ziemlich lange auf der Bühne gestanden haben muss, sieht er erstaunlich fit und frisch aus.
»Und du bist sicher nicht hier, um ein Autogramm abzustauben?« Sein linker Mundwinkel zuckt nach oben, und diese Geste, gepaart mit seinem viel zu frechen Spruch, macht mich nur noch wütender. Ich verenge meine Augen zu Schlitzen und balle meine freie Hand zur Faust. »Träum weiter, Walker. Nicht jeder Schlüpfer dieser Stadt fliegt dir entgegen, sobald du den Mund aufmachst. Ich bin nur hier, weil mein Hund abgehauen ist und sich an euren ekeligen Chips bedient hat. Ein bisschen Ordnung würde nicht schaden, weißt du?«
Uns trennen vielleicht vier Schritte voneinander, und obwohl er auf dem untersten Trittbrett des Busses steht und ich hier oben, sind wir fast auf Augenhöhe. Wie groß ist der Kerl bitte? Auf Videos und Plakaten kann man das schließlich schlecht einschätzen. Da ich mit meinen ein Meter fünfundfünfzig ein Gartenzwerg in Menschengestalt bin, sticht der Kontrast besonders hervor.
»Na gut, du Nicht-Groupie, meinen Namen kennst du aber trotzdem«, erwidert Isaac und fährt sich mit der Hand über den Nacken. Er trägt zu der schwarzen Jeans ein schwarzes, eng anliegendes Shirt, das seine Brustmuskulatur etwas zu sehr betont. Ich frage mich, wann er zwischen all den Gigs und Interviewterminen noch Zeit zum Trainieren hat.
»Wer kennt deinen Namen nicht?«, erwidere ich augenrollend. »Dein Gesicht springt einem ja überall entgegen. Letztens habe ich es in der Klokabine einer ranzigen Tanke gesehen.« Mist, ich denke heute viel zu häufig über Toiletten nach. Könnte daran liegen, dass ich seit einer Stunde pullern muss und mit meinem Equipment und Pumpkin keine Möglichkeit hatte, mir ein stilles Örtchen zu suchen.
»Dann habe ich dir also beim Pinkeln zugesehen?« Er nimmt die letzten beiden Stufen in den Bus und steht so dicht vor mir, dass ich schlucken muss. Der Bus bewegt sich unter seinem Gewicht. »Interessant.«
Ich antworte mit einem Schnaufen, weil mir dazu echt nichts einfällt. Pumpkin liebt Menschen, weshalb er freudig an Isaac schnuppert. Isaacs Blick wandert zu meiner felligen Begleitung, und sein Grinsen wird noch breiter. Und irgendwie echter.
»Wer bist du denn?«
Wenn ich dem Funkeln in seinen Augen trauen kann, ist er ein Hundemensch, aber das bringt ihm jetzt auch keine Pluspunkte mehr ein. Er streichelt Pumpkins Kopf, während ich ihn mit angehaltenem Atem mustere.
Trotz allem Ärger muss ich zugeben, dass Isaac Walker schön anzusehen ist. Er hat ein markantes Gesicht, eine eindrucksvolle Kieferlinie, und der Bartschatten in Kombination mit der wilden Out-of-bed-Frisur verleiht ihm den perfekten Rockstarlook. Seine Augen haben ein so stechendes Blau, dass er mich an einen Husky erinnert. Dichte Augenbrauen komplettieren das Bild. Ich schlucke, während mein Blick an seinem Hals entlangfährt, an dem eine fingernagelgroße Narbe prangt, und über seine definierten Arme wandert. Jetzt hör endlich auf, ihn so zu mustern, Hope!
»Könntest du uns jetzt bitte durchlassen? Ich muss nach Hause und kreischend in mein Tagebuch schreiben, dass ich dich getroffen habe.« Ungeduldig verschränke ich die Arme vor der Brust, und als Isaac die Streicheleinheiten stoppt und sich wieder mir zuwendet, bereue ich es fast, ihn unterbrochen zu haben. Aber nur fast.
»Ich lasse dich durch, wenn du aufhörst, mich mit deinen Blicken auszuziehen.« Dieser ungehobelte Arsch! Denkt wohl, dass ihm jedes Frauenherz zu Füßen liegt, nur weil er wie ein junger Ian Somerhalder aussieht und gut singen kann. Aber das spielt keine Rolle. Eine schöne Stimme kann auch nicht über einen schlechten Charakter hinwegtäuschen, und den präsentiert er mir gerade in seiner vollen Pracht.
»Ich ziehe dich nicht mit meinen Blicken aus«, halte ich dagegen. Wir sind uns wieder viel zu nahe. So nah, dass ich seinen Atem auf meiner Schläfe spüren kann. Er riecht nach einer Mischung aus Bier und Minze. Seltsamerweise ekelt mich der Geruch nicht an, obwohl ich nicht viel von Alkohol halte.
»Und ich soll dir wirklich glauben, dass du nur wegen deines Hundes hier bist? Nicht, um irgendwelche Videos von unserem Tourbus fürs Netz zu machen oder uns zu beklauen?« Beim letzten Wort trocknet mein Mundraum aus. Weiß er vielleicht doch, dass ich die Kopfhörer habe mitgehen lassen? Lass dir was einfallen, Hope! Du kannst die Nacht echt nicht auf dem Revier verbringen.
»Ich habe es nicht nötig, euch zu beklauen. Aber von mir aus … sieh in meinen Sachen nach.« Langsam lasse ich den Rucksack von meiner Schulter rutschen. Vielleicht komme ich aus der Scheiße raus, wenn ich ein wenig pokere.
Isaac blickt mich an, und wir liefern uns ein stummes Duell. Hätte ich nicht genug Ärger am Hals, würde ich ihm einfach in die Eier treten und so schnell wie möglich die Biege machen.
»Schon gut. Ich glaub dir.« Er leckt sich über die Unterlippe, steigt rückwärts aus dem Bus und deutet mit der rechten Hand an, dass ich frei bin zu gehen. Augenblicklich fühle ich mich zehn Pfund leichter. Mit immer noch erhobenem Kinn stolziere ich aus dem Bus, spüre ein unangenehm angenehmes Kribbeln in meinem Nacken, als ich an Isaac vorbeigehe, und marschiere auf das Tor zu.
Mist, daran habe ich gar nicht gedacht. Auf keinen Fall will ich mich vor ihm zum Idioten machen und wieder über den Zaun klettern müssen. Außerdem weiß ich nicht, wie ich Pumpkin auf die andere Seite bekommen soll. Also drehe ich mich schweren Herzens – und zum Missfallen meines Egos – zu Isaac um.
»Gibt es auch einen anderen Weg von diesem Grundstück?«
»Nope«, erwidert er kess grinsend. »Wie bist du denn hier raufgekommen?« Er lehnt sich jetzt von außen gegen den Bus, fischt eine Packung Zigaretten aus der Arschtasche seiner Jeans und schiebt sich eine zwischen die Lippen. Anschließend zündet er den Glimmstängel an und schiebt die Hände wieder in die Hosentaschen.
»Musste über den Zaun klettern«, murmle ich.
»Das hätte ich echt gerne gesehen, Freckles.«
Spinnt der Kerl jetzt völlig? Mir ist klar, dass die Sommersprossen in meinem Gesicht ziemlich markant sind, aber das gibt ihm noch lange nicht das Recht, mir so einen albernen Spitznamen zu geben.
»Hast du einen Schlüssel fürs Tor oder nicht?« Meine Würde habe ich wohl im Bus gelassen, als ich die Kopfhörer eingesteckt habe. Aber vielleicht finde ich sie ja wieder, wenn ich das hier hinter mir habe. Wäre schön, wenn es schnell passiert.
»Das Tor geht von innen auf.« Er deutet mit der Kippe im Mund hinter mich. Ohne mich bei ihm zu bedanken, mache ich auf meinen Chucks kehrt und gehe weiter.
»Es war mir eine Freude, Freckles!«
Schnaufend drehe ich mich um, zeige ihm mein süßestes Lächeln und präsentiere heute zum zweiten Mal meinen Mittelfinger. Scheinbar ist heute internationaler Mittelfinger-Tag. Oder Arschloch-Tag. Oder beides auf einmal.
»Mir nicht!«, rufe ich ihm zu. »Und weißt du, was? Beim nächsten Mal lasse ich meinen Hund in deine Koje kacken!« Ich fühle mich wie die Siegerin dieses Wortgefechts, als ich mich umdrehe und mit schnellen Schritten zum Zaun gehe. Aber diese Rechnung habe ich ohne Isaac Walker gemacht.
»Es wird also ein nächstes Mal geben, hm?«
Augenrollend greife ich nach dem Tor und stelle erleichtert fest, dass er die Wahrheit gesagt hat und es sich von innen problemlos öffnen lässt.