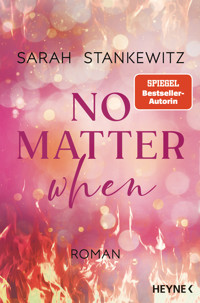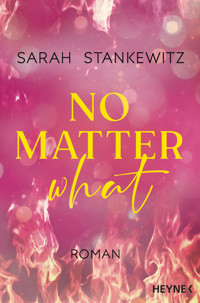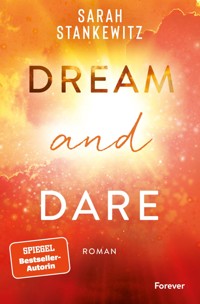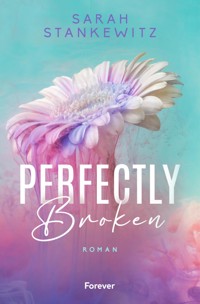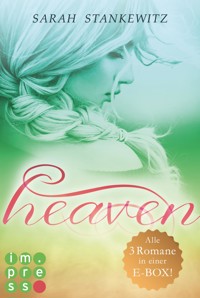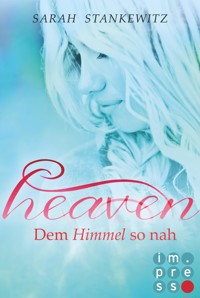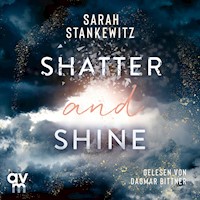
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Faith-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wenn in einer lauten Welt plötzlich alles verstummt, kannst du nur noch auf dein Herz hören Als Hazel die Nachricht vom Tod ihres Ex-Freundes in Afghanistan erhält, bricht für sie eine Welt zusammen. Doch auf einmal ist da Cameron. Cameron, der als Kriegsveteran einen Bombenanschlag überlebt, durch die Explosion jedoch sein Gehör verloren hat und dem sie nun helfen soll, sich in der stillen Welt zurechtzufinden. Cameron, der nicht hören kann, wie laut ihr Herz in seiner Gegenwart schlägt ... Der mitreißende 2. Band der Faith-Reihe, über Verlust, ein Leben mit Handicap und einen besonderen Neuanfang.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Shatter and Shine
Die Autorin
SARAH STANKEWITZ, 1994 in Wittstock geboren, ist Autorin und Buchbloggerin. Sie begeistert ihre Fans mit Geschichten, die sie selbst gerne liest, voller Leidenschaft, Drama und mit einer Prise Humor. Musik, Kerzen und ein bequemer Platz dürfen im Hause der Autorin ebenso wenig fehlen wie eine Tasse heißer Kaffee.
Sarah Stankewitz
Shatter and Shine
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin1. Auflage November 2022© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenAutorinnenfoto: © Patrick Thomas/Klick. AugenblickE-Book-Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2774-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Content Note
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Anmerkungen der Autorin
Danksagung
Content Note
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Content Note
Widmung
Für Selina.Du bist genauso stark wie Hazel.Vergiss das nie.
Content Note
Liebe Lesende,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deswegen findet ihr auf Seite 413 eine Triggerwarnung. Wir möchten, dass ihr das bestmögliche Leseeerlebnis habt.
Eure Sarah Stankewitz & das Forever-Team
Prolog
Hazel
Jeder kennt ihn. Den Moment, der das ganze Leben schlagartig verändert. Der aus bunt schwarz und aus einem Morgen mit Aussicht auf den besten Tag des Lebens eine Erinnerung macht, die man vergessen möchte.
Für den einen ist es der Tag, an dem er seinen ohnehin schlecht bezahlten Job verliert und nicht mehr weiß, wie er die nächste Miete bezahlen oder den Kühlschrank füllen soll. Für die andere ist es der Arzttermin, bei dem sie erfährt, dass sie keine Kinder bekommen kann. Und auf einmal wird aus dem Strampler im Kleiderschrank, den die Großmutter für das künftige Enkelkind mit vom Alter gezeichneten und aufgeregten Fingern gestrickt hat, ein Stück Wolle, das vermutlich nie getragen werden wird.
Vielleicht ist es auch ein Anruf, bei dem man gebeten wird, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen, weil es sonst zu spät sein könnte.
Ich habe einen Namen für diese alles verändernden Momente, denen jeder Mensch im Laufe seines Lebens begegnet, egal wie oft wir versuchen, uns davor zu schützen. Wir können laufen und laufen, uns verstecken, sie austricksen, aber wir können sie nicht aufhalten.
Die Herzensbrecher.
Mein zweitgrößter Herzensbrecher – nach dem Tod meiner Grandma – hat mich dieses Jahr im April erreicht. Ich war gerade auf dem Weg zu meinem Nachmittagsunterricht, die Sonne stand so hoch und rund am Himmel, als hätte man sie mit einem Zirkel zwischen die fluffigen Wolken gemalt. Nur wenige Straßen von dem Gebäude entfernt, in dem ich dreimal in der Woche Menschen Gebärdensprachunterricht gebe, erhielt ich die eine E-Mail, die alles veränderte. Sie kam von einer Frau namens Beth, die laut ihrer Mailadresse für die US Army in Austin arbeitete. Die Nachricht begann damit, dass es ihr leidtue.
Meine Schritte wurden langsamer, der Griff um den Gurt meiner Handtasche fester. Gleichzeitig rutschte er mir immer wieder aus den schweißnassen Fingern, weil es einen Teil in mir gab, der den Inhalt der Nachricht schon kannte, bevor ich sie ganz lesen konnte. Immerhin hatte ich im letzten Jahr ständig erwartet, dass es passieren würde. Dass man mir den Boden unter den Füßen wegreißen und mir anschließend mit einem mitleidigen Blick beim Fallen zusehen würde.
Ich erinnere mich daran, dass ein Vater mit seiner kleinen Tochter gegen mich rannte, weil ich wie vom Blitz getroffen stehen geblieben war. Sekunden später folgte das Weinen des Mädchens, weil sein erstes Eis des Jahres platschend auf dem Bürgersteig gelandet war. Der Vater warf mir einen missbilligenden Blick zu, aber ich hatte keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich musste die wenigen Zeilen wieder und wieder lesen, um zu verstehen, was passiert war.
Beth erzählte mir in knappen Worten von einem Vorfall, der Masons Lager in der Nacht zuvor überrascht hatte. Einem Vorfall, bei dem sieben Männer ihr Leben verloren hatten.
Darunter auch Mason.
Mein Mason.
Der Mann, mit dem ich noch vor einem halben Jahr ein Haus hatte bauen und Kinder hatte haben wollen. Der mich mit seinen stürmischen Augen und den intensiven Küssen um den Verstand gebracht hatte, bevor er sich entschied, zur Army zu gehen und mich in Texas zurückzulassen. Und gleichzeitig war er der Mann, der letztes Jahr in einem Brief mit mir Schluss gemacht hatte, weil ihn der Krieg verändert hatte und er nicht wusste, ob er mir noch geben konnte, was ich wollte. Ein Mann, der schon länger kein Teil meines Lebens mehr hätte sein sollen, aber erst jetzt ganz fort war. Und mir blieb nichts anderes übrig, als irgendwie weiterzuleben. Zu atmen, obwohl ich die Luft anhalten wollte, wenn er nicht mehr auf dieser Erde weilte.
Seit diesem Herzensbrecher waren meine Nächte lauter und meine Tage stiller. Nachts wachte ich schreiend und schweißgebadet auf, griff unter dem Bett nach der Kiste mit Masons alten Briefen und las jeden einzelnen durch. Wieder und wieder. Wort für Wort. Prägte mir seine letzten Zeilen an mich ein und wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Denn dann hätte ich Mason niemals einfach so gehen lassen. Ich hätte alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er uns noch eine Chance gab, anstatt das Wort Ende unter unsere Beziehung zu setzen, obwohl wir eigentlich erst am Anfang unseres gemeinsamen Lebens standen. Dann läge er jetzt in meinen Armen, während ich ihm durch das dichte goldbraune Haar streichen würde.
Ja, die Nächte waren schlimm, aber die Tage waren schlimmer. Mich verschluckte eine Leere, die alles um mich herum in Watte hüllte. Seit April wandelte ich wie ein Zombie durch meinen Alltag und versuchte, nicht zusammenzubrechen. Ich hielt durch, weil es das war, was meine Mutter von mir verlangte.
Reiß dich zusammen, Hazel. Durch deine Tränen wird Mason nicht zurückkommen. Wir Parkers sind Kämpfernaturen, also kämpfe gefälligst. Was sollen die Leute denken? Willst du etwa dein Studium in den Sand setzen? Deine Großmutter wäre enttäuscht von dir, Hazel.
Es gab nur einen Ort, an dem ich ich selbst sein konnte. Die alte Hazel, die kein Problem damit hatte, ihre Tränen zu zeigen und ihre Gefühle zu spüren.
Auf der Farm meiner Großeltern fühlte ich mich noch lebendig. Etwas zerbrochen, aber nicht komplett zerstört.
Meine Mutter hatte unrecht. Grandma wäre nicht enttäuscht von mir, das wäre sie nur, wenn ich nicht fühlen würde, was es zu fühlen galt. Deshalb war dieses heilige Fleckchen Erde nahe Beaumont der Ort, der mich vom Aufgeben abhielt.
Dank ihr, meinem Bruder Jamie, meiner besten Freundin Sky und meinem Grandpa war die Farm für mich in den letzten Monaten zum genauen Gegenteil eines Herzensbrechers geworden.
Sie wurde zu meinem Herzensretter.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste?
Mein Herz war längst wieder in Gefahr.
Und diese Gefahr hatte einen Namen.
Cameron.
1
Hazel
Es gibt Orte auf der Welt, an denen der Himmel immer etwas schöner, die Luft etwas heilsamer, die Sonne etwas strahlender und das Leben etwas leichter ist. Schon als Kind empfand ich das Land meiner Großeltern als Paradies, und jedes Mal, wenn meine Mutter meinen kleinen Bruder Jamie und mich übers Wochenende herbrachte, weil sie beruflich mal wieder vollkommen eingespannt war, hatten wir die beste Zeit unserer Kindheit.
Wir haben es geliebt, zwischen all den Tieren zu sein, draußen in der Natur. Zwischen Strohballen, warmem Sand und dem Geruch von Grandmas frisch gebackenen Brownies, die immer viel zu süß und klebrig waren. Den Teig haben wir manchmal nicht einmal mit heißem Wasser und Seife richtig von den Fingern bekommen. Wir saßen am Lagerfeuer, rösteten weiche Marshmallows, und im Hintergrund spielte Gramps auf seiner Ukulele Klassiker wie ›Somewhere over the Rainbow‹. Jamie saß dabei schon als kleiner Knirps auf seinem Schoß, weil er die Musik zwar nicht hören, aber spüren konnte.
In Momenten wie diesen – wenn die Sonne schon frühmorgens einen goldenen Schleier über das hektargroße Land und die umliegenden Felder wirft – vermisse ich die Tage der kindlichen Unbeschwertheit am meisten. Ich werfe einen Blick in den wunderschönen Oktoberhimmel und renne weiter. Schneller und schneller, als könnte ich den bösen Gedanken entfliehen, von denen ich dachte, dass ich sie schon besser im Griff hätte, und die sich jetzt wieder an die Oberfläche kämpfen.
Der Boden unter meinen Laufschuhen staubt, während ich versuche, nicht sauer auf dieses Leben zu sein, das mir erst einen Ort wie diese Farm geschenkt und mir dann in vier Jahren zwei der wichtigsten Menschen genommen hat. Als würde es mir mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht einen Mittelfinger zeigen, ganz nach dem Motto: Ha! Du warst zu gierig. Gierig nach Glück, nach warmen Lagerfeuernächten und den Menschen, die du liebst.
Nach dem Tod meiner Großmutter dachte ich, dass ich nie wieder glücklich werden könnte, immerhin stand ich dieser Frau näher als meiner eigenen Mutter. Sie hat mich gemeinsam mit meinem Großvater aufgezogen, wenn Mom mal wieder durch die halbe Welt gejettet ist, um Immobilien im Ausland zu begutachten. Ich weiß, dass ich fast alles, was ich über das Leben und die Liebe gelernt habe, ihnen zu verdanken habe. Zum Beispiel, dass Menschen, wenn sie sterben, nicht wirklich fort sind.
In jeder Diele, jedem Möbelstück, jedem Winkel des alten Landhauses, das längst ein paar Sanierungen nötig hat, lebt Grandma weiter. Nicht auf die gruselige Art, die einem einen Schauer über die Wirbelsäule schickt, sondern auf eine heilsame. Jedes Mal, wenn ich die abgeblätterte Holztür öffne und unseren Flur betrete, in dem es immer ein wenig nach Zimtkeksen duftet – selbst im Sommer –, spüre ich ihre Anwesenheit und muss lächeln. Mal ist das Lächeln traurig, mal dankbar. Aber es ist beständig. Es hat mich nie verlassen, so wie es Gramps nicht verlassen hat, obwohl er seiner großen Liebe nach fünfzig gemeinsamen Jahren Lebewohl sagen musste.
Mit Mason ist es anders. Seine Anwesenheit spüre ich nicht, egal wie sehr ich mich nach ihr sehne. Vermutlich liegt es daran, dass er schon verschwunden war, bevor er starb. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich ihn schon nicht mehr gefühlt, als wir uns beim letzten Mal am Flughafen voneinander verabschiedet haben. Er hatte eine zweiwöchige Pause von seinem Einsatz in Afghanistan hinter sich, und wir haben jeden Tag dieser zwei Wochen miteinander verbracht, weil es das ist, was Paare tun. Sie nutzen jede freie Sekunde aus, vor allem, wenn sie nicht wissen, wann sie sich wiedersehen. Ob sie sich wiedersehen.
Wir waren bei seinen Eltern zu Besuch, in meinem Studentenwohnheim, haben Zeit an unserem Lieblingsplatz verbracht, hatten Dates wie früher – und doch waren wir einander so fern wie nie zuvor in unserer dreijährigen Beziehung. Unser Ende war also längst absehbar, aber ich wollte es selbst dann nicht wahrhaben, als er einen Schlussstrich zog. Das war sieben Monate vor seinem Tod. Man sollte meinen, dass ein solcher Schicksalsschlag weniger wehtut, wenn man vorher derart verletzt wurde, wie Mason mich mit seinem Brief verletzt hat. Die bittere Wahrheit ist: Es tut trotzdem scheiße weh. Und es ist verflucht schwer, lange auf jemanden wütend zu sein, der nicht mehr da ist.
Die ersten Tränen bahnen sich ihren Weg über meine Wangen, mit dem Ärmel meines Sportpullis wische ich sie fort. Es ist noch früh am Morgen, nicht einmal die Tiere sind aus den Ställen gekommen, und ich nutze die morgendliche Stille, um meine Gefühle und Gedanken zu sortieren. Und das kann ich nun mal am besten, wenn ich in Bewegung bleibe und dabei frische Luft um mich habe.
Ich habe Routinen schon immer geliebt, selbst als ich noch ein kleines Mädchen war, das nicht einmal wusste, wie man das Wort richtig buchstabiert. Aber inzwischen sind sie nichts mehr, das ich liebe, sondern etwas, das ich zum Durchhalten brauche. Und deshalb sieht für mich seit Monaten jeder Morgen gleich aus. Ich stehe um sieben Uhr auf, schlüpfe in meine Sportsachen und laufe ohne Ziel los, egal ob ich den Tag auf dem Land oder in der Stadt verbringe. Obwohl mir die Landläufe lieber sind, weil die Luft hier draußen so viel klarer ist. Ich achte nie darauf, wie weit ich laufe oder wie schnell ich dabei bin, weil es keine Rolle spielt.
Jede Minute, in der ich nicht versucht bin, den Karton mit Masons Briefen unter dem Bett hervorzuholen, sauge ich wie ein Schwamm das Wasser auf. Der Schweiß rinnt mir über den Nacken, und ein paar meiner braunen Haarsträhnen haben sich aus meinem Zopf gelöst und kleben mir im Gesicht. Denn obwohl es morgens um diese Jahreszeit selbst in Texas kühl ist, ist mir bullenheiß. In der Ferne kann ich das große braune Tor sehen, das ich vor fünf Jahren neu gestrichen habe, und ich erhöhe meine Geschwindigkeit, bis es in meiner Lunge sticht und das Gefühl den emotionalen Schmerz ersetzt.
Als ich mein schnellstes Tempo für diesen Morgen erreiche, stellt sich ein Gefühl in mir ein, das mir fast fremd geworden ist. Ein Gefühl, von dem ich nicht glaubte, dass es noch in mir steckt, weil es das Leben in den letzten Jahren so schlecht mit mir gemeint hat. Vielleicht ist das seine Art der Entschuldigung, denn ich spüre zum ersten Mal Vorfreude auf den Tag. Und das fühlt sich verdammt großartig an.
Sofort flammt in mir der Wunsch auf, diese Neuigkeit mit Pablo zu teilen. Eilig schließe ich das Tor hinter mir, laufe auf die große Scheune neben dem Haus zu und gebe meinem Körper Zeit, sich nach dem Abschlusssprint wieder zu akklimatisieren.
Der Kies, den Gramps vor ein paar Jahren in die Auffahrt gestreut hat, knirscht unter meinen Laufschuhen, und als ich einen Blick auf meine Armbanduhr werfe, lächle ich zufrieden. Ich war fünfzig Minuten auf der Strecke, und es hat sich angefühlt, als wäre ich gerade erst losgelaufen. Genau das liebe ich am Joggen so sehr, es ist meine Form der Meditation geworden. Meine Art, all diese Emotionen zu verarbeiten. Nicht, um vor ihnen davonzulaufen, sondern um sie schonungslos zu spüren. Und neben dem Joggen gibt es noch etwas, das mich auf Trab hält: die Tiere.
Immer, wenn ich hier bin, greife ich Gramps so gut es geht unter die Arme und kümmere mich um unsere felligen Schützlinge. Das habe ich schon als Kind gern gemacht, aber jetzt kann ich natürlich viel besser anpacken als damals. Also fülle ich jeden Morgen die Wassertröge auf, füttere die bunte, wilde Herde und miste die Ställe aus. Meistens in dieser Reihenfolge, aber manchmal variiere ich sie auch.
Das Land befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie, damals wurde es noch als klassische Pferderanch genutzt. Zumindest so lange, bis mein Gramps hier das Sagen hatte und alles auf den Kopf stellte. Im guten Sinn. Uns liegt das Wohl aller Tiere am Herzen, und so haben meine Großeltern die Ranch in einen Lebenshof verwandelt, der seine Tore nicht nur für Pferde öffnete. Jahrelang haben wir fast monatlich kranke oder abgerichtete Tiere bei uns aufgenommen, sie verarztet und wieder aufgepäppelt. Manche blieben anschließend bei uns, so wie Sammy, unsere älteste Stute. Andere fanden ein neues liebevolles Zuhause, das sich erst einmal unter Gramps’ kritischem Blick beweisen musste.
Ich muss grinsen, wenn ich daran denke, wie oft er die Nase gerümpft hat, wenn wir Interessenten für die Tiere besucht haben und er sie nicht gut genug fand. Manchmal stimmte es, manchmal war er aber auch ein richtiger Griesgram. Das Einzige, was mein Großvater mehr als seine Tiere liebt, ist seine Familie.
Seit Grandma nicht mehr da ist, hat sich die Anzahl unserer Schützlinge drastisch verkleinert. Vor zehn Jahren gaben wir auf diesem paradiesischen Fleckchen Erde noch fünfundzwanzig Tieren ein Zuhause, inzwischen haben wir nur noch vier Pferde, eine Handvoll Hühner, zwei Katzen und einen Esel.
Ich ziehe die morsche Stalltür auf, schnappe mir routiniert Grandmas alten Stetson-Hut, der immer am rostigen Haken neben der Tür hängt, und setze ihn mir auf. Es ist ein beige-braunes Modell, das sicher schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat, und auch wenn er längst reif für den Müll wäre, kann und werde ich mich nicht von ihm trennen. Meiner Grandma stand er immer am besten.
Anschließend schnappe ich mir den an der Wand aufgewickelten Wasserschlauch und führe ihn zu den grauen Wassertrögen an der Seite des Stalls. Sobald frisches Wasser hineinläuft, höre ich es im Stroh hinter mir rascheln. Grinsend sehe ich dabei zu, wie sich die Tröge füllen. Ich muss mich nicht umdrehen, um zu wissen, wer sich mir nähert.
»Na, Pablo. Ausgeschlafen?«
Als Antwort erhalte ich ein müdes Schnaufen, das mich noch breiter lächeln lässt. Sekunden später spüre ich seinen warmen und etwas zu feuchten Atem an meinem Nacken. Automatisch wandert meine Hand in seine kurze Mähne, und ich beginne, ihn zu kraulen, woraufhin Pablo seinen Kopf dichter an mich drückt. Ich weiß genau, was er mir sagen will, der penetrante kleine Esel.
»Ist ja gut, ich stell das Wasser schon ab.« Sobald die Tröge genug gefüllt sind, drehe ich den Hahn zu, wickle den Schlauch wieder auf und wende mich Pablo zu, der sich in der Zwischenzeit einen Snack zum Frühstück gegönnt hat und munter auf Stroh herumkaut.
Pablos Geschichte bricht mir immer noch das Herz, jedes Mal, wenn ich in diese treuen, braunen Augen sehe. Er wurde von Tierschützern aus Mexiko geholt, wo er als Eseltaxi für Touristen benutzt wurde. Pablo war in einem miserablen Zustand, als er bei uns ankam. Sein Fell war verfilzt, seine Hufe wund, seine Wirbelsäule überstrapaziert, und er war befallen von Parasiten.
Ich balle meine Hände zu Fäusten, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man so wundervollen Wesen etwas derart Schreckliches und Unwürdiges antun kann. Pablo ist seit einem Jahr Teil unserer Farm, und ich behaupte ganz waghalsig, dass seine Anwesenheit mir in den letzten Monaten oft das Leben gerettet hat. Immer, wenn ich jemandem mein Herz ausschütten musste und Gramps gerade nicht da war, kam ich in den Stall und habe Pablo das süße Ohr abgekaut. Er ist ein wahnsinnig guter Zuhörer.
Wir sind seit einer Weile auf der Suche nach einem Freund für ihn, weil Esel unglaublich soziale Tiere sind, aber bis jetzt sind wir noch nicht fündig geworden. Was nicht heißt, dass wir die Suche aufgeben. Gramps kennt beinahe jeden weit entfernten Nachbarn der Gegend und durchforstet jeden Morgen die Zeitung, während ich mich online bei Tierschutzvereinen umsehe.
Pablo bedient sich an einer weiteren Portion Stroh und starrt mich anschließend wieder kauend an, als wüsste er längst, dass mir etwas auf dem Herzen brennt.
»Heute ist etwas anders, weißt du?« Ich stoße mich von der Wand des Stalls ab, trete auf Pablo zu und fahre mit meiner Hand ein paar Mal kräftig über seine Seite, weil ich weiß, wie sehr er diese Streicheleinheiten liebt. Anschließend lasse ich mich ins Stroh sinken und ziehe die Beine in den Schneidersitz. Die einzelnen Halme piksen mich durch die dünne Sportleggings, aber irgendwie mag ich das Gefühl. Vermutlich, weil mir das Farmersleben schon mit der Muttermilch verabreicht wurde. Der Geruch von Mist macht mir genauso wenig aus wie die Tatsache, dass ihn jemand wegmachen muss. Und dieser Jemand häufig ich bin.
Pablo legt seinen Kopf schief und beobachtet mich ganz genau. Seit er hier ist, weiß ich, wie wahnsinnig intelligent Esel sein können und dass ihnen ein verdammt blöder Ruf vorauseilt. Sie sind absolut nicht stur oder dumm! Meistens kann dieses Wesen meine Gefühlslage erkennen, bevor ich es selbst schaffe.
Ich zupfe an den Strohhalmen und genieße, wie die Sonne immer höher über den Horizont krabbelt und inzwischen direkt ins Innere des Stalls scheint. Pablos braunschwarzes Fell wird in ein schönes morgendliches Violett getaucht.
»Ich weiß nicht, was es ist, aber … ich glaube, ich bin wieder so weit.« Erneut pocht es so angenehm in meiner Brust. Ist das Vorfreude, die da anklopft und die ich gerade schon beim Laufen verspürt habe? »Ja, ich glaube, ich sollte wieder in den Unterricht gehen«, sage ich mehr zu mir selbst als zu dem Esel, der unbeirrt weiterfrisst, mich aber nicht aus den Kulleraugen lässt. Ich bilde mir ein, Zustimmung in seinem Blick zu erkennen, lasse mich rücklings ins Stroh fallen und starre an das Dach des Stalls, welches wir in den letzten Jahren so oft notdürftig flicken mussten. Erst letztens haben wir wieder eine Stelle entdeckt, durch die Feuchtigkeit ins Innere kommt. Wenn das nicht noch ein Grund ist, mich wieder an die Arbeit zu machen und ein bisschen Geld zu verdienen.
Neben meinem Studium zur Gebärdensprachdolmetscherin an der Lamar University gebe ich dreimal in der Woche Unterricht für Gehörlose und deren Angehörige. Auf der einen Seite plagt mich ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Studium noch nicht beendet und keine Prüfung abgelegt habe, aber auf der anderen Seite brauche ich das Geld dringend, um die Farm über Wasser zu halten. Die bloße Vorstellung, dass Gramps die Tiere abgeben oder gar das Land verkaufen müsste, um über die Runden zu kommen, bricht mir das Herz. Also habe ich für mich selbst einen Kompromiss gefunden: Ich gebe so lange privaten Unterricht, bis ich mit dem Studium fertig bin und Vollzeit als Dolmetscherin arbeiten kann. Ich bin keine Muttersprachlerin, habe mich aber nach der Geburt meines gehörlosen Bruders Hals über Kopf in diese wundervolle Sprache verliebt.
Seit der Schreckensnachricht im April habe ich nicht mehr unterrichtet, weil es einen Teil in mir gab, der Angst hatte. Angst davor, wieder eine Hiobsbotschaft zu erhalten, wenn ich vor dem Gebäude stehe. Angst davor, dass ich doch noch nicht so weit bin und mich zu schnell wieder in den Sattel setze.
Mein Studium habe ich nach wie vor durchgezogen, aber die Unterrichtsstunden habe ich vorerst auf Eis gelegt. Mehr als einmal wurde in die entsprechende WhatsApp-Gruppe geschrieben und gefragt, wann ich den Dienst wieder aufnehme, aber ich habe jedes Mal gesagt, dass ich noch nicht bereit bin.
Bis jetzt.
»Verdammt, ja, ich vermisse das Unterrichten, Pablo!« Mit diesen Worten setze ich mich wieder auf, und als ich Gramps im Hintergrund entdecke, verwandelt sich mein Entschluss in einen undefinierbaren Tatendrang.
»Guten Morgen, Nut.« Seine Reibeisenstimme sorgt sofort für eine Welle der Liebe, die durch mein System gespült wird und jeden Restzweifel, der sich vielleicht noch in mir versteckt haben könnte, vernichtet. Gramps hat mich schon als Kind immer Nut genannt, manchmal war ich Hazelnut, manchmal Peanut, je nach Lust und Laune. Seit ein paar Jahren bin ich nur noch Nut. Er sagt, so spart er sich kostbare Lebenszeit.
»Gramps, wieso bist du denn schon wach?« Ich rapple mich auf, klopfe mir das Stroh von den Leggings und drücke Pablo im Vorbeigehen einen Kuss auf die Stirn. Ein I-ah entfährt ihm, das mich sofort mitten ins Herz trifft.
»Ich bin zwar alt, aber schlafen kann ich auch noch, wenn ich tot bin.« Er greift in die Brusttasche seines rot-schwarz-karierten Hemdes und holt das alte Brillenetui heraus, das schon bessere Tage hinter sich hat. Sobald das runde Gestell auf seinem Kopf sitzt, wird sein Blick umgehend etwas klarer. Dass er es ohne Brille überhaupt bis zum Stall geschafft hat, gleicht einem Wunder, denn seine Gläser sind dicker als unsere Fensterscheiben.
»Hast du wenigstens deine Medikamente genommen?«, frage ich ihn und fülle nebenbei ein paar frische Möhren und Äpfel in den Futtertrog, damit sich nicht nur Pablo daran bedienen kann, sondern auch unsere Pferde.
»Jawohl, Schwester Hazel.« Gramps salutiert, und das Bild, was er dabei abgibt, sieht herrlich schräg aus. Seine Wohlstandsplauze – wie er sie immer liebevoll nennt – sorgt dafür, dass der Stoff des Hemdes ordentlich spannt. Sein lichtes Haar ist noch ungekämmt, und die wenigen Flusen stehen in alle Richtungen ab. Und zur Krönung trägt Gramps die Hausschuhe, auf denen Pablos Gesicht abgedruckt ist. Sie waren mein letztes Weihnachtsgeschenk an ihn, und seitdem trägt er sie bei Wind und Wetter.
»Sehr gut. Hast du Hunger? Ich könnte uns ein Brot backen? Wir müssten noch diese Fertigbackmischung dahaben.« Nachdem ich einen letzten prüfenden Blick in den Stall geworfen habe und sehe, dass Pablo inzwischen nicht mehr bei uns ist, sondern sich nach draußen auf die Wiese verzogen hat, lege ich meine Hand auf Gramps’ Schulter und hänge mit der anderen den Stetson wieder an den Haken. Arm in Arm schlendern wir Richtung Haus, und als ich in das faltige Gesicht meines Großvaters blicke, frage ich mich, wie es ihm wirklich geht. Schon früher war er ein Meister darin, schlechte Tage zu überspielen, und seitdem bei ihm Diabetes Typ II diagnostiziert wurde, ist aus dem Meister ein König geworden. Aber heute scheint er wirklich einen guten Morgen zu haben, weshalb ich nicht weiter darüber nachdenke.
»Brot klingt gut, Nut.« Er legt seine Hand auf meinen Rücken und reibt einmal kräftig darüber, wie er es schon früher oft getan hat. Sobald wir das Haus betreten und das gewohnte Knarzen der Dielen unter unseren Füßen erklingt, ist es wieder da. Das Lächeln, das mich jedes Mal überkommt, wenn ich über diese Schwelle trete. Unauffällig schiele ich zu meinem Großvater hinüber und sehe dasselbe Lächeln auf seinen Lippen.
Ich führe Gramps in die Landhausküche, ziehe ihm einen Stuhl zurück und drücke ihn nach unten, damit er sich setzt. Anschließend suche ich in den Schränken nach der Backmischung, krame mich durch längst abgelaufene Lebensmittel, die ich dringend mal ausmisten muss, und finde sie schließlich hinter einer Packung Roggenmehl.
Die Kaffeemaschine läuft bereits, und ich weiß, dass Gramps den besten Kaffee dieser Welt zubereitet. Der Duft wabert durch die komplette Küche und lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.
»Ich schätze, ich werde diese Woche wieder Unterricht geben«, sage ich möglichst beiläufig, auch wenn in mir wildes buntes Konfetti sein Unwesen treibt. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe die Menschen, und ich denke, dass es gut für mich wäre.
»Das weiß ich doch längst, Nut«, sagt Gramps lachend und sieht mir dabei zu, wie ich emsig die Zutaten für den Brotteig in eine große Schüssel schütte und mit den Händen verknete, nachdem ich sie gewaschen habe.
»Ach ja? Woher? Hast du mich schon länger im Stall belauscht?« Ich sehe Gramps von der Seite an, wie er mit der Zeitung in der leicht zittrigen Hand am Tisch sitzt und mich mit einem Grinsen bedenkt, das ihn trotz seiner zweiundachtzig Jahre so kindlich wirken lässt.
»Nö«, antwortet er, und sein Grinsen wird breiter.
Ich runzle die Stirn.
»Aber wenn du mich nicht belauscht hast, woher weißt du es dann?«
Gramps lehnt sich auf dem Stuhl zurück und richtet seine Brille, weil sie ständig leicht nach unten rutscht. »Ich wusste vermutlich schon vor dir, dass du wieder bereit bist, Nut. Du hast dir die Zeit genommen, die du brauchtest, und das war auch gut so. Aber in den letzten Tagen warst du wie ein hektisches Wiesel, das von A nach B gerannt ist, um sich irgendwie zu beschäftigen.«
Ich denke kurz über seine Worte nach und nicke abwesend. Er hat recht, selbst in der Uni habe ich mir Aufgaben vorgenommen, die gerade überhaupt nicht wichtig waren.
»Dir fehlt das Unterrichten, und immer, wenn dir etwas fehlt, wirst du zum Wiesel. Also wusste ich, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der Knoten platzt.«
»Du kennst mich wirklich besser als ich mich selbst.« Wieder ist da dieses Kribbeln in meinem Bauch, das die Vorfreude auf ein neues Level hebt. Normalerweise gebe ich montags, mittwochs und freitags Kurse, aber da heute Montag ist und die Teilnehmenden sicher nicht damit gerechnet haben, dass ich wieder zurück bin, werde ich mich wohl bis Mittwoch gedulden müssen. Ich setze auf meine innere To-do-Liste, dass ich gleich nach dem Frühstück und der Dusche eine Nachricht in die Gruppe schicken werde, in der ich mitteile, dass die Kurse ab Mittwoch wieder regelmäßig stattfinden werden. Einige werden inzwischen sicher woanders unterrichtet, weil die Welt nun mal nicht auf Hazel Parker wartet, aber wenn ich nur ein paar vertraute Gesichter sehe, ist das Grund genug zur Freude.
Als das Brot im Backofen und der Kaffee durchgelaufen ist, stelle ich Gramps seine Lieblingstasse vor die Nase und setze mich ihm gegenüber. Sein warmer Blick ruht auf mir.
»Ich bin wirklich stolz auf dich, Nut.«
»Danke, Gramps.«
Ich schätze, ich bin auch stolz auf mich.
2
Cameron
Es könnte so leicht sein. Kontaktliste aufrufen, seinen Namen anklicken, der in der Liste ganz oben steht, und auf »blockieren« klicken. Und schon hätte ich meine Ruhe, könnte mich weiter auf meine Zeichnung konzentrieren und müsste mich nicht mit dem schlechten Gewissen befassen, das mir seine Nachrichten machen werden, wenn ich sie öffne. In den letzten Wochen habe ich hellseherische Fähigkeiten entwickelt und weiß, auch ohne mein Handy in die Hand zu nehmen, was in seinen Nachrichten drinsteht.
Alter, lebst du noch?
Könntest ja wenigstens mal ein Zeichen von dir geben, damit ich nicht die Polizei in deine Wohnung schicke.
Stinkt der Hausflur vielleicht schon nach deiner Leiche?
Soll ich mir lieber die Nase zuhalten, wenn ich dich besuchen komme?
Weißt du schon, wo du beerdigt werden willst?
So in der Art. Andrew ist mein bester Freund seit der Highschool, aber früher war er nie so eine verdammte Nervensäge. Was vermutlich daran liegt, dass ich ihm früher immer geantwortet habe, wenn er etwas von mir wollte, und ihm in letzter Zeit aus dem Weg gehe.
Der Kohlestift rast in meinen Fingern über das Strukturpapier, die schwarzen Striche verbinden sich zu Formen, die ich umgehend rückgängig machen will. Scheiße. Wieder ein Tag, an dem nichts so funktioniert, wie ich es will. Nicht nur das Papier ist schwarz, auch meine Finger und die Außenseite meiner Hand sind von Kohle beschmiert, sodass ich nicht einmal das Gesicht in den Händen vergraben kann, um im Selbstmitleid zu versinken. Es kotzt mich selbst an, und ich bin froh, dass ich mich nicht als Außenstehender betrachten und das Elend mit eigenen Augen sehen muss. Außer morgens, wenn ich notgedrungen in den Spiegel sehe, meide ich meinen Anblick, so gut es geht.
Wieder vibriert mein Smartphone auf dem Tisch neben mir. Und wieder. Und wieder. Vier neue Nachrichten in zehn Minuten. Ich schätze, Andrew ist auf neuer Rekordjagd. Widerwillig lasse ich meinen Stift fallen, wische mir die Hand an der dunklen Jogginghose ab und schnappe mir das Handy, um den Bildschirm zu entsperren.
Andrew: Guten Morgen, Sonnenschein. Muss was mit dir besprechen, bist du wieder von den Toten auferstanden?
Meine Kiefer malmen, weil mir dieser harmlose Witz – dieses dämliche Sprichwort – einen heftigen Seitenhieb verpasst.
Andrew: Ich lebe noch, Drew. Und du bist auch mein Sonnenschein an kalten Tagen! Was kann ich für dich tun, mein Herzblatt?
Ich verdrehe die Augen, als ich mir einbilde, seine Stimme zu hören, die einige Oktaven nach oben schießt, während er mich nachmacht. In letzter Zeit kam er auf die glorreiche Idee, sich immer selbst auf seine Nachrichten zu antworten, wenn ich es nicht mache. Habe ich schon erwähnt, dass er nervig ist?
Andrew: Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste die Beerdigung planen und einen Song für die Beisetzung aussuchen. Nur mal so aus Interesse: Lieber was Peppiges oder eher was zum Heulen?
Andrew: Okay … Spaß beiseite. Ich stehe vor deiner Tür und habe schon zum dritten Mal geklingelt. Der Kaffee ist sicher gleich kalt, und ich glaube, wir müssen die Hersteller dieser Lichtklingel verklagen, denn das Teil scheint nicht zu funktionieren. Soll ich die Typen mal anrufen?
Scheiße, er ist hier? An einem Mittwochmorgen? Muss er nicht arbeiten oder so? Ich lasse mich tiefer ins Polster meines unbequemen Sofas sinken und denke darüber nach, wie ich Andrew loswerden kann, auch wenn er mein bester Freund ist. War. Keine Ahnung. Im Moment weiß ich nicht mehr, was wir sind und was nicht. Wieso sollte jemand mit mir befreundet sein wollen? Ich habe die verdammte Lichtklingel ausgestellt, weil ich keine Lust hatte, Besuch zu empfangen. Seit Monaten versucht meine Mom ständig, dieses Apartment auf den neuesten Stand der Technik für Menschen wie mich zu bringen. Für Menschen, die nichts hören können.
Oh, und wie ich hören kann. Meine Gedanken sind lauter als je zuvor und gehen mir mächtig auf den Sack. Erst als das Handy in meiner Hand erneut vibriert, widme ich mich wieder dem Chat mit Andrew. Soll ich ihn reinlassen oder einfach so tun, als wäre ich unterwegs? Dabei ist der Gedanke absurd, immerhin war ich seit Wochen nicht wirklich in der realen Welt, außer zum Einkaufen. Und das weiß mein bester Freund genauso gut wie ich, deshalb wäre es sinnlos, ihm was vorzuspielen. Ich könnte ihn weiter ignorieren, wie ich es seit Wochen mache, aber irgendwie funktioniert diese Masche nicht sonderlich gut.
Andrew: Ich kann dein schlechtes Gewissen bis in den Hausflur riechen, Alter. Jetzt mach mir die verdammte Tür auf!
Genervt feuere ich das Handy in die Ecke des Sofas, das ich mir unter anderen Umständen niemals ausgesucht hätte. Ich mag es eher gemütlich und nicht spießig, aber dieses Apartment ist im Besitz meiner Familie und war bereits vollständig möbliert, als ich hier einzog. Mitsamt riesiger Küche voller High-End-Geräte, die ich noch nicht mal mit dem Arsch genauer angesehen habe und auch nie ansehen werde, weil Kochen und Backen nicht auf der Liste der Dinge stehen, die ich gerne mache. Generell ist diese Liste mittlerweile mickrig klein geworden. Ich liebe das Zeichnen immer noch, habe aber anscheinend selbst das verlernt. Genauso, wie ich es verlernt habe, zu leben. Klingt vielleicht melodramatisch, ist aber die Wahrheit.
Dieses Loft hat neben der Schickimickiküche eine Klimaanlage. Die ist das einzige Gimmick, für das ich wirklich dankbar bin, vor allem in den heißen Sommermonaten.
Mein Blick wandert zur Wohnungstür, die ich vom Sofa aus sehen kann, und ich weiß, dass ich es einfach hinter mich bringen sollte. Also stehe ich auf, schlurfe durch das geräumige Wohnzimmer Richtung Flur und öffne die Tür. Mich empfängt das Tausend-Watt-Lächeln von Andrew Miller, und sofort will ich die Tür wieder schließen. So viel gute Laune kann ich so früh am Morgen nicht ertragen. Genau genommen ertrage ich sie auch mittags oder abends nicht, und das weiß er auch. Schon früher war ich ein Morgenmuffel, aber inzwischen mache ich meine schlechte Laune nicht mehr von der Tageszeit abhängig.
Andrews Haare sind länger als bei seinem letzten Besuch, inzwischen trägt er sie zu einem kleinen Zopf gebunden, was ihm einen Surferlook verleiht, auf den die Frauen sicher wahnsinnig stehen. Im Grunde genommen waren sie schon immer scharf auf ihn, egal mit welcher Frisur. In der Highschool war ich sein Wingman, aber ich wurde ziemlich schnell gefeuert, weil er mich zum Flirten nicht wirklich brauchte.
Mein bester Freund hat einen Coffee-to-go-Becher in der rechten und eine Tüte vom Bäcker in der linken Hand. Beides hält er jetzt in die Höhe und somit direkt vor meine Linse, als müsse er so sichergehen, dass ich seine Mitbringsel auch wirklich sehen kann. Am liebsten würde ich ihn sarkastisch daran erinnern, dass ich vor einem halben Jahr zwar mein Gehör, aber nicht mein Augenlicht verloren habe. Dafür müsste ich jedoch den Mund öffnen. Worte formen. Worte sagen. Worte nicht hören. Und deshalb trete ich einfach nur zur Seite und lasse ihn reinkommen.
Sobald ich wieder auf meinem Platz sitze, bereue ich schon, dass ich nachgegeben habe. Ich fühle mich wie der Arsch des Jahres, aber ich bin einfach nicht in der Stimmung für Besuch.
An meinem Hintern spüre ich, dass mein Handy wieder vibriert, und weil Andrew genau vor mir steht und mich mit seinen laserartigen Blicken mustert, greife ich schließlich danach.
Andrew: Siehst scheiße aus, Cam.
Cameron: Danke, weiß ich selbst. Was willst du hier?
Ich hebe den Blick nicht, während ich auf seine Antwort warte, weil ich weder Vorwürfe noch Mitleid in seinen babyblauen Surferaugen sehen will. Reicht schon, dass meine Mutter mich ständig so mitleidig ansieht, wenn sie herkommt. Es geht mir gut. So gut, wie es mir nach allem, was passiert ist, halt gehen kann. Die Sache ist: Niemand weiß, was wirklich passiert ist, weil ich nicht darüber rede. Nicht darüber reden kann, weil es zu sehr wehtun würde. Und weil ich dann meiner Mutter und Andrew Dinge erzählen müsste, die ich so lange für mich behalten habe.
Alle Menschen, die mir nahestehen, glauben, dass ich aufgrund meines Hörverlustes nicht sprechen möchte, aber das ist nicht die Wahrheit. Ich habe über zwanzig Jahre meines Lebens jeden einzelnen Tag gesprochen, und ich weiß schließlich immer noch, wie es geht. Aber es ist so verflucht schwer, das Gewicht auf meinem Herzen in die richtigen Worte zu packen. Deshalb fällt mir das Schreiben deutlich leichter. Andrew und Mom sind diejenigen, die unter meinem Entschluss leiden müssen, denn ich bin wirklich nicht der angenehmste Chatparnter.
Würde das Cochlea-Implantat, das mir Dr. Brooks nach dem Unfall ans Herz gelegt hat, nicht wahnsinnig viel Asche kosten, hätte ich mich vielleicht längst für die OP entschieden. Aber solange ich keine fünfzig Riesen zusammenhabe, steht die Operation nicht zur Debatte, da meine Versicherung den Eingriff nicht übernimmt.
Andrews nächste Nachricht reißt mich aus meinem Gedankenstrudel, in dem ich mich inzwischen schon richtig heimisch fühle.
Andrew: Dafür sorgen, dass du mir nicht vom Fleisch fällst. Achtung, ich schmeiß dir jetzt die Croissants an den Dickschädel, nicht erschrecken.
Sekunden später trifft mich die Tüte, und ich bin dankbar, dass er mich wenigstens vorgewarnt hat. Seit ich es nicht mehr hören kann, wenn sich mir jemand nähert, bin ich ziemlich schreckhaft geworden. Ich schnappe mir die Tüte und lege sie zur Seite, weil ich keinen Hunger habe. Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal etwas gegessen? Gestern Morgen? Vorgestern Abend? Andrew hat sich inzwischen auf die Lehne des zum Sofa passenden Sessels gehockt und tippt wieder auf seinem Handy.
Andrew: Und ich wollte dir sagen, dass deine Mutter mich angerufen hat.
Verstohlen schielt er zu mir herüber und verfasst blind eine zweite Nachricht, die mich Sekunden später erreicht.
Andrew: Und sie hat geweint.
Augenblicklich setze ich mich kerzengerade hin und starre meinen Freund an. Sieht er die Fragezeichen in meinem Gesicht? Wenn ja, ignoriert er sie und wartet darauf, dass ich ihn um mehr Infos bitte.
Cameron: Warum weint sie am Telefon, und warum ruft sie ausgerechnet dich an? Ist etwas passiert?
Andrew: Sie ruft mich an, weil man mit dir in letzter Zeit nicht sonderlich viel anfangen kann. Ich schätze, sie macht sich Sorgen um dich.
Cameron: Sie muss sich keine Sorgen um mich machen. Und du auch nicht. Ich komme klar und zeichne sogar wieder. Siehst du?
Mit zwei Fingern schiebe ich ihm das grässlich hässliche Bild hin, das er mit einem schmalen Lächeln betrachtet. Ich sage ihm nicht, dass ich alles, was ich zeichne, ein paar Minuten später in den Müll schmeiße, weil ich es anscheinend nicht mehr draufhabe. Das, was aufs Papier fließt, ist genauso wirr und düster wie meine Gedanken. Früher konnte ich das Zeichnen immer als Ventil nutzen, damit es in meinem Kopf sortierter wird, aber inzwischen will diese Taktik nicht mehr funktionieren. Und das belastet mich fast am meisten.
Andrew: Du solltest ihr so was zeigen, Mann.
Cameron: Werde ich. Bald.
Andrew rutscht jetzt von der Lehne des blaugrauen Sessels herunter, sodass er richtig vor mir sitzt. Seine Beine in den hellgrünen Bermuda-Shorts stellt er weit auseinander. Habe ich erwähnt, dass mein bester Freund auch im Winter immer kurze Hosen trägt? Da würde sich jeder andere Kerl trotz des recht milden Winters in Texas die Eier abfrieren, aber Andrew sagt immer, dass er frische Luft an den Waden braucht.
Andrew: Außerdem hat sie mir einen Link geschickt von einem Kurs, den du dir mal ansehen solltest.
Natürlich weiß ich auch ohne nachzufragen, welche Art von Kurs Andrew meint, und sofort spannt sich mein ganzer Körper an. Wie oft habe ich schriftlich mit Mom diskutiert, weil sie nicht einsehen wollte, dass ich keine Lust darauf habe? Schon als sie mir zum ersten Mal sagte, dass sie so einen Kurs für mich besucht, wollte ich sie davon überzeugen, dass es keinen Sinn hat, aber sie ging trotzdem jede Woche dorthin.
Cameron: Kein Interesse. Wieso erzählst du mir das, Mann? Du weißt doch, dass ich das nicht will.
Andrew bläst seine Backen auf und kratzt sich am Hinterkopf, wobei sich einige Strähnen aus seinem Zopf lösen. Er starrt das Handy in seinen Händen an, tippt, löscht, tippt, pausiert, löscht, tippt wieder. So unsicher ist Andrew sonst nie, also habe ich Angst vor seiner nächsten Nachricht.
Andrew: Ich sage dir das, weil ich an den kleinen Teil in dir appelliere, der kein gigantisches Arschloch ist. Deine Mutter geht auf dem Zahnfleisch, Cam. Ihr Anruf gestern war nur einer aus einer Reihe vieler. Sie weiß nicht, wie sie dir helfen soll, und ich weiß es langsam auch nicht mehr. Es wäre leichter, wenn du einfach zu diesem verdammten Kurs gehen würdest.
Sein Blick schießt nach oben, im selben Moment, in dem auch ich ihn ansehe. Sehe ich da Tränen in seinen Augen, oder sind es Tränen in meinen? Fuck, ich weiß es nicht, aber meine Brust fühlt sich auf einmal an, als würde ein Elefant auf ihr herumtrampeln und jegliche Luft aus meiner Lunge drücken. Wir halten den Blickkontakt noch ein paar Sekunden, bevor er wieder tippt.
Andrew: Geh wenigstens ein paar Mal hin und sieh es dir an, Alter. Es würde alles einfacher machen. Ich sags ja nur.
Mit dieser Nachricht steht er auf und legt mir im Vorbeigehen kurz die Hand auf die Schulter. Sanft drückt er zu, bevor er aus meinem Blickfeld verschwindet und ich seine vorletzte Nachricht noch zweimal lese. Andrew muss inzwischen meine Wohnung verlassen haben, und Sekunden später erreicht mich eine neue Nachricht von ihm mit einem Link zu einer Website. Mein Daumen verharrt über dem blau unterlegten Link, und alles in mir sträubt sich dagegen, ihn anzuklicken.
Ich will die Gebärdensprache nicht lernen.
Ich will nicht in einem bescheuerten Kurs sitzen und wieder zum Schüler werden, obwohl ich fünfundzwanzig bin. Dennoch überwinde ich mich, klicke den Link an und warte, bis sich die Website aufgebaut hat. Auf der ersten Seite überfliege ich die Zeilen nur, weil ich gar nicht richtig bei der Sache bin und es mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert, was da geschrieben steht. Bis ich das Bild einer jungen Frau sehe, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht wie ein verfluchter Magnet.
Sie hat braune Haare, die ihr in großen Wellen über die Brüste fallen, ein hübsches Gesicht mit weichen Zügen und einem ziemlich süßen Lächeln. Vor ein paar Jahren hätte ich diesen Kurs allein wegen dieser Frau besucht, weil sie genau meinem Beuteschema entsprach. Aber jetzt ist alles anders. Ich starre ihr Foto noch einen Moment an, bevor ich den Text daneben überfliege.
Hazel Parker, einundzwanzig Jahre alt, macht ein Studium zur Gebärdensprachdolmetscherin an der Lamar University und hat einen gehörlosen Bruder … Ich presse meine Zähne fest aufeinander, fahre mir mit der kohlefreien Hand übers Gesicht und halte mir die geballte Faust anschließend vor den Mund.
Andrew hat recht. Ich bin nicht nur ihm, sondern auch Mom gegenüber unfair. Sie hat sich in den letzten Monaten den Arsch für mich aufgerissen – okay, eigentlich hat sie das schon lange davor getan. Mein ganzes Leben lang war sie für mich da. Als Dad uns verlassen hat. Als ich mit dieser Wut in mir nicht klarkam, weil er ohne eine richtige Erklärung verschwunden ist. Als ich meinen ersten Liebeskummer hatte. Als ich eines Morgens wach wurde und beschloss, mein Kunststudium zu schmeißen und zur Army zu gehen. Sie ist nie von meiner Seite gewichen, obwohl sie gerade Letzteres nie wirklich verstehen konnte. Und mein Dank ist, dass ich nicht einmal in Erwägung ziehe, für sie in einen verdammten Kurs zu gehen?
Wieder sehe ich mir das Bild der Kursleiterin an, die vier Jahre jünger als ich ist und ihr Leben anscheinend wahnsinnig gut im Griff hat. Zumindest liest es sich in dem kurzen Abschnitt neben dem Foto so. Auf einmal fühle ich mich erbärmlich, aber das ist kein neues Gefühl für mich, es begleitet mich seit einem Jahr täglich. Gott, ich ertrage mich wirklich selbst nicht mehr lange.
Ich schließe die Augen, lasse alles im Schwarz meiner Gedanken verschwinden und atme tief durch. Ich kann ihn zwar nicht hören, aber ich bin mir sicher, dass mein Atem rasselt. Es ist nur ein Kurs, Mann. Nur ein Versuch, um Mom irgendetwas zurückgeben zu können. Und damit Andrew Ruhe gibt.
Ich hasse es, dass meine Mutter ihn anruft, wenn es ihr schlecht geht, und doch weiß ich, dass er im Moment viel besser für sie da sein kann als ich. Da wir in der Highschool beinahe jeden Tag zusammen verbracht haben, ist Andrew wie ein zweiter Sohn für sie. Ein Sohn, der nicht so ein Wrack ist wie ich.
Keine Ahnung, wie lange ich hier mit geschlossenen Augen sitze und einen Kampf mit meinen Gedanken ausfechte, aber als ich die Lider aufschlage, hat sich mein Handy schon wieder gesperrt, was bedeutet, dass ich mindestens fünf Minuten so dagesessen habe. Ich wische über das Display, scrolle erneut durch die Website und suche nach einer Info darüber, wann diese Kurse stattfinden. Noch während ich das mache, schlingt sich eine eiserne Faust um mein Herz und gleichzeitig um meine Kehle. Weil weder Andrew noch Mom wissen, wieso ich mich so sehr dagegen wehre, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Es mir zurückzuholen, nachdem es mir brutal entrissen wurde. Sie glauben, dass ich nicht mit ihnen rede, weil ich meine eigene Stimme nicht mehr hören kann. Aber das ist nicht der Grund für mein Schweigen, das war es nie. Ich könnte noch heute mein Handy in die Hand nehmen, meiner Mutter schreiben, dass sie herkommen soll, und ihr anschließend sagen, dass es mir leidtut. Dass ich sie liebe. Aber es geht nicht.
Ich schweige nicht, weil ich mein Gehör verloren habe. Damit komme ich irgendwie klar.
Ich schweige, weil ich Angst davor habe, wieder zu sprechen. Egal in welcher Sprache.
3
Hazel
Die Vorfreude von Montag hat sich zwei Tage später in blanke Nervosität verwandelt. Eine Nervosität, die sich heute Morgen genauso schlecht bändigen ließ wie meine Mähne. Nachdem ich vier verschiedene Frisuren ausprobiert habe und sie mir alle nicht gefielen, habe ich meine Haare einfach zu einem Pferdeschwanz nach oben gebunden und mir anschließend während des Frühstücks permanent Mut zugesprochen. Mut für den Tag, Mut für den Unterricht, Mut für die ganze Woche.
Ich habe keine Angst davor, dass ich das Unterrichten im letzten halben Jahr verlernt haben könnte, dafür lerne ich in meinem Studium und im Umgang mit meinem Bruder viel zu viel.
Als Jamie auf die Welt kam, war ich zwölf, und mein Leben sah vermutlich wie das der meisten Teenager in meinem Alter aus. Ich fing an, mich für Jungs zu interessieren, hatte aber neben meiner Grandma niemanden, mit dem ich darüber wirklich offen reden konnte. Meine Mutter war viel zu selten zu Hause und interessierte sich eigentlich immer nur für eine Sache, wenn ich aus der Schule kam: meine Noten. Waren sie gut, war sie zufrieden. Waren sie schlecht, strafte sie mich mit Schweigen. Damals wusste ich nicht, dass es auch Eltern gibt, die anders sind als Mom. Dass es auch Eltern gibt, denen Leistung nicht so wichtig ist. Bis Grandma mir zeigte, dass ich als Mensch viel wichtiger bin als irgendwelche Schulnoten.
Freundinnen hatte ich zwar, aber die meisten davon waren – im Nachhinein betrachtet – ziemlich schlecht darin, gute Freundinnen zu sein. Sie konnten beim besten Willen nicht verstehen, wieso ich mich so sehr auf die Geburt meines kleinen Bruders freute und sogar den errechneten Termin in meinem Schulkalender eintrug, damit ich die Tage zählen konnte.
Zu sagen, dass die Geburt meines Bruders ein Wunder für mich war, wäre also vollkommen untertrieben. Und als ich Jamie zum ersten Mal in die neugierigen Babyaugen sah und ihm in die süßen Bäckchen kneifen konnte, war es vollkommen um mich geschehen. Es dauerte nur wenige Wochen, bis die Ärzte bei den Untersuchungen merkten, dass etwas nicht mit ihm stimmte. Er reagierte nicht auf die Geräusche in seiner Umgebung, wie es andere Babys in seinem Alter taten. Unsere Stimmen konnten Jamie nie beruhigen, wenn er lauthals schrie – was sehr oft vorkam –, und so dauerte es nicht lange, bis mein Vater die Nerven verlor und sich aus dem Staub machte. Das ist jetzt knapp ein Jahrzehnt her, und ich habe seit diesem Sonntag im Januar nie wieder etwas von ihm gehört oder gesehen.
Ich vermisse ihn nicht, weil er ohnehin selten zu Hause war, aber ich hätte Jamie einen Vater gewünscht, der ihn so akzeptieren und lieben kann, wie er ist.
Sobald meine Mutter sich einigermaßen mit seiner Gehörlosigkeit abgefunden hatte, fing ich an, zu recherchieren. Ich wollte wissen, wie ich Jamie den Start ins Leben leichter machen konnte. Wie ich ihn beruhigen oder wie ich ihm Geschichten vortragen konnte, ohne dass er dafür seine Ohren brauchte.
Und so fing ich im Alter von vierzehn Jahren an, mir die Gebärdensprache beizubringen. Anfangs allein mithilfe von Büchern, die ich mir in der Stadtbibliothek ausgeliehen hatte. Später belegte ich an meiner Schule American Sign Language als Schulfach und ging parallel dazu in einen Nachmittagsunterricht.
Mein Blick geht über das dunkelrote Backsteingebäude vor mir, klettert an der Fassade empor und bleibt an dem heute ziemlich bewölkten Herbsthimmel hängen. Der Unterricht findet in Beaumonts ehemaliger Feuerwache statt und ist in zwei Klassen aufgeteilt. Ich leite den Anfängerkurs und weiß noch genau, wie überfordert man sich gerade zu Beginn fühlt. So wie bei jeder Sprache, die man lernt. Im Grunde genommen ist es nichts anderes, und doch werden gehörlose Menschen, die über Gebärden kommunizieren, immer noch häufig wie Außerirdische angesehen.
Ich wische mir den Schweiß von den Handflächen, gehe auf die dunkelrote Doppelflügeltür zu und betrete das Gebäude. Sobald meine Schritte in den hohen Fluren widerhallen, kriecht die Nervosität noch etwas höher und macht es sich in meiner Kehle bequem. Gott, ich hoffe, sie legt sich gleich wieder. Ich weiß, dass es der richtige Zeitpunkt ist, um wieder anzufangen, also wieso habe ich solche Angst? Und wovor? Davor, einen Fehler zu machen? Nach der Stunde zu merken, dass meine Euphorie nur ein Hirngespinst war und ich eher Rück- statt Fortschritte mache?
Ich komme schließlich im zweiten Stock an, in dem der Beginnerkurs stattfindet, und meine Zweifel sind wie weggeblasen, als ich die kleine Alice und ihre Mutter Naomi vor dem Raum warten sehe. Die beiden kamen vor einem Jahr zum ersten Mal hierher, nachdem Alice vor zwei Jahren durch einen Virus beinahe ihr komplettes Gehör verloren hat. Seitdem hat sie einen hohen Grad der Schwerhörigkeit, der zwar mit einem Hörgerät verbessert, aber nicht aus der Welt geschafft werden kann. Die Kleine kann damit immerhin laute Geräusche wie eine Hupe wahrnehmen, was vor allem im Straßenverkehr ziemlich hilfreich ist und Leben retten kann.
»Sieh mal, mein Schatz. Da ist Hazel!« Die Mutter von Alice gebärdet ihre Worte und deutet anschließend in meine Richtung. Umgehend dreht sich das blonde Mädchen zu mir um und sprintet los, als hätte es seit Jahren auf diesen Moment gewartet. Sie breitet ihre Arme zu beiden Seiten aus, und ich gehe vor ihr in die Hocke, damit ich sie auffangen kann. Alice vergräbt ihr Gesicht an meiner Schulter und drückt mich so fest, wie es eine Siebenjährige kann.
Sobald wir uns voneinander gelöst haben, begrüße ich sie per Gebärde und spreche die Sätze dabei laut aus. Das mache ich immer, wenn ich sowohl von hörenden als auch gehörlosen Menschen umgeben bin.
»Es ist so schön, dich zu sehen, meine Kleine. Wie geht es dir?«, frage ich sie und merke, wie ein breites Grinsen über mein Gesicht huscht, weil jegliche Nervosität verschwunden ist, als wäre sie nie da gewesen. Manchmal reicht ein Kinderlachen aus, um Zweifel im Keim zu ersticken, das weiß ich von Jamie am allerbesten. Egal wie schwer manche Tage in den letzten Monaten auch waren, ein Lächeln meines Bruders hat die Regenwolken in mir immer etwas beiseitegeschoben und der Sonne Platz gemacht.