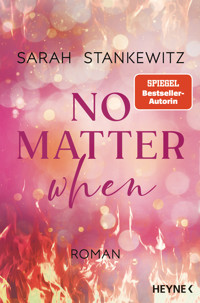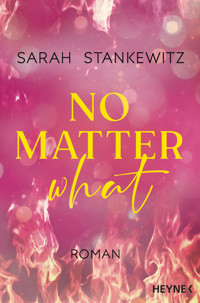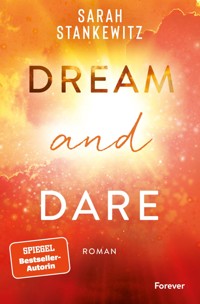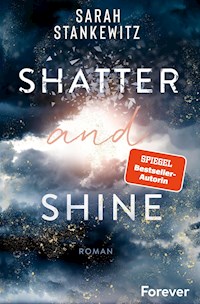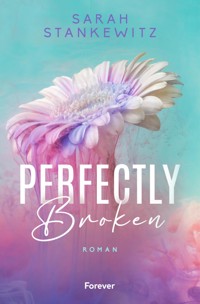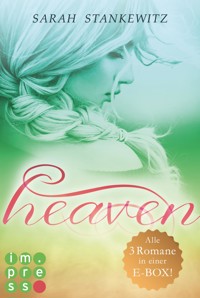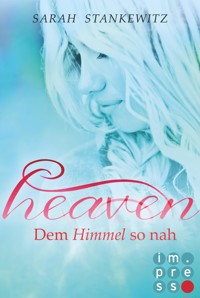12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Strong Hearts
- Sprache: Deutsch
Zurück an Islands Strände, zurück zur dramatischsten Liebesgeschichte des Jahres Hals über Kopf hat Lilly Island verlassen, als sie von Arons Lüge erfahren hat. Jetzt sitzt sie verloren bei ihrer Großmutter auf Sylt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Bis sie eine Nachricht von SaveTheIceland bekommt, die sie daran erinnert, dass ihr Herz längst für das karge Land im Nordatlantik schlägt. Genau wie für Aron, dem derweil die Zeit davonläuft und der seinen Augen nicht trauen kann, als Lilly eines Abends wieder vor ihm steht. Während in Island endlose Tage für die beiden anbrechen, schwindet die Hoffnung auf ein Spenderherz für Aron mit jedem Tag mehr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Shine Like Midnight Sun
Sarah Stankewitz, geboren 1994, war Bankkauffrau, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Seit ihrem Debüt 2015 lässt sie ihrer Fantasie freien Lauf und begeistert ihre Leser:innen mit ihren dramatischen Geschichten über Liebe, Verlust und Leidenschaft. Wenn sie nicht schreibt, bloggt sie auf TikTok und Instagram über ihr Leben als Autorin. Sarah Stankewitz lebt mit ihrem Freund in einer kleinen Stadt in Brandenburg.
Hals über Kopf hat Lilly Island verlassen, als sie von Arons Lüge erfahren hat. Jetzt sitzt sie verloren bei ihrer Großmutter auf Sylt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Bis sie eine Nachricht von SaveTheIceland bekommt, die sie daran erinnert, dass sie in ihrem Leben etwas bewirken kann. Für Aron läuft derweil die Zeit davon. Und während in Island endlose Tage anbrechen, schwindet seine Hoffnung auf ein Spenderherz mit jedem Tag mehr …»Emotional, authentisch, mitreißend: Lillys und Arons Geschichte geht über alle Grenzen hinaus und zeigt uns, dass es sich immer lohnt, für die wahre Liebe zu kämpfen.« herzimbuch
Sarah Stankewitz
Shine Like Midnight Sun
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin1. Auflage Oktober 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenAutorenfoto: © Tina WendtE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN978-3-95818-843-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Phase ISchock
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Phase IIGlauben
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Phase IIIAkzeptanz
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Epilog
Anhang
Danksagung
Leseprobe: Perfectly Broken
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Motto
Und auf einmal wurde aus einemDavoreinDanach.Prolog
Aron
Vergangenheit
Notiz an mich selbst: Träume platzen nicht nur.Manchmal sterben sie auch.
Mein Herz hat aufgehört zu schlagen.
Einfach so.
In einer Sekunde hat es noch voll Adrenalin hinter meinem Brustbein gewütet, in der nächsten … war da Stille. Ich weiß nicht, wie lang, geschweige denn, wieso es passiert ist. Ich weiß nur, dass es verflucht beängstigend ist, zu merken, wie schnell alles vorbei sein kann. In einem Moment fühlst du dich noch wie der König der Welt, und schon im nächsten liegst du in einem unbequemen Krankenhausbett und kannst dich kaum bewegen, weil dir jede Regung wehtut.
Mein Unfall ist inzwischen eine Woche her, und noch immer kann ich nicht ganz verstehen, was an diesem Morgen wirklich geschehen ist. Da ist nur dichter Nebel in meiner Erinnerung. Alles, was ich weiß, ist das, was Elva mir erzählt hat. Laut meiner besten Freundin habe ich urplötzlich mein Bewusstsein verloren, bin mit der Schulter auf einen Eisbrocken geknallt und ins Wasser gestürzt. Sie war diejenige, die mich an Land gezogen und wiederbelebt hat. Ohne meine beste Freundin wäre ich jetzt nicht mehr hier, nicht mehr am Leben.
Nach der Operation an meiner verletzten Schulter wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt, aber bisher hat mir noch niemand die Ergebnisse mitgeteilt. Der Blick des Docs auf der anderen Seite des ordentlich sortierten Tisches spricht Bände. Meine Schonfrist ist wohl offiziell vorbei.
Er hat mich heute Morgen in sein Büro zitiert, weil er mit mir reden müsse. Mir ist jetzt schon klar, dass dieses Gespräch kein gutes werden wird. Links neben mir sitzt meine Mutter, die nervös ihre Hände knetet und den Blick auf die Tischplatte vor uns gerichtet hat. Rechts meine Freundin Jóhanna, die mir seit dem Unfall nicht von der Seite gewichen ist, weil sie furchtbare Angst davor hat, dass mein Herz wieder seinen Dienst quittiert und dieses Mal endgültig. Wie viel Angst mir dieser Gedanke macht, behalte ich für mich.
»Also, Doc. Wann kann ich wieder aufs Wasser?« Obwohl ich erst seit ein paar Tagen an dieses Krankenhausbett gefesselt bin, fehlt mir das Surfen schon jetzt wie verrückt. Wenn ich sage, dass ich den Sport wie die Luft zum Atmen brauche, klingt es vielleicht abgedroschen, aber es ist schlicht und ergreifend die Wahrheit.
»Das wird jetzt vermutlich schwer zu verdauen sein, und ich hasse es, solche Nachrichten zu übermitteln, vor allem bei so jungen Menschen wie dir.« Er räuspert sich, als hinge ihm ein fetter Kloß im Hals. Dabei bin doch ich derjenige, dessen Welt gleich von einem wildfremden Vierzigjährigen aus den Angeln gerissen wird.
»Nun sagen Sie es schon«, fleht meine Mutter. »Was fehlt meinem Sohn?«
Unter dem Tisch spüre ich Jóhannas warme Hand auf meinem Oberschenkel, aber ich bin nicht in der Lage, sie zu nehmen. Dafür bin ich viel zu sehr damit beschäftigt, den entschuldigend dreinblickenden Doktor mit meinen Blicken aufzuspießen. Er wird in den nächsten Sekunden mein Leben ruinieren, das spüre ich. Seine Antwort entscheidet darüber, wie ich dieses Zimmer im Anschluss verlassen werde. Ob als gesunder, junger Mann oder jemand, dessen Leben nie wieder dasselbe sein wird.
»Wir hatten schon vor unseren Tests eine Vermutung, was für deinen Zusammenbruch verantwortlich gewesen sein könnte.« Er macht eine Kunstpause, die mir mächtig gegen den Strich geht. Nichts hiervon hat etwas Künstlerisches an sich. »Es ist dein Herz selbst, Aron.«
»Mein Herz.« Die beiden Worte stolpern aus mir heraus wie Steine, deren Gewichte mich wieder in die Tiefe ziehen wollen.
»Wir haben beunruhigende Rhythmusstörungen bei dir festgestellt. Die Herzkatheteruntersuchung hat unseren Verdacht leider Gottes bestätigt. Du hast eine arrhythmogene Kardiomyopathie.«
Mein verfluchtes Herz, das ich in den letzten Wochen so oft um Hilfe rufen gehört und doch konsequent ignoriert habe, wummert wieder unangenehm in meiner Brust. Das hier ist meine Quittung.
Es ging mir in den letzten Monaten des Öfteren nicht gut, aber ich habe es auf den Stress geschoben. Jetzt weiß ich, dass ich die Warnzeichen falsch gedeutet habe. Jedes Mal, wenn mir das Herz beinahe aus der Brust gesprungen ist, jedes Mal, wenn ich mich abstützen musste, um nicht umzukippen.
Arrhythmogene Kardiomyopathie.
Ich verstehe den ärztlichen Fachjargon nicht, doch allein diese beiden Worte sind so verdammt beängstigend, dass ich sie am liebsten sofort wieder vergessen würde.
»Was genau macht diese Kardiomyopathie mit mir?«
»Die genaue Ursache dieser Erkrankung wird in der Medizin bis heute noch nicht vollständig verstanden. Man geht davon aus, dass zu einem großen Teil genetische Mutationen dafür verantwortlich sind. Dein gesundes Herzmuskelgewebe wird im Laufe der Zeit durch Fett- und Bindegewebe ersetzt.« Mein Doc spricht weiter, erklärt mir, was in meinem Körper passiert, dabei kann ich ihm gar nicht mehr richtig folgen.
Meine Mutter schlägt sich die Hand vor den Mund, um ein Schluchzen zu unterdrücken, und sosehr ich sie auch trösten möchte, ich kann es nicht. Sie schüttelt vehement den Kopf, als könnte sie so verhindern, dass die Worte des Doktors wahr sind. Aber sie sind wahr, ich kann es in seinen blauen Augen lesen. Auch Jóhanna hat inzwischen zu weinen begonnen. Nur ich bleibe regungslos zwischen ihnen sitzen und vergieße keine Träne. Noch nicht. Weil ich mich fühle, als wäre ich gar nicht richtig da, als wäre ich kein Teil dieser Szene.
»Das ist natürlich erst einmal schwer zu verdauen, aber es ist jetzt umso wichtiger, die nächsten Schritte einzuleiten. Diese Form der Krankheit wird zu einem großen Teil vererbt. Gibt es in der Familie bekannte Fälle?«
»Nein«, flüstert meine Mutter atemlos. »Nicht, dass ich wüsste.«
»Wie sieht es väterlicherseits aus?«
Bei der Erwähnung meines Vaters balle ich meine Hände zu Fäusten und würde am liebsten auf etwas einschlagen. Auch wenn ich diesem Mann noch nie in meinem Leben begegnet bin, verabscheue ich ihn. Weil er meine Mutter verlassen hat, noch bevor ich auf der Welt war, und sie sich immer allein durchschlagen musste.
»Ich … ich weiß es nicht«, stottert meine Mutter.
»Was bedeutet das jetzt für mich?« Die Worte kommen kalt über meine Lippen, weil ich das alles immer noch für einen schlechten Scherz halte. Ich bin gesund. Ich bin Sportler. Das alles ergibt keinen Sinn! Ich bin erst einundzwanzig Jahre alt, verdammt!
»Ich habe hier ein paar Broschüren, damit du dich mit den Möglichkeiten vertraut machen kannst. Außerdem müssen wir noch ein paar weitere Tests durchführen, um herauszufinden, wie stark dein Herz bereits geschädigt ist.«
»Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet«, murmle ich geistesabwesend. »Wann kann ich wieder aufs Wasser?«
»Baby, das spielt doch momentan gar keine Rolle«, sagt Jóhanna entsetzt und greift nach meiner Hand, die jetzt wieder leblos in meinem Schoß liegt.
»Für mich spielt es eine große Rolle.« Mein Blick schießt zum Doktor. »Also?«
»Wir müssen dein Herz so gut wie möglich unterstützen und schonen. Die Diagnose bedeutet nicht gleich das Schlimmste, aber man muss sie ernst nehmen. Sehr ernst. Es kann sein, dass es dir in den nächsten Jahren wieder besser geht und die Symptome erst mit voranschreitendem Alter wieder schlimmer werden, aber alles in allem musst du auf dich achtgeben, mein Junge. Und das bedeutet leider auch: kein Extremsport mehr für dich.«
»Fuck!« Ich springe von meinem Stuhl auf, als hätte ich mich an ihm verbrannt, dabei sind es eigentlich die Worte des Arztes, die mir den Gnadenstoß verpassen. Jóhanna versteht nicht, wie viel mir dieser Sport bedeutet. Das Kitesurfen ist so viel mehr als ein Hobby, das man beliebig wechseln kann wie seine Unterwäsche. Es ist mein Leben.
»Komm, setz dich wieder, Aron.« Meine Mutter will nach meiner Hand greifen, doch ich halte es keine Sekunde länger in diesem Raum aus. Einem Raum, der ab jetzt für immer mit dem Tod meiner Leidenschaft in Verbindung stehen wird. Genau wie dieses Krankenhaus. Und der Diamond Beach.
Ohne meine Mutter und Jóhanna anzusehen, stürme ich aus dem Zimmer und laufe los. Ich weiß nicht, wohin, weiß nicht, wie weit. Ich weiß nur, dass ich wegmuss. Während ich über den kalten Krankenhausflur laufe, muss ich die Tränen zurückhalten.
Normalerweise würde ich jetzt mein Equipment einpacken, meinen Pick-up anschmeißen und zum Meer fahren, um aufs Brett zu steigen und meine Emotionen auf dem Wasser zu verarbeiten.
Normalerweise.
Ein Begriff, den es für mich nicht mehr geben wird.
Manche Träume zerplatzen leise wie eine Seifenblase. Aber meine nicht. Meine starben soeben mit einem lauten Knall.
Phase ISchock
Kapitel 1
Lilly
Gegenwart
Notiz an mich selbst: Zerbrechen geht schneller als Heilen.
Der Wintergarten meiner Großmutter war für mich immer der gemütlichste Ort dieser Welt. Überall befinden sich Pflanzen, deren Blätter einem mit ihrem satten Grün das Gefühl geben, mitten im Dschungel zu stehen. Auf dem Holzboden liegen mehrere flauschige Teppiche in den unterschiedlichsten Pastelltönen, und die zahlreichen Traumfänger, die von der Decke herabhängen, halten alles Schlechte von einem fern. Zumindest habe ich das bislang immer geglaubt. Doch jetzt ist alles anders.
Denn zum ersten Mal sitze ich in diesem idyllischen Plätzchen und fühle mich beim Anblick der Wellen, die wenige Meter entfernt an den Strand von Sylt schlagen, einfach nur leer. Weil Luca nicht neben mir sitzt und ich alle Fortschritte, die ich seit seinem Tod gemacht habe, in Island zurückgelassen habe. Genau wie Aron, als ich vor drei Wochen in dieses Flugzeug gestiegen bin. Ein Teil meines Herzens ist bei ihm auf der Insel geblieben.
»Hat hier jemand nach meinem berühmten Brombeertee verlangt?« Oma betritt den Wintergarten mit einem braunen Tablett, auf dem eine hellblaue Keramikkanne neben zwei geblümten Teetassen steht.
»Immer her damit, ich war schon auf Entzug«, witzle ich, aber meine Stimme bricht. Weil ich mich schuldig fühle und mir seit meiner überstürzten Abreise jeden Tag die Frage stelle, ob ich mich richtig entschieden habe. Ich musste gehen, das weiß ich. Weil ich Abstand brauchte, um zu verarbeiten, dass eine tickende Zeitbombe auf meine kleine, zerbrechliche Welt geworfen wurde. Und das bereits zum zweiten Mal!
Ich vermisse Aron. Ich vermisse ihn so sehr, dass ich nachts kein Auge zubekomme und am Tage nur an seinen Gesichtsausdruck denken kann. An das stumme Flehen, zu bleiben.
Er hat noch ein paar Mal versucht, mich zu erreichen, aber ich konnte nicht mit ihm sprechen. Konnte nicht einfach seiner Stimme lauschen, als wäre zwischen uns kein riesengroßer Graben aufgerissen.
»Ach, Kindchen.« Oma lässt sich neben mir in den geflochtenen Korbsessel fallen und gießt erst mir, dann sich selbst den heißen Früchtetee ein. »Es bricht mir das Herz, dich so traurig zu sehen. Du warst immer ein so fröhliches Kind.« Sie seufzt und legt ihre von Falten und Altersflecken gezeichnete Hand auf meinen Unterarm. »Und damit meine ich nicht, dass du nicht jedes Recht dazu hast, traurig zu sein. Du darfst traurig sein. Du darfst wütend sein. Du musst es sogar, wenn du mich fragst. Weil es gesund ist, so zu fühlen. Solange du diese Gefühle am Ende des Tages wieder loslassen und abgeben kannst.«
»An wen abgeben?«, flüstere ich und nehme einen zögerlichen Schluck meines Tees, der noch brühend heiß ist. Der Duft von frischen Brombeeren steigt mir in die Nase und mit ihm auch der Duft meiner Kindheit. Unserer Kindheit. Luca und ich haben früher jeden Sommer in diesem Haus am Strand verbracht, haben diesen Platz als unser Zuhause angesehen, obwohl wir den Rest des Jahres in Berlin lebten. Im Vergleich zu der Wohnung in Kreuzberg gab es in diesen vier Wänden immer nur Liebe und Geborgenheit – nicht nur für meinen Bruder, sondern für uns beide.
»An die Wellen«, schlägt Oma lächelnd vor. »An den Himmel. Oder etwas ganz Verrücktes: an mich?« Sie tätschelt meine Wange, und ich schmiege mein Gesicht an ihre warmen Fingerspitzen, die schon damals eine so heilsame Wirkung hatten. Die Berührung eines geliebten Menschen reicht manchmal schon aus, um der inneren Einsamkeit den Kampf anzusagen.
»Ich möchte dich nicht mit meinem Drama belasten, Oma. Du sollst deinen Ruhestand genießen.«
»Ach, papperlapapp. Wer rastet, der rostet. Ich will diesen süßen Mund wieder lächeln sehen.« Sie zwickt mir in die Wange, wie sie es schon damals immer getan hat. Mit dem Unterschied, dass ich inzwischen kein kleines Kind mehr bin. Trotzdem würde ich mich gerade am liebsten in ihre schützenden Arme werfen, mein Gesicht in ihrer geblümten Schürze vergraben und vergessen, dass ich inzwischen erwachsen bin und für meine Entscheidungen geradestehen muss, egal, wie gut oder schmerzhaft sie sich auch anfühlen. Und Aron zu verlassen war nicht nur schmerzhaft, es war niederschmetternd.
»War es falsch, zu gehen?« Ein wässriger Film legt sich über meine Sicht, und ich blicke zu meiner Großmutter auf, deren Augen selbst an grauen Tagen wie diesen wie von der Sonne geküsst leuchten. Ich musste ihr nach meiner Rückkehr von Aron erzählen. Von seiner Lüge. Von meinem Herzschmerz. Und sie hat mir stundenlang zugehört, wie sie mir schon immer zugehört hat.
»Das kann ich dir nicht beantworten, Kindchen. Glaubst du denn, dass es für dich richtig war?«
»Ich denke schon«, murmle ich. »Aber es fühlt sich so falsch an. Aron ist krank, sehr krank. Und ich habe ihn im Stich gelassen.«
»Weißt du, Lilly. Manchmal müssen wir jemand anderen für einen kurzen Augenblick im Stich lassen, damit wir uns selbst retten können. Du hast gerade erst deinen Bruder verloren. Natürlich will sich dein Herz vor einem weiteren Verlust schützen und sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Daran ist nichts verwerflich. Und nach allem, was du mir in den letzten Wochen von deinem Freund auf Island erzählt hast, wird er deine Entscheidung verstehen und respektieren.«
Ein Schluchzen bricht aus mir heraus, so wie die Wolken in dieser Sekunde aufbrechen und einen unerbittlichen Regen freigeben. Das Geräusch der Regentropfen, die auf das gläserne Dach des Wintergartens prasseln, ist irgendwie tröstlich. Ich habe es schon als Kind geliebt, dem Regen von hier bei seiner Magie zuzusehen. Im Trockenen zu sitzen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, mitten im Regen zu sein.
»Vermisst du ihn?« Meine Großmutter hat sich inzwischen einen Knäuel roter Wolle geschnappt. Die Stricknadeln in ihren Händen bewegen sich so schnell, dass ich ihren Bewegungen kaum folgen kann.
»Es gibt keine Sekunde, in der ich ihn nicht vermisse.« Ihn und sein unbeschwertes, ansteckendes Lachen. Seine tiefgrünen Augen, die eine noch schönere Farbe haben als die Blätter von Omas Monstera-Pflanzen. Seine Küsse, seine Umarmungen, seinen Optimismus, und ich frage mich, wie er ihn überhaupt so lange aufrechterhalten konnte. Er hat trotz der Diagnose sein Lachen nicht verloren.
»Er erinnert mich an ihn«, flüstere ich und sehe dabei zu, wie Omas Hände etwas für die Ewigkeit erschaffen. Wolle, die eines Tages zu Kleidung wird. Kleidung, die jemanden warm hält und Geborgenheit schenkt. »An Luca, meine ich. Die beiden haben so viele Ähnlichkeiten und jetzt auch noch diese fiese Krankheit? Ich weiß nicht, ob ich ihn je wieder ansehen kann, ohne zusammenzubrechen.«
»Manchmal müssen wir zusammenbrechen, Lilly. Damit wir im Anschluss wieder heilen können. Vielleicht werden wir danach nicht mehr derselbe Mensch sein, doch wir werden stärker sein. Echter. Ich will dir nicht sagen, was du tun sollst. Du bist alt genug. Aber ich rate dir, in dich zu gehen und auf dein Herz zu hören. Es kannte schon immer den richtigen Weg.«
»Danke«, flüstere ich und lehne meine Stirn gegen ihre. Eine Weile sitzen wir schweigend in Omas Wintergarten. Dieses Haus, dieses Grundstück, alles ist voll von Luca und seiner Abwesenheit. Und ich bin verzweifelt auf der Suche nach jedem Fleck Erde, der mich ihm wieder nahe fühlen lässt.
»Ich gehe mal kurz raus, ja?«
»Natürlich, Kindchen. Aber nimm dir einen Schirm mit, sonst wirst du mir noch krank.«
»Mach ich, Oma.« Im Vorbeigehen schnappe ich mir einen rot-schwarz gepunkteten Regenschirm aus dem Ständer, öffne die Holztür des Wintergartens und trete in den Frühlingsregen. Er trommelt seine traurige Melodie, und ich genieße das Gefühl der wenigen Tropfen, die meine Haut trotz Schirm treffen. Wünschte, sie könnten all meine Zweifel einfach von mir waschen wie wasserlösliche Farbe. Als ich die Wahrheit über Aron erfahren habe, fühlte es sich an, als wäre ich mit schwarzer Tinte übergossen.
Der Boden unter meinen Füßen schmatzt, als ich zu dem kleinen Schuppen hinübergehe, der neben dem Haus steht und in dem Luca und ich so oft als Kinder gespielt haben. Sobald ich wieder im Trockenen bin, ziehe ich die Tür hinter mir zu und knipse das Deckenlicht an. Früher war das hier unsere Festung, unser liebstes Versteck. Wir haben in diesen vier Wänden große Pläne geschmiedet, lange bevor mein Bruder seine Diagnose bekam. Wir haben hier drin gelacht, wenn wir spielten, und geweint, wenn wir uns lautstark stritten. Wir haben gelebt. Zusammen. Als Zwillinge, als beste Freunde. Ich lasse mich auf den Boden des kleinen Schuppens gleiten und lehne mich gegen die kalte Steinwand in meinem Rücken.
»Ich vermisse dich unendlich«, wispere ich und sehe mich in dem diffus beleuchteten Schuppen um. Und als mein Blick an der Wand rechts neben mir hängen bleibt, lege ich eine Hand über mein Herz. Damals hat Luca diese Wand wie eine Art Tagebuch genutzt, um auf ihr niederzuschreiben, was ihn beschäftigt hat.
Ich rutsche dichter an die Wand heran, fahre mit den Fingern über Lucas kindliche Handschrift und die Zeichnungen, die er darauf hinterlassen hat. Ein van Gogh ist definitiv nicht an meinem Bruder verloren gegangen, aber das spielt keine Rolle. Weil jedes Bild kostbar ist, allein, weil es von ihm gezeichnet wurde. Irgendwann hat Luca schließlich angefangen, auch seine Wünsche darauf niederzuschreiben. Einer dieser Wünsche zieht meine Aufmerksamkeit wie ein Magnet an.
Wenn wir groß sind, werden wir die Welt retten!
Meine Mundwinkel verziehen sich zu einem Lächeln, weil dieser Wunsch sinnbildlich für das komplette Leben meines Bruders steht. Er wollte diese Welt immer zu einem besseren Ort machen, wollte jedem Menschen und jedem Tier helfen, das in Not war. Ich fahre mit den Fingern über die Zeichnung einer kleinen Schnecke und reise gedanklich in eine Zeit, die ich mir so sehnlichst zurückwünsche.
»Luca!« Ich schniefe und laufe mit dem kleinen Tierchen in meiner geöffneten Hand in unseren Schuppen. Dicke Tränen kullern über meine Wangen und werden schneller, als mein Bruder aufspringt.
»Was ist los, Lilly?« Seine blonden Locken wippen bei jedem Schritt und sehen unfassbar witzig aus. Aber mir ist heute wirklich nicht nach Lachen zumute, jetzt nicht mehr.
»Ich b-bin auf s-sie getreten«, schniefe ich und zeige meinem Bruder die kleine Schnecke, deren braunes Haus jetzt ein großer Riss durchzieht. »Ich wollte es nicht, ich wollte doch nur durch den Garten rennen, um Oma einen Schmetterling zu zeigen! Und dann … dann hat es knack gemacht und … Ich wollte ihr nie wehtun!«
»Hey, kleine Schwester.« Luca wuschelt mir über den Kopf. »Wir können sie noch retten.«
»Können wir?« Überrascht sehe ich zu ihm auf. Zu meinem Bruder, der zwar nur wenige Minuten älter, aber trotzdem schon einen halben Kopf größer als ich ist.
»Na klar. Wusstest du, dass Schnecken Kalk brauchen, um ihren Panzer zu reparieren?« Er nimmt mir die kleine, verletzte Schnecke behutsam ab und sucht anschließend im Regal neben der Tür nach einem Behälter für sie. Sobald er einen passenden gefunden hat, reicht er ihn mir.
»Hier drin müssen wir Blätter sammeln, damit sich die Schnecke wohlfühlt. Oma muss uns ein bisschen Kalk besorgen, und dann können wir sie reinsetzen!«
»Und das klappt?«, frage ich neugierig. »Wird sie dann wieder gesund?«
»Wird sie. Ich bin Schnecken-Experte«, sagt Luca und verdreht die Augen, als wäre es keine Neuigkeit. Gemeinsam bauen wir der Schnecke ein gemütliches Nest, und Luca hat recht. Schon nach wenigen Tagen sehen wir dabei zu, wie der kleine Riss langsam verheilt und es der Schnecke wieder besser geht.
»Siehst du, hab ich doch gesagt.« Luca stupst mich mit dem Ellbogen an und schenkt mir ein breites Grinsen. Dieses Grinsen wickelt Oma jedes Mal um den Finger und sorgt dafür, dass wir auch vor dem Abendessen Schokolade naschen können.
»Wir sollten das hier machen, wenn wir groß sind«, murmelt Luca nachdenklich, hüpft zu seiner Leinwand hinüber und schnappt sich seinen schwarzen Edding. Seit einigen Wochen trägt er ihn immer bei sich.
»Was machen?«, frage ich und stelle mich neugierig neben ihn.
»Na, das hier!« Er zuckt mit den Schultern und beginnt, auf die Wand zu kritzeln. Wenn wir groß sind, werden wir die Welt retten!, schreibt er in großen, unordentlichen Buchstaben. Und dann malt er eine Schnecke daneben, die irre komisch aussieht.
»Sie sieht aus wie Gary von SpongeBob!«, sage ich kichernd.
»Dann sollten wir unseren kleinen Freund wohl Gary nennen.« Luca malt ein Herz neben seine Zeichnung. In dieser Sekunde weiß ich, dass ich, wenn ich groß bin, genau das tun will. Gemeinsam mit meinem Bruder die Welt retten.
Kapitel 2
Lilly
Notiz an mich selbst: Auch ein Halbmond kann die Nacht erhellen.
Früher hat mich das Rauschen der Wellen vor Omas Haus immer in den Schlaf getragen, jetzt hält es mich die ganze Nacht wach. Alles, was früher einmal funktioniert hat, scheint inzwischen seine Magie verloren zu haben. Selbst das Meer.
Ich ziehe das Kopfkissen über mein Gesicht und brülle stumm in die Fasern, die nach demselben Waschmittel duften, das unsere Großmutter, seit ich denken kann, benutzt. Keine Ahnung, wie spät es ist, denn wenn man sich stundenlang von links nach rechts wälzt, verliert man irgendwann das Gefühl für die Zeit. Die letzten Nächte erinnern mich an die ersten Wochen ohne Luca, als ich noch in Berlin war und jede Nacht in sein Zimmer geschlichen bin, um ihm nahe zu sein.
Im Grunde genommen stehe ich jetzt, Monate später, wieder ganz am Anfang. Als hätte ich erst letzte Nacht Lucas Hand gehalten, während er an meiner Seite friedlich eingeschlafen ist.
Irgendwann, als bereits Licht durch die dünnen altrosafarbenen Vorhänge ins Zimmer fällt, dringt ein Poltern aus der unteren Etage des Hauses, gefolgt von der gedämpften Stimme meiner Großmutter, die sonst immer so friedlich klingt und jetzt einen scharfen Unterton angenommen hat. Was ist da unten los? Rasch springe ich aus dem Bett und ziehe mir die erstbesten Sachen über, die ich zu greifen bekomme.
Sobald ich im Hausflur stehe und die Treppe ins Erdgeschoss ansteuere, werden die Stimmen lauter. Zu meinem Entsetzen erkenne ich die meiner Mutter.
Ich nehme zwei Stufen auf einmal und stolpere in den Hausflur. Als ich meiner Mutter zum ersten Mal seit Monaten gegenüberstehe, entflieht mir ein heiseres »Was machst du denn hier?«.
»Liliana«, krächzt Mama, die, seit ich Berlin so fluchtartig verlassen habe, optisch um Jahre gealtert ist. Die Schatten unter ihren Augen haben sich so tief in ihre Haut gefressen, dass sie sicher nie wieder verschwinden werden, und ihr Gesicht ist bleich wie das eines Phantoms.
»Du solltest besser wieder fahren«, klinkt Oma sich ein und verschränkt die Arme vor der Brust. Sie stellt sich zwischen uns, wie ein menschlicher Schutzschild. Unsere Großmutter hat schon immer versucht, Luca und mich vor Stürmen dieser Art zu bewahren. Mit mehr oder weniger Erfolg.
Drei Generationen ein und derselben Familie befinden sich gerade in diesem Haus, aber es fühlt sich an, als lägen unüberwindbare Welten zwischen uns.
»Ich würde gern mit meiner Tochter reden, Mutter.«
»Du hast dabei etwas vergessen. Das hier ist mein Haus, und hier herrschen meine Regeln. Eure Tochter hat gerade vieles zu verarbeiten, und ich werde nicht zulassen, dass …«
»Es ist okay«, platze ich dazwischen und unterbreche Oma zu meinem eigenen Erstaunen. Sie will meine Mutter hinausschmeißen, weil sie weiß, wie sehr sie mich vor meiner Reise nach Island verletzt hat. Ich sollte sie darin bestärken, aber ich bin es leid, immer nur davonzurennen, ohne jemals irgendwo anzukommen. Es ist anstrengend, permanent auf der Flucht zu sein. Irgendwann muss ich mich diesem Konflikt in meinem Leben schließlich stellen, und an Schlaf ist ohnehin nicht zu denken. Da kann ich das Gespräch auch gleich hinter mich bringen.
»Ist Papa nicht dabei?« Allein, ihn Papa zu nennen, fühlt sich befremdlich an. Mama schüttelt den Kopf, natürlich tut sie das. »Jemand muss sich ja um den Laden kümmern.«
Warum überrascht mich die Abwesenheit meines Vaters nicht? Er hat sich schon seit Lucas Diagnose in die Arbeit gestürzt und mehr Zeit bei den City-Flowers als zu Hause verbracht.
»Können wir vielleicht ein Stück spazieren gehen, Liliana?« Ihr Blick huscht über den alten Pulli von Luca, den ich zum Schlafen trage. Aber sie sagt nichts dazu, verkneift sich einen Kommentar. Ob sie ihre Vorwürfe wirklich in Berlin gelassen hat? So richtig traue ich dem Frieden noch nicht.
Oma legt ihre Hand auf meine Schulter und wirft mir einen Blick zu, der fragt: Kommst du klar? Mit einem Nicken gebe ich sie frei, und sobald sie in die Küche verschwunden ist, sehe ich wieder meine Mutter an. »Lass uns an den Strand gehen.«
Die rauschenden Wellen verteilen den Geruch von Salz und Meer in der Luft, während Mama und ich schweigend nebeneinanderher laufen. Ich schlinge die Arme um meinen Oberkörper und achte penibel darauf, ihr nicht zu nahe zu kommen. Sie hier an diesem mir heiligen Ort zu sehen tut weh.
»Woher weißt du, dass ich wieder in Deutschland bin?«
»Deine Großmutter musste mir irgendwann die Wahrheit sagen, Liliana. Sie kann dich nicht ewig hier vor uns verstecken.«
Oma hat ihr also von meiner Rückkehr erzählt, aber ich kann deshalb nicht sauer auf sie sein. Es war ohnehin viel verlangt, sie als mein Alibi zu nehmen.
»Du warst also auf Island?«
Mein erster Impuls will ihr sagen, dass es sie nichts angeht, aber ich beiße mir auf die Zunge. Dieses Gespräch wird zu nichts führen, wenn ich mich wie ein trotziger Teenie benehme. Mama hat die Hände tief in die Jackentaschen gegraben. »Wusstest du, dass Luca immer nach Island wollte?«
Meine Augen weiten sich ohne mein Zutun. Meine Mutter, die es zu Beginn des Jahres nicht einmal ausgehalten hat, seinen Namen zu hören, spricht freiwillig über Luca? Was zur Hölle passiert hier gerade?
»Natürlich wusste ich das«, antworte ich etwas zu harsch. »Luca war derjenige, der mir gesagt hat, dass ich gehen soll. Dass ich mal rausmuss aus Berlin.« Raus aus dieser traurigen Stadt und dieser noch traurigeren Wohnung.
Ein Seitenblick zu Mama genügt, um zu sehen, wie schwer es ihr immer noch fällt, über meinen Bruder zu reden. Dass sie es überhaupt versucht, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Mehr, als ich in ihrer Nähe zugeben kann. Noch nicht. Dafür sind die Wunden noch zu frisch.
»Und du wirst nicht zurückkommen, oder? Nach Hause, meine ich?«
»Berlin fühlt sich nicht wie mein Zuhause an, Mama. Hat es nie. Das wüsstest du, wenn du mir in den letzten Jahren je zugehört hättest.«
Sie zieht scharf die frische Luft in ihre Lunge, als hätte sie meine Ehrlichkeit wie eine Ohrfeige getroffen.
»Ich habe dir zugehört, Liliana. Aber ich habe gerade erst meinen Sohn beerdigt.«
»Lilly«, korrigiere ich sie. »Ich will Lilly genannt werden, und falls du es vergessen hast, auch ich habe jemanden verloren. Luca war mein Zwillingsbruder, egal, wie oft ihr ihn für euch allein haben wolltet.«
»Wir wollten ihn nie für uns allein haben.«
»Nicht? Denn genau so hat es sich angefühlt. Ich war wie ein fünftes Rad am Wagen, jedenfalls war ich das für euch.« Für Luca war ich immer so viel mehr.
»Ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe, genau wie dein Vater. Aber ist Wegrennen wirklich die Lösung? Wie soll es für dich weitergehen? Was hast du mit deinem Leben vor?«
»Das versuche ich gerade herauszufinden. Vielleicht ist es kindisch von mir, vielleicht verantwortungslos. Aber Lucas Tod hat mir gezeigt, wie kurz das Leben sein kann. Dass man es auskosten sollte, anstatt es zu verschwenden. Und deshalb werde ich nicht mehr nach Berlin kommen. Weil ich in den letzten Monaten gelernt habe, dass ich mir selbst wichtig sein darf.« Meine Schuhe versinken im hellen Sand, hinterlassen Spuren, die schon bald wieder vom Wasser ausradiert werden.
Zum ersten Mal sage ich all das, was ich ihr schon vor Jahren hätte sagen müssen. Als Luca noch da und ich somit noch vollständig war. Mit Luca war ich ein strahlender Vollmond, und ohne ihn werde ich für den Rest meines Lebens ein Halbmond sein. Aber es ist okay, denn auch Halbmonde sind schön und können einem die Nacht erhellen.
»Ich kann dich wohl nicht vom Gegenteil überzeugen?« Mama klingt an diesem frischen Frühlingsmorgen zum ersten Mal wie ein Mensch, der tatsächlich Gefühle hat. Wie jemand, der ein Herz besitzt, das brechen kann. Tränen steigen in ihren Augen auf, die mich erstaunlich kaltlassen. Nach Lucas Diagnose habe ich vehement versucht, ihre Tränen zu trocknen, weil ich es gehasst habe, Mama weinen zu sehen. Jetzt mache ich mich nicht mehr dafür verantwortlich. Ich gebe diese Last an sie zurück, weil sie nicht zu mir gehört, nie zu mir gehört hat.
»Unsere Tür steht dir trotzdem immer offen.« Mama schluckt schwer, tritt auf mich zu und legt mir etwas unbedarft die Hand auf die Schulter, aber diese Geste kann meine Entscheidung nicht ändern. Dennoch stoße ich sie nicht von mir, lasse zu, dass sie ihre Arme stoisch um mich legt, bevor sie mich allein am Strand zurücklässt.
Erst als sie längst verschwunden ist, realisiere ich, was gerade passiert ist. Meine Beine verselbstständigen sich, tragen mich dichter an die Wellen heran, als wäre da ein Band zwischen mir und dem Meer, das mich leitet. Der Wind peitscht mir wüst ins Gesicht, meine Haare wirbeln durch die Luft wie blonde Luftschlangen. Und dann weine ich. Ich weine so laut, dass es selbst das Heulen des Windes übertönt. Weil ich mich seltsam befreit fühle und ich dieses Gefühl so gern mit Luca teilen würde. Ich weiß, dass er wahnsinnig stolz auf mich wäre. Stolz auf mich ist. Da oben in den Wolken.
»Oh, Kindchen …« Oma tritt nach einer kleinen Ewigkeit an meine Seite, greift nach meiner Hand. »Es tut mir so leid, dass ich ihr die Wahrheit gesagt habe. Ich dachte nicht, dass sie sich extra ins Auto setzen und herkommen würde.«
»Das muss es nicht«, sage ich schnell. »Ich weine nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich mich frei fühle. Zum ersten Mal seit Langem.« Es auszusprechen verdreifacht dieses positive Brodeln in meinem Magen. Ich habe meiner Mutter die Wahrheit gesagt, darüber, wie ich empfinde. Habe ihr gesagt, dass Berlin nie wirklich mein Zuhause war.
»Genieße diese Freiheit, Lilly.« Oma sieht gemeinsam mit mir auf das heute unruhige, fast schon wütende Meer hinaus.
Ich weiß nicht, wie lange wir Seite an Seite dastehen und der Melodie des Windes lauschen. Ich weiß nur, dass ich für immer hier stehen bleiben könnte. An ihrer Seite, mit dem Peitschen der Wellen in den Ohren und endloser Ruhe im Herzen.
Ein »Ping« reißt mich aus diesem achtsamen Moment, und als ich einen Blick auf mein Handy werfe, beginnen meine Hände zu zittern. Der Betreff der E-Mail leuchtet wie ein Reklameschild auf.
Bist du bereit, mit uns die Welt zu retten, Lilly Sommer?
Ich vertippe mich vor Aufregung mehrere Male, bis ich endlich die Mail offen vor mir sehe. SaveTheIceland hat mir geantwortet. In den letzten Wochen habe ich fast vergessen, dass ich mich für das Frühsommerprogramm dieses Jahr beworben habe! Ich lese die Zeilen auf meinem Handy, als wären sie die Heilige Schrift.
Sie wollen mich tatsächlich in ihrem Programm haben.
»O mein Gott!« Das Gespräch mit meiner Mutter rückt in weite Ferne, weil ich auf einmal nur noch an diese Chance denken kann, die ich mir gewünscht habe und die mir gerade auf dem Silbertablett präsentiert wird.
Wenn ich mich für das Programm entscheide, muss ich bereits in einer Woche auf Island sein, um an den ersten Informationsveranstaltungen teilzunehmen, bevor die eigentliche Arbeit beginnt.
Wieder und wieder lese ich den Betreff der Mail.
Bist du bereit, mit uns die Welt zu retten, Lilly Sommer?
Bin ich das? Unweigerlich muss ich an Lucas Worte denken, an unsere erste Rettungsaktion, an unseren gemeinsamen Traum, diese Welt zu verändern. Bin ich es ihm nicht schuldig?
Vielleicht ist das hier ein Zeichen aus dem Universum, ein kleiner Schubser von Luca, damit ich erneut über meinen Schatten springe.
»Was ist das, Kindchen? Ich habe meine Lesebrille im Haus vergessen.« Meine Großmutter kneift ihre Augen zuckersüß zusammen, damit sie die Zeilen auf meinem Handy lesen kann. Scheinbar ohne Erfolg, denn sie runzelt angestrengt ihre ohnehin faltige Stirn.
Ich suche nach den richtigen Worten. Nach Worten, die beschreiben, was gerade in mir passiert. Welche Knoten platzen und welche Grenzen sich gerade sprengen. »Das, Oma, ist meine Zukunft.«
Es gibt nur einen Haken an dieser Nachricht. Wenn ich mich für diese Chance entscheide, entscheide ich mich gleichzeitig für Island. Und auf Island werde ich Aron und meine Angst um ihn nicht länger ignorieren können.
Kapitel 3
Aron
Notiz an mich selbst: Ich kann die Steine auf meinem Weg nutzen, um mir daraus eine Festung zu bauen.
Es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist, als ein krankes Herz in seiner Brust zu haben: ein krankes Herz mit Liebeskummer. Überall in diesem Krankenhaus sehe ich Lilly, selbst in Räumen wie diesem, den sie noch nie betreten hat. Drei Wochen sind vergangen, seit sie unter Tränen mein Zimmer verlassen hat. Drei Wochen, in denen ich versucht habe, mich irgendwie zusammenzuhalten. In denen ich einem Herzschrittmacher zugestimmt habe, damit ich mehr Zeit bekomme. Zeit, um all das zu reparieren, was ich mit meiner Lüge so gekonnt zerstört habe.
Unruhig trommle ich mit den Fingerspitzen auf die Armlehne des Stuhls. Derselbe Stuhl, auf dem ich letztes Jahr saß, als ich meine Diagnose bekam. Ich erinnere mich an dieses Gespräch, als wäre es erst gestern gewesen. An das nervöse Händekneten meiner Mutter, das unkontrollierte Schluchzen von Jóhanna und den mitfühlenden Blick des Arztes, der inzwischen so viel mehr für mich ist als der Mann, der mich und mein Herz behandelt.
Doktor Torger Arnarsson ist seit Tag eins mein behandelnder Arzt, er war da, als ich gelernt habe, in diesen neuen Schuhen zu laufen, die mir anfangs viel zu klein erschienen. Schließlich hatte ich seit Jahren ein genaues Ziel vor Augen: eines Tages den Worldcup im Kitesurfen zu gewinnen.
Im Nachhinein betrachtet weiß ich natürlich, dass ich schon vor meinem Zusammenbruch nicht gesund war, aber ich habe mich gesund gefühlt. Habe mir eingeredet, alles sei in Ordnung.
Ein kräftiges Klopfen an der Tür lässt mich zusammenfahren. Torger betritt den Raum, unter seinem Arm klemmt ein Stapel Patientenakten. Man erwischt ihn selten ohne, denn er ist eigentlich immer auf dem Sprung zum nächsten Patienten.
Vor vierzehn Monaten saß ich diesem Mann zum ersten Mal gegenüber, und seitdem hat sich vieles verändert. Der Faltenkranz an seinen Augen ist ausgeprägter geworden, sein Haar lichter, und die ersten grauen Strähnen durchziehen das sonst helle Braun. Seufzend lässt er sich auf seinen Drehstuhl fallen und beginnt, die Akten akribisch zu sortieren, als wäre es seine wichtigste Aufgabe heute. Dabei bin ich sicher nicht hier, um ihm bei seiner täglichen Büroarbeit zuzusehen und mich währenddessen mit ihm über das Wetter zu unterhalten, sondern darüber, wie es jetzt weitergeht. Mit mir. Meinem Herzen. Meinem Leben. Einem Leben, zu dem er mittlerweile gehört.
Es fällt ihm von Tag zu Tag schwerer, mir in die Augen zu sehen, weil ich ihm wichtig geworden bin. Nicht auf die Art, wie jeder Patient seinem Arzt wichtig sein sollte, sondern auf einer viel tieferen, verflochteneren Ebene. Er nennt mich noch immer seinen Jungen, und inzwischen ist er mehr Vater als Arzt für mich. Ich bin mir sicher, dass Ärzte diese Grenze zu ihren Patienten niemals überschreiten sollten, aber wir haben sie überschritten, und es gibt längst kein Zurück mehr.
Ich habe seine Familie kennen- und lieben gelernt. Seine fünfjährige Tochter Svala, die ein Faible für Tiere hat, die längst ausgestorben sind. Ihr ganzes Zimmer besteht aus Plüsch-Dinosauriern und Mammuts, die allesamt ausgeflippte Namen von ihr bekommen haben. Manche davon durfte ich sogar selbst aussuchen. Ich kenne seine Frau, seine vier Jahre jüngere Schwester, saß bereits in dem Auto, mit dem er jeden Tag in die Klinik fährt, und hab unzählige Male mit ihm zu Abend gegessen.
»Wie geht es jetzt weiter?«, breche ich das unangenehme Schweigen zwischen uns und versuche, mein Gewicht leicht zu verlagern, weil mir das Sitzen auf diesem Stuhl schwerfällt. Seit Wochen tut mir alles weh, aber am allermeisten das Ding in meiner Brust, das nicht mehr funktioniert. Nicht ohne Hilfe jedenfalls. Eine Hilfe, die ich viel zu lange verweigert habe, weil ich dachte, dass ich es ohne schaffe.
»Bereitet dir der Herzschrittmacher irgendwelche Probleme?« Er übergeht meine Frage einfach, und am liebsten würde ich wie ein Idiot winken, damit er endlich zu mir aufsieht. Mich ansieht. Ich bin noch hier! Direkt vor dir! Warum siehst du mich nicht an, verdammt?
»Keine nennenswerten«, antworte ich stattdessen auf seine Frage. »An manchen Tagen fühlt er sich immer noch wie ein Fremdkörper an, aber die Schmerzen sind verschwunden.« Instinktiv greife ich nach meiner Brust, schiebe den Kragen meines grauen Shirts ein Stück herunter und fahre mit den Fingern über die kleine Narbe, welche sich fünf Zentimeter unter meinem Schlüsselbein befindet und inzwischen gut verheilt ist.
Der Herzschrittmacher ist kaum größer als eine Münze, dennoch könnte ich in manchen Nächten schwören, dass er so groß wie ein Unterteller ist. Es ist seltsam, so ein kleines Teil in meinem Körper zu wissen, das mich vor einem erneuten Zusammenbruch bewahren soll.
»Das ist gut.« Torger schürzt seine Lippen. »Das ist sehr gut, Aron.« Er benimmt sich schon seit Tagen seltsam, aber heute erreicht seine Seltsamkeit ein neues Level, weil er vehement auf den Tisch zwischen uns starrt. Ich fühle mich zum ersten Mal in seiner Gegenwart wie ein Geist. Durchsichtig. Nicht da.
»Nun sag schon: Was ist los?« Ich möchte nicht länger um den heißen Brei reden, schließlich ist Zeit kostbar, und ich weiß nicht, wie viel mir davon noch bleibt, wenn ich diesen Raum erst einmal verlassen habe. Endlich hebt er den Blick. Seine treuen, klugen Augen von einem wässrigen Film überzogen, der meine Brust blitzschnell eng werden lässt.
Als ich ihn zum ersten Mal in den Räumen dieser Klinik gesehen habe, wirkte er auf mich wie ein Mann, der niemals die Fassung verliert. Er war rational, hatte immer das große Ganze im Blick. Wenn ich eines im vergangenen Jahr gelernt habe, vor allem über mich selbst, dann, dass Masken verrutschen. Sie zeigen einem irgendwann unweigerlich die Wahrheit darunter.
»Die letzten Tests haben gezeigt, dass die Schädigung deines rechten Ventrikels schneller voranschreitet, als wir es gehofft hatten.«
Meine Finger schließen sich um die Armlehnen und packen so fest zu, wie es meine nachlassende Kraft erlaubt. Seit meiner Einlieferung fühle ich mich wie eine zerkochte Nudel, weil mein Körper zu keinerlei Spannung mehr fähig ist. In diesem Zustand kann ich niemals wieder auf mein Board steigen.
»Wir müssen dich auf die Liste setzen, Aron.«
Da ist er.
Der Satz, vor dem ich vierzehn Monate geflohen bin, als hätte ich bei diesem Marathon auch nur den Hauch einer Chance. Die Liste bedeutet, dass es verflucht ernst ist. Das Gerät in meiner Brust reguliert vielleicht meinen Herzschlag, aber es kann das Voranschreiten der Krankheit nicht verhindern. Ich hatte trotzdem gehofft, noch etwas mehr Zeit zu haben.
Mit Mühe versuche ich mich an einem überzeugenden Lächeln, weil ich es hasse, die Menschen um mich herum traurig zu machen. Und die Nachricht, die er mir gerade übermittelt hat, macht nicht nur ihn traurig. Sie wird auch Mamma und Elva zerschmettern. Lilly. Verdammt, ich bin es so leid, bei all den Leuten, die ich liebe, nur Schaden anzurichten. Genau aus diesem Grund habe ich mich damals überhaupt erst bei stronghearts angemeldet. Weil ich Wege finden wollte, den Schmerz meiner Familie zu verstehen und irgendwie kleiner werden zu lassen. Stattdessen habe ich Lilly kennengelernt und die Liste um eine Person erweitert.
Plötzlich ging es nicht mehr um meine Familie oder meine Erkrankung, sondern um mich als gesunden Menschen, dem kein steiniger Krankheitsweg bevorsteht. Immer, wenn ich mit Lilly geschrieben habe, war ich wieder der Aron vor der Diagnose. Der abenteuerlustige Mann, der die Steine in seinem Weg einfach wegräumen konnte.
Für einen Moment lasse ich den Gedanken an ihre diamantblauen Augen zu. Augen, die mir von Tag zu Tag mehr fehlen und die ich vermutlich nie wieder sehen werde, weil ich alles falsch gemacht habe, was man nur falsch machen kann. Als sie Anfang des Jahres vor mir stand und mir von Luca erzählte, hätte ich ihr die Wahrheit sagen müssen, stattdessen habe ich immer auf den richtigen Moment gewartet. Aber den richtigen Moment gibt es nicht, wenn man weiß, dass man das Herz eines anderen Menschen brechen wird. Es gibt einfach kein gutes Timing für so etwas.
»Wie fühlst du dich dabei, mein Junge?«
»Schon in Ordnung«, lüge ich. Natürlich kauft er es mir nicht ab. Wie soll es einem auch nach so einer Information gehen? Auf ein Spenderherz zu warten bedeutet im Umkehrschluss, auf jemandes Tod zu warten. Ich will nicht, dass jemand stirbt, damit ich leben kann. Ich will nicht, dass eine Mutter ihr Kind verliert oder ein Bruder seine Schwester, damit ich die Aussicht auf ein paar weitere Jahre auf dieser Erde habe.
»Aron …«
»Kann ich …« Nur mühsam schaffe ich es, meine Tränen zurückzuhalten. »… in meinem Zustand fliegen?«
»Fliegen? Wohin willst du denn fliegen?«
»Ich muss nach Deutschland. So schnell wie möglich.« Weil mir keine Zeit mehr bleibt und ich es mir niemals verzeihen würde, nicht ein letztes Mal mit Lilly gesprochen zu haben. Ja, ich habe ihr bereits erklärt, warum ich ihr die Wahrheit verschwiegen habe, aber keines meiner gesagten Worte fühlt sich rückblickend gut genug an. Ehrlich genug. Es gibt noch so vieles, das ich ihr sagen muss.
Auf einmal sitze ich nicht mehr auf diesem unbequemen Stuhl, sondern liege unter ihr im Bett, während draußen die Nordlichter tanzen. Sie über mir, ihre Schultern bedeckt von der kratzigen grauen Decke. Ihre Augen strahlend, ihre Lippen lächelnd. All das habe ich kaputt gemacht, bevor es überhaupt richtig begonnen hat, weil ich zu feige war. Weil ich mich lieber hinter Lügen versteckt habe, als mich mit meiner Wahrheit zu zeigen.
»Also? Kann ich fliegen?«
»Das halte ich für keine gute Idee«, murmelt Torger und schüttelt bedauernd den Kopf. »Dein Zustand ist immer noch äußerst kritisch. Glaub mir, du willst nicht in Deutschland sein, wenn der wichtige Anruf kommt.«
»Es kann Monate dauern, bis ein passendes Herz gefunden wird.« Entschlossen sehe ich ihn an. »Vielleicht sogar länger.«
Und sein Blick ist Antwort genug.
So viel Zeit bleibt dir vielleicht nicht mehr, mein Junge.