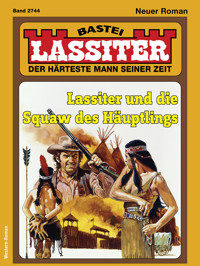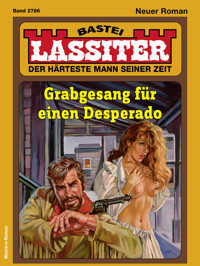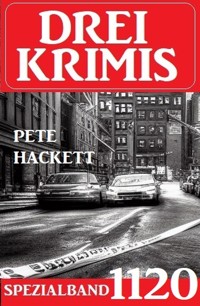
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: (399) Pete Hackett: Trevellian und die Umweltkiller Pete Hackett: Trevellian und der Sumpf des Verbrechens Pete Hackett: Trevellian und die Gespielin des Todes In New York werden tote Mädchen auf den Müllhalden gefunden. Bei allen waren Heroinspuren im Blut. Bald finden die FBI-Agenten Trevellian und Tucker heraus, dass die Mädchen entführt und gezwungen wurden, in Pornofilmen mitzuspielen. Es gelingt den Agents recht schnell, die dafür Verantwortlichen ausfindig und dingfest zu machen. Nur dem Haupttäter gelingt es zu entkommen. In dieser Situation bekommen Trevellian und Tucker eine erschreckende Nachricht von ihrem Chef. In New York ist ein Kilo Plutonium angekommen. Genug um hunderttausende Menschen umzubringen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Drei Krimis Spezialband 1120
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1120
Copyright
Trevellian und die Umweltkiller
Trevellian und der Sumpf des Verbrechens
Trevellian und die Gespielin des Todes
Drei Krimis Spezialband 1120
Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Pete Hackett: Trevellian und die Umweltkiller
Pete Hackett: Trevellian und der Sumpf des Verbrechens
Pete Hackett: Trevellian und die Gespielin des Todes
In New York werden tote Mädchen auf den Müllhalden gefunden. Bei allen waren Heroinspuren im Blut. Bald finden die FBI-Agenten Trevellian und Tucker heraus, dass die Mädchen entführt und gezwungen wurden, in Pornofilmen mitzuspielen. Es gelingt den Agents recht schnell, die dafür Verantwortlichen ausfindig und dingfest zu machen. Nur dem Haupttäter gelingt es zu entkommen. In dieser Situation bekommen Trevellian und Tucker eine erschreckende Nachricht von ihrem Chef. In New York ist ein Kilo Plutonium angekommen. Genug um hunderttausende Menschen umzubringen...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und die Umweltkiller
Krimi von Pete Hackett
Der Umfang dieses Buchs entspricht 246 Taschenbuchseiten.
Als die Fische im Long Island Sound sterben, zeigen Untersuchungen, dass illegale Giftablagerungen daran schuld sind. In Verdacht gerät die Akorn Chemicals Inc., in deren Produktionsstraßen dieser Müll anfällt. Bei den Ermittlungen stoßen die FBI-Agenten Trevellian und Tucker auf ein weiteres Verbrechen: Jemand erzeugt Ecstasy in großem Stil. Sollte Akorn auch dafür verantwortlich sein?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Es war Nacht. Der Himmel war bewölkt. Der Mond war hinter den Wolken nur als heller, verschwommener Fleck wahrzunehmen. Die Sterne blieben hinter der Wolkendecke verborgen.
Ein kleiner Frachter schipperte den East River hinauf. An Bord brannten einige Scheinwerfer. Der Arm des Krans, der auf Deck montiert war, war eingezogen. An Deck befanden sich einige Männer in Overalls.
An und für sich nichts besonderes. Die Wasserschutzpolizei hatte keinen Grund, den Kahn zu überprüfen. Der East River war voll von solchen schwimmenden Transportern.
Der Frachter nahm Kurs in den Long Island Sound. Die Scheinwerfer verloschen. Die Motoren liefen tuckernd weiter. Vom Festland aus war er nicht mehr zu sehen. Die riesige Ladeluke wurde geöffnet. Ein Mann setzte sich in den Kran. Der stählerne Arm hob sich, knirschend schwenkte er herum. Die Winde quietschte, der Haken senkte sich in die Ladeluke. Ein mittelgroßer, gedrungener Bursche, der gebeugt an deren Rand stand, rief etwas nach unten. Im Laderaum brannte Licht – einige trübe Funzeln, die düstere Schatten warfen. Ein anderer Mann stand auf einem Stahlcontainer, an dessen Ecken starke Ketten befestigt waren, deren Enden bei einem Karabinerhaken zusammenliefen. Der Bursche fing den Kranhaken ab und klinkte ihn in den schweren Karabinerhaken ein.
„Ab damit!“, rief er nach oben und sprang von dem Container. Sein Englisch wies einen harten Akzent auf.
Der Mister an Deck gab dem Kranführer ein Zeichen.
Die Winde des Krans begann sich rückwärts zu drehen. Das Stahlseil spannte sich knirschend. Ein leichter Ruck ging durch den Kran, als er durch das Gewicht des Containers belastet wurde. Langsam schwebte der Container in die Höhe. Der Kran hob ihn aus dem Bauch des Schiffes, schwenkte herum, der Container baumelte über dem Gewässer. Ein metallisches Schaben ertönte, als ein ferngesteuerter Mechanismus den Boden öffnete. Giftiger Schlamm, Abfallprodukt der Chlor-Chemie, klatschte auf die Wasseroberfläche, verteilte sich und versank. Chlorierte Kohlenwasserstoffe und Dioxine wurden freigesetzt.
Drei große Container wurden insgesamt entleert.
Das Schiff nahm wieder Kurs in Richtung Kanal, fuhr nach Süden, passierte die Freiheitsstatue und nahm schnellere Fahrt auf.
2
Einige Wochen verstrichen. In regelmäßigen Abständen fuhr der Frachter des nachts zum Long Island Sound und entsorgte seine Ladung. Mehr und mehr wurde das Wasser vergiftet. Erste tote Fische wurden von der Strömung an die Strände getrieben. Ein privater Radiosender brachte die Nachricht zuerst. Noch dachte niemand an eine Umweltkatastrophe.
Dee Fitzgerald, stellvertretender Abteilungsleiter bei Akorn Chemicals Inc., hörte die Meldung im Autoradio. Er war auf dem Weg zur Arbeit. Vor ihm, hinter ihm und auf der anderen Fahrspur wälzte sich eine Blechlawine in die verschiedenen Richtungen. Motorenlärm, ungeduldiges Gehupe und pulsierendes Leben erfüllte Manhattans Straßen. Fitzgerald drehte das Radio lauter. Der Nachrichtensprecher äußerte die Vermutung, dass das Wasser im Long Island Sound verseucht sei. Ein Grund für die Verseuchung sei noch nicht bekannt, aber die Umweltbehörde sei informiert und dem Wasser seien Proben entnommen worden. Man werde die Hörer auf dem Laufenden halten.
Dee Fitzgeralds Miene nahm einen nachdenklich Ausdruck an.
Eine halbe Stunde später stellte er seinen Wagen auf dem Firmenparkplatz ab und fuhr im Verwaltungsgebäude in den dritten Stock. Er suchte aber nicht sein Büro auf, sondern begab sich sofort zu Leland Taylor, den Abteilungsleiter.
Leland Taylor war ein großer, hagerer Mann Mitte der 50; grauhaarig, gesetzt, natürliche Autorität verströmend. Er trug einen grauen Seidenanzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte, auf der die Farben rot und silbergrau vorherrschend waren.
„Hast du die Nachricht auch gehört?“, fragte Fitzgerald und musterte seinen unmittelbaren Vorgesetzten.
„Welche?“
„Im Long Island Sound sterben die Fische“, erklärte Fitzgerald, nachdem Taylor einladend auf einen Stuhl gewiesen und Fitzgerald Platz genommen hatte. „Vorhin kam es im Radio durch. Allerdings nur auf einem lokalen Sender. Kann es sein, dass das Fischsterben auf die Absprachen mit Jack Jennings zurückzuführen ist?“
Leland Taylor fixierte Fitzgerald kurze Zeit prüfend. „Kaum“, erwiderte er dann. „Jennings hat mit dem Kapitän des Flying Barracuda vereinbart, dass die Abfälle weit draußen im Atlantik entsorgt werden. Nein, mit der Sache im Long Island Sound haben wir nichts zu tun.“
„Ruf Jennings an, Leland“, drängte Fitzgerald. „Ich traue dem Frieden nicht. Ruf ihn an. Er soll mit Carter klären, wo der Giftmüll gelandet ist.“
„Verdammt, Dee“, zischte Taylor. Er ließ sich nicht gerne drängen. Und schon gar nicht von jemandem, der in der Firmenhierarchie unter ihm stand. „Jetzt mach dir nicht gleich in die Hosen, nur weil da ein paar verendete Fische angeschwemmt worden sind. Das kann ganz natürliche Ursachen haben.“
„Ruf an, Leland. Mir geht der Hintern seit der Meldung auf Grundeis, kann ich dir sagen. Wenn es unser Müll ist, der im Long Island Sound gelandet ist, dann …“
„Was ist dann?“, fragte Taylor drohend. Seine Brauen hatten sich finster zusammengeschoben.
„Ach, verdammt, ich weiß es selbst nicht.“ Rasselnd sog Fitzgerald frische Luft in seine Lungen. Fiebrig durchrann ihn die Erregung. „Allerdings brauche ich dir wohl nicht zu sagen, dass wir dann ein Problem am Hals haben. Nicht nur, dass der Dreck mit unserem Wissen illegal entsorgt wurde, Leland. Wir haben die Akorn um immense Summen betrogen.“
„Und ganz gut davon gelebt, würde ich mal sagen“, grollte Taylors Organ. „Jeder von uns. Wer will außerdem beweisen, dass des möglicherweise unser FCKW-Müll ist, der im Long Island Sound versenkt wurde?“
„Es gibt eine Reihe von Mitwissern. Der eine oder andere wird vielleicht zusammenbrechen, wenn ihn die Polizei in die Mangel nimmt. Gosh, Leland. Der Fluch der bösen Tat. Er fällt auf uns zurück.“
Dee Fitzgerald malte sich aus, was kommen würde, wenn es sich um Giftmüll der Akorn Inc. handelte, der in den Long Island Sound gekippt wurde. Seine Zukunftsaussichten stellten sich plötzlich ziemlich trübe dar.
„Dazu muss die Polizei erst mal auf uns kommen“, wischte Taylor den Einwand seines Gegenübers vom Tisch.
Fitzgerald starrte seinen Boss ungläubig an. „Man wird das FCKW sehr schnell im Wasser und in den Fischleichen feststellen“, knirschte er. „Die Akorn arbeitet mit FCKW. Wir werden die Ermittler schneller im Haus haben, als wir denken.“
„Jetzt pass mal auf, Dee“, grollte Taylors Organ. „Was die illegale Müllentsorgung anbelangt, so hast du genauso mitkassiert wie ich und jeder andere, der davon weiß. Flipp jetzt bloß nicht aus. Wegen dir lassen wir uns die Sache nämlich ganz sicher nicht vermasseln.“
Fitzgerald knetete seine schwitzenden Hände. „Ruf endlich Jennings an, Leland. Ich will es wissen“, presste er zwischen den Zähnen hervor.
Achselzuckend, seinem Gegenüber einen entnervten Blick zuschießend, griff Leland Taylor zum Telefon. Jack Jennings meldete sich. Taylor sagte, nachdem er seinen Namen genannt und gegrüßt hatte: „Im Long Island Sound sterben die Fische, Jack. Kannst du ausschließen, dass Carter den Müll dort abgeladen hat, den du regelmäßig von uns abholst?“
Er hörte Jennings asthmatisch atmen, dann erwiderte Jennings: „Mit Carter ist vereinbart, dass er den Müll …“
„… aufs offene Meer schippert und dort auskippt. Ich weiß, was wir vereinbart haben. Ich weiß aber nicht, ob sich Carter daran gehalten hat.“
„Nun, ich gehe davon aus. Ich kann ihn ja mal fragen.“
Taylor lachte rasselnd auf. „Die Antwort, die du von ihm erhältst, kann ich dir jetzt schon sagen. Also vergiss es.“ Er warf den Hörer auf die Gabel und schaute Fitzgerald an. „Jennings weiß von nichts“, dehnte er. „Die Antwort kann dir nur Carter geben. Und der bindet es dir sicher nicht auf die Nase, wenn er das Fischsterben im Long Island Sound verursacht hat.“
„Verdammt, mir ist ganz flau im Magen, wenn ich daran denke, was auf uns zukommt, wenn wir auffliegen.“ Während er sprach, erhob sich Fitzgerald. „Ich hätte mich niemals auf diese Sache einlassen dürfen. Wie ich es schon sagte: Es geht nicht nur um Umweltverschmutzung, es geht um Betrug großen Stils. Wenn sie uns schnappen, werden sich die Gefängnistore für lange Zeit hinter uns schließen.“
Leland Taylor schaute verkniffen. „Mach jetzt nur nicht schlapp, Dee. Kein Schwein kommt auf uns, falls Carter den Müll tatsächlich im Long Island Sound entsorgt hat. Solltest du aber plötzlich Gewissensbisse bekommen, dann könntest du eine Gefahr für uns darstellen. Und das ist nicht gut.“
„Wie soll ich das verstehen?“, brauste Fitzgerald auf. „Als Drohung?“
„Versteh es als Warnung, Dee“, meinte Taylor, und seine Stimme klang sanft. „Es ist ratsam, bei der Stange zu bleiben. Du wusstest, worauf du dich eingelassen hast. Das Geld hast du ohne mit der Wimper zu zucken kassiert. Also behalte jetzt die Nerven.“
Wortlos machte Dee Fitzgerald kehrt und verließ Taylors Büro.
Der Verwaltungsleiter starrte mit einem versonnenen Ausdruck auf die Tür, die Fitzgerald hinter sich geschlossen hatte. Er murmelte für sich: „Spiel nur nicht verrückt, mein Freund. Spiel nur nicht verrückt …“
Fitzgerald warf sich in seinem Büro auf den Drehstuhl hinter seinem Schreibtisch. Er schaute sich um. Der Raum war hochmodern ausgestattet. Ein Arbeitsbereich, wie er einem stellvertretenden Abteilungsleiter zukam. Er verdiente viel Geld bei Akorn. Und er fragte sich aufs Neue, wie er sich auf das höllische Spiel einlassen konnte.
Fitzgerald schaute auf die Uhr. Es war zehn Minuten nach neun. Er holte ein kleines Radio aus seinem Kleiderschrank und schaltete es ein. Dann griff er nach einer der Akten, die auf seinem Schreibtisch lagerten.
Es gelang ihm nicht, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Im Radio wurde Musik ausgestrahlt. Immer, wenn die Musik endete und der Rundfunksprecher seine Stimme erklingen ließ, saß Fitzgerald aufrecht und lauschte. Er wartete auf eine Sondermeldung über das Fischsterben im Long Island Sound. Aber jedes Mal waren es nur Verkehrshinweise oder irgendwelche Kalauer, die der Sprecher zwischen den Songs zum Besten gab.
Fitzgerald war nur noch ein Nervenbündel. Er rief in der Buchhaltung an und verlangte den Hauptbuchhalter. „Webster“, flüsterte er fast, „hast du die Nachrichten gehört? Im Long Island Sound wurden tote Fische angeschwemmt. Man nimmt an, dass das Wasser verseucht worden ist.“
„Na und?“, kam es lakonisch durch die Leitung.
„Ich denke, dass Carter entgegen der Absprachen den Giftmüll nicht auf offener See, sondern einfach dort oben entsorgt hat“, sagte Fitzgerald mit gesenkter Stimme.
Kurze Zeit herrschte betroffenes Schweigen. Dann klang Websters Organ heiser durch den Draht: „Ich komme mal bei dir vorbei. Das am Telefon zu besprechen ist unmöglich.“
Fitzgerald legte auf und wartete nervös.
Schließlich erschien Webster, ein schmalbrüstiger Mann von eins-siebzig mit einer Brille auf der Nase, hinter deren Gläsern seine Augen unnatürlich groß erschienen. Er trug einen braunen Anzug. Alles in allem war Wilson Webster eine wenig bemerkenswerte Erscheinung.
Webster setzte sich. „Ich hab nichts davon gehört“, murmelte er und zerrte nervös an seinem Hemdkragen, als wäre der ihm plötzlich zu eng. Sein Krawattenknoten verrutschte etwas. „Weiß Taylor davon?“
„Ja. Er hat in meinem Beisein Jennings angerufen. Jennings erzählte was von den Absprachen mit Carter. Und Taylor spielt den Lässigen. Er tut, als berühre ihn das nicht. – Weißt du, was das heißt, wenn Carter unseren Dreck im Long Island Sound abgeladen hat, Wilson, und wenn sie ihm auf die Schliche kommen? Weißt du, dass wir alle mit einem Bein im Zuchthaus stehen?“
Wilson Webster nahm unruhig seine Brille ab. Er hatte blass-blaue Augen. Jetzt zwinkerte er nervös. Er holte ein Tuch aus der Jackentasche und fing an, seine Brillengläser umständlich zu putzen.
„Muss das jetzt sein, verdammt?“, herrschte ihn Fitzgerald entnervt an.
Webster zuckte zusammen, als hätte Fitzgerald ihn geschlagen. Er murmelte etwas Unverständliches, schob das Tuch wieder ein und setzte sich die Brille auf die Nase. Dann entrang es sich ihm: „Mit einem Bein stand jeder von uns bereits im Zuchthaus, als er in das Geschäft einstieg.“
Fitzgerald verzog das Gesicht. Aber die Wahrheit musste er sich gefallen lassen – wenn sie auch so schwer wie ein Backstein im Magen lag.
Webster hob wieder an: „Die Buchführung ist in Ordnung, Dee. Die Abholmengen stimmen mit den Produktionsmengen überein, die Abrechnungen von Jennings mit den Abholmengen. Von daher …“
„Dummkopf!“, zischte Fitzgerald. „Natürlich sind unsere Papiere in Ordnung. Sonst wäre der Betrug der Innenrevision längst aufgefallen.“
„Werde jetzt bitte nicht persönlich“, erregte sich Webster. „Was hast du überhaupt für ein Problem?“
Fitzgerald knirschte: „Falsch sind allerdings die Quittungen über die Anlieferungen bei den Verbrennungsanlagen, die Wiegebescheinigungen und Rechnungen bezüglich der Entsorgungsgebühren. Auf der Grundlage dieser Nachweise hat Carter mit Jennings abgerechnet und Jennings mit der Akorn Chemicals. Da liegt der Hase im Pfeffer. Sollte Carter den Long Island Sound verseucht haben, dann werden sie ihn früher oder später hops nehmen. Das ist nur eine Frage der Zeit.“
„Und er wird den Kopf nicht für uns alle hinhalten“, krächzte Webster mit unvermittelt ausgetrocknetem Hals. „Das ist deine Sorge, nicht wahr? Du befürchtest, dass er uns alle verpfeift.“
„Befürchten ist wohl ziemlich gelinde ausgedrückt“, schnappte Fitzgerald. „Ich bin überzeugt davon.“ Er knetete seine Hände und starrte kurze Zeit gedankenverloren vor sich hin. Plötzlich quoll es über seine Lippen: „Ich muss mich davon überzeugen, ob Carter den Müll absprachegemäß im Meer versenkt hat.“
„Du willst ihn zur Rede stellen? Kennst du ihn überhaupt persönlich?“
„Nein. Trotzdem fahre ich zu ihm. Die Ungewissheit bringt mich sonst um. Ich kann an überhaupt nichts mehr anderes denken. Mann, Webster, weißt du, was auf dem Spiel steht? Alles, was wir uns aufgebaut haben ist unter Umständen futsch. Wir landen in einer kahlen Zelle …“
Er schlug die Hände vor das Gesicht. Ein Ton, der sich anhörte wie ein trockenes Schluchzen, entrang sich Dee Fitzgerald.
„Weißt du, wo Carters Boot liegt?“, fragte Webster.
Fitzgerald nahm die Hände wieder herunter. „Yeah. In der Newark Bay. An einem der Piers bei Bergen Point.“
„Er wird dich von Bord jagen, Dee“, murmelte Webster. „Womöglich hält er dich für einen Polizeispitzel.“
Fitzgerald starrte den Buchhalter an, ohne ihn bewusst wahrzunehmen. Er schien durch ihn hindurchzusehen. „Ich nehme Jennings mit. Den kennt er.“
„Carter wird alles abstreiten“, sagte Webster bedrückt. Seine Stimme senkte sich, er flüsterte rau: „Außerdem begibst du dich auf ein gefährliches Pflaster, Dee. Einige Leute werden wird nicht zulassen, dass du …“
Mit einer unwirschen Handbewegung unterbrach ihn Fitzgerald. „Ähnliche Worte hörte ich schon, Taylor. Aber das kann mich nicht abschrecken. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Und wenn ich auch nur im Entferntesten zu dem Ergebnis komme, dass Carter Mist gebaut hat, steige ich aus.“
„Du – du wirst doch nicht zur Polizei gehen und uns alle auffliegen lassen?“, entsetzte sich Webster.
„Ich weiß nicht, was ich tue“, röchelte Fitzgerald.
„An so was darfst du nicht einmal denken“, mahnte Webster beschwörend.
Fitzgerald griff zum Telefon. Er wählte Taylors Nummer. Leland Taylor meldete sich. Fitzgerald sagte mit dumpfer Stimme: „Ich fahre zu Carter. Jennings nehme ich mit. Ich kann erst dann wieder ruhig schlafen, wenn er mir definitiv versichert, dass er sich an die Abmachungen gehalten hat.“
„Ist es im Endeffekt nicht egal, ob er irgendwo im Atlantik das Meerwasser vergiftet oder den Long Island Sound?“, bellte Taylors Organ. „Willst du tatsächlich die Pferde scheu machen, Dee?“
„Ich fahre zu Carter und nehme Jennings mit“, beharrte Fitzgerald auf seiner Absicht.
„Tu, was du nicht lassen kannst“, knurrte Taylor ins Telefon.
Als der Hörer wieder auf dem Apparat lag, richtete Fitzgerald den Blick auf Webster. „Ich fahre. Und zwar sofort. Du erfährst von mir Bescheid, Wilson.“
3
„Es ist allein Carters Problem, wenn er den giftigen Dreck in den Long Island Sound gekippt hat“, sagte Jack Jennings, nachdem Fitzgerald ihm sein Anliegen erklärt hatte. „Wer soll außerdem auf Carter kommen?“
„Sie machen es sich zu einfach, Jennings“, stieß Fitzgerald hervor. „Die Wasserschutzpolizei wird jetzt, da die Umweltkatastrophe eingetreten ist, besonders aktiv sein. Dort, wo der Flying Barracuda vor Anker liegt, ist sicherlich nicht verborgen geblieben, dass er immer wieder mit Giftmüll beladen wurde. Die Polizei wird gerade die Gifttransporter, unter anderem den Flying Barracuda, kontrollieren und Fragen stellen. Man wird Ermittlungen anstellen und herausfinden, dass Carter mit seinem Boot bei der Verbrennungsanlage, deren Quittungen sich bei den Abrechnungen befinden, so gut wie nie gesehen wurde.“
„Und dann haben sie Carter am Arsch“, entrang es sich Jennings. „Das ist richtig. Und Carter wird natürlich nicht den Märtyrer für uns, die wir mitverdient haben, spielen. Okay, Fitzgerald, fahren wir zu Carter. Holen Sie mich ab.“
Wenn Jennings zunächst keine große Begeisterung gezeigt hatte, jetzt konnte er es kaum erwarten, Carter gegenüberzustehen. Der dicke Geschäftsführer der Jack Jennings – Trading Consulting & Recycling Corporation war nach Fitzgeralds Anruf die Unruhe in Person. Die Ordner in seinem Büro waren voll mit gefälschten Belegen der Verbrennungsanlage; Belegen, die er selbst gefälscht hatte.
Er schaltete den Computer ein und klickte eine Datei an. Es war ein Formular, das auf dem Bildschirm angezeigt wurde, eine Wiegebescheinigung. Er hatte ein mit einer Unterschrift und einem Stempel der Verbrennungsanlage versehenes Original eingescannt und mit einem Bildbearbeitungsprogramm die Eintragungen ausgeschnitten. Anstelle dieser hatte er Textfelder eingesetzt, in die er nach Belieben die notwendigen Angaben per Computer eintragen konnte.
Er öffnete eine weitere Datei, ebenfalls ein Formular, und zwar die Quittung über entrichtete Entsorgungsgebühren. Ebenso aufbereitet wie die Wiegebescheinigung, ebenfalls mit einer Unterschrift und einem Stempel der Verbrennungsanlage versehen.
Ausgedruckt und kopiert konnte niemand feststellen, ob die Kopien, die er zu seinen Akten nahm und für die Abrechnungen mit Akorn verwendete, von einem Originaldokument oder einer Fälschung gefertigt wurden. Die Ausdrucke mit der eingescannten Unterschrift und dem Stempel landeten im Reißwolf.
Jennings schloss die Dateien wieder und fuhr den Computer herunter. Er machte sich Sorgen.
Schließlich fuhr Dee Fitzgerald in den Hof des Betriebes. Jennings wurde aus seiner Versunkenheit gerissen. Er wuchtete seinen übergewichtigen Body aus dem gepolsterten Lederdrehstuhl, ging ins Sekretariat und sagte zu der Angestellten, die irgendwelche Eingaben an ihrem PC machte: „Ich bin in drei Stunden etwa wieder zurück. Sollte was Wichtiges sein in der Zwischenzeit, dann wissen Sie ja meine Handynummer.“
Die Sekretärin nickte.
Jennings verließ das Gebäude und warf sich ächzend auf den Beifahrersitz von Fitzgeralds Ford. Das Auto ging unter seinem Gewicht auf der rechten Seite besorgniserregend in die Knie. Jennings tupfte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn.
„Wie wär‘s mal mit einer Diät, Jennings?“, knurrte Fitzgerald, und es klang keineswegs humorvoll.
Jennings schoss ihm von der Seite einen wütenden Blick zu. „Mein Gewicht sollte nicht Ihr Problem sein, Fitzgerald“, schnaufte er.
„Nun, wenn die Sache auffliegt, sollten Sie sich schon mal auf eine unfreiwillige Abmagerungskur einstellen“, gab Fitzgerald zu verstehen. „Im Gefängnis wird das Essen nämlich portioniert.“
„Sie scheinen ja ziemlich überzeugt zu sein davon, dass Carter den Long Island Sound vergiftet hat.“
„Nun, ich schätze mal, dass sich die meisten Entsorger von Giftmüll an die nationalen und internationalen Vorschriften halten. Wir haben beschlossen, sie zu umgehen. Und wenn der Abfall auf hoher See entsorgt worden wäre, dann hätte der Müll so etwas wie einen Placeboeffekt bewirkt, das heißt, er wäre nicht oder kaum ins Gewicht gefallen. Das FCKW hätte sich im ganzen Atlantik verteilt und die nächsten hundert Jahre wäre kein Fisch daran eingegangen. Aber dazu hätte Carter weit hinausfahren müssen auf den Atlantik, über den Golfstrom hinaus. Diesen Weg wird er sich gespart haben. Und nun haben wir wahrscheinlich den Salat.“
„Wenn Ihre Vermutung zutrifft, dann soll Carter die Hölle verschlingen!“, presste Jennings hervor und wischte sich intensiver den Schweiß aus dem feisten Gesicht. Es waren nicht nur die sommerlichen Temperaturen, die ihn schwitzen ließen.
Sie fuhren nach New Jersey und wandten sich von dort zur Newark Bay. Bei den Piers westlich von Bergen Point hielt Fitzgerald an. Hier lagen einige kleinere Frachter vor Anker. Am Rand der Piers waren einige Wohncontainer aufgestellt worden. Die Tür einer dieser Notunterkünfte stand offen. Hämmernde Musik hallte ins Freie. Fitzgerald stieg aus. Unschlüssig schaute er sich um. Sein Blick sprang über die Frachter hinweg, die hier dümpelten. Ein Ruck durchfuhr ihn, er marschierte zu dem offenstehenden Container hin und ging hinein.
Jennings blieb im Auto sitzen und seufzte.
Einige Männer in Unterhemden, die wahrscheinlich Brotzeitpause hatten und um einen Tisch saßen, schauten Fitzgerald fragend an. Offene Bierflaschen standen auf dem Tisch. Zigarettenrauch wallte unter der Wellblechdecke ihrer Behausung.
„Ich suche den Flying Barracuda“, erklärte Fitzgerald. „Der Frachter soll hier irgendwo liegen.“
„Den Flying Barracuda“, wiederholte einer der Arbeiter und erhob sich. Er ging zur Tür, trat an Fitzgerald vorbei ins Freie und wies in Richtung des südlichsten Piers. „Der Giftmüllfrachter liegt da unten. Die Kerle, die dort arbeiten, sind mit Vorsicht zu genießen. Ich schätze mal, auf dem Kahn kommen hundert Jahre Zuchthaus zusammen.“
Fitzgerald ging nicht darauf ein. Er bedankte sich und kehrte zu Jennings zurück, setzte sich hinter das Steuer, startete und ließ das Fahrzeug über die Betonpiste rollen. Es ging an Lagerhallen und Werkstätten vorbei. Hier sah alles ziemlich verkommen und heruntergewirtschaftet aus. In den Ritzen zwischen den Betonplatten wuchs kniehohes Unkraut. Viele Fenster der Gebäude waren zerbrochen, das Glas der unbeschädigten war staubblind. Der Wagen holperte über verrostete Schienenstränge hinweg, die zu den Lagerhallen führten.
Sie erreichten den südlichsten Pier. Fitzgerald stoppte.
Da lag der Flying Barracuda etwa anderthalb Meter neben der Kaimauer. Ein ziemlicher alter Kahn, von dessen Rumpf der Lack schon abblätterte und der viele rostige Stellen aufwies. Der Arm des Krans auf dem Frachter war ausgefahren. Einige Container standen auf Deck herum. Die Ladeluke war geöffnet. Sie sahen einige Männer, die untätig herumlungerten.
Fitzgerald und Jennings stiegen aus und warfen die Autotüren zu. Sie näherten sich dem vertäuten Schiff. Drei Planken führten von der Kaimauer an Bord. Zuerst betrat der übergewichtige Jack Jennings mit gemischten Gefühlen diesen provisorischen Steg. Die Bohlen bogen sich unter seinem Gewicht bedenklich durch und ächzten. Unter ihm plätscherte das Wasser gegen die Mauer. Öllachen schwammen in allen Regenbogenfarben schimmernd auf der Wasseroberfläche. Der Geruch von Öl und Seetang hing in der Luft. Aufatmend sprang Jennings schließlich an Deck.
Fitzgerald folgte.
Die Kerle näherte sich ihnen; verwegen wirkende, bärtige Gestalten. Ausländer, wie Fitzgerald sofort feststellte. Mexikaner, Kubaner oder Südamerikaner. Sie hatten allesamt eingefallene, hohlwangige Gesichter, die seltsam bleich anmuteten, ihre Augen glänzten fiebrig. Diese Kerle sahen irgendwie krank aus. Misstrauen prägte die Mienen, Unsicherheit flackerte in ihren Augen, eine stumme Bedrohung ging von ihnen aus.
Sie bauten sich vor den beiden Ankömmlingen auf. „Was wollt ihr?“, fragte einer lauernd, mit hartem Akzent.
Da rief eine raue, unduldsame Stimme von der Brücke: „Lasst die Männer durch, ihr dreckigen Halunken! Heh, Jennings, suchen Sie mich?“
Ein mittelgroßer, gedrungener Mann in abgewetzter Jeans, weißem Hemd und einer Kapitänsmütze auf dem Kopf stand am Geländer neben der Treppe, die zum Deck hinunterführte. Lange Haare fielen unter der Mütze hervor fast bis auf seine Schultern. Auch er trug einen Bart, das scharf geschnittene Gesicht verriet Durchsetzungsvermögen, der schmallippige Mund ein hohes Maß an Brutalität.
Die Arbeiter traten zur Seite. Finster starrten sie Fitzgerald und Jennings an. Fitzgerald bemerkte jetzt, dass das Weiße ihrer Augen einen gelblichen Schimmer aufwies. Ein Symptom, das auf eine kranke Leber hindeutete.
Fitzgerald und Jennings schritten an ihnen vorbei. „Ja, Carter, wen sonst?“, gab Jack Jennings zu verstehen, als sie am Fuß der schmalen Treppe anlangten.
„Wer ist er?“, fragte der Bursche mit der Mütze und wies mit einer knappen Geste auf Fitzgerald.
Jennings erklärte es ihm.
Carter wusste Bescheid. „Ja“, sagte er, „über Ihre Rolle bin ich informiert, Fitzgerald.“
„Hat Ihnen das Jennings auf die Nase gebunden?“, stieß Fitzgerald hervor. Dieser Carter war nicht sein Typ. Er erinnerte ihn eher an einen heruntergekommenen, gewissenlosen Piraten als an einen Mann, der irgendwann ein ordnungsgemäßes Kapitänspatent erworben hatte.
„Natürlich“, knurrte Carter. „Ich wollte die Leute kennen, die mitmischen. Hätte er mich im Unklaren gelassen, hätte er den Dreck selbst hinausschippern und abladen können.“
„Wir sollten nicht hier darüber sprechen“, murmelte Fitzgerald.
„Geh‘n wir in meine Kajüte“, kam es von Carter. Dann hob sich seine Stimme: „Geht an eure Arbeit, ihr faulen Hunde!“, brüllte er. „Wenn ihr denkt, es gibt im Moment keine, dann sucht euch eine. Schrubbt das Deck. Sieht aus wie n Schweinestall hier.“
Als sie sich in der Kajüte gegenüber saßen, sagte Carter verächtlich: „Es sind Illegale. Einer kommt aus Bolivien, zwei stammen aus Kuba, zwei aus Kolumbien und einer aus Mexiko. Sie arbeiten für den halben Lohn und scheuen sich nicht vor der größten Drecksarbeit.“ Er grinste breit.
„Die Kerle sehen krank aus“, murmelte Fitzgerald.
„Sie arbeiten direkt am Giftmüll. Aber das ist deren eigenes Problem. Wenn sie motzen, kriegen sie eins aufs Maul. Wenn es ihnen nicht passt, können sie verschwinden. Das ist mein Motto.“
„Und wir sollten uns da nicht einmischen“, murmelte Jennings.
„Also, was treibt euch her?“, kam Carter auf den Punkt.
Fitzgerald schaute ihn zwingend an. Dann stieß er hervor: „Haben Sie den Müll, den Sie von Jennings übernommen haben, im Long Island Sound abgeladen, Carter?“
Carter kniff die Augen eng. „Wie kommen Sie darauf?“, fragte er ausweichend.
„Weil da oben ein Fischsterben seinen Anfang genommen zu haben scheint. Die Behörden und Umweltschützer gehen davon aus, dass das Wasser verseucht wurde. Also, raus mit der Sprache, Carter: Haben Sie entgegen der Absprachen den Müll in den Long Island Sound gekippt?“
Carter schürzte die Lippen. „Ihr Ton gefällt mir nicht, Fitzgerald“, knurrte er. „Außerdem sollten Sie nicht vergessen, dass wir sozusagen in einem Boot sitzen. Sie und Taylor haben es doch mitgetragen, dass ich das Gift wild entsorgte. Und sicher haben Sie nicht schlecht verdient dabei.“
„Das ist keine Antwort auf meine Frage“, knirschte Fitzgerald.
„Das war eine glasklare Feststellung“, gab Carter mit klirrendem Tonfall zurück. „Sie sind keinen Deut besser als ich oder Jennings. Also kommen Sie runter von Ihrem hohen Ross.“
„Wir wollen lediglich Sicherheit“, mischte sich Jennings ein. Er grinste maskenhaft. „Also sagen Sie‘s schon. Haben Sie den Müll absprachegemäß im Atlantik versenkt, oder ist was dran an Fitzgeralds Verdacht?“
Carter lehnte sich zurück und verschränkte die Hände über seinem Bauch. Er zeigte ein spöttisches Grinsen. „Was wollt ihr überhaupt? Sie besitzen Quittungen über die ordnungsgemäße Entsorgung und rechneten mit Akorn ab, Jennings. Sie, Fitzgerald, und Ihr Boss, Leland Taylor, haben darauf geachtet, dass die Gelder pünktlich geflossen sind. Die Kohle haben wir uns geteilt. Was interessiert euch der Rest?“
„Also doch!“, fauchte Fitzgerald.
„Sie berufen sich auf Quittungen, die allesamt auf meinem Computer erstellt wurden, Carter“, knurrte Jennings. „Fälschungen, die einzeln als solche nicht zu erkennen sind. Wenn man sie aber nebeneinanderlegt, sieht ein Blinder, dass Stempel und Unterschrift sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Sie sind jeweils Ihren Abrechnungen beigeheftet. Man wird im Zusammenhang mit dem Umweltskandal sämtliche Entsorgungsbetriebe überprüfen, auch die Jack Jennings – Trading Consulting & Recycling Corporation.“
„Schmeißen Sie die Abrechnungen in den Reißwolf, Jennings“, schlug Carter vor.
„Ich kann Ihre Abrechnungen nicht vernichten, Carter, denn Kopien davon befinden sich bei Akorn, mit der wiederum ich abgerechnet habe. Ich schätze, Sie haben uns da ein verdammtes Ei ins Nest gelegt, Carter.“
Carter schaute verunsichert.
Fitzgerald stieß wütend hervor: „Wissen Sie, dass das ein Fall für die Bundespolizei wird, Carter? Und mit den Kerlen vom FBI ist gewiss nicht zu spaßen.“
Carters Stirn umwölkte sich. Ein Schatten der Besorgnis lief über sein Gesicht. „Verdammt“, grunzte er, „Sie malen den Teufel an die Wand.“
„Der Teufel soll Sie holen, Carter!“, brach es aus Fitzgerald heraus. „Wenn wir die nächsten Jahre hinter Gefängnismauern verbringen, dann nur Ihretwegen.“
Carter kratzte sich am Kinn. Seine Miene verriet plötzlich Rastlosigkeit. „Wenn das FBI ins Spiel kommt, dann fängt die Sache an heiß zu werden“, quoll es über seine Lippen. „Der Kahn ist im Moment ungefähr halb voll mit Giftmüll. Ich schätze, ich setze mich ab. Schließlich muss ich die Bullen nicht nur wegen des Giftmülls fürchten, sondern auch wegen der Kerle an Bord, die sich unerlaubt in den Staaten aufhalten. Auf hoher See können mir auch die Schnüffler vom FBI nichts anhaben. Ich versenke den Dreck weit draußen im Meer und such mir einen sicheren Hafen irgendwo in Südamerika.“
„Interpol wird Sie aufspüren“, knurrte Fitzgerald. „Sie haben in gravierender Art und Weise gegen internationale Vorschriften verstoßen. Sie wären schneller wieder in den Staaten, als Sie denken können, und zwar an Händen und Füßen gefesselt.“
Carter sprang auf. „Wieso habe ich gegen Vorschriften verstoßen?“, schnappte er fast hysterisch und tippte sich mit dem Daumen gegen die Brust. „Das war alles doch eure Idee, Ihre, Jennings, Taylors, und die Ihre, Fitzgerald. Versucht jetzt nur nicht, mich zum Sündenbock zu stempeln.“
Seine Augen versprühten wilde Blitze. Es sah aus, als wollte er sich auf Fitzgerald stürzen.
„Natürlich sind wir alle gleichermaßen verantwortlich“, gab Fitzgerald zu. „Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, was auf dem Steckbrief stehen wird, mit dem man international nach Ihnen fahndet, wenn Sie fliehen.“
Carter stierte ihn sekundenlang aus unterlaufenen Augen an, dann keuchte er: „Verdammt, soll ich hier warten, dass sie mich wie einen Hammel zur Schlachtbank führen?“
„Leider kann ich Ihnen da auch keinen Rat geben, Carter“, presste Fitzgerald hervor. „Schlachthammel sind wir dank Ihrer Ignoranz alle.“
Fitzgerald und Jennings verließen das Schiff. Die finsteren Blicke der Arbeiter folgten ihnen.
Als sie mit ihrem Auto außer Sichtweite waren, brüllte Carter: „Wir legen ab! Löst die Taue. Presto, presto, ihr lahmarschigen Hunde. Oder muss ich euch Beine machen?“
4
Kaum, dass sie die Piers hinter sich gelassen hatten, nahm Jack Jennings per Handy Verbindung mit Leland Taylor auf. Er berichtete.
Taylor legte, nachdem Jennings geendet hatte, den Hörer erst gar nicht auf die Gabel, sondern tippte eine Nummer, und als sich eine männliche Stimme meldete, stieß er hervor: „Du musst eine Sache für mich erledigen, Ray. Der Bursche heißt Anson Carter und ist Kapitän des Flying Barracuda. Der Frachter liegt am südlichsten Pier bei Bergen Point, New Jersey. Den Preis für den Hit bezahle ich dir mit Ware.“
„Wann soll es geschehen?“, fragte der Mann am anderen Ende der Strippe.
„Sofort. Dein Mann kann Carter daran erkennen, dass er der einzige Amerikaner an Bord ist. Er trägt eine Kapitänsmütze, ist mittelgroß und gedrungen.“
„Ich schicke sofort jemanden los. Muss ich lange auf die Ware warten?“
„Barton ist fleißig. Er produziert im Moment Ecstasy. Du kriegst soviel, dass du wahrscheinlich ganz New York damit süchtig machen könntest.“
„All right, Leland. Du kannst dich auf mich verlassen.“
„Ja, das weiß ich. Eine Hand wäscht die andere.“ Taylor lachte.
Als Jennings im Hof von Jack Jennings – Trading Consulting & Recycling Corporation aus dem Auto stieg, sagte er: „Carter ist alleine verantwortlich, wenn es da oben zu einer Umweltkatastrophe kommt, Fitzgerald. Wenn er mich mit gefälschten Papieren über die ordnungsgemäße Entsorgung bedient hat, kann mir keiner einen Strick daraus drehen.“
„Der Haken an der Sache ist nur, dass Sie die Papiere selbst gefälscht haben, Jennings.“
„Und wer, bitte, soll mir das beweisen? Ich werde sofort die verräterischen Dateien von meinem Computer löschen und die Sicherungsdisketten vernichten. Soll Carter doch verschwinden. Solange er sich dem Zugriff der Polizei entzieht, können wir uns auch in Sicherheit wiegen.“
„Und wenn er der Polizei ins Netz geht?“
„Ich besitze Quittungen, wonach ich Carter die Entsorgungskosten bis auf den letzten Cent bezahlt habe. Sollte Carter geschnappt werden, können wir alles abstreiten. Am Ende wird nur er als Umweltkiller und Betrüger dastehen.“
„Nichtsdestotrotz werden unsere Namen ins Spiel kommen“, streute Fitzgerald seine Zweifel aus. „Die Polizei wird eine Reihe von Nachforschungen und Ermittlungen anstellen. Und irgendwo gibt es immer eine undichte Stelle. Ich glaube nicht, dass wir ungeschoren davonkommen, wenn Carter auffliegt.“
„Sie verstehen es, einem den Tag zu verderben, Fitzgerald“, maulte Jennings und knallte die Autotür zu.
Fitzgerald fuhr zurück zur Akorn Inc. und ging zu Taylor. Der fixierte ihn ohne eine Spur von Freundlichkeit und sagte mit schmalen Lippen: „Deine Vermutung hat sich also bestätigt, Dee. Aber dass Carter den Müll in den Long Island Sound gekippt hat, ist für uns noch lange kein Grund, auszurasten. Es ist allenfalls dazu angetan, dass wir eine Zeitlang die Finger vom illegalen Geschäft lassen.“
„Ich glaube nicht daran, dass wir so einfach aus der Nummer herauskommen, Leland“, blaffte Fitzgerald.
„O doch“, versetzte Taylor. „Wenn Carter nicht mehr reden kann, wer soll unsere Namen dann ins Gespräch bringen? Ich habe schon mit Stanford gesprochen. Er schickt jemanden hinaus zum Flying Barracuda.“
„Ich verstehe nicht“, sagte Fitzgerald und blinzelte verblüfft.
„Es ist ganz einfach“, knurrte Taylor mit unbewegtem Gesicht. „Carter wird den heutigen Abend nicht mehr erleben. Denn Tote schweigen zuverlässig.“
Fitzgerald prallte zurück. „Du schickst ihm einen Killer!“, platzte es entsetzt aus seinem Mund. „Du – du willst Carter umbringen lassen?“ Fitzgerald kämpfte mühsam um seine Fassung. Abwehrend hob er die Hände. „Nein! O nein“, keuchte er. „Da mache ich nicht mit. Ich …“
„Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, Dee“, kam es ungerührt von Leland Taylor.
„Mord!“, stieß Fitzgerald mit ausgepresstem Atem hervor. Rasselnd holte er Luft. „Herr im Himmel. Das kann nicht gut geh‘n“, röchelte er dann. „Wir verstricken uns immer tiefer in diesem Sumpf. Gütiger Gott, Leland, ruf Stanford an und lass die Sache abblasen. Mit Mord will ich nichts zu tun haben.“
Taylor musterte sein Gegenüber mit einer Mischung aus Geringschätzigkeit, Ungeduld und Unwillen. Seine rechte Braue hatte sich gehoben, was seinen Zügen einen erhaben-arroganten Ausdruck verlieh. „Zu spät. Außerdem hast du bereits damit zu tun, Dee. Denn seit zwei Minuten bist du Mitwisser. Du steckst mit drin. Aussteigen kannst du nicht.“
Einen Augenblick fand Fitzgerald vor Erregung keine Worte. Doch dann hechelte er: „Und ob ich das kann. Ich …“ Er brach ab, zwang sich zur Ruhe und sagte abgehackt: „Lass mich bei Mord aus dem Spiel, Leland. Ich bin ein Betrüger, sicher. Aber ich bin kein Mörder.“
„Ich kann dich nicht mehr aus dem Spiel lassen, Dee“, erwiderte Taylor mit ausdrucksloser Miene. „Du weißt nämlich zu viel.“
Fitzgerald setzte zu einer Erwiderung an, verschluckte aber, was ihm auf den Lippen brannte, aus seinen Augen brach jäher Hass. Unvermittelt machte er auf dem Absatz kehrt und strebte der Tür zu.
Taylors Stimme holte ihn ein: „Denk daran, Dee. In unserer Situation kann jeder Fehler verheerende Folgen haben. Anson Carter wird es zu spüren kriegen. Du solltest dir sein Schicksal vor Augen führen, ehe du dich zu irgendetwas hinreißen lässt.“
„Das war deutlich, Leland“, entrang es sich Fitzgerald. Er verließ das Büro. Hinter ihm schlug die Tür zu.
5
Während in Dee Fitzgerald Leland Taylors unmissverständliche Drohung nachhallte, fuhren zwei Kerle durch den Holland Tunnel nach New Jersey. Sie ließen die Röhre hinter sich und wandten sich nach Süden. Bei den Piers westlich von Bergen Point hielten sie an. So sehr sie sich auch die Augen ausschauten, vom Flying Barracuda war nichts zu sehen.
„Der Hurensohn hat sich abgesetzt“, knurrte Cash Hanson, ein hagerer, krankhaft bleich wirkender Bursche.
„Ich frage mal einen der Arbeiter dort drüben“, sagte Antonio Barkley, ein dunkelhaariger Mann mit blatternarbigem Gesicht, dessen Mutter Mexikanerin war, daher auch der spanische Vorname. Er stieg aus dem Wagen und stapfte zu einer Gruppe von Männern, die bei einem der Lagerschuppen einen Lkw beluden. Der Gabelstapler verursachte einen höllischen Lärm.
Barkley wandte sich an einen der Arbeiter: „Ich suche den Flying Barracuda“, rief er.
„Der ist vor einer guten halben Stunde abgedampft“, kam es laut zurück. Der Arbeiter fixierte Barkley schärfer. „Sind Sie von der Polizei?“
„Wie kommen Sie darauf?“
„Na, weil doch jeder weiß, dass es auf dem Kahn nicht mit rechten Dingen zugeht. Nichts als zwielichtige Gestalten. Angefangen beim Kapitän. Auf dem Flying Barracuda möchte ein vernünftiger Mensch nicht mal tot über der Reling hängen. Da waren heute schon mal zwei da …“
„Welche Richtung hat er genommen?“ Mit dieser Frage unterbrach Barkley den Redefluss des Arbeiters.
Der Mann wies nach Süden. „Er ist um die Südspitze herum und in den Kanal geschippert. Wahrscheinlich will er in die Meerenge zwischen Brooklyn und Staaten Island, und von dort hinaus auf den Atlantik.“
„Wie schnell fährt so ein Frachter?“, erkundigte sich Barkley.
Der Arbeiter wiegte den Kopf. „In diesen Gewässern keine drei Knoten.“
Fragend schaute Barkley den Mann an. „Das sind ungefähr fünfeinhalb Kilometer in der Stunde“, lachte dieser.
Barkley bedankte sich, indem er lässig die Hand hob, dann kehrte er zu dem wartenden Wagen zurück. „Der schwimmt wahrscheinlich noch im Kill van Kull-Strom“, gab er zu verstehen. „Wir fahren an der Küste entlang. Vielleicht holen wir ihn noch ein, ehe er aufs offene Meer hinausdampft.“
Der Wagen rollte auf die Bayonne Bridge, über die man von New Jersey nach Staten Island gelangte. Das Verkehrsaufkommen auf der 511 Meter langen Brücke war nicht sehr groß. Trotz absoluten Halteverbots fuhr Cash Hanson mitten auf der Brücke rechts ran. Einige Autofahrer hupten, andere zeigten eindeutige Handbewegungen.
Barkley griff unter eine Decke auf dem Rücksitz. Da lagen ein Präzisionsgewehr und ein Fernglas. Der Killer nahm das Fernglas. Sie stiegen aus und rannten über die vierspurige Straße, erreichten das Brückengeländer, und Barkley hob das Glas an seine Augen. Über ihnen spannte sich die Stahlkonstruktion des Rundbogens. Unter ihnen lag der Kill van Kull, ein breiter Fluss, der die Newark Bay mit der Upper Bay verbindet, und den der Arbeiter auf dem Pier mit Kanal bezeichnete.
„Da vorne schwimmt ein Kahn“, murmelte Barkley. „Das könnte er sein.“ Er reichte das Fernglas seinem Komplizen.
Hanson schaute hindurch. Sein Blick erfasste einen Frachter, der ziemlich weit auf der rechten Seite auf dem Kill van Kull in Richtung Upper Bay tuckerte. Durch das Fernglas schien das Boot greifbar nahe zu sein. „Der im Ruderhaus hat eine Kapitänsmütze auf dem Kopf“, sagte Hanson zwischen den Zähnen. „Das könnte er sein.“
„Folgen wir ihm.“
Sie hetzten zurück zum Auto. Nach etwa 250 Metern war die Brücke zu Ende. Sie fuhren ab, folgten auf dem breiten Highway den Gleisen der Island Rapid Transit Railway bis zu den Piers von St. Georg.
200 Meter vom Festland entfernt schwamm der Flying Barracuda, den Bug in Richtung The Narrows ausgerichtet. Weit im Süden spannte sich die Verrazano Narrows Bridge über die Meerenge, dahinter beginnt das offene Meer.
Die beiden Killer wandten sich auf der Bay Street nach Süden und überholten den Frachter. Dann endeten die Piers. Hanson hielt am Rand der Kaimauer an. Antonio Barkley stieg um auf den Rücksitz. Er holte das Gewehr unter der Decke hervor und kurbelte die Seitenscheibe nach unten. Er zog den Kolben an die Schulter, legte den Schaft auf den unteren Rand des Fensters, drückte das linke Auge zu und schaute durch das Zielfernrohr. Die Häuser von Bay Ridge in Brooklyn auf der anderen Seite der Meerenge schienen infolge der vielfachen Vergrößerung greifbar nahe gerückt zu sein.
Barkley senkte das Gewehr wieder. Die Justierung war in Ordnung. Der Killer war zufrieden.
Sie warteten. Da der Frachter nur langsam vorwärts kam – er bewegte sich kaum viel schneller als im Schritttempo – verging fast eine Viertelstunde, bis der Flying Barracuda in ihrem Blickfeld erschien.
Hanson hob das Fernglas und beobachtete das Boot. „Er steht noch immer am Ruder“, sagte er.
Barkley lud durch und hob das Gewehr. Der Frachter erschien im Fadenkreuz. Barkley nahm die Waffe etwas höher, dann schwenkte er sie langsam nach links. Er bekam das Ruderhäuschen ins Visier. Dann den Kopf des Mannes mit der Kapitänsmütze. Der Killer sah ein bärtiges Gesicht. Es erschien im Mittelpunkt der Visiereinrichtung. Langsam krümmte sich Barkleys Zeigefinger um den Abzug. Er erreichte den Druckpunkt und hielt den Atem an. Dann peitschte der Schuss. Zwischen den Geräuschen ringsum hörte er sich an wie Fehlzündung eines Automotors.
Wie vom Blitz getroffen brach Anson Carter auf dem Frachter zusammen. Der Flying Barracuda schwamm träge weiter in der eingeschlagenen Richtung. Die Kerle, die an Deck herumlungerten, schienen gar nicht bemerkt zu haben, dass das Boot plötzlich führerlos war.
Antonio Barkley zog das Gewehr zurück. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel. Hanson startete den Motor und fuhr an. Die Killer verschwanden über die Verrazano Narrows Bridge nach Brooklyn.
6
Leland Taylor hatte sich in die Chemieabteilung begeben. Er betrat das Büro James Bartons. Barton war Diplomchemiker und führte sogar einen Doktortitel.
Das Büro war verwaist. Aber die Tür zum Labor war nur angelehnt. Taylor durchquerte das Büro, stieß die Tür auf und durchschritt sie.
Barton, der irgendeine chemische Verbindung in einem Reagenzglas gegen das Neonlicht der Deckenbeleuchtung hielt, wandte sich ihm zu und ließ die Hand mit dem röhrenartigen Glas sinken.
Taylor schloss die Tür. „Wie sieht es aus, James?“, fragte er. „Wie viel hast du produziert?“
„Drei Beutel voll. Habe die halbe Nacht gearbeitet. Willst du das Zeug gleich mitnehmen?“
„Nein. Ich hole es am Abend, wenn niemand mehr im Betrieb ist. Wann steigst du in die LSD-Produktion ein?“
„Dazu benötige ich noch eine – hm, Zutat. Die musst du mir beschaffen.“
„Was für eine Zutat? Ich denke, du verfügst über alle Chemikalien, die du benötigst?“
„Die Chemikalien habe ich. Das ist richtig. Aber ich brauche Lysergsäure. Ohne sie ist eine Produktion von LSD unmöglich. Und so etwas haben wir bei Akorn nicht.“
„Was ist das?“
„Der Grundbaustein von Mutterkornalkaloid. Aber das jetzt zu erklären würde zu weit führen und dich auch sicher nicht interessieren.“
„Wo kriege ich dieses Zeug her? Und wie kann ich den Ankauf legalisieren? Schließlich musst du ja einen Verwendungsnachweis führen.“
„Kaufen kannst du es bei jedem pharmazeutisch-chemischen Betrieb. Legalisieren musst du es mit den verschiedenen Tests, die wir zur Verbesserung unserer Produkte durchführen. Das muss auch die Innenrevision schlucken. Diese Kerle haben doch von Chemie und chemischen Verbindungen keine Ahnung.“
Taylor schaute skeptisch. „Vielleicht sollten wir uns das mit dem LSD noch einmal überlegen. – Die Pillen, die du erstellt hast: Sind sie sauber? Wie hoch ist die Dosierung, und was kosten sie?“
„Natürlich sind sie sauber. Pro Pille enthalten sie hundertdreißig Milligramm Methylendioxyamphetamin-Derivate, abgekürzt MDMA. Pro Pille kannst du zehn Dollar verlangen. Der Preis für die Pille, den der Verbraucher zahlt, liegt bei etwa fünfzehn Dollar. Deine Abnehmer haben also immer noch fünf Dollar Gewinn an der Pille.“
„Wie viele Dance Drugs hast du in den Beuteln?“
„Ich habe sie nicht gezählt. Schätzungsweise zweitausend.“
Taylor pfiff durch die Zähne. „Zwanzigtausend Bucks. Nicht schlecht. Zehntausend für jeden von uns. – Ich komme gegen sieben Uhr vorbei und hole sie ab. Gehst du noch einmal in die Produktion?“
„Wenn du willst. Wichtig ist, dass wir die Dinger auch loswerden. Und dein Abnehmer muss sicher sein. Wenn sie ihn erwischen, sobald er das Zeug unter die Leute bringt, fliegen wir unter Umständen auch auf.“
„Keine Sorge. Möglicherweise gibt es im Zusammenhang mit einem Umweltskandal einige polizeiliche Ermittlungen im Betrieb, aber du brauchst dich deswegen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Es geht um unsachgerecht entsorgten Müll. Hat also nichts mit deiner Arbeit zu tun. Bis sieben Uhr also. Dein Geld kriegst du wie immer bar.“
Barton nickte.
Taylor verließ das Labor. Als er in seinem Büro ankam, gab ihm seine Sekretärin zu verstehen: „Webster hat schon zweimal angerufen. Er muss Sie unbedingt sprechen, behauptet er. Klang ziemlich aufgeregt.“
„Danke. Ich rede mit ihm.“
Er verzog sich in sein Büro und griff zum Telefonhörer. „Was wollen Sie, Webster? Was ist so dringlich, dass Sie …“
„Ich glaube, Fitzgerald will abspringen. Er machte Andeutungen, dass er sich nicht in Dinge hineinziehen lasse, die er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren könne, und dass er den Job hier hinschmeißen will.“
„In welche Dinge will er sich nicht hineinreißen lassen?“, knurrte Taylor.
„Das habe ich ihn auch gefragt, und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er in der Sache schon drinsteckt bis zum Hals. Er hat nur abgewunken. Er meinte, er müsse in sich gehen und dann eine Entscheidung treffen.“
„Was für eine Entscheidung?“
„Keine Ahnung. Aber ich denke, dass er überlegt, ob er sich der Polizei stellen soll.“
„Dieser Dummkopf!“, quetschte Taylor zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor. „Wie sieht es bei Ihnen aus, Webster? Spielt Ihre Psyche auch nicht mehr mit?“
„Meinetwegen brauchen Sie sich keine Sorgen machen, Taylor. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Sollte die Polizei hier aufkreuzen und herumschnüffeln, wird sie nichts anderes finden als die Abrechnungen von Jennings und die Überweisungsbelege, die die Zahlungen an Jennings dokumentieren.“
„Haben Sie das Fitzgerald auch gesagt?“
„Natürlich. Aber es konnte ihn nicht beruhigen, und er hat den Betrieb verlassen.“
„Er hat den Betrieb verlassen?“, echote Taylor beunruhigt.
„Ja. Er meinte, er müsste alleine sein.“
„Ist gut, Webster.“ Taylor unterbrach die Verbindung. Kurzentschlossen wählte er eine Nummer, und gleich darauf sagte er halblaut in die Muschel: „Fitzgerald verliert die Nerven, Ray. Er kann uns gefährlich werden. Er sprach davon, sich stellen zu wollen. Du solltest dir was einfallen lassen.“
„Wie bei Anson Carter?“
„Genauso. Am besten noch heute Nacht.“
„Kein Problem. Bezahlung – dieselbe?“
„Sicher. Brauchst du Fitzgeralds Adresse?“
„Wäre vielleicht nicht schlecht, sie zu kennen.“
Taylor gab sie durch. Dann legte er zufrieden auf. „Du hast es dir selber zuzuschreiben, Dee“, murmelte er ohne jede Gemütsregung vor sich hin.
7
Punkt sieben Uhr erschien Leland Taylor mit einem Diplomatenkoffer im Büro James Bartons. Er packte die drei Beutel mit den Dance Drugs, wie die Ecstasy-Tabletten in der Szene genannt werden, ein.
„Am LSD wäre vielleicht mehr verdient“, meinte er und grinste seicht. „Ich muss mal drüber nachdenken, wie ich dieses Zeug – wie heißt es doch gleich wieder?“
„Lysergsäure.“
„… wie ich dieses Zeug beschaffen kann, ohne dass es Verdacht erregt. Könntest du das LSD auch in Tablettenform herstellen?“
„Mikrotabletten“, versetzte Barton. „Zweihundertfünfzig Mikrogramm Wirkstoff.
„Zunächst bleiben wir beim Ecstasy, James. Bis zum nächsten Mal also.“
Er verließ das Büro, wenig später trat er aus dem Gebäude und ging zu seinem Wagen auf dem Firmenparkplatz. Er nahm sein Handy zur Hand und sprach hinein: „In einer Stunde beim Bryant Park. Bring zwanzigtausend Dollar mit.“
„Fünfzehntausend, Leland. Fünftausend verlangt Beecher für die beiden Hits. Wie viel Drugs hast du?“
„Zweitausend, pro Drug zehn Bucks. Das ist doch in Ordnung? – Heh, Beecher ist ja nicht gerade billig.“
„Alles hat eben seinen Preis. – Okay. In einer Stunde an der Südseite des Parks.“
Von Taylor unbemerkt hatte auch James Barton das Betriebsgebäude verlassen. Er war zu seinem Chevy gegangen und hatte sich hineingesetzt. Als Taylor anfuhr, folgte er ihm in sicherem Abstand.
Taylor fuhr auf der Sixth Avenue nach Norden und bog vor dem Bryant Park nach rechts in die 40th Straße ab. Gleich darauf parkte er.
Barton fuhr ein kurzes Stück auf der Sixth Avenue weiter, ließ den Chevy auf einen Parkplatz für Parkbesucher rollen und schlug sich zwischen die Büsche. Schon bald konnte er im Schutze dichter Büsche Leland Taylors Wagen sehen. Es war ein schwarzer Mercedes der S-Klasse.
Der Chemiker wartete geduldig.
Dann rollte ein Ford heran. Er näherte sich von der Fifth Avenue und hielt auf der Höhe von Taylors Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite an. Ein dunkelhaariger Mann stieg aus, warf die Tür zu und ging über die Fahrbahn. Er winkte Taylor zu, dann ging er um den Mercedes herum und warf sich auf den Beifahrersitz.
„Hi, Leland“, grüßte er. „Das nenne ich prompte Lieferung. Lass das Zeug mal sehen.“
Taylor angelte sich vom Rücksitz den Diplomatenkoffer und öffnete ihn auf seinem Schoß. Die drei Beutel mit Ecstasy-Tabletten waren der einzige Inhalt. „Erstklassige Ware, Ray“, gab Taylor zu verstehen. „Und gewiss nicht zu teuer.“
„Dafür, dass sie die Akorn finanziert, verlangst du genug.“ Stanford schnappte sich mit dem letzten Wort einen der Beutel. Er war zugeschweißt. Es handelte sich um einen Gefrierbeutel, wie er in jedem Haushalt verwendet wird. „Kann ich den Koffer haben?“ Er warf den Beutel wieder hinein.
„Wenn ich ihn wiederkriege“, grinste Taylor.
„Mach dich nicht lächerlich.“ Stanford griff in die Innentasche seiner Jacke. Seine Hand kam mit einem Umschlag zum Vorschein, der gut gefüllt war. „Fünfzehntausend in Hundertern.“
Taylor klappte den Koffer zu und reichte ihn Stanford. Er nahm das Kuvert und steckte es in die Tasche. „Nachzuzählen brauche ich ja nicht, wie?“
„Nein. Wann kann ich mit Nachschub rechnen?“
„Ich ruf dich an. – Die Sache mit Fitzgerald hast du geregelt?“
„Yeah. Der ist so gut wie tot.“
Stanford stieg mit dem Koffer in der Hand aus dem Auto. Barton verließ seinen Platz hinter den Büschen. Er hatte sich die Zulassungsnummer des Drogenaufkäufers notiert. Über sie den Besitzer des Wagens herauszufinden, würde nicht schwer sein.
Es war ganz einfach. Von einer Telefonzelle aus rief Barton das nächste Polizeirevier an und sagte: „Mir hat einer auf dem Parklatz am Bryant Park eine Delle ins Auto gefahren. Er hat es wohl nicht bemerkt, denn er ist nicht mal ausgestiegen, sondern weggefahren. Ein aufmerksamer Spaziergänger hat sich seine Zulassungsnummer notiert.“
Er gab die Nummer durch.
„Damit ich meinen Schaden regeln kann, würde ich gerne wissen, um wen es sich bei dem Unfallfahrer handelt, und wo ich den Mann finden kann.“
„Möchten Sie Anzeige erstatten?“, fragte der Officer.
„Nein. Mir wäre geholfen, wenn Sie in Ihrem Computer den Namen des Mannes und seine Anschrift heraussuchen würden.“
Drei Minuten später hatte er, was er begehrte. Ray Stanford, Plymouth Street 211, Brooklyn, notierte er, bedankte sich und fuhr nach Hause.
8
Zwei Stunden später schellte bei Stanford das Telefon. Er nahm ab und nannte seinen Namen.
Der Anrufer stellte sich nicht vor. Er sagte: „Ich weiß, dass Sie an Drogen interessiert sind, Stanford. Ich könnte sie Ihnen liefern.“
„Wer sind Sie?“
„Das tut nichts zur Sache. Sagen Sie mir nur, dass Sie interessiert sind. Dann kommen wir ins Geschäft.“
„Welche Drogen wären es, die Sie zu bieten haben?“
„Ecstasy. In jeder beliebigen Dosierung.“
Tiefes Misstrauen erfüllte Ray Stanford. Der Anrufer konnte auch ein Bulle oder ein V-Mann der Polizei sein. Er dehnte: „Kein Interesse, Mister. Ich nehme keine Drogen.“
Der Anrufer lachte herablassend. „Ich spreche auch nicht vom Eigenbedarf, Stanford. Ich rede vom Handel. Denken Sie nur nicht, dass ich nicht Bescheid weiß.“
„Und woher verfügen Sie über Ihre Kenntnis, Mann?“, zischte Stanford.
„Neugierde ist eine schlechte Charaktereigenschaft, Stanford. Also, haben Sie Interesse? Sie kriegen von mir den Drug mit hundertdreißig Milligramm MDMA für acht Dollar.“
In Stanfords Zügen arbeitete es. „Das am Telefon zu bereden ist nicht gut, Mister. Können wir uns irgendwo treffen?“
„Heute nicht mehr. Ich rufe wieder an. Und – keine Angst, Stanford. Ich bin nicht vom Narcotic Squad oder einer anderen Polizeiabteilung. Ich will mit Ihnen ins Geschäft kommen.“
Der Anrufer legte auf.
Stanford setzte sich sofort mit Leland Taylor in Verbindung. „Wer weiß von unserem Ecstasy-Geschäft außer dir und mir, Leland?“, schrie er in den Äther.
„Was brüllst du wie ein Irrer?“, fragte Taylor. „Niemand. Nicht mal Barton weiß, wer der Abnehmer seiner Seligmacher ist. Weshalb fragst du?“
Stanford berichtete ihm von dem Anruf eben.
Betroffen schwieg Taylor eine ganze Weile. Stanford hörte ihn nur in die Muschel atmen. Dann erklang Taylors Stimme: „Hat dich nicht schon einige Male die Polizei des Drogenhandels verdächtigt, Ray?“
„Ja, verdammt, aber die Bullen bekamen nie was in die Hand gegen mich. Ich bin cleverer als der gesamte Polizeiapparat New Yorks. Ich hab die Schnüffler ablaufen lassen wie kaltes Wasser. Wie es aussieht, haben sie es längst aufgegeben, mir nachzustellen. Unabhängig davon bin ich erst wieder aktiv, seit wir beide zusammenarbeiten.“
„Was meinst du – wurden wir heute Abend beobachtet?“
„Möglicherweise.“
„Hoffentlich war es kein Schnüffler, der uns observiert hat“, sorgte sich Taylor. „Fiel mein Name?“
„Nein. Bist du dir sicher, dass Barton nicht weiß, für wen er die Drugs produziert?“
„Hundertprozentig. Es interessiert ihn auch gar nicht. Er hat noch nie irgendeine Frage gestellt.“
„Dann kann ich nur abwarten, dass sich der Mistkerl noch einmal meldet“, schloss Stanford das Gespräch ab.
Er hatte ein ungutes Gefühl. Der Anruf rief große Unsicherheit in ihm hervor. Die Zweifel waren da. Dass der Anrufer versichert hatte, kein Polizist zu sein, hieß gar nichts. Andererseits aber war das Angebot verlockend.
Er führte ein weiteres Gespräch. Diesmal hatte er Tom Beecher, einen Barbesitzer, an der Strippe. Nachdem er von dem seltsamen Anruf berichtet hatte, schloss er: „Ich traue der Sache nicht so recht. Möglicherweise sitzen mir die Bullen immer noch auf der Fährte und haben mich beobachtet, als ich heute Abend das Zeug von Taylor in Empfang nahm. Ich habe plötzlich das Gefühl, auf einer Bombe zu hocken. Kannst du den Stoff nicht sofort abholen lassen?“
„Wenn sie euch beobachtet hätten, Ray, dann hätten sie es gewiss nicht dabei belassen“, erklärte Tom Beecher. „Sie hätten sich die Gelegenheit, dich auf frischer Tat zu ertappen, gewiss nicht entgehen lassen. Morgen Nachmittag kommt Virgy zu dir und holt die Drugs ab. Wie viel Geld kriegst du?“
„Siebzehntausend Dollar. Es sind zweitausend Tabletten.“
„Wenn ich die fünftausend, die ich kriege, hinzurechne, dann macht das für die Tablette elf Bucks.“
„Das ist billig, Tom, verdammt billig. Zehn Dollar verlangt Taylor, einen ich als Zwischenhändler.“
„Heh, Ray“, lachte Beecher. „Du solltest dir das Geschäft mit den acht Bucks pro Pille überlegen. Könntest deinen Gewinn verdreifachen.“
„Ich werd drüber nachdenken“, murmelte Stanford.
Der Anruf begann ihn wieder zu beschäftigen. Und er fragte sich, ob die Polizei es tatsächlich aufgegeben hatte, gegen ihn wegen seiner Rauschgiftgeschäfte, die er über Jahre hinweg tätigte, zu ermitteln.
Er war sich plötzlich gar nicht mehr so sicher.
9
Dee Fitzgerald war ziellos durch Manhattan gefahren. Er lief über eine Stunde durch den Central Park. Unablässig bemühte er sich, eine klare Struktur in sein Denken zu zwingen. Aber es war ihm nicht möglich, auch nur einen einzigen vernünftigen Gedanken zu fassen. Seine Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, machte ihn wütend. Er saß wieder im Auto. Innerlich total zerrissen hielt er bei einem McDonalds-Laden, kaufte sich zwei Hamburger und schwemmte sie mit einer Cola hinunter.
Ja, er dachte daran, zur Polizei zu gehen und sich selbst anzuzeigen. Das alles wuchs ihm über den Kopf. Aber da war die Zukunftsangst. Ihm blühten einige Jahre Gefängnis. Er würde hinterher vor dem Nichts stehen. Bei Akorn hatte er sich hochgearbeitet. Eines Tages sollte er die Nachfolge Leland Taylors als Abteilungsleiter antreten …
Als der Name seines Vorgesetzten durch seinen Verstand sickerte, durchlief ihn ein eisiger Schauer. Leland Taylor hatte sich als Wolf im Schafspelz entpuppt. Er war absolut skrupellos, er ging über Leichen. Das war Dee Fitzgerald an diesem Tag zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Er schreckte vor nichts zurück, um seine Haut zu retten. Nicht mal vor Mord.
In einen solchen sollte er, Fitzgerald, jetzt auch noch verwickelt werden. Beim Gedanken daran krampfte sich ihm der Magen zusammen.
Den Gedanken, sich selbst anzuzeigen hatte er wieder verdrängt. Er dachte daran, sich umzubringen. Diese Idee verwarf er ebenfalls sofort wieder. Mit seinen 38 Jahren fühlte er sich zu jung zum Sterben. Dann noch eher ins Gefängnis. Plötzlich glaubte er, die Lösung gefunden zu haben. Flucht! Er hatte Geld genug gespart, um sich abzusetzen und sich eine Weile über Wasser zu halten.
Sofort aber tauchte die quälende Frage auf, was sein würde, wenn das Geld verbraucht war. Dann stehst du genauso vor dem Nichts wie nach der Haftentlassung, hämmerte es fast schmerzhaft durch seinen Kopf.
Die Angst zerfraß Dee Fitzgerald. Er war der Verzweiflung nahe. Einerseits flackerte in ihm immer wieder die Entschlossenheit auf, die Konsequenzen zu tragen, andererseits fürchtete er sich davor.
Er verließ den Fastfood-Laden und fuhr zu einem Pub in der Nähe seiner Wohnung. Er wollte sich betrinken, die Gedanken, die ihn peinigten, im Alkohol ertränken. Er bestellte sich einen doppelten Whisky. Einen zweiten … Die zermürbenden Gedanken, die durch seinen Verstand geisterten, wurde er nicht los. Schließlich wollte er nur noch schlafen.
Es war ein Uhr vorbei, als er aus dem Pub wankte. Seinen Wagen ließ er vor der Kneipe stehen. Bis zu seiner Wohnung waren es nur ein paar Schritte. In dem Haus, in dem er wohnte, brannte kein Licht mehr. Sämtliche Bewohner lagen in ihren Betten und schliefen den Schlaf der Gerechten. Der Schlüsselbund in seiner Hand schepperte.
Er musste dreimal ansetzen, ehe es ihm gelang, das Schlüsselloch zu finden. Es knirschte leise, als er aufschloss. Das Haus war schon ein älterer Bau. Es gab hier 12 Appartements, verteilt auf Erdgeschoss und zwei Stockwerke. Jeweils vier der kleinen Wohnungen waren über einen Korridor zu erreichen. Sein Appartement lag in der 2. Etage. Über einen Aufzug verfügte das Gebäude nicht.
Es gab ein knackendes Geräusch, als Dee Fitzgerald das Treppenhauslicht einschaltete. Er stieg die Treppe empor. Die Wand zu seiner Rechten war verschmutzt und von Kindern und Halbstarken vollgekritzelt. Darauf aber achtete Dee Fitzgerald in diesem Stadium der Alkoholisierung nicht. Er zog sich mühsam am Treppengeländer hinauf. Die Wirkung des genossenen Whiskys hatte während des kurzen Marsches an der frischen Luft zugenommen.
2. Etage. Endlich. Der Mann atmete auf. Die dritte Tür auf dem Flur war die zu seiner Wohnung. Er schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. Zehn Minuten nach ein Uhr. Er öffnete die Wohnungstür und trat ein. Die Tür klappte hinter ihm ins Schloss. Das Licht in dem engen Flur flammte auf.
Dee Fitzgerald schlüpfte aus seiner Jacke und hängte sie an die Garderobe. Er schüttelte sich die Schuhe von den Füßen und verlor dabei beinahe das Gleichgewicht. Er zerkaute eine Verwünschung, als er mit der Schulter gegen die Wand zu seiner Linken prallte.
Da knarrte die Tür, die in die Küche führte. Wie von Geisterhand geführt ging sie langsam auf. Dee Fitzgerald erstarrte. Das Herz schlug ihm plötzlich bis zum Hals. Hatte ein Luftzug die Tür ein Stück geöffnet? Oder sah er schon weiße Mäuse?
Ein Luftzug kann es nicht sein, durchzog es seinen umnebelten Verstand. Denn ehe du am Morgen aus der Wohnung gegangen bist, hast du sämtliche Fenster geschlossen. Hast du doch? Oder etwa nicht? – Doch, hast du!
Er gab sich einen Ruck. So betrunken, dass er schon Gespenster sah, war er auch wieder nicht.
Auf Socken näherte er sich der Küchentür. Hinter dem Spalt, den sie offen stand, war Dunkelheit. Nur der schmale Lichtbalken vom Korridor, der in die Küche fiel, zerschnitt die Finsternis und legte sich auf den Fußboden.
Er stieß die Tür auf und betrat den Raum. Seine Hand tastete nach dem Lichtschalter. Das Licht aus dem Flur umfloss seine Gestalt und lag auf seinem Rücken. Hinter Dee Fitzgerald war ein schabendes Geräusch zu vernehmen. Gepresstes Atmen …
Fitzgeralds Verstand arbeitete viel zu träge. Die Impulse, die er versandte, wurden nur mit Verzögerung in die Tat umgesetzt. Und als bei Fitzgerald das Begreifen kam und er sich umdrehen wollte, fuhr ihm etwas wie glühendes Eisen zwischen die Schulterblätter. Ein Schrei staute sich in ihm und wollte ihm schmerzhaft in die Kehle steigen. Er erstarb bereits im Ansatz. Er fiel auf die Knie. Eine jähe Schwäche kroch wie flüssiges Blei durch seinen Körper. Dumpfe Benommenheit brandete in ihm auf.
Ein zweiter, glühender Schmerz, als ihm das Messer seitlich in den Hals gerammt wurde. In seiner Brust entstand ein zerrinnendes Gurgeln – der Schmerz verebbte. Die Schwäche kam, als würde schnell wirkendes Gift durch Dee Fitzgeralds Adern fließen. Ja, er war über den Schmerz hinaus. Der Tod griff mit kalter, gebieterischer Hand nach ihm …
Dee Fitzgerald hatte das Empfinden, von einer weichen, schwarzen Wolke fortgetragen zu werden. Er fiel nach vorn. Dann spürte er nichts mehr. Seine Beine zuckten noch einmal unkontrolliert, dann erschlaffte seine Gestalt. Das Blut des Mannes pulsierte aus den tiefen Wunden und versickerte in dem Läufer aus synthetischem Material, der am Boden lag.
Ebenso heimlich, wie er in die Wohnung eingedrungen war, verschwand der Mörder. Er ging ohne besondere Eile Richtung Madison Avenue. Die Latex-Handschuhe, die er getragen hatte, warf er unterwegs in eine Mülltonne am Gehsteigrand. In der Madison Avenue hatte er seinen Wagen geparkt. Er schloss ihn auf, klemmte sich hinter das Lenkrad, startete, schaltete das Abblendlicht ein und fuhr los.
10
Am übernächsten Morgen brachte NBC News die Meldung, dass im Long Island Sound tote Fische in großer Zahl angetrieben worden waren. Der Grund, auf den das plötzliche Fischsterben zurückzuführen sei, war noch nicht bekannt. Es stand jedoch zu befürchten, dass große Mengen an giftigem Abfall im Long Island Sound entsorgt worden waren. Die Polizei ermittle, einige namhafte Wissenschaftler seien eingeschaltet worden, um den Grund für das plötzliche Fischsterben herauszufinden …
Ich hörte es in den Morgennachrichten. Und ich dachte mir nicht viel dabei. Umweltkatastrophen sind nahezu an der Tagesordnung. Mal verliert ein Tanker seine gesamte Ölladung, dann werden wieder überproportionale Quecksilbervorkommen gemessen, ein anderes Mal kippen gewissenlose Umweltgangster ihren giftigen Dreck ins Meer …
Ich verließ meine Single-Wohnung, holte Milo ab, und gemeinsam fuhren wir zur Federal Plaza. Wir saßen derzeit einem Mister auf der Fährte, der in Discotheken und Nachtbars Ecstasy, LSD-Trips und zeitweise sogar Heroin an Jugendliche und auch ältere Konsumenten verhökern ließ, der aber seit einiger Zeit schon nicht mehr in Erscheinung trat, nachdem er einige Male verhört und einmal sogar vorübergehend festgenommen worden war. Einige Straßenverkäufer, die die Kollegen verhaftet hatten, schwiegen, wahrscheinlich aus Angst vor Rache.
Wir vermuteten, dass ein ganzer Drogenring hinter der Sache steckte. Aber das war reine Spekulation. Ansatzpunkt war für uns ein gewisser Ray Stanford, der Mister, der sich bisher dem Zugriff von Recht und Gesetz erfolgreich entzogen hatte.
Ihm war nie etwas nachzuweisen gewesen, was für eine Anklage wegen Handels mit gefährlichen Drogen ausgereicht hätte. Also hatten sich die Jungs vom Narcotic Squad zurückgezogen und den Fall an das FBI übertragen, weil man hinter dem Drogenhandel ein grenzüberschreitendes Delikt vermutete, das zu verfolgen nun einmal in die Zuständigkeit des FBI fiel.
Jay Kronburg und Blacky Blackfeather, unsere Kollegen, observierten das Haus Ray Stanfords, den wir für den Boss des Drogenrings hielten. Um zehn Uhr sollten wir sie ablösen.
Ich nahm mit Jay Verbindung auf. „Wie sieht‘s aus, Jay?“, fragte ich.
„Stanford ist gestern Abend gegen elf Uhr nach Hause gekommen, hat seinen Ford in die Garage gefahren und wurde seitdem von uns nicht mehr gesehen.“
„Hat er etwas ausgeladen?“
„Das wissen wir nicht. Die Garage besitzt einen direkten Zugang zum Haus.“
„Hat er Besuch empfangen? Irgendwelche zwielichtigen Gestalten?“
„Nein. Kurz nach elf Uhr gingen die Lichter aus. Und jetzt liegt der Bursche wahrscheinlich noch in seinem warmen Bett und lässt den Herrgott einen guten Mann sein, während wir uns im Auto den Hintern wund sitzen. Bis zweiundzwanzig Uhr haben George und Fred den Bunker beobachtet. Ohne besondere Vorkommnisse. Sieht aus, als hätte der gute Ray Lunte gerochen und mimt den braven Mann.“
„Das hält er sicher nicht besonders lang durch“, lachte ich. „Dazu ist er wahrscheinlich viel zu geldgierig. Nichtsdestotrotz, Jay, in anderthalb Stunden lösen wir euch ab. Dann könnt ihr es machen wie Stanford und in die Furzmulde kriechen.“
„Bis dann, Jesse. Ende.“
Ich legte auf.
Milo blätterte in der Zeitung. Die Sache mit dem unnatürlichen Fischsterben im Long Island Sound musste schon vor Redaktionsschluss der New York Times bekannt gewesen sein, denn Milo knurrte: „Schau dir diese Schlagzeile an. Die Zeitungsleute haben wohl ein Sommerloch auszufüllen. Mir scheint, sie sind geradezu glücklich darüber, wenn es irgendwo auf der Welt zu brennen beginnt. Die zieh‘n die Sache auf, als wären es keine toten Fische, sondern tote New Yorker, die im Long Island Sound angeschwemmt worden wären.“
Am frühen Morgen war mit meinem Freund und Kollegen nicht immer gut Kirschen essen. Vor allem, wenn wir an einem Fall arbeiteten, in dem wir nur schleppend vorwärts kamen, wie im Fall Ray Stanford. Der Bursche war clever und gewitzt, und es war ihm immer wieder gelungen, sich unserem Zugriff zu entziehen.
„Ich hab es schon in den Morgennachrichten gehört“, sagte ich. „Der Grund für das Fischsterben ist noch nicht bekannt. Aber sie haben sicher findige Leute angesetzt, die ihn schon herausfinden werden. Kann auf völlig natürlichen Ursachen beruhen.“
Milo überflog mit den Augen den Bericht. „Ja, stimmt“, sagte er. „Bist ein schlaues Kerlchen. Hier steht es …“ Er begann zu lesen: „In Seen setzt durch die Gewässeranreicherung mit Pflanzennährstoffen ein Massenwachstum von Algen ein. Die Algen trüben das Wasser, so dass nach einiger Zeit nur noch in der oberflächennahen Schicht genügend Licht für die Photosynthese vorhanden ist. Die Algen der tieferen Schichten sterben ab. Durch die anschließenden Zersetzungsprozesse werden große Mengen an Sauerstoff verbraucht …“
Er schaute von der Zeitung hoch und erklärte: „Man spricht hier von Sauerstoffzehrung.“
„Steht das in dem Artikel“, fragte ich ihn, „oder ist das auf deinem Mist gewachsen?“ Ich grinste etwas lahm. Denn es interessierte mich kaum.
„Du traust mir wohl gar nichts zu“, brummelte Milo, dann las er laut weiter.