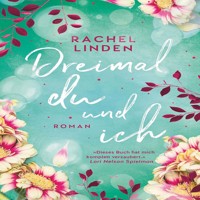12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Menschen. Drei Entscheidungen. Eine große Liebe? Seit dem tragischen Verlust ihrer Mutter widmet Lolly all ihre Zeit dem Familienrestaurant. Nur was ist mit ihren eigenen Träumen? Als sie kurz vor ihrem 33. Geburtstag eine Liste mit den Dingen findet, die sie sich als junges Mädchen gewünscht hat, wird ihr klar, dass sie bislang keines ihrer Ziele erreicht hat. Doch gerade als Lolly sich fragt, wie sie das ändern könnte, erhält sie ein ganz besonderes Geschenk: Sie kann für jeweils einen Tag in drei verschiedene Versionen ihres Lebens schlüpfen und dabei wichtige Entscheidungen korrigieren. Denn was wäre, wenn sie ein eigenes Lokal eröffnet hätte? Und ihre große Liebe nicht verlassen hätte? Wie wird sie sich entscheiden? Oder hat das Schicksal am Ende ganz andere Pläne mit ihr? Warmherzig, emotional und wunderschön – die romantischste Liebesgeschichte des Jahres! »Dieser charmante Roman ist ein Muss für alle, die sich auch eine zweite Chance wünschen. Ein Juwel von einem Buch, das mich komplett verzaubert hat.« Lori Nelson Spielman
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Rachel Linden
Dreimal du und ich
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Dr. Kathryn A. Smith, die echte Tante Gert.
Auch wenn du mir keine Zitronenbonbons geschenkt hast, hast du mir doch neue Welten eröffnet.
Dafür bin ich dir unglaublich dankbar.
1
Mein Leben ist eine Zitrone.
Wieder einmal mit dieser Wahrheit konfrontiert, beugte ich mich über die kalte Rührschüssel und verwandelte durch kräftiges Schlagen Eiweiß und Zucker in eine steife Masse für die Baiserhaube.
»›Lollys Lebensziel Nummer zwei‹«, las meine Schwester Daphne laut vor. Sie saß auf einem Hocker auf der anderen Seite des glänzenden Arbeitstisches aus Edelstahl in der Küche unseres kleinen Restaurants. Kurz überflog sie die Liste der ambitionierten Wunschvorstellungen meines viel jüngeren Ich, die ich als Schülerin mit violettem Glitzergelstift und einer Menge Optimismus in meinem Tagebuch festgehalten hatte.
»›An einem spektakulären Ort mein eigenes Restaurant haben.‹« Skeptisch blickte sie zu mir herüber. »Ob die Leitung unseres Familiendiners in Magnolia da wohl zählt?«
»Ich glaube nicht, dass ich dänisches Wohlfühlessen in einem alten Diner vor Augen hatte, als ich das schrieb«, antwortete ich und bedachte sie mit einem schiefen Blick. Im Grunde war so einiges in meinem Leben nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, als ich diese Liste angelegt hatte. Mit neuem Elan widmete ich mich dem Rührgerät.
Draußen vor den Sprossenfenstern schummelte sich gerade ein perlweißer Schimmer in die winterliche Dunkelheit. Der Morgen brach an. Vermutlich würden die Wolken für einen feinen Nieselregen sorgen, der den ganzen Tag anhielt. Der Winter in Seattle war gegen Ende oft nass, kalt und dauergrau. Normalerweise liebte ich diese Tageszeit – Kuchenbackzeit, ganz allein in der Küche mit ernsthaftem Arbeitseifer und Tanya Tuckers wehmütigem Gesang im Radio –, aber nicht heute. Heute passte das Wetter hervorragend zu meiner Laune.
»›Nummer drei: mich verlieben.‹« Wieder unterbrach sich Daphne und starrte angestrengt auf die Seite. »Du hast da noch etwas an den Rand geschrieben. ›Er sollte aussehen wie Freddie Prinze junior oder Brad Pitt.‹« Leicht verwirrt zog sie die Nase kraus. »Wer ist Freddie Prinze junior?«
»Hast du nie Eine wie keine gesehen? Hm, dafür bist du wahrscheinlich zu jung.« Ich schob eine lose Strähne zurück in meinen hoch sitzenden Pferdeschwanz. »Das waren die Neunziger. Freddie war ganz der verträumte Typ, ein totaler Mädchenschwarm.« Ich widmete mich wieder meiner Eiweißmasse, die nun von selbst stand und schaumige weiße Spitzen bildete.
Daphne starrte weiter auf das Blatt. »Wozu hast du diese Liste damals überhaupt erstellt?«
Ich schloss die Augen und wurde sofort in das Klassenzimmer der Siebten zurückkatapultiert, durchtränkt von Hormonen und dem Gefühl der Unbesiegbarkeit, hatte wieder den Geruch des alten Linoleums und der heranwachsenden Jungen mit zu wenig Deodorant in der Nase, ergänzt durch den Duft der Mädchen mit übertrieben viel fruchtigem Bodyspray.
»Für Ms. Beesons Englischkurs. Wir sollten aufschreiben, welche Ziele wir im Leben hatten, sozusagen einen Plan für die nächsten zwanzig Jahre machen. Was schon irgendwie irre war, da die meisten von uns mit dreizehn noch so gut wie überhaupt nicht vorausschauend waren. Aber sie war ein großer Fan von Plänen. Von Bleistiftröcken und Plänen.«
»Sehr ehrgeizig jedenfalls«, befand Daphne, nachdem sie noch einen Blick auf die Liste geworfen hatte.
»Eigentlich ziemlich traurig, wenn man sie aus heutiger Sicht liest«, stellte ich leichthin fest.
»Wieso traurig?«
Ich schaltete den Mixer aus. »Nächsten Monat werde ich dreiunddreißig. Es ist jetzt fast zwanzig Jahre her, dass ich diese Liste zusammengestellt habe, und ich habe keinen einzigen Punkt davon erfüllt.« Obwohl ich das ganz nüchtern sagte, versetzte mir die Erkenntnis einen schmerzhaften Stich. Zwar hatte ich seit Jahren nicht mehr an die Liste gedacht, trotzdem war es enttäuschend, dass ich nicht einmal eines dieser Ziele erreicht hatte.
Daphne klappte das Tagebuch zu und warf es auf die Arbeitsfläche, dann streckte sie ihren jungen, geschmeidigen, in Yogaklamotten gehüllten Körper. Dabei glitt ihr glänzendes braunes Haar über ihre Schultern. Rein äußerlich betrachtet, war diese Haarfarbe unsere einzige Gemeinsamkeit. Daphne kam nach unserem Dad, sie war klein, sehnig und durchtrainiert, hatte die Figur einer Tänzerin. Ich hingegen vertrat den dänischen Part der Familie, die Seite unserer Mutter: hochgewachsen, kurvig, mit breiten, ausgeprägten Wangenknochen. Nachdem sie von ihrem Hocker geglitten war, musterte meine Schwester mich abschätzend. »Willst du all das denn immer noch?«
»Freddie Prinze junior ist wirklich gut gealtert. Ich mag diesen Silberfuchs-Look.« Grinsend verteilte ich die Eiweißmasse auf der gelben Füllung der sechs vorbereiteten Zitronenkuchen und wich so der eigentlichen Frage aus. Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt eine Antwort darauf hatte oder es riskieren konnte, genauer über eine solche nachzudenken. Meine Träume und persönlichen Wünsche hatte ich vor rund zehn Jahren aufgegeben. Diesen Luxus konnte ich mir einfach nicht mehr leisten.
Daphne warf einen Blick auf ihr Telefon und quiekte alarmiert. »Ich muss in fünfzehn Minuten eine Vinyasa-Stunde geben.« Hastig riss sie die Tür des Gastro-Kühlschranks auf und nahm sich einen Apfel. »Ich habe bis halb fünf Unterricht, aber dann komme ich und helfe euch beim Abendgeschäft. Damien kann mich fahren.«
Sie war im ersten Jahr ihrer Tanzausbildung am Cornish College of Arts in Seattle und gab nebenbei Yogaunterricht, um für einen Teil der horrenden Studiengebühren aufkommen zu können. Ihr Freund Damien studierte ebenfalls an der Cornish. Seufzend wischte ich mir die Hände an meiner grünen, mit weißen Punkten verzierten Fünfzigerjahre-Rüschenschürze ab – der Standardbekleidung im Diner, seit ich denken konnte.
»Hilfe beim Abendgeschäft wäre prima. Tante Gert und ich schaffen die Tische kaum allein.«
Bei der Erwähnung unserer temperamentvollen Großtante wechselten wir einen vielsagenden Blick.
»Okay, dann bis heute Abend.« Daphne öffnete die Hintertür und warf mir eine Kusshand zu. »Hab dich lieb.«
Ich fing den Luftkuss auf und drückte ihn an meine Wange. »Ich dich mehr.« Diese Verabschiedung hatte unsere Mutter uns beigebracht, als wir klein gewesen waren, und wir hatten sie bis heute beibehalten.
Daphne verschwand, streckte dann aber noch einmal den Kopf durch die Tür und sagte nachdenklich: »Weißt du, es wäre nicht zu spät, um die Liste abzuarbeiten, wenn du das immer noch willst.«
Ich winkte ab. »Und wer soll dann hier alles am Laufen halten? Wer wäre der Kleister, der das Ganze zusammenhält?«
»Ich wusste, dass du das sagen würdest.« Sie verzog das Gesicht. »Und genau das werden sie auch in deinen Grabstein meißeln, wenn sie dich irgendwann alt, grau und tot auffinden, mit dem Gesicht in einem deiner Zitronenbaiserkuchen. ›Ich war der Kleister.‹«
Welch ein schrecklicher Gedanke. Und traurigerweise nicht einmal besonders weit hergeholt. Ich streckte Daphne die Zunge heraus.
»Bist du nicht eigentlich spät dran?«
Das entlockte ihr einen leisen Schrei, und sie stürzte hektisch davon, während ich ihr mit einer Mischung aus mütterlicher Zuneigung und schwesterlicher Verzweiflung hinterherblickte. Da sie zwölf Jahre jünger war als ich, war Daphne erst zehn gewesen, als Mom gestorben war. Also hatte ich versucht, diese Lücke in ihrem Leben bestmöglich zu füllen. Und an manchen Tagen hatte ich beinahe den Eindruck, dass es mir gelungen war.
In der nun stillen Küche widmete ich mich wieder dem Ei-Schnee und türmte ihn mit der Rückseite eines großen Löffels zu dekorativen Spitzen auf. Dann überprüfte ich noch einmal alle sechs Kuchen. Gut, die Baiserhaube reichte überall bis zum Rand. Das verhinderte, dass das Baiser hinterher anfing Tropfen zu bilden, als würde es weinen – eine besondere Tücke des Schaumgebäcks. In den vergangenen zehn Jahren hatte ich beinahe täglich sechs Zitronenbaiserkuchen gebacken. Mein Dad Marty, der Küchenchef unseres Diners, kümmerte sich mit seinem Hilfskoch Julio um das gesamte restliche Essen, aber ich machte unseren berühmten Kuchen, den besten in ganz Seattle. Denn nur ich kannte das Geheimrezept meiner Mutter. Sie hatte es mich auswendig lernen lassen, am Abend bevor sie gestorben war.
Nachdem ich die Kuchen in den riesigen Ofen geschoben hatte, stellte ich den Timer und sah kurz auf die Uhr. Noch eine Stunde, bis um acht das Restaurant öffnete. Bald würden Dad und Julio kommen und mit den Vorbereitungen für den Abend beginnen. Mein Tagebuch lag noch immer auf der Arbeitsfläche, ein Gruß aus der Vergangenheit mit grellbunten Einhörnern, die über einen farbenfrohen, mit Sternen überzogenen Regenbogen sprangen. Mit dreizehn hatte ich das Lisa-Frank-Tagebuch mit dem schrill-fröhlichen Cover geliebt, dessen linierte Seiten nur darauf zu warten schienen, mit den Träumen und Wünschen meines jungen, idealistischen Herzens gefüllt zu werden. Daphne hatte es vor ein paar Tagen wiedergefunden, als sie in einer Kiste mit Kindersachen von uns gekramt hatte.
Wehmütig strich ich mit den Fingern über den Einband, hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, es loszuwerden oder aufzuschlagen und jede einzelne Zeile zu verschlingen. Vielleicht könnte ich so für einen kurzen Moment noch einmal das Gefühl genießen, vor einer unendlichen Anzahl von Möglichkeiten zu stehen, und mich der naiven Annahme hingeben, dass die Dinge Realität werden könnten, wenn ich einfach nur fest genug daran glaubte … Heute kam mir der Gedanke beinahe dreist vor. Und doch war er irgendwie auch reizvoll.
Ich schniefte kurz. Unter dem sich langsam ausbreitenden Zitrusduft der backenden Kuchen glaubte ich einen Hauch von Bedauern zu riechen, stechend und bitter wie Rosmarin. Schnell schaltete ich das altmodische CD-Radio am Fenster ein, suchte nach einem klassischen Countrysender und öffnete die Hintertür, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Ich bekam allerdings nur einen kalten, nassen Windstoß ab, der den herben Geruch von Traurigkeit mitbrachte, schwer und salzig wie das Meer. Also schloss ich die Tür wieder und drehte dafür das Radio lauter. Gegen Shania Twains Rockabilly-Girlpower hatte die Nostalgie keine Chance.
Ich nahm das Tagebuch, verließ die Küche und legte es in der zu einem Büro umfunktionierten Speisekammer auf meinen Schreibtisch. Dann zog ich mit einem Ruck die Tür zu. Ich hatte eine Familie zu versorgen und musste einen Diner am Laufen halten, der ganz schön zu kämpfen hatte. Da blieb keine Zeit für Nostalgie oder Reue.
2
Ist der frische Kaffee schon fertig?«, bellte Tante Gert und schob sich durch die Schwingtür in die Küche. Wir hatten seit einer Stunde für Frühstücksgäste geöffnet. »Norman verlangt bereits Nachschub.« Missbilligend schnalzte sie mit der Zunge.
»Die Kanne müsste eigentlich voll sein, ich habe die Maschine vorhin angestellt.« Dad blickte von seinem Schneidebrett auf, auf dem sich die Kartoffelwürfel auftürmten. Julio und er steckten mitten in den Vorbereitungen für das Tagesgeschäft. Nun streckte ich den Kopf aus der Tür meines Minibüros, in dem ich gerade wieder einmal über den deprimierenden Bilanzen brütete.
»Ich kümmere mich drum.«
Unsere Frühstückskarte war einfach gehalten und bestand eigentlich nur aus dem Gebäck von Petit Pierre, der französischen Bäckerei in unserer Straße. Dazu gab es den typisch mittelmäßigen Diner-Kaffee, der gratis nachgeschenkt wurde. So war der morgendliche Ansturm leicht in den Griff zu bekommen, obwohl der Begriff »Ansturm« nicht mehr ganz zutreffend war, da in den letzten Jahren lediglich ein magerer Strom an Kundschaft vor dem Mittagessen den Weg in unseren Gastraum fand. Und in den trüben Wintermonaten ging das Geschäft sogar noch schlechter.
Tante Gert nickte mir hoheitsvoll zu. »Vielen Dank.«
Heute trug sie einen orangefarben gemusterten Kaftan, der mit so vielen Holzperlen bestickt war, dass sie bei jeder Bewegung klapperten. Auf ihrem feinen weißen Haar thronte ein dazu passender Turban. Zusammen mit ihrer Hakennase und den eisblauen Augen erweckte sie den Eindruck eines reich geschmückten Raubvogels. Eines Falken vielleicht.
Dr. Gertrude Lund, meine Großtante mütterlicherseits, war achtzig Jahre alt und eine angesehene emeritierte Professorin für Religionswissenschaften und Mythologie, die vor knapp zwei Jahren aus New England in das winzige Cottage in unserem Garten übergesiedelt war. Sie zeichnete sich aus durch eine äußerst willensstarke, fast schon von Starrsinn geprägte Persönlichkeit, einen absurden Modegeschmack und einen messerscharfen Verstand. Und obwohl ihre sauertöpfische Art sie so gar nicht für den Beruf der Kellnerin qualifizierte, bestand sie darauf, uns im Diner zu helfen. Ihren Beitrag zu leisten, wie sie es nannte. Unsere Stammgäste hatten gelernt, das dumpfe Knarzen ihrer orthopädischen Schuhe zu fürchten.
Ich holte die Kaffeekanne von ihrem Platz neben der Küchentür, und Tante Gert folgte mir in den Gastraum. »Der alte Kauz haut euch doch übers Ohr. Kommt jeden Morgen her und blockiert stundenlang einen ganzen Tisch, während er nur eine lausige Tasse Kaffee bestellt.« Sie spitzte die Lippen und sah mit finsterer Miene zu Norman hinüber, der wie immer an seinem üblichen Tisch an dem großen Sprossenfenster saß.
»Ich glaube, er ist einfach nur einsam. Immerhin ist es noch kein Jahr her, dass Mabel gestorben ist«, rief ich meiner Tante ins Gedächtnis. Ich hatte eine gewisse Schwäche für Norman und spendierte ihm regelmäßig Kuchen vom Vortag, wenn wir welchen übrig hatten. Trauer war mir nicht fremd, und auch wenn ein Stück Kuchen den Schmerz über den Verlust seiner Frau nicht lindern konnte, wusste ich doch aus Erfahrung, dass kleine freundliche Gesten der reinste Balsam für verwundete Herzen sein konnten.
Tante Gert hingegen räusperte sich empört. »Du bist viel zu weichherzig, meine Liebe«, stellte sie fest. Dann fuhr sie mit erhobener Stimme fort, damit Norman sie am anderen Ende des Raumes auch hören konnte: »Weißt du, was die Bhagavad Gita über gierige Menschen sagt? Wollust, Zorn und Gier bilden die drei Tore zur Hölle. Nicht meine Worte, sondern die des heiligen Krishna.«
»Was für ein herzerwärmender Gedanke.« Ich ging an einem Paar mittleren Alters in Wanderkleidung vorbei, das in einer der Nischen saß und unser Gespräch neugierig verfolgt hatte. Tante Gert stapfte in ihren so gar nicht zum Outfit passenden schwarzen Schnürschuhen hinter mir her.
Im hellen Morgenlicht wirkte der Diner pittoresk, aber auch ein wenig heruntergekommen.
Vom Glanz des einst warmen goldbraunen Holzbodens war nicht viel übrig, nachdem jahrzehntelang Gäste darübergelaufen waren. Die minzgrünen Paspeln an den mit weißem Kunstleder überzogenen Sitznischen waren stellenweise ausgefranst, aber insgesamt war dem Diner ein großer Teil seines nostalgischen Charmes erhalten geblieben.
Das schlicht Eatery genannte Restaurant befand sich im Besitz meiner Familie, seit meine Großeltern mütterlicherseits es in den Fünfzigerjahren als frisch gebackenes Ehepaar eröffnet hatten. Als Anzahlung für den kleinen Laden hatte das für die Hochzeitsreise gesparte Geld gedient. Er lag direkt an der Hauptstraße des reizenden Örtchens Magnolia, in einer ruhigen Gegend westlich von Seattle, die an drei Seiten vom Puget Sound umschlossen wurde. Magnolia war die Art von Ort, in dem die Nachbarn kurz vorbeischauten und einem ein Pfund Manila-Muscheln schenkten, wenn sie vom Muschelsammeln am Hood Canal zurückkehrten. Ein Ort, in dem man jedes Mal Bekannte traf, wenn man sich samstagmorgens bei Petit Pierre anstellte, um Schokocroissants zu kaufen, und in dessen Buchhandlung – dem Magnolia Bookstore – stets die perfekte Empfehlung auf einen wartete, sobald man durch die Eingangstür trat.
Ich liebte Magnolia und das Restaurant. Immerhin war ich in diesem Diner aufgewachsen, hatte zwischen den Kunstlederbänken und Barhockern meine ersten Schritte gemacht, immer an dem langen weißen Resopaltresen entlang. Hier war ich zu Hause. Nun atmete ich tief ein, roch den jahrzehntealten Duft von starkem, bitterem Kaffee und rissigem Kunstleder, überlagert von einem Hauch frischen Zitronenbaiserkuchens. Den Geruch meiner Kindheit.
»Guten Morgen, Norman.« Ich füllte seine Kaffeetasse auf.
»Morgen, Lolly.« Norman kämpfte gerade mit einem Zuckerpäckchen.
»Darf ich dir helfen? Die können wirklich verzwickt sein.« Ich riss den oberen Rand des Päckchens ab und reichte es ihm.
Norman nahm den Zucker entgegen und tätschelte mir dir Hand. »Du bist ein gutes Mädchen, Lolly. Und bildhübsch. Warum hat dich nicht schon längst irgendein Kerl eingesackt?«
»Sie ist doch kein Linsengericht im Sonderangebot. ›Eingesackt‹, also wirklich«, schnaubte Tante Gert hinter mir abfällig. Sie war meines Wissens nie verheiratet gewesen und eine überzeugte Verfechterin der Frauenrechte. Bei einer Kundgebung hatte sie sogar einmal mit Gloria Steinem auf dem Podium gestanden.
Ich verkniff mir ein Lächeln und antwortete so neutral wie möglich: »Momentan habe ich keine Zeit für die Liebe, Norman. Mit meiner Familie und dem Diner habe ich alle Hände voll zu tun.«
Nachdem er mich einen Moment lang mit wässrigen Augen gemustert hatte, blickte er angestrengt über meine Schulter hinweg, als versuchte er, sich an etwas Bestimmtes zu erinnern.
»Was ist denn aus diesem Jungen geworden, der so verknallt in dich war? Hat vor einigen Jahren hier gearbeitet, hat Tische abgeräumt, glaube ich. So ein netter junger Mann, sehr höflich. Hatte Haare wie ein glänzender Penny. Wie hieß er noch gleich?«
Mein Mund war plötzlich wie ausgetrocknet. Diesen Namen hatte ich seit Jahren nicht mehr laut ausgesprochen.
»Rory. Rory Shaw.«
Sofort hellte sich Normans Miene auf. »Genau. Er schien völlig hin und weg von dir zu sein. Mabel hat immer gesagt, er sei die Sonnenblume und du die Sonne. Wann immer du den Raum betreten hast, hat er sich dir zugewandt, als würde er dem Licht folgen, meinte sie.«
Ich schob mir meine Vintage-Cat-Eye-Brille höher auf die Nase und gab mir alle Mühe, eine ausdruckslose Miene aufzusetzen. Dabei spürte ich, wie Gert und Norman mich neugierig musterten. In Wahrheit hatte Rory genau diesen Impuls bei mir ausgelöst. Wir waren beide die Blume des anderen gewesen, beide die Sonne. Auf der Liste der Dinge, die ich in meinem Leben bereute, stand Rory Shaw mit Abstand auf dem ersten Platz.
»Manches soll wohl einfach nicht sein«, sagte ich schließlich mit einem schmalen Lächeln und versuchte, Normans Kommentar als belanglos abzutun, auch wenn Rorys Name mir einen feinen bedauernden Nadelstich ins Herz versetzt hatte.
»Na ja, hoffentlich lernst du bald mal wieder jemanden kennen. Mabel und ich waren fast sechzig Jahre verheiratet, und wir waren so glücklich miteinander. Ein solches Glück hast du auch verdient, Lolly.«
Ich nickte leicht verdrießlich. Was hatte dieser Tag nur an sich, dass er mich ständig mit meinen unerfüllten Hoffnungen und Wünschen konfrontierte? »Vielleicht lande ich ja eines Tages einen Glückstreffer«, erwiderte ich.
Als ich hochblickte, bemerkte ich, dass Tante Gert mich mit schmalen Augen musterte. Der Blick, den sie mir unter ihrem gefältelten Turban hervor zuwarf, war so durchdringend, als wäre ich ein mysteriöser Code, den es zu knacken galt.
»Ja, vielleicht«, stimmte sie mir bedächtig zu. »Oder du schlägst einen ganz anderen Weg ein.«
Überrascht sah ich sie an. Das hatte irgendwie bedeutungsvoll geklungen. Dabei konnte sie doch gar nichts von der Lebensliste in meinem Büro wissen. Ich wich ihrem scharfen Blick aus, befürchtete plötzlich, sie könnte mich durchschauen. Könnte die Enttäuschung in mir sehen, die Sehnsucht. Heute fühlte ich mich extrem verwundbar, quasi nackt. Es wurde höchste Zeit, dass ich mich zusammenriss.
»Sag mal, Lolly, habt ihr zufällig noch Kuchen von gestern übrig?«, fragte Norman hoffnungsvoll. »Ich denke, heute könnte ich ein Stückchen zu meinem Morgenkaffee vertragen.«
»Aber sicher, Norman. Lass mich kurz nachsehen.« Ich ging zu der Kuchenkühlvitrine, die direkt am Eingang stand, um möglichst viele Gäste in den Laden zu locken. Diese Strategie hatte mehr als sechzig Jahre lang gut funktioniert. Am Ende des Tages blieb kaum Kuchen übrig. Auch heute lag nur noch ein einsames Stück Zitronenbaiserkuchen auf dem Servierteller hinter der Scheibe. Als ich es für Norman herausnahm, überfiel mich eine so lebhafte Erinnerung, dass ich mich einen Moment lang nicht rühren konnte. Genau hier hatte ich gestanden, als ich Rory Shaw das erste Mal gesehen hatte.
3
Neunzehn Jahre zuvor
Juli
Lolly, das ist Rory, der Sohn der neuen Nachbarn, von denen ich dir erzählt habe.« Meine Mutter stand vor der Kuchenvitrine. Ihre Hand ruhte auf der Schulter eines Jungen, der ungefähr in meinem Alter sein musste. »Er ist gerade vierzehn geworden, ihr werdet euch also bestimmt schnell anfreunden.«
Ich ließ den Glasreiniger sinken, mit dem ich die Vitrinentür putzte, und sah mir den Neuankömmling an. Er war groß und schlaksig, und seine Hose war ein wenig zu kurz, so als wäre er über Nacht ein Stück in die Höhe geschossen, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Seine braunen Haare hatten einen kräftigen roten Schimmer, wie ein neuer Penny, der noch schön glänzte. Sie waren so kurz geschnitten, dass sie am Hinterkopf ein wenig abstanden. Dazu Sommersprossen und warme braune Augen. Sah er jetzt blöd aus oder cool? Ich konnte mich nicht entscheiden. Vielleicht ein wenig von beidem.
Als ich ihn ansah, vollführte mein Magen eine Art Purzelbaum. Anders als meine beste Freundin Ashley, die seit der fünften Klasse ständig einen neuen Freund an ihrer Seite hatte, interessierte ich mich noch nicht für Jungs. Aber Rory hatte etwas an sich, das mich sofort anzog. Irgendwie wirkte er vertraut, ihn anzusehen war wie ein warmes Kaminfeuer an einem kalten, verregneten Nachmittag. Nein, das war keine Liebe auf den ersten Blick zwischen mir und Rory Shaw. Aber wir mochten uns auf Anhieb. Sehr sogar. Völlig verunsichert trat ich einen Schritt zurück. Ich war dreizehn – das hieß Pferdeschwanz, ein kaum ausgefüllter Sport-BH und spitze Ellbogen. Jungs waren absolutes Neuland für mich.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte er und zeigte auf den Glasreiniger in meiner Hand. Seine Augen hatten die Farbe von Rootbeer, bemerkte ich nun, und irgendwie war sein Blick ähnlich prickelnd.
»Okay.« Ich zeigte ihm, wie er die Zeitung knüllen musste, und dann putzten wir gemeinsam die Sprossenfenster des Gastraums, während unsere Mütter an einem der Tische zusammen Kaffee tranken. Meine Mom gab jedem von uns einen Quarter, und wir suchten uns abwechselnd etwas in der Jukebox aus. Diese Maschine hatten meine Eltern sich geleistet, als sie in ihrem ersten Ehejahr das Restaurant übernommen hatten. Meine Mutter liebte klassische Countrymusik, und sie hatten die Box günstig von einer Westernbar in Tacoma erstanden, die gerade pleitegegangen war. In einen Diner, der dänische Spezialitäten servierte, schien die Jukebox irgendwie nicht ganz zu passen, aber das hatte meine Mutter nie gekümmert. Sie hatte immer einige Münzen in der Tasche, um jederzeit Nummer C9 hören zu können, Tanya Tucker mit What’s Your Mama’s Name. So war ich mit Johnny Cash, Hank Williams, Loretta Lynn und ihren Liedern über Liebe, Leid und Herzschmerz aufgewachsen, während meine Mutter ihren Gästen flæskesteg als Tagesgericht servierte.
Ich entschied mich für F4, Dolly Partons I Will Always Love You, was ich damals für den tragischsten und romantischsten Song aller Zeiten hielt. Anschließend wählte Rory etwas von Johnny Cash. Neben der Musik bekam ich mit, wie meine Mutter Rorys Mom Nancy fröhlich Löcher in den Bauch fragte. Die Shaws waren in der ersten Juliwoche aus der Bay Area in das Haus aus den Fünfzigern gezogen, das genau auf der anderen Straßenseite stand. Und meine Mom – selbst ernanntes Begrüßungskomitee der Nachbarschaft – hatte ihnen prompt einen Zitronenrührkuchen vorbeigebracht und sie eingeladen, mal im Diner vorbeizuschauen. Was sie an diesem Nachmittag dann auch getan hatten. Am Ende ihres Gesprächs überlegte meine Mutter bereits, Rory als Abräumhilfe einzustellen, sobald er alt genug dafür wäre, und hatte die Familie Shaw für das kommende Wochenende zum Essen zu uns eingeladen. Meine Mutter verplante gerne das Leben anderer Leute.
Während unsere Mütter sich unterhielten, arbeiteten Rory und ich schweigend vor uns hin. Er war schlaksig, aber nicht tollpatschig. Erstaunlicherweise schien er sich in seiner Haut vollkommen wohlzufühlen. Das machte es leicht für mich, in seiner Nähe zu sein, und ich atmete befreit auf. Dabei nahm ich seinen Duft wahr: frisch gewaschenes Fußballtrikot und darunter ein Hauch sauberer Jungenschweiß. Und dann war da noch etwas, eine Nuance, die mich an Eichenlaub und den süßen Sonnentee denken ließ, den meine Mutter im Sommer auf der Terrasse ansetzte. Immer wieder sah ich verstohlen zu ihm hinüber. Wenn sich unsere Ellbogen berührten, jagte das kleine Stromstöße durch meinen Arm, die bis in den Magen kribbelten. Eigentlich wischten wir bloß Fingerabdrücke von einem Fenster, aber ich hätte ewig weiterputzen können, solange ich dabei nur neben ihm stand.
Das war der Anfang.
4
Drei Uhr morgens, und ich stand wieder in der Küche des Diners und rollte mit gereizten, kraftvollen Stößen sechs Teigstücke für die Kuchen aus. Stundenlang hatte ich mich im Bett hin und her gewälzt, bevor ich den Gedanken an Schlaf aufgegeben, mein kleines Mansardenzimmer verlassen und mich an unserer schnarchenden Bassethündin Bertha vorbeigeschlichen hatte, um dann zu Fuß durch die stillen, kalten Straßen von Magnolia zur Eatery zu wandern. Jetzt bereitete ich die tägliche Kuchenration vor und hörte dabei leise Johnny Cashs Greatest Hits, um mein aufgewühltes Herz zu besänftigen. Ich bekam diese dämliche Liste einfach nicht mehr aus dem Kopf.
Immer wieder wanderte mein Blick zu dem Tagebuch hinüber, das neben der französischen Butter auf der Arbeitsfläche lag. Die fröhlich hüpfenden Einhörner ahnten nichts von dem Aufruhr in meinem Innern. Nachdem ich mir die Hände an der Schürze abgewischt hatte, schlug ich die Seite auf, die Daphne vorgelesen hatte. In violettem Glitzer sprang mir die Liste entgegen:
Lollys Lebensziele
In einem anderen Land leben.
An einem spektakulären Ort mein eigenes Restaurant haben.
Mich verlieben.
Meiner Familie dabei helfen, für immer vereint und glücklich zu sein.
Ein eigenes Pferd.
*
Der letzte Punkt entlockte mir ein reuiges Lächeln. Ein eigenes Pferd. Dieser Wunsch hatte sich verflüchtigt, als ich irgendwann meinen Führerschein gemacht hatte, doch in meinen frühen Teenagerjahren hatte ich noch von einer Reitkarriere geträumt.
Punkt Nummer vier … Meiner Familie dabei helfen, für immer vereint und glücklich zu sein. Der unbeschwerte Optimismus dahinter ließ mich schmerzlich zusammenzucken.
»Wie sich herausgestellt hat, liegt es nicht in unserer Macht zu entscheiden, ob unsere Lieben sicher oder glücklich sind«, erklärte ich meinem jüngeren Ich leise. Zehn Jahre nachdem ich diese Liste verfasst hatte, hatte sich unsere kleine glückliche Familie in einen Scherbenhaufen verwandelt, da uns der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens genommen worden war.
Aber die restlichen drei … Ich fuhr die geschwungenen Buchstaben von Punkt eins und zwei mit dem Finger nach. In einem anderen Land leben. An einem spektakulären Ort mein eigenes Restaurant haben. Ich hatte tatsächlich immer davon geträumt, in einem anderen Land zu leben. Während meines ersten Studienjahrs an der Portland State University hatte ich ein Auslandssemester in London absolviert und mich dabei bis über beide Ohren in England verliebt. Eine Zeit lang hatte ich sogar dorthin ziehen und ein Restaurant eröffnen wollen.
»Toast.« Wieder ein Name, den ich seit Jahren nicht laut ausgesprochen hatte. Er stand für meine Wunschvorstellung von einem Café: vielschichtig und ein wenig verschroben (so wie ich), spezialisiert auf nachhaltige, regionale Bioprodukte. Selbst heute noch konnte ich das Traumbild des hellen, weitläufigen Ladens mit diesem gewissen Retrochic vor meinem inneren Auge heraufbeschwören: ein Ort, an dem Menschen zusammenfanden, ein Ort der Ruhe und Entschleunigung. Dort sollte gutes, einfaches Essen geschätzt werden, dazu Wein aus der Region und entspannte Gespräche über Bücher oder Filme. Dabei ging es nicht nur darum, den Leuten schmackhafte Gerichte zu servieren; der Besuch sollte zu einem Erlebnis werden, das die Gäste stärker mit Mutter Erde und miteinander in Verbindung brachte, das Dankbarkeit und Besonnenheit förderte. In jedem Bissen sollten schlichte Freude und Herzensgüte stecken.
»Toast. Gemeinsam genießen.« Leise sagte ich den Slogan auf, den ich in einem Marketingkurs am College mühevoll erarbeitet hatte. Manchmal dachte ich heute noch sehnsuchtsvoll an England und an den Traum vom Toast zurück. Er war nie Wirklichkeit geworden, denn das Leben hatte mir dazwischengefunkt. Nach Moms plötzlichem Tod war ich nach Hause zurückgekehrt und geblieben. Mein Dad und die damals zehnjährige Daphne wären niemals allein zurechtgekommen, also hatte ich nach Kräften versucht, Moms Platz im Diner und in der Familie auszufüllen.
Nun sah ich mich in der Küche um. Ja, ich hatte getan, was ich konnte, doch an vielen Tagen schien das einfach nicht genug zu sein. In Wahrheit störte mich so einiges an meiner Rolle im Diner: die ewige Buchhaltung, die sich ständig ändernden behördlichen Vorschriften, dazu all die Kleinigkeiten, die nötig waren, um den täglichen Betrieb möglichst reibungslos am Laufen zu halten. Ich verfügte über eine Menge Verantwortungsgefühl und Organisationstalent, aber ich war nicht sonderlich erpicht darauf, die Hintergrundlogistik eines angeschlagenen Diners zu stemmen. Das war meilenweit von dem entfernt, was ich mir mit meinem Restaurant namens Toast erträumt hatte. Aber nach Moms Tod hatte ich nun mal keine andere Wahl gehabt. Dad litt unter einer schweren Form von Dyslexie; zwar konnte er allein mit Panzerband und einer Tüte einen Rohrbruch reparieren und außerdem leckere karbonader auf den Grill hauen, aber die geschäftliche Seite des Diners war wie Buchstabensuppe für ihn. Und Daphne war noch so klein gewesen, als wir Mom verloren hatten. Zu jung, um all die Pflichten zu schultern, die unsere Mutter uns hinterlassen hatte. Niemand außer mir hatte ihren Platz einnehmen können. Also war ich eingesprungen.
Abrupt legte ich das Tagebuch weg und kehrte zu meinem Teig zurück. Lebensziele waren schwierig. Aber Kuchen backen konnte ich. Ich schob die Teigkreise in die eingefetteten Aluminiumformen, drückte mit schnellen Kniffen die Kanten zurecht, legte Backpapier darüber und beschwerte es mit Kuchengewichten. Nachdem ich den Timer eingestellt hatte, schob ich die Formen in den Ofen, um die Böden vorzubacken. Dann schlug ich fünf große Eier auf, trennte Dotter und Eiweiß und stellte Letzteres beiseite, da ich es später für die Baiserhaube brauchte. Im Radio stimmte Johnny in typisch rauem Ton I Walk the Line an.
Ich verrührte bei mittlerer Hitze Wasser, Zucker, Maisstärke, Salz, Zitronensaft und Zitronenzesten miteinander. Laut Moms Geheimrezept wurden nur Meyer-Zitronen verwendet, da sie dem Kuchen ein süßeres, volleres Aroma verliehen. Das war einer ihrer Tricks. Das und die europäische Butter. Da sie einen höheren Fettgehalt hatte als amerikanische, machte sie den Boden knuspriger.
»Was sind die drei Geheimzutaten, die unseren Zitronenbaiserkuchen zum besten der Welt machen, Lolly?« In der Nacht vor ihrem Tod hatte sie mir alles eingetrichtert, hatte mich jede Zutat wiederholen lassen, jeden Arbeitsschritt, bis sie schließlich sicher gewesen war, dass ich alles aus dem Effeff aufsagen konnte.
»Die drei Geheimzutaten sind Meyer-Zitronen, europäische Butter und ein Blättchen Zitronenmelisse, das mit in den kochenden Sirup gegeben wird«, hatte ich an ihrem Krankenbett sitzend aufgezählt. Schon damals hatte ich die erstickende Trauer gespürt, und mit jedem Wort hatte mich die Last der Verantwortung stärker niedergedrückt.
Zitronenmelisse war für ein Kuchenrezept eher ungewöhnlich, aber Mom hatte immer gerne mit essbaren Blüten und Kräutern gekocht und gebacken. Von ihr hatte ich alles gelernt, was ich darüber wusste. Jetzt streckte ich die Hand nach dem kleinen Topf mit der Zitronenmelisse aus, der auf dem Fensterbrett an der Spüle stand, und zupfte vorsichtig ein Blättchen ab.
»In der Sprache der Blumen steht die Zitronenmelisse für Mitgefühl und Fröhlichkeit«, hatte sie mir einmal erklärt. »Also trägt jeder Bissen dieses Kuchens dazu bei, den Tag ein wenig fröhlicher zu machen.«
Ich zerdrückte das Blatt zwischen den Fingern und atmete seinen Duft ein, vielleicht half es ja. Doch ich hatte kein Glück. Schließlich ließ ich das Blatt in den Topf fallen und rührte weiter. Jedes Mal, wenn ich diese Kuchen backte, glaubte ich, Moms Anwesenheit zu spüren. Sie hatte Zitronen geliebt – ihren herben, frischen Duft und ihre fröhliche Farbe. Manchmal schnitt sie eine Zitrone auf und roch einfach nur daran.
»Weißt du, Lolly«, sagte sie dann glücklich, »durch Zitronen wird jeder Tag ein bisschen schöner. Sie enthalten eine Prise Küchenmagie, und wir brauchen schließlich alle etwas Zauber in unserem Leben.« Da sie die Schalen oft zwischen ihren Fingern verrieb, rochen ihre Hände immer nach Sommersonnenschein. Aber nach ihrem plötzlichen Tod und allem, was dann passiert war, hatte ich Zitronen nicht mehr viel Positives abringen können. Heute standen sie für mich viel eher für Pflicht und Verlust.
Das flüssige, trübe Gebräu in meinem Topf war ungefähr so ansprechend wie Spülwasser. Doch in ein paar Minuten würde es eindicken und fröhlich vor sich hin köcheln. Schon jetzt stieg ein verführerischer Duft aus dem Topf auf, eine Mischung aus dem sauren Geruch des Zitronensafts und der Süße des schmelzenden Zuckers, mit einem Hauch von Zitronenmelisse. Fröstelnd lehnte ich mich an den Herd; in der voll gefliesten Küche mit ihren Stahlschränken war es morgens immer kalt. Zwar trug ich eine Jogginghose und ein Sweatshirt unter der Schürze, doch ich spürte die Kälte trotzdem. Während ich darauf wartete, dass die Masse anfing zu köcheln, spähte ich verstohlen zu der Liste hinüber, die noch immer offen auf dem Arbeitstisch lag. Mein Blick scheute vor allem vor Nummer drei zurück. Dabei wusste ich ja, was dort stand: mich verlieben. Technisch gesehen hatte ich dieses Ziel bereits erreicht.
Sofort zogen reihenweise Bilder an meinem inneren Auge vorbei, bunt und flüchtig wie das Feuerwerk am vierten Juli. Hellbraune Augen, um die sich feine Lachfältchen bildeten; die zimtfarbenen Bartstoppeln an seinem Kinn, die er so gerne über die zarte Haut an meinem Hals rieb, nur um mich quietschen zu hören; die besondere Anordnung der Sommersprossen auf seinen Schulterblättern; seine starken Arme, die sich um mich legten und uns nahezu nahtlos miteinander verschmelzen ließen; meine Wange an der knotigen Wolle seines Seemannspullovers; seine Lippen auf meinem Haar. Und ich hörte, wie er meinen Namen sagte, fast als wäre er die Antwort auf seine Gebete, so rau und zärtlich, dass es mich dahinschmelzen ließ wie französische Butter.
Rory Shaw. Ohne jeden Zweifel hatte ich mich in ihn verliebt. Der Weg unserer Liebe war steinig gewesen, und trotzdem hatte es mich voll erwischt, so sehr, dass ich danach Jahre gebraucht hatte, um mich davon zu erholen. Eigentlich war ich mir gar nicht sicher, ob ich mich tatsächlich davon erholt hatte. Einen Augenblick lang glaubte ich den Geruch seiner von der Sonne erhitzten Haut in der Nase zu haben und diese Mischung aus honigweichem Eichenduft von Bourbon und süßem Tee. Die Trauer umfing mich so intensiv, dass ich kaum atmen konnte. Er war der erste und einzige Junge gewesen, den ich je geliebt hatte. Der Junge, dem ich das Herz gebrochen hatte. Der Junge, der mein Herz in tausend Stücke geschlagen hatte.
Schnell beugte ich mich über den Topf, um die Füllung zu prüfen, dann trat ich vom Herd weg und tupfte mir die Tränen ab, die hinter meiner Brille aufstiegen, da ich befürchtete, sie könnten meine Zitronenmischung versalzen. Es war ein dumpfer Schmerz, die Liebe zu einem Mann, der so absolut unerreichbar war, unwiderruflich fort. Zählte es denn, wenn man sich zwar verliebte, diese Liebe dann aber ein katastrophales Ende nahm, das man selbst herbeigeführt hatte?
»Die Antwort auf diese Frage lautet mit großer Wahrscheinlichkeit Nein«, flüsterte ich, während ich versuchte, den drückenden Kloß in meinem Hals herunterzuschlucken.
So sah sie aus, die Wahrheit über mein zitronenartiges Leben. Mein dreiunddreißigster Geburtstag stand demnächst bevor, und diese violett glitzernde Liste verkündete klar und deutlich, was ich alles nicht erreicht hatte. Bittere Verzweiflung überfiel mich in meiner einsamen Küche. Wie hatte es so weit kommen können? Warum hatte ich es nicht geschafft, auch nur einen Punkt auf dieser Liste abzuhaken? Direkt über der Tür zum Gastraum hing ein Schild mit einem der Lieblingssprüche meiner Mutter. Auf dem dünnen, weißlich bemalten und auf alt getrimmten Metall stand: SCHENKT DIR DAS LEBEN ZITRONEN, MACH LIMONADE DARAUS. Die Botschaft war so altbekannt, dass sie fast schon abgedroschen wirkte, aber meine Mutter hatte sie trotzdem stets voller Hingabe umgesetzt. Sie war eine Limonadenfrau gewesen und jedem Hindernis mit forschem, tatkräftigem Optimismus begegnet. Ich wusste genau, was sie mir gesagt hätte, wenn sie jetzt hier gewesen wäre.
»Hör auf, dich über die Zitronen in deinem Leben zu beklagen, Lolly. Fang lieber an, dir zu überlegen, wie du Limonade aus ihnen machen kannst.«
Doch sie war nicht hier, und ihre Abwesenheit war der Hauptgrund dafür, dass mein Leben zu einer Zitrone geworden war. Noch einmal las ich den Spruch auf dem Schild über der Tür, und plötzlich regte sich Entschlossenheit in mir. Als ich die Liste erstellt hatte, war ich fest davon überzeugt gewesen, all das erreichen zu können. Und bis vor zehn Jahren war ich auch auf einem guten Weg dorthin gewesen, bis mir das Leben einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Es war nicht meine Schuld, dass ich durch äußere Umstände vom Weg abgekommen war. Und fair war es schon gar nicht. Aber es war nun einmal geschehen.
Jahrelang hatte ich mir eingeredet, dass ich meine Träume irgendwann weiterverfolgen würde, nur halt etwas später: wenn Daphne älter wäre, wenn das Restaurant finanziell wieder besser aufgestellt wäre, wenn, wenn, wenn. Aber irgendwie war dieser Moment nie gekommen.
Es ist noch nicht zu spät, raunte mir die Stimme meiner Mutter in Gedanken zu.
»Wo sollte ich überhaupt anfangen?«, flüsterte ich zurück.
Aber wenn ich jetzt nichts unternahm, wann dann? Noch einmal sah ich zu der Liste hinüber, und plötzlich traf ich eine Entscheidung. Auf gar keinen Fall würde ich meinen dreiunddreißigsten Geburtstag feiern, ohne meine Ziele erreicht zu haben.
»Mir bleibt noch über einen Monat«, sagte ich laut und reckte entschlossen das Kinn. Dort, in der kalten Küche mit der köchelnden Zitronenfüllung auf dem Herd und Johnnys seltsam schwermütiger Interpretation von You Are My Sunshine im Ohr, gab ich mir selbst ein Versprechen. »Ich werde mindestens einen Punkt auf dieser Liste abhaken, bevor ich die Kerzen auf meinem Geburtstagskuchen ausblase. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
Dann griff ich zum Löffel und rührte voller Tatendrang meine Kuchenfüllung um. Dabei versuchte ich, mich voll und ganz auf die Zukunft und all die vielen Möglichkeiten zu konzentrieren, die vor mir lagen – nicht auf die Scherben der Vergangenheit und das, was ich zurückgelassen hatte.
5
Achtzehn Jahre zuvor
Silvesterabend
An Silvester saß ich allein in meinem Zimmer und las für meinen Englischkurs Wer die Nachtigall stört. Die Hälfte hatte ich schon geschafft. Irgendwann wanderte mein Blick zum Fenster und hinüber auf die andere Straßenseite. In Rorys Zimmer brannte Licht. Das war merkwürdig. Eigentlich hatte ich gedacht, er wäre auf Jessica Sharmas Silvesterfeier. Jessica war das beliebteste Mädchen in Rorys Jahrgangsstufe, und angeblich schmiss sie heute eine Party für fünfzig Auserwählte. Die Einladungen waren heiß begehrt. Natürlich gehörte ich nicht zu den Glücklichen, aber selbst wenn ich eingeladen gewesen wäre, hätte ich nicht hingehen können. Ich musste heute zu Hause bleiben, da meine Eltern zusammen mit Mr. und Mrs. Shaw und den Stewarts in Green Lake Silvester feierten und sie mich dafür bezahlt hatten, dass ich auf Daphne aufpasste. Die lag inzwischen fest schlafend auf der anderen Seite des Flurs in ihrem Bett, und ich bereute es bereits, mich heute als Babysitter verpflichtet zu haben.
Ich hatte meine Freundin Ashley eingeladen rüberzukommen, damit wir uns zusammen ansehen konnten, wie um Mitternacht am Times Square der Zeitball heruntergelassen wurde, aber sie hatte am Morgen abgesagt, weil sie sich eine Magen-Darm-Grippe eingefangen hatte. Und so stand mir nun wohl das langweiligste Silvester aller Zeiten bevor. Angestrengt sah ich aus dem Fenster und versuchte, Rory in seinem Zimmer zu erspähen, doch bei ihm rührte sich nichts. Vielleicht hatte er nur aus Versehen das Licht angelassen.
Mit einem enttäuschten Seufzer wandte ich mich dem nächsten Kapitel zu, behielt dabei aber weiterhin Rorys Fenster im Auge. Nachdem die Shaws letztes Jahr gegenüber eingezogen waren, hatten sich unsere Mütter schnell angefreundet, sodass Rory und ich uns plötzlich öfter über den Weg liefen. Montags – am einzigen Tag der Woche, an dem der Diner geschlossen war – kamen die Shaws oft auf einen Spieleabend vorbei. Während die Erwachsenen dann im Esszimmer Poker spielten und Bier oder trockene Martinis tranken, schauten Rory und ich uns im Arbeitszimmer einen Film an. Rory liebte unsere alte Bassethündin Myrtle und konnte prima mit Daphne umgehen, die gerade erst laufen lernte. Ständig kroch sie auf ihm herum und steckte ihm die Fingerchen in die Ohren oder in die Nase, oder er trug sie wie ein Pferd auf seinem Rücken.
Mein bester Freund war Rory nicht – dafür hatte ich Ashley und er seine Kumpels aus dem Fußballteam der Schule. Aber wir verstanden uns gut. Rory war eine Jahrgangsstufe über mir, doch er grüßte mich immer, wenn wir uns zwischen den Schulstunden auf dem Flur begegneten. Abgesehen von den montäglichen Spieleabenden unternahmen wir eigentlich nichts miteinander, trotzdem machte es mich irgendwie glücklich, dass er gegenüber wohnte. In Rorys Gegenwart war ich nie angespannt. Bei ihm fühlte ich mich rundum wohl in meiner Haut. Wenn er da war, war die Welt immer genau richtig.
Wieder seufzte ich und sah auf die Uhr. Kurz nach elf. Mein Magen knurrte, also sprang ich aus dem Bett. Zeit für einen kleinen Snack. Vielleicht sollte ich den Fernseher einschalten und mir den Silvesterball trotzdem ansehen, auch wenn es ein wenig trist war, das allein zu tun. Leise schlich ich die Treppe hinunter, um Daphne nicht zu wecken. Myrtle schnüffelte erwartungsvoll an meinen Füßen. Sie beherrschte die Kunst des Bettelns wie keine Zweite.
Nachdem ich in der Küche Licht gemacht hatte, holte ich mir einen Teller und die Schachtel mit den Crackern. Einen ließ ich für Myrtle fallen, die mich aber nur traurig anblickte und mit dem Schwanz wedelte. Sie hoffte auf Käse.
»Heute kein Käse, meine Liebe«, erklärte ich ihr und nahm einen Apfel aus der Obstschale. Mit dem guten Gemüsemesser, das Dad jeden Monat schärfte, schnitt ich den Apfel auf. Zack, zack. Nun das Kerngehäuse rausschneiden. Ich summte eine flotte Version von Auld Lang Syne, während ich schnippelte. Gerade als ich beim letzten Apfelstück zum Schnitt ansetzte, rammte Myrtle ihren rundlichen, nicht einmal kniehohen Körper gegen mein Bein. Das Messer glitt durch den Apfel und durch das weiche Fleisch an meinem Daumen.
Mit einem erstickten Keuchen ließ ich Apfel und Messer fallen und umklammerte meine Hand. Die Wunde begann sofort zu bluten, tiefrot und glänzend quoll es aus dem Schnitt, lief über mein Handgelenk und tropfte auf die Arbeitsfläche. Oh nein, das war schlimm. Leicht benommen versuchte ich, einen klaren Gedanken zu fassen. Mein Herz raste, und irgendwie war mir schwindelig. Es tat höllisch weh. Myrtle, die spürte, dass etwas nicht in Ordnung war, bellte leise und starrte verwirrt und besorgt zu mir auf.
»Oh nein, nein, nein. Mädchen, was sollen wir nur tun?« Ich schnappte mir ein Geschirrtuch und wickelte es um die verletzte Hand. Dann griff ich ungeschickt zum Telefon und rief bei den Stewarts an, bei denen meine Eltern heute feierten. Es ging niemand dran. Ashleys gesamte Familie lag mit dem Magen-Darm-Virus flach, sie konnten mir also auch nicht helfen. Ängstlich kaute ich auf meiner Unterlippe herum. Sicher war es nicht so schlimm, dass ich einen Krankenwagen brauchte, und selbst wenn ich zum Arzt müsste, konnte ich Daphne nicht allein lassen. Im Krankenwagen mitfahren konnte sie auch nicht. Das würde ihr nur schreckliche Angst machen. Ich zögerte noch eine Minute, dann rief ich drüben bei den Shaws an. Stumm betete ich, dass Rory wirklich zu Hause war. Mein Herz pochte wild, und mir wurde immer schwindliger.
Nach zweimal Klingeln nahm er den Hörer ab. »Hallo?«
Sobald ich seine Stimme hörte, war ich erleichtert. »Rory, hier ist Lolly. Ich habe mir in die Hand geschnitten, und es blutet ziemlich stark.« Plötzlich fing ich an zu weinen. »Kannst du rüberkommen?«
Kurz darauf war er auch schon da. Offenbar hatte er gerade geduscht, denn seine kupferroten Haare waren noch nass und kräuselten sich über den Ohren, außerdem trug er ein altes Fußballshirt und eine Jogginghose mit einem Loch am Knie. Ich ließ ihn herein, wobei ich die verletzte Hand über meinen Kopf hielt. Irgendwo meinte ich gehört zu haben, dass man das bei einer Blutung tun solle. Myrtle begrüßte Rory mit einem Schwanzwedeln, fiepte dann aber leise, da sie nicht begriff, was los war.
»Wie schlimm ist es?«, fragte er besorgt, während er die Turnschuhe auszog und gleichzeitig meine Hand musterte. An manchen Stellen war das Blut schon durch das Geschirrtuch gesickert. Es sah schrecklich aus.
Ich verzog das Gesicht. »Weiß nicht. Ich habe mir den Schnitt gar nicht richtig angesehen, irgendwie stand ich unter Schock.«
Rory runzelte die Stirn. »Soll ich dich in die Notaufnahme bringen? Eigentlich darf ich nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren, aber bei einem Notfall …« Er sah mich aufmerksam an. Inzwischen war er fünfzehn und hatte einen Lernführerschein.
Zögernd schüttelte ich den Kopf. Dabei streckte ich die verletzte Hand so weit in die Höhe, als wollte ich mich in der Schule zu Wort melden. Ich versuchte, ruhig zu bleiben und logisch zu denken. »So schlimm ist es bestimmt nicht. Hoffentlich nicht. Ich habe schon versucht, meine Eltern anzurufen, aber da ist niemand rangegangen. Daphne schläft oben, und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll.« Wieder kamen mir die Tränen. Mein Daumen tat schrecklich weh.
»Schauen wir es uns doch einmal an, dann wissen wir, wie schlimm es ist«, schlug Rory ganz ruhig vor.
Schniefend nickte ich. »Okay.«
Er hielt stützend meinen Ellbogen und führte mich vorsichtig zur Küchenspüle, wo er behutsam das Geschirrtuch von meiner Hand abwickelte. Ich schloss ängstlich die Augen, während er die Wunde untersuchte.
»Aua«, murmelte er mitfühlend. Vorsichtig öffnete ich ein Auge, aber nur einen Spalt weit. Offenbar hatte ich mir ein Stück von meiner Daumenbeere abgeschnitten. Es war eine einfache, offene Wunde, die aber noch immer stark blutete.
»Wie schlimm ist es?«, flüsterte ich. »Muss ich genäht werden?«
Abschätzend musterte Rory die Wunde. Er hatte im Herbst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, außerdem wusste ich, dass er später einmal Arzt werden wollte. »Es blutet zwar ziemlich, aber ich denke nicht, dass es viel bringen würde, das zu nähen. Eigentlich gibt es ja gar nichts, was vernäht werden könnte. Die Haut ist ab. Wir müssen die Wunde reinigen und Druck auf sie ausüben, um die Blutung zu stoppen.«
»Okay«, hauchte ich schwach. Dass er genau zu wissen schien, was getan werden musste, war eine Riesenerleichterung für mich.
»Komm, setz dich.« Er holte einen Stuhl und half mir, mich hinzusetzen, den Arm weiter über der Spüle, sodass das Blut direkt in den Abfluss tropfte. »Wo ist euer Erste-Hilfe-Kasten?« Durch seinen gelassenen Tonfall fühlte ich mich gleich viel ruhiger.
»Oben im Bad«, murmelte ich. Mir wurde schlecht, schwarze Flecken tanzten am Rande meines Gesichtsfelds. Ich stützte den Kopf gegen das Spülbecken und schloss die Augen, während Rory das Verbandszeug holte.
»Lolly, alles okay?« Plötzlich stand er wieder neben mir und beugte sich über mich. Konzentriert sah er mir ins Gesicht. Seine Hand lag auf meiner Schulter und gab mir Halt.
Ich nickte. »Glaube schon. Es tut nur so weh.«
»Ich werde die Wunde jetzt verbinden, okay?« Rory wies mich an: »Wenn du dich schwach fühlst, kannst du dich einfach bei mir anlehnen.«
Wieder nickte ich und schmiegte mich dankbar an seine Seite. Sein T-Shirt war alt und deswegen schön weich. Er roch nach Teebaumöl-Shampoo und nach Rory, nach dieser feinen Mischung aus Eichenlaub und süßem Tee, die ich jedes Mal in mich aufsaugen wollte, wenn ich ihn sah. So nah wie jetzt waren wir uns noch nie gekommen. Jeder seiner Atemzüge war mir deutlich bewusst, genau wie die straffen Muskeln, die ich an meiner Wange spürte. Es war einerseits beruhigend, ihm so nah zu sein, andererseits machte es mich aber auch nervös. Immerhin hatte ich ihn ziemlich gern. Zögerlich beugte ich mich noch ein wenig näher zu ihm.
»Das könnte jetzt etwas wehtun«, warnte er mich leise. »Aber nur für einen Moment.«
Ich stieß einen erstickten Schrei aus, als er die Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Wunde goss. Es zischte und brodelte. Plötzlich beugte Rory sich vor und pustete auf die Wunde. »Meine Mom hat das früher immer gemacht«, erklärte er mir mit einem verlegenen Lächeln. »Keine Ahnung, ob es wirklich hilft, aber mir ging es danach immer gleich besser.«
Und seltsamerweise fühlte ich mich tatsächlich besser. Als Rory mich angrinste, konnte ich sogar schwach zurücklächeln.
»Nur noch ein paar Schritte«, tröstete er mich. Er tupfte die Wunde mit einer sauberen Kompresse ab, wickelte geschickt eine Mullbinde darum und klebte sie fest. Ich spürte, dass seine Finger bei der Arbeit leicht zitterten, und sein Atem ging schnell. Dadurch wurde mir klar, dass er ziemlich nervös war, es sich aber nicht anmerken lassen wollte. Er versuchte, stark zu sein und sich um mich zu kümmern. Krampfhaft biss ich die Zähne zusammen und schloss die Augen, um nicht zu weinen. Ich wollte auch stark und tapfer wirken.
»Okay, das war’s.«
Vorsichtig öffnete ich die Augen wieder. Rory schob gerade den Abfall in den Mülleimer, darunter auch das blutige Geschirrtuch. Das Blumenmuster war vermutlich sowieso nicht mehr zu retten. Dann packte er das Verbandsmaterial zurück in den Erste-Hilfe-Kasten. Und schon sah es aus, als wäre nie etwas passiert.
»Vielen Dank.« Ich musterte meinen verbundenen Daumen. Er hatte jetzt den Umfang und die Form eines Hühnerbeins. »Willst du noch etwas bleiben und dir mit mir den Silvesterball ansehen?« Inzwischen war es kurz vor Mitternacht.
»Gerne. Ich sollte sowieso noch einmal überprüfen, ob die Blutung wirklich aufgehört hat, bevor ich gehe.« Rory führte mich ins Wohnzimmer, schaltete den Fernseher ein und suchte NBC, wo die Silvesterfeier am Times Square übertragen wurde. Er legte eine Decke über meine Beine und bettete meine verletzte Hand auf einen Kissenstapel, sodass sie über Herzniveau lag. Von meiner Mom einmal abgesehen, hatte sich noch nie jemand so liebevoll um mich gekümmert. Ich fand das überraschend schön.
Wir setzten uns zusammen auf die Couch – ohne auf Tuchfühlung zu gehen, aber auch nicht sonderlich weit auseinander. Myrtle streckte sich zu unseren Füßen aus, froh, dass nun alles wieder normal zu sein schien. Als sie einschlief, fing sie an zu schnarchen. Auf dem Bildschirm wirkte der Times Square eisig und festlich, und er quoll regelrecht über vor Menschen, die zusammen das neue Jahr begrüßen wollten. Verstohlen spähte ich zu Rory hinüber. Sein Blick war auf den Fernseher gerichtet.
»Ich dachte, du wärst heute auf Jessica Sharmas Party«, sagte ich.
Er zuckte mit den Schultern. »Ja, war ich auch. Es war ganz okay, aber ziemlich laut. Irgendwie war mir nicht danach. Also bin ich früh gegangen.«
»Ich bin froh drum.« Ein bisschen zittrig fühlte ich mich schon noch. »Danke, dass du rübergekommen bist. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte.«
Rory sah mich ruhig an. »Ich werde immer für dich da sein, Lolly«, versicherte er mir, und ich glaubte ihm. Und in diesem Augenblick war das der tröstlichste Gedanke der Welt.
Am Time Square wurde der Countdown gestartet. »Zehn … neun … acht … sieben …«
Wieder blickte ich zu ihm hinüber. Er hatte uns den sprudelnden Cranberrysaft eingeschenkt, den Mom für Ashley und mich in den Kühlschrank gestellt hatte, weil wir ja noch zu jung waren, um Sekt zu trinken. Jetzt nippte ich daran und musterte Rorys Profil. Mir war regelrecht schwindelig vor Erleichterung, und ich fühlte mich beinahe schwerelos, als würde ich ein paar Zentimeter über der Couch schweben. Gleichzeitig war ich zutiefst dankbar dafür, dass er bei mir war und mir geholfen hatte. Hier, an seiner Seite, war ich rundum glücklich und zufrieden.
»Vier … drei … zwei … eins. Frohes neues Jahr!« Auf dem Times Square brach Jubel aus. Rory drehte sich zu mir um, zog belustigt eine Augenbraue hoch und erhob sein Glas. Ungeschickt beugte ich mich vor und stieß mit ihm an.
»Frohes Neues, Lolly.«
»Frohes Neues.« Wir tranken.
Nun erschienen auf dem Bildschirm Zusammenschnitte von verschiedenen Feierlichkeiten überall in den Staaten: Menschen mit Partyhüten und funkelnder Abendgarderobe in Atlanta; ein großes Lagerfeuer in Wyoming, wo mit Bier angestoßen wurde. In Maryland stand eine Gruppe älterer Damen in Badeanzügen am Ufer der Chesapeake Bay, zählte von drei runter und sprang dann ins Wasser.
»Das wollte ich auch immer schon mal machen«, meinte Rory, während er zusah, wie die alten Damen sich kreischend gegenseitig mit Wasser bespritzten. »Ich glaube, man nennt das Neujahrsbaden.«
Ich dachte kurz nach. »Wir könnten das morgen machen.« Eine völlig verrückte Idee, aber ich fühlte mich mit Rory so wohl, das sollte nicht schon vorbei sein. Und der Gedanke, mit ihm ein kleines Abenteuer zu erleben, war wirklich aufregend.
Sofort leuchteten seine Augen auf. »Echt jetzt?«
In diesem Moment dachte ich weder an meine verletzte Hand, noch überlegte ich, wie wir unsere Eltern davon überzeugen könnten, uns gehen zu lassen. Ich sagte einfach zu.
»Klar«, versicherte ich achselzuckend. »Wir treffen uns morgen früh um zehn hier. Ich weiß auch schon genau, wo wir das machen können.«
*
»Wow. Einfach nur wow.«
Am folgenden Vormittag stand Rory mit mir an dem langen, einsamen, felsigen Küstenstreifen von Magnolia, der einfach nur South Beach genannt wurde. Er sah sich um und nahm die Aussicht in sich auf: das stahlgraue, rastlose Wasser des Sound erstreckte sich bis zu den grünen Hügeln von Bainbridge Island, dahinter ragten majestätisch die Olympic Mountains in den wolkenverhangenen Himmel auf. Er stieß einen leisen Pfiff aus. »Lolly, das ist atemberaubend.«
Ich musste lächeln, auch wenn ich in der eisigen Luft ein wenig fröstelte. Da konnte ich ihm nur zustimmen. Es war ein kalter, klarer Neujahrstag, und meine Mom hatte uns am Discovery Park abgesetzt, der sich knapp eine Meile von unserem Haus entfernt mit seinen weitläufigen Wäldern, Wiesen und Klippen am Puget Sound entlangzog. Mit den langen Wanderwegen, dem Leuchtturm und dem wundervollen, abgelegenen South Beach hatte der Park schon immer zu meinen absoluten Lieblingsorten gehört. Seit ich denken konnte, waren meine Eltern mit mir hierhergefahren, und heute wollte ich diesen Ort mit Rory teilen. Außerdem war es der perfekte Platz für unser Neujahrsbad.
Eingepackt in warme Jacken und Schals, die uns gegen den kalten Januarwind schützen sollten und unter denen wir schon unsere Schwimmsachen trugen, standen wir nun am nördlichen Ende des Strandes, hinter dem Leuchtturm mit seinem kleinen Parkplatz. Eine kalte Brise fuhr durch Rorys kupferfarbene Locken und ließ die Sommersprossen auf seinen Wangen noch deutlicher hervortreten.
»Bereit?«, fragte ich nervös. Es war so schon kalt, und das Wasser war sicherlich eisig. Langsam bekam ich Bedenken, dass mein Vorschlag vielleicht etwas überstürzt gewesen sein könnte. Ich hatte Mom gesagt, wir wollten wandern gehen, denn sie hätte uns höchstwahrscheinlich nicht erlaubt herzukommen, wenn sie gewusst hätte, was wir wirklich vorhatten. Außerdem hatte ich nicht an meinen verletzten Finger gedacht. Ich hatte einen kleinen Ziplock-Beutel und ein Gummiband mitgenommen, um ihn wasserfest zu verpacken. Doch jetzt, im hellen, kalten Tageslicht, kam mir der ganze Plan plötzlich dumm vor.
Rory nickte. »Klar, ziehen wir’s durch.«
»Dann komm.« Ich signalisierte ihm, mir zu folgen, und ging zum Wasser hinunter. Es war so klar, dass ich jede einzelne Wasserpflanze über dem Sand und den bunten Steinen auf dem Grund sehen konnte. Weiter draußen streckte ein Seehund den Kopf aus dem Wasser und beobachtete uns neugierig. Kleine Wellen rollten an den Strand. Ich zog Jacke, Pulli und Leggings aus, schnürte meine Turnschuhe auf und stand dann zitternd und mit Gänsehaut überzogen in meinem einteiligen Badeanzug im kalten, nassen Sand. Rory folgte meinem Beispiel. Er stellte sich neben mich und schlang schützend die Arme um seine nackte Brust. Vorsichtig schob ich meine Hand in den Plastikbeutel, und Rory half mir dabei, ihn mit dem Gummiband an meinem Handgelenk zu fixieren. Hoffentlich blieb der Verband in dem Beutel trocken.
»Okay«, sagte Rory dann, als wollte er sich innerlich wappnen. Ich hatte ihn bisher noch nie ohne Hemd gesehen, und der Anblick von so viel nackter, sommersprossiger Haut trieb mir das Blut in die Wangen. Allerdings waren die Wangen auch das Einzige an meinem Körper, das warm war. Meine Oberschenkel schienen bereits halb erfroren zu sein. Und nachdem wir im Wasser gewesen wären, stünde uns ja noch der lange, kalte, nasse Heimweg bevor. Um möglichst tapfer zu wirken, tauchte ich einen Zeh ins Wasser. Ich keuchte. Es war so kalt, dass meine Haut brannte.
»Bereit?« Rory griff nach meiner gesunden Hand. Warm drückte sich seine Handfläche an meine. Ich nickte und atmete noch einmal tief durch. Das war eine wirklich grauenvolle Idee.
»Eins … zwei …« Ohne mich aus den Augen zu lassen, begann Rory, langsam zu zählen. Ich spürte, wie er sich für den Sprung ins Wasser bereitmachte.
»Halt!«, schrie ich im allerletzten Moment. »Es ist viel zu kalt, und ich bin viel zu feige dazu.«
Erleichtert stieß Rory den Atem aus. »Ich auch«, gestand er grinsend. »Mir sind gewisse Bedenken gekommen, dass wir vielleicht Erfrierungen erleiden könnten, bevor wir es bis nach Hause schaffen, aber ich wollte nicht kneifen. Jetzt können wir einfach zusammen feige sein.«
»Klingt gut«, entschied ich ebenfalls grinsend. Da ich nur eine Hand benutzen konnte, war es etwas mühsam, Leggings und Pulli wieder anzuziehen, trotzdem musste ich lachen, während mir gleichzeitig die Zähne klapperten. Voller Erleichterung schlüpften wir, so schnell wir konnten, wieder in unsere Kleidung.
»Sollen wir noch ein bisschen bleiben, oder willst du direkt nach Hause?«, fragte ich, während ich den Reißverschluss meines dicken Mantels zuzog. Herrlich warm.
Rory sah sich um. »Lass uns noch bleiben. Zu Hause muss ich meinem Vater dabei helfen, die Weihnachtsbeleuchtung abzubauen. Hier ist es bestimmt lustiger.«
»Dann komm mit.« Ich führte ihn zu einem riesigen, ausgebleichten Treibholzstamm, der, solange ich zurückdenken konnte, hier am Strand lag. Ganz unten, dicht bei den knorrigen Wurzeln, gab es eine geschützte Mulde im Sand, die gerade groß genug war für zwei Personen. Meine verletzte Hand schützend, ließ ich mich in den Sand gleiten und winkte Rory zu mir heran. Er setzte sich neben mich.
»Weißt du, wo du hier gerade bist?«, fragte ich.
Er warf mir einen belustigten Blick zu. »Ist das so eine Kontrollfrage wie bei Patienten mit Kopfverletzungen? Datum, Uhrzeit, wer ist gerade Präsident?«
Ich musste lachen. »Nein, die Frage war ernst gemeint. Das hier ist mein absolut liebster Ort auf der ganzen Welt.«
Rory wurde sogleich wieder ernst und sah sich aufmerksam um. »Kann ich verstehen.«
Von hier war die Aussicht einfach atemberaubend: die schneebedeckten Berggipfel, das funkelnde graue Wasser, der menschenleere Felsenstrand. Majestätisch, ruhig und ein wenig wild. Ich liebte es einfach.
»Manchmal liegen dort drüben am Strand kleine Babyrobben.« Ich zeigte auf die Stelle. »An diesem Strandabschnitt ist eigentlich nie jemand.«
Rory stützte die Arme auf die Knie und lehnte sich gegen den Holzstamm. Entspannt wirkte er, als wäre er vollkommen mit sich im Reinen. »Das hier ist tausendmal besser, als den ganzen Tag über Weihnachtslichter abzuhängen«, befand er. »Mein Dad verbraucht dabei in einer Stunde einen Jahresvorrat an Schimpfwörtern. Danke, dass du mich davor bewahrt hast.«
»Na ja, du hast mich ja zuerst gerettet«, entgegnete ich fröhlich.
Als meine Eltern um ein Uhr morgens nach Hause gekommen waren, hatten sie mich mit verbundener und hochgelegter Hand auf dem Sofa vorgefunden, den Kopf an Rorys Schulter gelehnt. Wir hatten beide tief und fest geschlafen, der Fernseher war noch gelaufen. Vermutlich fühlten sich meine Eltern schuldig, weil ich sie nicht hatte erreichen können und weil Rory und ich gezwungen gewesen waren, ganz allein mit diesem medizinischen Notfall fertig zu werden. Meine Mom war ihm so dankbar für die Erste Hilfe gewesen, dass sie Mrs. Shaw dazu überredet hatte, Rory heute mit mir losziehen zu lassen. Ich hatte sie dann dazu überredet, uns hier abzusetzen und zu Fuß nach Hause laufen zu lassen. So hatten wir einen halben Tag, an dem wir tun konnten, was immer wir wollten.
»Ich habe noch nie jemanden hierher mitgenommen«, gestand ich.
Neugierig sah Rory zu mir herüber. »Und warum ausgerechnet mich?«
Achselzuckend antwortete ich: »Weil ich es mit dir teilen wollte.«
Das war die Wahrheit. Diesen Ort hatte ich bislang nicht einmal Ashley gezeigt. Doch als ich Rory nun neben mir im Sand sitzen sah, wusste ich, dass es die richtige Entscheidung gewesen war. Er gehörte hierher, an meine Seite.
Ich weiß nicht mehr, wie lange wir dort saßen, doch es waren bestimmt mehrere Stunden. Anfangs genossen wir schweigend die wilde Schönheit, die uns umgab. Dann fingen wir nach und nach an zu reden, erzählten uns voneinander. Wir sprachen über so ziemlich alles. Rory berichtete mir von seinem Traum, Sportmediziner zu werden und für eine Profimannschaft zu arbeiten. Ich schilderte ihm meinen Traum vom eigenen Restaurant. Als wir irgendwann Hunger bekamen, holte Rory einen leicht zerdrückten Schokoriegel aus der Tasche, den wir gerecht aufteilten. Während wir aßen, suchten wir nach Seehunden und beobachteten die riesigen Containerschiffe, die zum Hafen von Seattle unterwegs waren.
Als wir dort saßen, an den dicken Treibholzstamm gelehnt, allein mit dem Wasser, dem Himmel und dem Geschrei der Möwen, schien es fast so, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Wir redeten über Musik, über unsere Englischkurse, über Rorys letzte Fußballsaison. Dabei fanden wir heraus, dass wir beide Keith Urban und Wer die Nachtigall stört