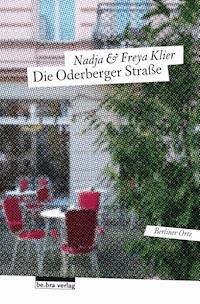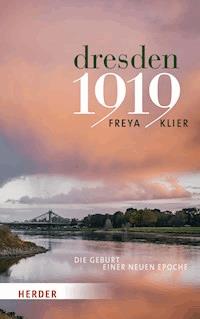
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dresden 1919 – die Stadt gleicht einem Brennglas, in dem sich die Lage der entstehenden Weimarer Republik spiegelt: Klassenkämpfer treffen auf Sozialdemokraten und ein kaisertreues Bürgertum. Kriegskrüppel und Schwerverwundete prägen den Alltag ebenso wie eine pulsierende Künstlerszene. Jederzeit droht der Bürgerkrieg. Aus historischen Zeugnissen und den Erinnerungen beteiligter Akteure formt Freya Klier ein beeindruckendes Panorama der damaligen Jahre und spannt den Bogen in unsere Zeit, indem sie Parallelen zur Gesellschaft heute zieht. "Über dem Europa des Jahres 1919 liegen Hunger und eine tiefe Erschöpfung – sowohl auf Seiten der Sieger als auch der Besiegten. Der Habsburger Völkerstaat ist in seine Bestandteile aufgespalten, und Deutschland als dem größten Verlierer des Weltkriegs wird ein Friedensvertrag diktiert, der die Menschen quer durchs Land in Zorn und Depressionen versetzt. Aus dem Osten droht der Bolschewismus, im Westen halten die Siegermächte deutsche Gebiete besetzt. Wie soll das weitergehen? Niemand will die Verantwortung für diesen Krieg übernehmen – am wenigsten jene, die ihn zu verantworten haben." Freya Klier lässt Menschen zu Wort kommen, die damals hautnah dabei waren: sie zitiert aus den Tagebüchern von Käthe Kollwitz und Victor Klemperer, sie zeichnet Erinnerungen von Erich Kästner, Ernst Toller, Oskar Kokoschka und Marie Stritt auf. Die zwölfjährige Jüdin Johanna Lindemann schildert beeindruckend, was Kinderarmut in der Kriegs- und Nachkriegszeit bedeutete. Noch weiß sie nichts von dem dramatischen Schicksal, das sie erwartet. Vieles von dem, was nach Ende des Ersten Weltkriegs geschieht, läuft in Dresden zusammen. In den Metropolen der anbrechenden Weimarer Republik sind die Stimmungen sehr unterschiedlich. Nur im Vergleich mit den Ereignissen in München, Berlin oder Köln lässt sich die Umbruchzeit im Elbetal des Jahres 1919 beschreiben. Wieso sind die Freikorps hier nicht so brutal wie im Ruhrgebiet oder in Bayern? Wieso verläuft die Revolution fast friedlich, ebenso die Ausrufung des Freistaates? Dresden wird zum Zentrum der Reformpädagogik. In keiner anderen Stadt gründen sich im Jahr 1919 so viele Vereine wie in der sächsischen Hauptstadt. Alle handeln aus derselben Motivation: Sie wollen die Welt verändern. Und "kaum wahrgenommen in der Welt des patriotischen Rauschens macht sich eine Generation starker Frauen auf den Weg, um ein gesamtdeutsches Frauenwahlrecht zu erkämpfen – an ihrer Spitze die Schauspielerin Marie Stritt. Sie agieren aus der bürgerlichen Mitte heraus, ohne aggressive Ausfälle gegen das männliche Geschlecht. Sie bekommen großen Zulauf und sind auf Anhieb erfolgreich, wie die Wahlen zur Nationalversammlung zeigen." Im Jahr 2019 feiert der Freistaat Sachsen mit der Hauptstadt Dresden seinen 100. Jahrestag. Am Beispiel dieser Stadt erzählt Freya Klier auf beeindruckende Weise von dem schwierigen Wandel des Kaiserreichs in die Weimarer Republik, in dem sie einen neuen Blick auf die Geschehnisse der Jahre 1918-1920 wirft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Freya Klier
Dresden 1919
Die Geburt einer neuen Epoche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Judith Queins
Umschlagmotiv: © MPower/photocase
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN E-Book 978-3-451-81323-8
ISBN Print 978-3-451-35999-6
Inhalt
Vorwort
Krieger
Frauen
Oktober 1918: Noch immer werden Eiserne Kreuze verliehen
November 1918: »Der fliegt nie, der jetzt nicht flog«
Dezember 1918: Die Rückkehr der Fronttruppen
Januar 1919: Der Mord an den kommunistischen Führern
Februar 1919: Frauen auf dem politischen Parkett
März 1919: Dresdner Sezession Gruppe 1919
April 1919: Die Bluttat von Dresden
Mai 1919: Die Kriegsfackel einmal um den Erdball
Juni 1919: Kategorischer Imperativ mit dem Revolver in der Hand
Juli 1919: »Warum wir den Frieden unterzeichnen müssen«
August 1919: Es ist heiß im August
September 1919: Gottesfürchtig und königstreu – das war gestern
Oktober 1919: Kokoschkas (seelische) Gesundung
November 1919: Der erste Jahrestag der Revolution
Dezember 1919: Wir brauchen Wohnungen!
Januar 1920: Männliche Anmaßung
Februar 1920: Von Spielern und Prostituierten
Frühjahr 1920: Die Herrschaft der 100 Stunden
Ausblick ins Düstere
Quellen
Nachweise
Über die Autorin
Vorwort
Über dem Europa des Jahres 1919 liegen Hunger und eine tiefe Erschöpfung – sowohl auf Seiten der Sieger als auch der Besiegten. Der Habsburger Völkerstaat ist in seine Bestandteile aufgespalten, und Deutschland als dem größten Verlierer des Weltkriegs wird ein Friedensvertrag diktiert, der die Menschen quer durchs Land in Zorn und Depressionen versetzt. Aus dem Osten droht der Bolschewismus, im Westen halten die Siegermächte deutsche Gebiete besetzt.
Wie soll das weitergehen? Niemand will die Verantwortung für diesen Krieg übernehmen – am wenigsten jene, die ihn zu verantworten haben. Die SPD springt in die Bresche; nun lastet alles auf ihren Schultern. Doch kaum ist der Waffenstillstand da, trommelt Linksaußen zum Bürgerkrieg, als sei es der seelischen Verheerung noch nicht genug. In den Wochen vor ihrer Ermordung wird die plötzlich zur Demokratie tendierende Rosa Luxemburg von ihren heißblütigen Genossen behandelt wie eine alte Tante.
Und wie verläuft der Umbruch vom Krieg in den Frieden bei den Heimkehrern? Um das zu erspüren, kehren wir noch einmal auf die Schlachtfelder zurück, lassen Otto Dix und Oskar Kokoschka vom Inferno berichten, Ernst Toller und Otto Griebel. War alles unausweichlich, was da geschah? Mit dem Blick aus dem 21. Jahrhundert erkennen wir Momente, über die wir schaudernd sagen können: Es gab sie doch auch vor hundert Jahren! Es gab Pazifisten und mitten im Krieg die streng untersagte Verbrüderung an der Front – das deutsch-englische Weihnachtsliedersingen im Schützengraben, das Fußballspiel der Kriegsgegner im Niemandsland. Den Maschinenbaustudenten der Technischen Hochschule Dresden Max Immelmann holen wir aus dem Vergessen, der als Fliegerleutnant abstürzte und dem britische Piloten unmittelbar danach als Zeichen der großen Anerkennung seiner Fairness einen Kranz an der Frontlinie abwarfen.
Ein Europa der Verständigung blitzt auf, das 1919, nach dem Ende des Großen Krieges, in sehr weiter Ferne liegt …
Doch da gibt es noch eine zweite Linie: Kaum wahrgenommen in der Welt des patriotischen Rauschens macht sich eine Generation starker Frauen auf den Weg, um ein gesamtdeutsches Frauenwahlrecht zu erkämpfen – an ihrer Spitze die Schauspielerin Marie Stritt. Sie agieren aus der bürgerlichen Mitte heraus, ohne aggressive Ausfälle gegen das männliche Geschlecht. Sie bekommen großen Zulauf und sind auf Anhieb erfolgreich, wie die Wahlen zur Nationalversammlung zeigen.
Vieles von dem, was nach Kriegsende geschieht, läuft in Dresden zusammen. Und hier ist einiges anders als in München oder Berlin, die Revolution verläuft fast friedlich, die Ausrufung des Freistaates ebenfalls. Zwar hat das Militär Mühe, vom König auf die Sozialdemokraten umzuschwenken; die aber, unter Führung des Juristen und früheren Journalisten Georg Gradnauer, sind zur Verständigung bereit, zum gemeinsamen Blick nach vorn. So geht 1919 auch hier die größte Aggression von Linksradikalen aus: Sie zielen auf eine Revolution nach russischem Vorbild und haben vor allem die gemäßigte SPD im Visier. Deren Minister Gustav Neuring wird auf die Augustusbrücke gezerrt, dort unter Johlen in die Elbe gestoßen, sein Kopf zur Zielscheibe, bis er versinkt … Doch wer steckt hinter diesem Mord? Sind wir wirklich schon alle DDR-Geschichtslügen los?
Die Stimmungen in den Metropolen der anbrechenden Weimarer Republik sind sehr unterschiedlich. Und ohne den vergleichenden Blick nach München, Berlin oder Köln ließe sich die Umbruchzeit im Elbetal des Jahres 1919 nicht beschreiben. Wieso sind die Freikorps hier nicht so brutal wie im Ruhrgebiet oder in Bayern? Ist das vorübergehend?
In jeder Großstadt herrscht eine andere Temperatur. Die in der Reichshauptstadt Berlin umreißt der Dadaist George Grosz im Nachhinein giftig:
»An allen Ecken standen Redner. Überall erschollen Haßgesänge. Alle wurden gehaßt: die Juden, die Kapitalisten, die Junker, die Kommunisten, das Militär, die Hausbesitzer, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die Schwarze Reichswehr, die Kontrollkommissionen, die Politiker, die Warenhäuser und nochmals die Juden. Es war eine Orgie der Verhetzung, und die Republik war schwach, kaum wahrnehmbar. Das mußte mit einem furchtbaren Krach enden …«
Das gilt für Berlin, doch gilt das auch für Dresden – die Stadt von Karl May, die »Vornehmste, schönstgelegene Kunst- und Fremden-Stadt Deutschlands«, wie es 1919 in ihrer Werbung heißt?
Jeder versucht, sich neu zu finden, und Bettler prägen die Stadt ebenso wie eine pulsierende Künstlerszene. Kriegsheimkehrer wie Otto Dix und Oskar Kokoschka malen sich ihre Traumata von der Seele. Und während Dix den Gewinn seiner Bilder gern ins Bordell trägt, sehnt sich Kokoschka nach zärtlichen Mädchenhänden. Erich Kästner zieht es weg aus Dresden, Victor Klemperer gerade jetzt hierher.
Dresden wird zum Zentrum der Reformpädagogik. Und nirgendwo gründen sich 1919 so viele Vereine wie in der sächsischen Hauptstadt – Christen und Juden, Mädchen und Jungen, Kommunisten und Nationalisten. Alle wollen die Welt verändern – und dabei auch wandern. Die Sächsische Schweiz liegt gleich nebenan. Je mehr das erste Friedensjahr ins Land zieht, desto leidenschaftlicher wird getanzt …
Um die Atmosphäre von damals hundert Jahre später zu erspüren, brauchen wir Informationen aus erster Hand: Wir lesen in den Tagebüchern von Käthe Kollwitz und Victor Klemperer, in den Erinnerungen von Erich Kästner und Ernst Toller, Oskar Kokoschka und Marie Stritt.
Wie kommen die ersten Frauen in der Politik zurande, wie die Kriegsversehrten über die Runden? Die Jüdin Johanna Lindemann, die ein dramatisches Schicksal erwartet, kommt als Zwölfjährige zu Wort: Beeindruckend schildert sie, was Kinderarmut in der Kriegs- und Nachkriegszeit bedeutete.
Deutschland kommt nicht zur Ruhe. 1920 wird die junge Republik vom Kapp-Putsch erschüttert – viele Männer finden sich jetzt nicht mehr im Schützengraben wieder, sondern im Straßengraben und auf der Barrikade. Ostern 1920 wird auch Dresden vom Putsch heimgesucht: Freiwilligenverbände und rechtsradikale Einwohnerwehren unterstützen ihn, dazu Teile der Reichswehr. Auf der anderen Seite bilden sich Arbeiterräte und Aktionsausschüsse, die den Widerstand gegen die Putschisten organisieren. Gewerkschaften rufen zum Generalstreik auf, Linksradikale zum bewaffneten Kampf …
In der Stadt toben schon bald bürgerkriegsähnliche Zustände: Geschossen wird im Zwinger, am Theaterplatz, unter der Brühlschen Terrasse. Als die Kämpfe abgeflaut sind, bleiben 59 Tote und 200 Verwundete zurück.
Auch die Kunst kommt nicht ungeschoren davon: Im Zwinger hat eine verirrte Kugel das Fenster der Gemäldegalerie durchschlagen und sich Rubens’ »Bathseba im Bade« in den Kopf gebohrt! Oskar Kokoschka ist fassungslos. Wutschnaubend läuft der sonst so sanfte Professor am darauffolgenden Tag durch die Gänge der Akademie. Er verfasst ein Plakat, das er mit studentischen Anhängern druckt. Darin richtet er sich – bezugnehmend auf die durchbohrte »Bathseba« –
»an alle, die hier in Zukunft vorhaben, ihre politischen Theorien, gleichviel ob links-, rechts- oder mittelradikale, mit dem Schießprügel zu argumentieren, die flehendlichste Bitte, solche geplanten kriegerischen Übungen nicht mehr vor der Gemäldegalerie des Zwingers, sondern etwa auf den Schießplätzen der Heide abhalten zu wollen, wo menschliche Kultur nicht in Gefahr kommt …«
Das Plakat prangt am nächsten Tag in allen Dresdner Zeitungen. Und es löst einen so bösartigen »dadaistischen« Kommentar seiner Berliner Kollegen um George Grosz aus, dass der sensible österreichische Maler beschließt, Deutschland zu verlassen.
Krieger
Woran fehlt es den Europäern am beginnenden 20. Jahrhundert? An nichts, was einen Krieg rechtfertigen würde. Die industrielle Revolution hat sie wirtschaftlich stark gemacht, und auch kulturell ist Europa hoch entwickelt, bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Länder. Doch statt zusammenzuarbeiten, wirkt jeder gegen jeden. Nationalismus, Militarismus, Neid und verhängnisvolle Allianzen verwandeln den alten Kontinent in ein gewaltiges Pulverfass. Das explodiert im Sommer 1914. Beteiligt werden sein: Der Zweibund Deutsches Reich und Österreich-Ungarn, Frankreich, England, Russland. Kurz nach der Nachricht von der russischen Generalmobilmachung richtet am 31. Juli 1914 Kaiser Wilhelm II. in der Reichshauptstadt die Worte an sein Volk:
»An mein Volk!
Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand.«
Die Deutschen brechen, nach einem quälenden Hin und Her der internationalen Politik, in einen erlösenden Jubel aus. Als der Kaiser tags darauf die Mobilmachung Deutschlands verkündet, versammeln sich spontan 50 000 Menschen vor dem Berliner Stadtschloss und lauschen andächtig seinen Worten:
»In dem jetzt bevorstehenden Kampfe kenne ich in meinem Volke keine Parteien mehr. Es gibt unter uns nur noch Deutsche. Und welche von den Parteien auch im Laufe des Meinungskampfes sich gegen mich gewandt haben, ich verzeihe ihnen allen. Es handelt sich jetzt nur darum, daß alle wie Brüder zusammenstehen.«
Das reißt mit, die Worte des Kaisers erzeugen ein lange nicht gekanntes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Großstädte Deutschlands versinken in einem patriotischen Freudentaumel – wenn auch nicht gerade in Ostpreußen, welches unmittelbar an den Kriegsgegner Russland grenzt, oder im Elsass, das mit dem Kriegsgegner Frankreich fast verwoben ist. Vor allem Bürgerliche sind mitgerissen, Studenten und Gymnasiasten, Professoren, auch viele Künstler und Theologen. Nicht mitgerissen von den ersten Begeisterungsstürmen sind zunächst die Arbeiter – ihnen dämmert, sie könnten das Kanonenfutter sein, wie in allen Kriegen. Doch als der Auszug der ersten Soldaten aus den Kasernen in Richtung Front einsetzt, weht auch in den meisten Arbeitervierteln die schwarz-weiß-rote Fahne, erklingen auch hier patriotische Lieder.
Aus Bayern laufen Züge aus, geschmückt mit Bierflaschen und Rettichen. Sitzt der Student Ernst Toller in einem solchen Zug? Ernst Toller aus der Provinz Posen meldet sich 1914 freiwillig als Soldat. Seit Februar 1914 studiert er an der »Ausländeruniversität« im französischen Grenoble – nun aber, mit Kriegsausbruch, setzt er sich sofort in einen Zug nach Deutschland. Er ist nicht der einzige Patriot im Abteil:
»Als der Zug in Lindau, auf deutschem Boden, einläuft, singen wir wieder ›Deutschland, Deutschland über alles‹«, wird Toller sich später in seinen Memoiren »Eine Jugend in Deutschland« erinnern.
»Wir winken den bayrischen Landwehrmännern zu, die den Bahnhof bewachen, jeder von ihnen ist das Vaterland, die Heimat; wenn ihre Vollbärte wedeln, hören wir die deutschen Wälder rauschen …
Ich habe die Stimmen der Menschen noch im Ohr, die schrien, daß Frankreich angegriffen sei. Jetzt lese ich in deutschen Zeitungen, daß Deutschland angegriffen wird, und ich glaube es. Französische Flieger, sagte der Reichskanzler, haben Bomben auf bayrisches Land geworfen, Deutschland wurde überfallen, ich glaube es.
An den Bahnhöfen schenkt man uns Karten mit dem Bild des Kaisers und der Unterschrift: ›Ich kenne keine Parteien mehr‹.
Der Kaiser kennt keine Parteien mehr, hier steht es schwarz auf weiß, das Land kennt keine Rassen mehr, alle sprechen eine Sprache, alle verteidigen eine Mutter, Deutschland.«
Im August 1914 ist es nicht leicht, Soldat zu werden, die Kasernen quellen bereits über von Freiwilligen. Und so streift der aus Samotschin bei Posen stammende 21-Jährige erstmal durch die Straßen Münchens. Im Englischen Garten wird er irrtümlich für einen Franzosen gehalten, also für einen Feind:
»Ich setze mich auf eine Bank, über die alten Buchen streicht ein lauer Wind, es sind deutsche Buchen, nirgends auf der Welt wachsen herrlichere. Neben mir sitzt ein hagerer Mensch, selbst sein Adamsapfel, spitz und riesig, erscheint mir liebenswert. Er steht auf, er geht fort, er kommt mit anderen Menschen wieder. Verwundert sehe ich, wie man auf mich zeigt, dann auf meinen Hut, dessen Futter, allen sichtbar, mit großen blauen Buchstaben, den Namen eines Lyoner Hutfabrikanten trägt. Ich nehme meinen Hut, gehe weiter – die Gruppe, zu der andere Neugierige stoßen, folgt mir, ich höre erst einen, dann viele rufen ›Ein Franzose, ein Franzose!‹
Ich beschleunige meine Schritte, Kinder laufen neben mir her, weisen auf mich mit Fingern, ›ein Franzos, ein Franzos!‹. Zum Glück begegnet mir ein Schutzmann, ich zeige ihm meinen Paß, die Menschen umringen uns, er zeigt ihnen meinen Paß, unwillig und schimpfend zerstreuen sie sich.«
Gleich am nächsten Morgen meldet sich Ernst Toller bei der Artillerie. Nun zeigen alte Unteroffiziere und junge Kadetten den Kriegsfreiwilligen, wie ein richtiger Mann stillzustehen und wie er sich zu rühren hat. Toller lernt, dass niemand ein Held des Krieges werden kann, der den Stechschritt des Friedens nicht »wie im Schlaf« beherrscht.
Es ist der ultimative Aufbruch – Einzelschicksale gibt es nicht mehr, nur das Vaterland gilt. Die Begeisterung schiebt auch unter den Zivilisten alle Widerwärtigkeiten in den Hintergrund. In ganz Deutschland verlassen im August Soldatenzüge die Städte: blumengeschmückt und von winkenden Frauen und Kindern gesäumt. An das August-Fieber 1914 werden sich jene erinnern, die diesen Krieg überleben.
Otto Griebel, Sohn eines Tapeziermeisters aus der westsächsischen Industriestadt Meerane, studiert seit 1912 an der Dresdner Kunstgewerbeschule, an der seit 1910 auch der Thüringer Otto Dix studiert:
»Ich hatte Dix im Aktsaal kennengelernt, einen schmächtigen Burschen, der damals schon auffiel«, wird sich Otto Griebel später erinnern. »Zu jener Zeit kam die Mazdaznan-Mode auf, der auch ich vorübergehend verfiel. Da mußte man morgens Atemübungen vornehmen, Eukalyptusöl inhalieren, Pinienkerne kauen und dem Fleischgenuß entsagen. Otto Dix und seine Freunde Lohse und Baumgärtel waren fanatische Anhänger davon, aßen kein Ei, ohne vorher den giftigen Keim zu entfernen, und speisten im ›Vegetarisches Restaurant Pomona‹ auf der Grunaer Straße. Dix huldigte dem Nietzeschen Übermenschen, trug den ›Zarathustra‹ bei sich und betrachtete Max Klinger als künstlerisches Idol.
Doch bald geschah ein Wandel zu den Malern der italienischen Frührenaissance, im besonderen zu Boticelli hin. Innerhalb des Dix’schen Umgebungskreises entstanden nun Bildnisse in diesem Stil auf geöltem Papier, dessen Glätte Überlasuren und feine Pinselzeichnung gestattete. Aus dieser Zeit stammt das Selbstbildnis von Dix im roten Hemd mit der Ponyfrisur und der Phantasie-Landschaft im Hintergrund …«
Doch nun ist der Krieg ausgebrochen, und sowohl Dix als auch Griebel melden sich als Freiwillige an die Front. Otto Dix rückt am 22. August 1914 als Ersatz-Reservist beim Feld-Artillerie-Regiment Nr. 48 in Dresden ein. Hart wird er ausgebildet, kommt aber durchaus zum Zeichnen. Am 12. Februar 1915 wird er zur 2. Ersatzbatterie des Reserveregiments 102 nach Bautzen überstellt – neben Fahrzeugen und Geschützen kommen auch Pferde zum Einsatz. Ein Vierteljahr später lässt Otto Dix sich in Bautzen zur MG-Kompanie XII versetzen.
Otto Griebel würde auch gerne, doch er darf noch nicht. Er ist noch nicht volljährig, und sein Vater gibt ihm nicht die Erlaubnis fürs Militär. Er schämt sich. Nun fragen ihn Mädchen, warum nicht auch er das feldgraue Ehrenkleid trage.
Und einer nach dem anderen rücken sie aus, seine Mitstudenten – mit Jubel und Musik und Blumen an den Patronentaschen und Gewehren. Er darf nicht miterleben, wie sie die Grenze zu Frankreich überschreiten, unter dreimal donnerndem »Hurra!« und dem Absingen der deutschen Nationalhymne. Bald schon hocken auch Maler, Zeichner und Bildhauer in den Schützengräben oder wechseln im Lazarett Verbände, erleiden auch sie nun das gleiche Schicksal wie siebzig Millionen andere Europäer. Die ersten fallen an derselben Front: Franz Marc und August Macke werden die ersten beiden Kriegsjahre nicht überleben.
Der Kunststudent Otto Griebel
Der Leipziger Maler Max Beckmann will nicht schießen, er geht 1914 als freiwilliger Sanitätshelfer an die Ostfront.
»Auf die Franzosen schieße ich nicht, von denen habe ich so viel gelernt. Auf die Russen auch nicht, Dostojewskij ist mein Freund.«
Max Beckmann wird im Krieg keinen einzigen Schuss abgeben. Doch er erleidet 1915 aufgrund seiner Erlebnisse in Flandern, wo er in einem Typhuslazarett eingesetzt ist und Zeuge des ersten Chlorgasangriffs bei Ypern wird, einen Nervenzusammenbruch. Beckmann wird vorübergehend beurlaubt und bekommt dann einen Schonposten: Er wird Zeichner fürs Militär in Straßburg.
Es gibt scharfe Kriegsgegner. Schon in den ersten Kriegsjubel hinein meldet sich die Deutsche Friedensgesellschaft zu Wort. In ihrem »Zweiten Kriegsflugblatt« vom 15. August 1914, veröffentlicht in der »Friedens-Warte 1914«, mahnen die Pazifisten:
»Europa steht in Flammen! Ein Krieg ist ausgebrochen, wie ihn die Welt seit einem Jahrhundert, seit der Zeit der Napoleonischen Kriege nicht gesehen, furchtbarer und zerstörender noch als jene, sowohl durch das gigantische Wachstum der Technik und der Zerstörungsmittel, wie durch die unendlich gesteigerte Empfindlichkeit des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens.
Noch vor wenigen Wochen würden die leitenden Staatsmänner Europas es für Wahnsinn erklärt haben, ihre Völker zu einem solchen Kriege aufzurufen; sie würden den Gedanken voll Empörung abgelehnt haben. Nun ist der Wahnsinn Wirklichkeit geworden.
Wenn das möglich ist, so liegt letzten Endes die Schuld an dem alle Völker beherrschenden und alle internationalen Beziehungen vergiftenden gegenseitigen Mißtrauen. (…)
Wir wissen, daß Millionen von Engländern und Franzosen mit uns diesen Krieg auf das lebhafteste beklagen und daß unsere – wir wagen trotz des Krieges zu sagen: unsere englischen und französischen Freunde – mit uns ihr Bestes daran gesetzt haben, ihn zu verhindern. Wir wissen besser als viele unserer Landsleute, wie stark und aufrichtig in weiten Kreisen des englischen und französischen Volkes das Bestreben war, mit Deutschland zu einer dauernden Verständigung zu gelangen.«
Ein klares, aber dünnes Stimmchen durchzieht das patriotische Rauschen, es wird kaum vernommen. Doch da der Krieg trotz aller Mahnungen nun bereits im Gange ist, stellen sich auch die Friedensfreunde eindeutig an die Seite ihrer Landsleute.
Am 4. Oktober 1914 veröffentlichen 93 deutsche Gelehrte den »Aufruf der 93«, der den aggressiven Kriegskurs des Kaiserreichs rückhaltlos billigt, aktuell insbesondere den Überfall auf das neutrale Belgien. Gegen diesen Aufruf wenden sich daraufhin der Mediziner Georg Friedrich Nicolai und der Physiker Albert Einstein mit einem »Aufruf an die Europäer«, der die sofortige Beendigung des Krieges durch alle Parteien fordert. Zu den Erstunterzeichnern – viel weniger als beim »Aufruf der 93« – zählen der Petersburger Philosoph und Journalist Otto Buek sowie der Astronomie-Professor Wilhelm Julius Foerster. Er nimmt ein friedliches Europa vorweg, das erst ein halbes Jahrhundert später Wirklichkeit sein wird, nach einem weiteren, noch verheerenderen Weltkrieg.
Der »Aufruf an die Europäer« ist ein Menetekel:
»Denn der heute tobende Kampf wird kaum Sieger, sondern wahrscheinlich nur Besiegte zurücklassen. Darum erscheint es nicht nur gut, sondern bitter nötig, daß gebildete Männer aller Staaten ihren Einfluß dahin aufbieten, daß – wie auch immer der heute noch ungewisse Ausgang des Krieges sein mag – die Bedingungen des Friedens nicht die Quelle künftiger Kriege werden, daß vielmehr die Tatsache, daß durch diesen Krieg alle europäischen Verhältnisse in einen gleichsam labilen und plastischen Zustand geraten sind, dazu benutzt werde, um aus Europa eine organische Einheit zu schaffen. – Die technischen und intellektuellen Bedingungen dafür sind gegeben.«
Die öffentliche Reaktion auf diesen pazifistischen Aufruf von Mitte Oktober 1914 – er wird erst 1917 veröffentlicht – ist negativ. Andere Geistesschaffende stehen fest auf der Seite des Krieges. Dem späteren Nobelpreisträger Thomas Mann zum Beispiel steht – noch ehe der erste Schuss gefallen ist – das »Herz in Flammen«. Der Autor triumphiert über den Zusammenbruch der verhassten, von den »Zersetzungsstoffen der Zivilisation« stinkenden »Friedenswelt«. Noch im Herbst 1914 verfasst er gemütlich von seinem Schreibtisch aus für die »Neue Rundschau« den Aufsatz »Gedanken zum Kriege«, in dem er den militärischen Kampf der deutschen Kultur gegen die barbarische Flachheit des Westens rühmt, den bewaffneten Widerstand gegen den »anti-heroischen« und »antigenialen« Geist der »wölfisch-merkantilen Bourgeoisie-Republiken«. Das »heute wichtigste Volk Europas«, gemeint ist Deutschland, sträube sich, den »zivilen Geist als letztes und menschenwürdigstes Ideal anzuerkennen.«
Die Propagandaschrift löst bei Manns Freunden Bestürzung aus. Sein Bruder Heinrich wirft ihm vor, er nehme für seine geistigen Liebhabereien »Elend und Tod der Völker in Kauf«. Für Thomas Mann bleibt aber auch in seinen sich über die restlichen Kriegsjahre ziehenden »Betrachtungen eines Unpolitischen« der Weltkrieg ein »Entscheidungskampf« zwischen der metaphysischen deutschen Nation und dem ihr wesensfremden Westen: »Fort also mit dem landfremden und abstoßenden Schlagwort ›demokratisch‹! Nie wird der mechanisch-demokratische Staat des Westens Heimatrecht bei uns erlangen.«
Einzelstimmen sind es, die untergehen im Geheul der Apokalypse, im satanischen Pfeifen der Granaten und Schrapnells über den europäischen Schützengräben.
Die ersten Gefallenennachrichten trafen schon Anfang August ein. Nun reißen sie nicht mehr ab. Kinder beten für den »lieben Pappi im Feld«, doch nicht jeder Vater kehrt mehr zurück. Leichen säumen die Wege und Wälder beim Vorrücken, es mischen sich eigene und die der Feinde. Dann wieder ein Sieg, die ersten vollständig aufgeriebenen Regimenter, dann wieder ein Sieg. Und eine Niederlage. Gespensterhafte, menschenleere Orte, die meisten niedergebrannt. Das emotionale Auf und Ab eines Krieges, in dessen ersten Monaten besonders viele Soldaten ihr Leben lassen. Auch Zivilisten.
Dennoch kommt es an der Westfront zu einzelnen Verbrüderungen gegnerischer Soldaten. Die europäische Vision der Pazifisten um Nicolai und Einstein leuchtet am Heiligabend 1914 wie ein Stern. Der deutsche Soldat Josef Wenzl berichtet in seiner Feldpost vom 28. Dezember an die Eltern:
»Es klingt kaum glaubhaft, was ich euch berichte, ist aber pure Wahrheit. Kaum fing es an, Tag zu werden, erschienen schon die Engländer und winkten uns zu, was unsere Leute erwiderten. Allmählich gingen sie ganz heraus aus den Gräben, unsere Leute zündeten einen mitgebrachten Christbaum an, stellten ihn auf den Wall und läuteten mit Glocken. Alles bewegte sich frei aus den Gräben, und es wäre nicht einem in den Sinn gekommen zu schießen.
Was ich vor ein paar Stunden noch für Wahnsinn hielt, konnte ich jetzt mit eigenen Augen sehen. (…) Zwischen den Schützengräben stehen die verhaßtesten und erbittertsten Gegner um den Christbaum und singen Weihnachtslieder. Diesen Anblick werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Man sieht bald, daß der Mensch weiterlebt, auch wenn er nichts mehr kennt als Töten und Morden (…) Weihnachten 1914 wird mir unvergeßlich sein.«
Der bayrische Soldat Josef Wenzl wird ein friedliches Europa nicht mehr erleben, er fällt am 6. Mai 1917.
Doch finden sich ähnliche Weihnachtserfahrungen auch in den Briefen französischer, belgischer oder britischer Kriegsteilnehmer. Am Frontabschnitt bei Diksmuide ist es der Soldat Gustave Berthler, ein französischer Familienvater, der sich wie viele seiner Kameraden über das Verbot hinwegsetzt, mit den Feinden zu fraternisieren. Über seine weihnachtliche Begegnung mit den Deutschen schreibt er seiner Tochter Alice:
»Sie sind es genauso leid wie wir, Krieg zu führen, sie sind verheiratet wie ich auch, was sie an meinem Ehering gesehen haben, und sie wollen nur eins, nach Hause. Möglichst schnell nach Hause. Sie haben mir ein Paket Zigarren geschenkt und eine Schachtel Zigaretten, und ich habe ihnen eine Ausgabe von ›Le Petit Parisien‹ gegeben im Austausch für eine deutsche Zeitung.«
Nachdem sie Weihnachtslieder gesungen und ihren Friedenswillen bekundet haben, verlassen Soldaten die Schützengräben und treffen sich zwischen den Fronten zum Gespräch, zum Austausch von Souvenirs und Lebensmitteln. Vaterländische Liebesgaben, die zur Hebung der Truppenmoral auf allen Seiten der Front verteilt wurden, wechseln bestimmungswidrig ihre Besitzer: Deutsche Kronprinz-Heinrich-Pfeifen und belgische König-Albert-Zigarren werden zu ebenso begehrten Tauschobjekten wie französischer Wein oder englische Plumpudding- und Corned-Beef-Dosen. Souvenirjäger erbeuten Uniformknöpfe. Einem britischen Soldaten gelingt es sogar, gegen ein umfangreiches Fressalienpaket eine deutsche Pickelhaube einzutauschen. Doch damit nicht genug: Als der deutsche Soldat kurz darauf bei einer angekündigten Inspektion seinen Helm vorzeigen muss, wird organisiert, dass er ihn aus dem gegnerischen Schützengraben vorübergehend wieder zur Verfügung gestellt bekommt. Schnell entwickelt sich die weihnachtliche Kommunikation der Schützengrabenmannschaften über den Austausch von Waren und Souvenirs hinaus – da schneidet ein zum englischen Militär eingezogener Friseur Freund und Feind die Haare, man organisiert ein Picknick mit Lagerfeuer oder spielt Fußball im Niemandsland. Auch einer traurigen Verpflichtung kommen die Soldaten nach: Nun, da sie keinen feindlichen Kugelhagel befürchten müssen, bestatten sie die zwischen Stacheldrahtverhauen und Granattrichtern verstreuten Leichen ihrer gefallenen Kameraden …
Das Weihnachtswunder an der Westfront bleibt zeitlich begrenzt. Meist werden die Kampfhandlungen für ein paar Tage unterbrochen, manchmal hält der eigenmächtig organisierte Waffenstillstand der Frontsoldaten sogar ein paar Wochen. In einigen Kampfzonen sind monatelang keine Verluste zu verzeichnen, weil die Mannschaften sich auf den Ausbau der eigenen Stellungen beschränken und auf Angriffe verzichten. Auch wo sich unter dem Druck der militärischen Führung die Waffenruhe nicht aufrechterhalten lässt, wirkt der Weihnachtsfrieden nach. Um Blutvergießen zu vermeiden, vereinbart man Warnschüsse, sobald neue Angriffe bevorstehen.
Anders als einzelne Offiziere, die die vertrauensbildenden Maßnahmen ihrer Soldaten zulassen, versuchen die Heeresleitungen der Kriegsnationen jede Ausweitung der Verbrüderungsaktionen zu verhindern. Drakonische Strafen werden angedroht bis hin zur Erschießung derjenigen, die sich weigern, die Kampfhandlungen wieder aufzunehmen. Um »Schützengraben-Freundschaften« und jede Wiederholung der »Ausschweifungen« von 1914 zu unterbinden, dekretiert die deutsche Heeresleitung 1915:
»Jeder Versuch der Verbrüderung mit dem Feind wie z.B. eine stillschweigende Abmachung, nicht aufeinander zu schießen, gegenseitige Besuche, Austausch von Neuigkeiten, wie es letztes Jahr an Weihnacht und Neujahr passierte, ist hiermit streng verboten. Zuwiderhandlungen werden als Hochverrat betrachtet.«
Die Militärhierarchien Deutschlands, Englands und Frankreichs üben massiven Druck auf die Frontoffiziere aus und verstärken ihre Feindbildpropaganda. Auch an der Heimatfront stoßen die Verbrüderungsberichte an Weihnachten 1914 auf Ablehnung. Und doch bleibt es ein Lichtblick von Humanität und Frieden in einer Nacht der Gewalt, die noch lange nicht endet.
Nichts von alledem dringt zu Otto Griebel, Student an der Dresdner Kunstgewerbeschule, als er endlich mitkämpfen darf! 1915 wird er zur Infanterie gezogen. Zum Drill geht es nach Posen, in ein ödes, eintöniges Barackenlager. Und von dort dann an die Westfront: an die Somme, nach Lens, nach Angres.
»Dort, es war im Spätsommer 1916, traf ich dann eines Morgens ganz unvermutet auf Otto Dix, meinen Mitstudenten aus der Kunstgewerbeschule. Er war Unteroffizier einer Maschinengewehrgruppe des Infanterieregiments 102. Dix nahm mich mit nach seinem Unterstand und zeigte mir da einen ganzen Stapel von Temperabildern und Tuschzeichnungen, die er sehr fleißig in seinen Freistunden geschaffen hatte. Es waren kubistisch gehaltene Kompositionen, meist Kriegsthemen. Die Leute seiner Korporalschaft lächelten spöttisch, als er mir die Sachen vorführte, und Dix meinte: ›Siehst Du, die halten mich für verrückt; was sie nich fressen können, begreifen sie nich!‹«
Otto Dix befindet sich mit seinem Feld-MG-Zug 390 1916 vor allem in der Champagne, »in der blöden Läuse-Schlampagne«. Und schreibt auf einer Feldpostkarte nach Dresden:
»Wir schießen mit dem Maschinengewehr gegen Flieger. Aber es wurde noch kein Flugzeug heruntergeschossen, es ist nicht leicht. Es ist immer das Gleiche, das Wetter ist sonnig und schön. Heute erhielt ich von der K.G.Sch. (Kunstgewerbeschule, d. Verf.) Zigarren. Aber ich muß sie immer weggeben, da ich selbst nicht rauchen kann. Ich hoffe sehr stark, daß bald Frieden ist, aber ich glaube es nicht. Mit vielen Grüßen Ihr Dix«
Feldpostkarte von Otto Dix
Der längst zum Unteroffizier avancierte MG-Schütze ahnt nicht, dass ihm die schlimmsten Kriegserfahrungen noch bevorstehen. Otto Dix durchlebt das »Naturereignis Krieg« mit allen Sinnen. Er ist ein Künstler, der noch immer Ja sagt zu »Läusen, Ratten, Drahtverhau«, zu »Leichen, Blut, Schnaps … Gas, Kanonen, Dreck«. »Das ist der Krieg! Alles Teufelswerk!« schreibt er in sein Kriegstagebuch.
Zwei Monate später geht es wirklich um Leben und Tod. Er schreibt an Helene Jakob:
»In meinem kleinen Erdloch, 1 mtr. hoch, 2 mtr. lang, lag ich noch allein mit einem Infanteristen stundenlang im Trommelfeuer. Am Abend wurde es ruhiger, und ich ging zurück. – Die folgenden Tage waren fast noch furchtbarer. (…)
Am Abend griff der Feind an. Wegen des Nebels schoß eine Batterie zu kurz und schoß in unseren Steilhang. Furchtbare Bestürzung, schreckliche Verluste, die Leichen lagen herum, Arme und Beine flogen. Von der 6. Komp. dieses Regiments blieben 9 Mann übrig. (…) Jetzt sind wir weit hinter dieser Hölle in Maurois. Vielleicht erhalte ich nun bald mal Urlaub. Es sind viele gute Kameraden draußen geblieben, schade um die Kerle. Recht viele Grüße Dix«
Fern vom französischen Schlachtfeld kommt 1915 der 28-jährige Maler und Dramatiker Oskar Kokoschka an der Ostfront zum Einsatz – hoch zu Ross. Der Österreicher Kokoschka ist längst kein Unbekannter mehr in der Kunstwelt. Vor seinem Kriegseinsatz verfasste er erste Theaterstücke, malte und leitete einen Abendkurs an der Kunstgewerbeschule in Wien, um sich zu finanzieren. Zeitweilig arbeitete er in der Redaktion des »Sturm« in Berlin mit. In der berühmten Galerie von Paul Cassirer kam der Maler 1910 zum ersten Mal in Deutschland groß raus – mit einer Einzelausstellung von 27 Gemälden und 27 seiner Grafiken. Für Gustav Klimt ist Kokoschka noch immer »das größte Talent der jüngeren Generation«. Auch auf der »Großen Kunstausstellung« in Dresden, seiner späteren Wirkungsstätte, waren 1912 zwei Gemälde von Oskar Kokoschka ausgestellt. Es folgten Karlsbad, Hagen und erneut Wien. Kokoschka malte den Schriftsteller Karl Kraus und den Architekten Adolf Loos und traf in Frankfurt auf den Maler Franz Marc. Und immer gestaltete der Christ Kokoschka auch religiöse Themen.
Das war, bevor der Maler aus Wien in den Krieg zog. Er wäre wohl nicht rekrutiert worden, hätte nie einen Gestellungsbefehl erhalten. Dass er nun auf dem Pferd gegen die Kosaken stürmt, verdankt er einer Frau – Alma Mahler. Zwei Jahre zuvor war er der 26-jährigen Alma erstmals begegnet, der Witwe des Komponisten Gustav Mahler. Er war hingerissen und schrieb Alma Mahler kurz danach einen glühenden Brief, in dem er sie bat, seine Frau zu werden. Daraus wurde nichts. Man zog zusammen, bereiste gemeinsam die Schweiz, Venedig, Neapel und Pompeji, es ging leidenschaftlich zu, samt heftigen Eifersuchtsszenen und anderen exzentrischen Auftritten. Kokoschka malte den als Verlobungsbildnis angelegten »Doppelakt Liebespaar« sowie »Die Windsbraut« – ein Sturmbild der Liebe, das später zu seinen berühmtesten Werken gehören wird. 1914 wird Alma Mahler von ihm schwanger. Sie treibt das Kind ab, was Oskar Kokoschka in zusätzliche Verzweiflung stürzt. Der Maler wählt vor Liebeskummer den Krieg. Er verkauft »Die Windsbraut« und erwirbt von dem Erlös ein Pferd. Dann meldet er sich beim k.u.k. Dragonerregiment »Erzherzog Joseph« Nr. 15.
Im Januar 1915 beginnt seine militärische Ausbildung in der Wiener Neustadt. Schon einen Monat später trennt sich Alma Mahler von Kokoschka und heiratet kurz darauf den Architekten Walter Gropius. Für Fähnrich Kokoschka und sein k.u.k. Regiment soll es nach Galizien und in die Ukraine gehen. Sie werden eingekleidet für die Kavallerie, man könnte auch vermuten, für die Operette, wie Oskar Kokoschka sich in »Mein Leben« später erinnert:
»Ich war eine wunderbare Zielscheibe in meiner hellblauen Jacke mit weißen Aufschlägen, roten Breeches und goldenem Helm, während die Russen bereits von den Japanern gelernt hatten, in Khakimontur sich zu camouflieren und mit Spaten sich einzugraben. Wir meinten, mit Trompeten und wehenden Fahnen heldenhaft den Feind zu überrennen, der sich im Schützengraben versteckt hielt.
Beim Abschied habe ich meine Mutter gebeten, mir eine Halskette mit blutroten Glasperlen aufzuheben, ein Andenken an Alma Mahler. Meine Mutter steckte sie in einen Blumentopf, um nicht an Blut denken zu müssen …«
Eine große Ausmusterungsparade der Kavallerieregimenter wurde anbefohlen, denn wegen der großen Verluste mussten bereits Reserveregimenter herangezogen werden.
Ende August 1915 geht es für den seelisch verwundeten Maler um Leben und Tod, wie er später in seinen Lebenserinnerungen beschreibt. Doch zunächst gibt es Tuchfühlung mit den eigenen Landsleuten:
»Aufsitzen! Der Trompeter gab dieses Zeichen. Wie ein Blitz waren die Säbel aus den Scheiden, dann eiserne Stille. Ich lag auf meinem Pferd, zwei Schritte vor der Front, ausgerichtet wie an einer Schnur mit den Chargen. Ich hatte Glück, mein Pferd stand ruhig. Das Regiment hörte auf zu atmen. Der Generalfeldmarschall v. Mackensen, auf seinem graugescheckten Araber, das Sturmband der Totenkopfhusarenmütze martialisch vor das Kinn geschoben, ritt hinter dem baumlangen Stabstrompeter die ausgerichtete Front entlang. Ich dachte eben: ›Wie gut er in die Zeit der napoleonischen Kriege gepaßt hätte! Ein zu spät Gekommener!‹ – als er mich ansprach. Über dem schönen Schauspiel hatte ich ganz überhört, ob es ein Befehl war, den er gab, wovon vielleicht meine ganze militärische Karriere abhing. Ich salutierte stramm, schon blitzte der Staub …«
Der Maler Kokoschka erinnert sich an das Hauptquartier des berühmten Reitergenerals, dem inzwischen auch die österreichischen Truppen unterstellt sind. Und er erinnert sich eines Festbankettes, das der berühmte Reitergeneral von Mackensen gab und an dem er teilnehmen durfte – der glänzenden deutschen Adlerhelme, der vielen silbernen Schnüre, funkelnden Orden und Sterne, der Federbüsche der k.u.k. Generäle … Kein Feldgrau weit und breit, dezent allerdings die Militärgeistlichen:
»Diskret getrennt von diesen hohen Kriegsherren waren die Feldkuraten, die das einheitlich schwarze Kleid trugen und ein Kreuz an der Brust. Der Glaubensstreit der sieben Konfessionen in der evangelischen Sendung der Nächstenliebe schien an jenen Tagen geschlichtet beim Wein und nicht zu trockenem Brote. Ein Gleicher unter Gleichen, ebenbürtig, saß auch der Rabbiner in ihrer Mitte, der seinen persönlichen Grund zur Feier hatte, war doch soeben ein Appell vom deutschen Generalquartiersmeister Ludendorff an die galizische Judenschaft gekommen, daß sie der gemeinsamen, guten deutschen Sache mit allen Kräften helfen sollte. Wer fühlte sich da nicht verstanden, geborgen am Urquell der deutschen Kraft und Freude! Als ein besonderes Zeichen der Aufmerksamkeit war nicht vergessen worden, den Aufruf in jiddischer Sprache abzufassen.
An meine lieben Jidden! So stand es im Tagesbefehl.«
Einige Monate währt die Abrichtung Kokoschkas, der zuvor nie gedient hat. Inzwischen ist er ein guter Reiter. Dann geht es in endlos langen Reisen in Viehwagen, in denen auch die Pferde transportiert werden, nach Osten. Bald wird es ernst für den sensiblen Maler und Dramatiker, der jetzt als Fähnrich auf fremder Erde dient und den ersten schweren Schock erlebt:
»Die ersten Gefallenen, die ich traf, waren meine jungen Kameraden, mit denen ich einige Nächte zuvor noch am Wachtfeuer in den ukrainischen Wäldern Karten gespielt und gescherzt hatte. Fast Knaben noch, hockten diese in ihren bunten Hosen im Moos, um einen Baumstamm gruppiert. An einem Ast, ein paar Schritte weiter davon, hing die Mütze, am nächsten Baum der blaue Dragonerpelz eines der Kameraden. Er selber hing nackt, mit dem Kopf abwärts, von einem dritten Baum. Ihre Pferde lagen, alle viere in die Luft gestreckt, aufgedunsen und bedeckt mit Fliegenschwärmen im Walde. Vor den riesigen Unrat-Haufen bäumte sich mein eigenes Pferd, so daß ich absteigen mußte, um es zu beruhigen.
Meine Patrouille sollte diese Freunde ablösen, die da so friedlich wie bei einer Landpartie zusammensaßen. Nur waren sie jetzt stumm. Und als ich mit der Hand dem Jüngsten ins Haar faßte, da blieb es in meiner Hand und seine Kopfhaut verrutschte …«
Die russischen Soldaten erwarten im Hinterhalt die österreichische Patrouille, die wild beschossen wird. Doch diesmal kommen Fähnrich Kokoschka und sein Halbblut davon.
Am 29. August 1915 gelingt das nicht mehr:
»Im Walde überraschend ein Hagel von Geschossen. Der große Tag war gekommen, auch ich hatte ihn eigentlich herbeigewünscht. Attacke!! Wer hätte sich vorgestellt, daß dies ritterliche Zauberwort mein schönes Dragonerregiment jäh zu einer blutigen Masse, Mann wie Pferd, verwandeln würde …
Keiner hatte mehr Herrschaft über sein Tier. Es ging viel zu schnell, als daß man an Heldentaten denken konnte. Nur nicht wie ein Wurm zertreten sein! Die Heißsporne unter uns sind in die Falle geraten, in die man sie gelockt. Ich habe genau das russische Maschinengewehr gesehen, bevor ich den dumpfen Stoß gegen meine Schläfe bekam.
Mein Hirn schmerzte zum Närrischwerden. Das Schreien um mich herum und das Jammern der Verwundeten, von welchem der ganze Wald voll war, konnte ich nicht verstehen. Jeder mußte seine großen Schmerzen tragen. Dann hat meine Aufmerksamkeit wieder beschäftigt, daß ich den Reiterstiefel mit dem Bein, der sich vor meinen Augen bewegte, nicht beherrschen konnte, obwohl er mir gehörte. Den Stiefel habe ich an meinen Sporen erkannt, die nicht scharf waren, wie es Vorschrift ist …«
Was macht das kleine Loch in seinem Kopf mit dem österreichischen Reiter? Auf der Wiese, so scheint es Kokoschka, tanzen zwei Offiziere in russischen Uniformen ein »Pas de deux«, wie im Ballett, fassen sich zierlich an den Händen und küssen sich am Ende gegenseitig heftig die Wangen ab:
»Was war denn mit mir geschehen? Ich hatte doch nur ein kleines kreisrundes Loch im Schädel. Vielleicht, daß mein Pferd, das schwer auf mir lag, im Verenden noch einmal ausgeschlagen hat. Der Hufschlag hatte mich wach gemacht. Zerronnenes Blut begann auf meinem Gesicht zu einer harten Kruste zu erstarren. Immer größer und riesiger sind die Schatten vor meinen Augen geworden. Seltsam, daß es so finster sein kann, wo doch Sonne und Mond zugleich am Himmel standen. Ich konnte mich nicht erheben, meine Glieder blieben unbeweglich. Ich gab auf. Ich mag einige Tage so bewußtlos gelegen sein.
Ich erwachte erst wieder, als feindliche Sanitäter mich von der Feldbahre zu Boden fallen ließen, weil sie mich für einen Toten hielten, für den jede weitere Plage unnütz sei. Ich kam neben einem Russen zu liegen mit aufgerissenem Bauch, woraus eine unglaubliche Masse von Gedärm quoll. Es stank so heftig, daß ich mich übergab, wobei mir das Bewusstsein ganz zurückkehrte.«
Der als Leiche abgekippte Maler hat wirre Gedanken, doch Gedanken immerhin. Und so befällt ihn, dass er ja seiner Mutter versprochen hat, bis zu einem bestimmten Datum zurück zu sein. Doch er hat die Zeitrechnung vergessen. Wie ging das? Er rechnet: eins, zwei, drei, vier, fünf …?
»Ich konnte nicht weiterrechnen, weil ich ein kleines, kreisrundes Loch im Schädel hatte. Sicher lebte ich noch, denn ich habe meiner Mutter einmal eine Schnur mit roten Glasperlen zum Aufheben gegeben, das konnte nur ich wissen. Was ist geschehen mit mir?«
Bei diesem Gedanken schreit der Schwerverwundete so laut auf, dass ihn selbst das Entsetzen ob seiner Lautstärke packt. Leider hört ihn nun auch ein russischer Soldat:
»Darauf kam der Mörder lautlos angeschlichen. Mit aufgerissenen Augen sah ich den Mann aus dem Volke, vielmehr bloß seinen Blick unter dem Stahlhelm, der mir den Gnadenstoß versetzen wird. Befehl ist Befehl! Er setzte bereits die Spitze seines im Mondlicht glänzenden Bajonetts mir an die Brust. Meine rechte Hand belebte sich, in der ich den Revolver fühlte, der mit einer Koppel am Handgelenk festgemacht war. Der Revolver mochte wohl direkt auf die Brust des Mannes zielen, der es nicht sehen konnte, weil er, gebeugt über mich, in seinem eigenen Schatten stand. So war meine rechte Hand also nicht gelähmt.
Ich versuchte, die Feder behutsam zu spannen. Er hatte das Schnappen des Hahns nicht gehört, auf welchen mein Finger preßte. Ich wußte, daß eine Kugel im Lauf war, nach der Vorschrift, die anderen vier noch im Magazin, denn ich hatte während des ganzen Krieges nie geschossen.
Indessen drang sein Bajonett durch die Jacke und ich begann zu schwitzen vor Angst. Ich werde schießen! Aber es war ja vor dem Tod, daß ich solche Angst hatte, denn sein Bajonett glitt erst noch immer durch den Stoff der Jacke, die es ja nicht fühlte. Schon eine Ewigkeit schien es mir, länger konnte ich es nicht aushalten. Ich muß der Marter ein Ende machen, denn ich bin ja selber bloß ein Mensch.«
Oskar Kokoschka, der ja nicht wegen großer Vaterlandsliebe in den Krieg gezogen war, sondern weil ihn eine geliebte Frau verschmäht hatte, schafft es nicht, abzudrücken. »Du darfst nicht töten!«, fällt ihm in der entscheidenden Sekunde ein, und so dringt das Bajonett in seinen Brustkorb ein:
»Im wütenden Schmerz krampften sich die Muskeln, spannten sich meine Rippen zum Bersten, so daß ich nicht mehr atmen konnte, denn jetzt schnitt das Messer durch die Haut und öffnete das Fleisch in meiner Brust. Schwächer und schwächer werdend wiederholte ich im Geiste: Aushalten! Einen einzigen Augenblick nur noch … da hörte der Schmerz von selber auf. Es war überstanden. Es wurde mir mit einem mal so leicht, es schleuderte mich ordentlich in die Höhe, ich schwebte in der Luft auf meinem Blutstrom, der mir aus Lungen, Mund, Nasenlöchern, Augen und Ohren sprang. So einfach ist sterben, daß ich ihm ins Gesicht lachen mußte, bevor meine Augen brachen.
Das Gewehr hatte er stecken lassen, es muß durch das eigene Gewicht umgefallen sein; sein war die Angst, so rannte er davon.«
Oskar Kokoschka ereilt ein Blutsturz. Doch den Bajonettstich überlebt er nur, weil er sich, als das Metall ins Fleisch stößt, zusammenrollt, sodass die Bajonettspitze lediglich die Herzhaut ritzt.
Er verliert das Bewusstsein. Später findet er sich in einem russischen Lazarett wieder, in der Nähe von Smolensk. Als Schwerverwundeter ist er in einer Abteilung der Baracke allein: Man hält ihn irrtümlich für einen höheren Offizier. Denn die Epauletten und gelben Abzeichen am Kragen sind so blutdurchtränkt, dass sie golden schimmern. Doch dem Maler geht es schlecht. Seine rechte Hand ist als Folge des Kopfschusses gelähmt, er kann nicht schreiben und versucht, sich Zeilen einzuprägen für ein Theaterstück, das er verfassen will. Später wird er in einem Bauernwagen hinter die österreichischen Linien zurücktransportiert, tage- und nächtelang geschüttelt über polnische Feldstraßen und Schotter.
Für Oskar Kokoschka ist der Krieg noch lange nicht vorbei: In Feldlazaretten in Brünn und Wien wird der Verwundete notdürftig behandelt, dann für ein Vierteljahr als »felduntauglich« erklärt. In dieser Krankenzeit in Wien lernt er Rainer Maria Rilke kennen, mit dem er sich mehrfach trifft. Und er verarbeitet seine gescheiterte Liebesbeziehung zu Alma Mahler. Dann wird er als Verbindungsoffizier an die Isonzo-Front abkommandiert, einem slowenisch-italienischen Kriegsschauplatz. Soll er den Krieg nun malen? Er hat es so satt. Mitte Juli 1916 schreibt er an Albert Ehrenstein nach Berlin:
»Am 14. Juli muß ich die gefürchtete Malerreise antreten, was mich sicher nach kurzer Zeit den Kopf kosten wird … Ich bin schon todmüde vom Leben und warte auf den Weltuntergang, wo sich für mich hoffentlich auch eine Erdspalte findet zum Ausruhen.«
An der Isonzo-Front malt und zeichnet er – umgepflügte Landschaften und Kriegerportraits. Als dicht neben ihm eine Granate explodiert, erleidet Kokoschka einen »Shellshock« und wird nach Wien in ein Militärlazarett transportiert. Es reicht ihm! Kaum einigermaßen genesen, fährt er auf Urlaub zu seinen Verbündeten und Kunstmäzenen nach Berlin – zu Paul Cassirer, Herwarth Walden und dem Verlag Fritz Gurlitt. Seine Malerei steht bereits hoch im Kurs. So kann er seinen Eltern im September 1916 schreiben:
»Positiv habe ich einen Vertrag unterschrieben, daß ich für 3 Jahre monatlich eine fixe Rente von 2.000 Mk bekomme, dafür 10 Zeichnungen monatlich, jährlich 12 Ölbilder zu liefern habe.«
Kokoschka sieht eine Chance, sich in Dresden als Kunstprofessor zu bewerben. So fährt der noch stark unter seinen Verwundungen leidende österreichische Maler im Herbst in die sächsische Hauptstadt, quartiert sich aber zunächst in ein Sanatorium in Dresden-Weißer Hirsch ein, das zugleich als Lazarett dient. Er muss seiner Wiedereinberufung zuvor kommen! Die Ärzte beschützen ihn, so lange es geht.
***
Das opferreiche Abschlachten und nun auch noch der Giftgaskrieg lassen so manchen Frontkämpfer mit dem Gedanken spielen, sich bei den Fliegern zu melden. Die Vorstellung vom übersichtlichen, ehrenhaften Kampf auf Leben und Tod, »Mann gegen Mann«, gar der Verbindung von moderner Maschine mit »ritterlichem Ideal« motiviert. Der aus Schlesien stammende Leutnant der Reserve Walter Wackwitz schreibt seiner Frau am 18. Juli 1917:
»Nach dem Schlamm und Dreck im Trichterfeld wie Nov. bis Dez. 1916 habe ich kein Verlangen, auch nicht danach, im anonymen Trommelfeuer den ›Tod fürs Vaterland‹, ›auf dem Feld der Ehre‹ zu sterben. Daß ich wieder an die Front komme, ist klar; dort braucht man schon jetzt jeden ›Krüppel‹ und ›krummen Hund‹. Muß ich fallen, dann in einem ehrlichen, offenen, ritterlichen Kampf gegen einen sichtbaren Gegner, Mann gegen Mann; das wäre die Fliegerei. Werde ich abgeschossen, nun ja; aber es ist ein anständiger Kampf.«
Auch Leutnant Ernst Jünger strebt nun zwischen blutigen Schlachten die Fliegerei an: »In der Luftwaffe kann man ja zeigen, was Kaltblütigkeit ist, und braucht nicht die Kastanien für andere Leute aus dem Feuer zu holen«, notiert er am 12.8.1917 in sein Kriegstagebuch. Ernst Jünger aber bleibt am Boden – er meldet sich zweimal hoffnungsvoll bei den Fliegern und wird zweimal abgewiesen.
Entspricht die Vorstellung vom ritterlichen Mann gegen Mann in der Lufthoheit der Realität? Max Immelmann, Kgl. Sächs. Fliegerleutnant, sieht das nüchterner. Seiner Mutter schreibt der 24-jährige bisherige Maschinenbaustudent an der TH Dresden, der sich von Kriegsbeginn an freiwillig zur Fliegerei meldete, im November 1914 nach Dresden:
»Ich weiß genau, daß Du mit meinem Schritt nicht einverstanden bist, daß ich nicht in Deinem Sinne gehandelt habe, wenn ich für ein wenig gefahrvolles Leben ein Leben voller Gefahren gewählt habe …«
1915 erhält Leutnant Immelmann sein Flugzeugführer-Patent. Er ist bald hoch geachtet aufgrund seines flugtechnischen Verständnisses und seiner Bescheidenheit. Max Immelmann wird als einer der ersten Jagdflieger des Fokker-Eindecker mit synchronisiertem Maschinengewehr eingesetzt. Obwohl er in seinen Briefen der Mutter immer wieder von beängstigenden technischen Schwierigkeiten während der Flüge berichtet, zeigt er eine hohe Fertigkeit an seiner Fokker und wird bald bei Freund und Feind der »Adler von Lille« genannt. Denn der Dresdner gilt als Erfinder des »Immelmann-Turns« – eines Flugmanövers, bei dem der Pilot nach einem Angriff die Maschine nach oben reißt und so mit einer vertikalen Drehung erneut angreifen kann. Der 26-Jährige erhält 1916 für seine acht Luftsiege zwei der höchsten militärischen Orden, darunter den »Ritter des Ordens Pour le Mérite«.
Doch die Tage des jungen Dresdner Fliegers sind gezählt: Am Abend des 18.Juni 1916 startete der nach seinem 15. Luftsieg zum Oberleutnant beförderte Max Immelmann zu seinem letzten Flug. Während eines Luftkampfes stürzt sein Flugzeug aus 2000 Metern in die Tiefe und zerschellt bei Sallaumines in Frankreich auf dem Boden. Nur aufgrund der Monogramme auf seiner Wäsche lässt sich der junge Dresdner Flieger noch identifizieren. Sein Tod löst Fassungslosigkeit aus, bei Freund und Feind – was ist passiert? Deutsche Militärs und Ingenieure gehen später von einem technischen Defekt aus, durch den Immelmann mit seinem Maschinengewehr den Propeller seiner Fokker zerschoss und es daher zum Absturz kam.
Britische Flieger werfen nach der Todesnachricht auf der deutschen Frontlinie einen Kranz mit der Nachricht ab:
»Wir sind herübergekommen, um diesen Kranz abzuwerfen als ein Zeichen der Achtung, die das Britische Flying Corps für Leutnant Immelmann empfindet. Wir betrachten es als eine Ehre, für diese besondere Aufgabe ausgewählt worden zu sein. Leutnant Immelmann war bei allen britischen Fliegern hoch geachtet. Einer wie alle stimmen darüber überein, daß er ein wirklicher Sportsmann war.«
Die Einäscherung des Fliegers Max Immelmann auf dem Tolkewitzer Johannisfriedhof in Dresden am 25. Juni 1916 wird zu einem der größten deutschen Medienereignisse des Krieges. Über dem Krematorium kreisen ein Zeppelin und mehrere Flieger. Zu den Tausenden Gästen des Begräbnisses gehört ein Vertreter des Kaisers, gehören Generaladjutant Ludwig Freiherr von Müller als Vertreter des sächsischen Königs sowie der Kriegsminister Viktor von Wilsdorf, Oberst von Koppenfels und Major von der Gabelentz-Linsingen. Für das Generalkommando des XII. Armeekorps ist General von Broizem anwesend und Maximilian von Laffert, General der Sächsischen Kavallerie. Von ziviler Seite nimmt Dresdens Oberbürgermeister Bernhard Blüher teil, für das sächsische Gesamtministerium Kultusminister Heinrich Gustav Beck sowie der Rektor der Technischen Hochschule Prof. Cornelius Gurlitt. Man rauft sich zusammen, eine Siegeseuphorie will nicht mehr aufkommen.
***
1917 ist auf ganzer Fläche die Lust am Krieg ebenso abgeflaut wie die Überzeugung, man könne aus dem Gemetzel als Sieger hervorgehen. Im Spätherbst 1917 wird Otto Griebel als Genesender zur Bewachung französischer Kriegsgefangener abkommandiert. Doch inzwischen ist auch sein Feindbild ins Wanken geraten:
»Unser Lager befand sich in einem armseligen französischen Dorf unweit Rethel. Meine Aufgabe bestand darin, mit den Gefangenen zur Arbeit zu gehen, wobei uns vom Kommandanten nahe gelegt wurde, das Tun der Leute auf das schärfste zu beobachten, da Sabotagehandlungen vorgekommen seien.
Zu meinem Arbeitstrupp gehörten außer dem Hauptteil weißer Franzosen auch einige hünenhafte Neger vom Senegal-Regiment Nummer fünf, darunter ein wahrer Riese mit einem gutmütigen Gesicht, den wir ›Jumbo‹ nannten.
Eines Nachmittags nun mußte Munition ausgeladen werden, die von den Wagen des langen Güterzuges über eine hölzerne Brücke hinweg zum nahen Pionierpark zu schaffen war. Keine leichte Arbeit, denn die langen Geschoßkörbe enthielten Zweizentnerminen, unter deren Last die meisten Gefangenen stöhnten und schwankten. Den Schwarzen allerdings schien diese Last nicht viel auszumachen. Sie schleppten die schweren Körbe ruhig und ohne abzusetzen an mir vorüber. Als ich beobachtete, daß ›Jumbo‹ den Schwächlichen unter seinen weißen Kameraden mehrere Male zu Hilfe kam, um ihnen den drückenden Geschoßkorb abzunehmen und an den befohlenen Ort zu bringen, steckte ich dem gutmütigen Senegalesen heimlich eine Zigarre zu, die dieser dankbar grinsend sofort zerbrach und als ›Schick‹ zu priemen begann.
Inzwischen fiel von dem Gefangenen einer nach dem anderen aus. Sie setzten sich erschöpft an den Wegrand und konnten nicht mehr, während die Schwarzen, allen voran ›Jumbo‹, die restliche Arbeit geduldig weiter verrichteten. Endlich aber war es geschafft.
›Jumbo‹ lud sich die letzte Zweizentnermine auf die Schulter, und ich folgte ihm, um drüben zu melden, daß alle Munition ausgeladen sei. Auf der Brücke, die über einen sumpfigen Bachgrund führte, holte ich den Schwarzen ein. Als er mich neben sich bemerkte, blieb er stehen. Seine Schulter tat einen Ruck und die Mine rutschte von ihr über das Brückengeländer in den aufglucksenden Sumpf. ›Jumbos‹ Augen schauten mich strahlend an, ohne Angst und ohne Bösartigkeit. Und er sagte ein einziges Wort von den wenigen, die er überhaupt in unserer Sprache zu sprechen vermochte: ›Culture!‹«
Wird sich nach dem Kriegsende noch irgendjemand dafür interessieren, was für Bilder und Geschichten in den Überlebenden stecken?
Deutsches Lazarett an der Westfront
Während Otto Griebel, Otto Dix und Arnold Vieth von Golßenau 1917 noch an der Westfront kämpfen, ist Oskar Kokoschka zwar gesundheitlich angeschlagen, doch in Dr. H. Teuscher’s Sanatorium in Dresden-Weißer Hirsch ist er ziemlich sicher vor einem weiteren Militäreinzug. Der Maler leidet an Gleichgewichtsstörungen infolge seiner Verwundung. Das hindert ihn aber kaum am Malen und nicht an fruchtbaren Begegnungen mit Dresdner Künstlern.
Künstlerisch ist der Rekonvaleszent hochproduktiv. Inzwischen ist er in die »Felsenburg« eingezogen – ein kleines Hotelrestaurant in Oberloschwitz, nicht weit vom Sanatorium entfernt. Geleitet wird es von »Mutter Nachtwey«; es gilt als preisgünstige Künstlerherberge und Unterkunft der Sanatoriumspatienten. Hier trifft Kokoschka auf die Schauspieler Ernst Deutsch, Heinrich George und Käthe Richter. Und er wohnt hier zusammen mit dem Lyriker und Dramatiker Walter Hasenclever, den er schon in Wien traf und dessen anfängliche Kriegsbegeisterung sich ebenfalls ins Gegenteil verkehrt hat. Auch Hasenclever ist Sanatoriumspatient. Er gilt als unsteter Neurotiker und schafft es, 1917 aus dem Kriegsdienst entlassen zu werden. Doch die »Neurose« hat einen handfesten Grund, und der entlädt sich zwar mitten im Krieg, jedoch fern eines Kriegsschauplatzes: Im Oktober 1916 bringt der junge Dramatiker und Lyriker am Dresdner Albert-Theater sein Stück »Der Sohn« zur Aufführung – im Rahmen einer Matinée und vor geladenen Gästen. Immerhin löst er damit einen Tumult im Saale aus: Ein Teil der Zuschauer reagiert empört, ein zweiter Teil eher betroffen, der dritte ist begeistert. Gespielt wird die Hauptrolle vom jungen Prager Schauspieler Ernst Deutsch, einem Jugendfreund Franz Werfels. Diese Rolle macht Ernst berühmt, er gilt von nun an als der expressionistische Schauspieler par excellence. Der bei der Vorführung anwesende Lyriker und Erzähler Albert Ehrenstein aus Berlin nennt die Aufführung denn auch einen Theaterknall.
Bebte nun das ausgewählte Dresdner Publikum bei der Premiere, so sind Stück und Autor schon bald Gespräch unter den deutschen Theaterleuten von München über Frankfurt bis Berlin. Und als das altehrwürdige Hof- und Nationaltheater Mannheim im Frühjahr 1918 das Stück »Der Sohn« zur Aufführung bringt – nun schon in einer expressionistischen Inszenierung, mit kargen Bühnenbildern, um die seelische Deformierung der Figuren zu betonen, herrscht bereits eine revolutionäre Stimmung – nicht nur im Theatersaal. Denn der »Sohn« wird zur Identifikationsfigur einer ganzen Generation: Ein Vater-Sohn-Konflikt in einer als menschenverachtend gezeichneten patriarchalischen Welt, die bereits ein deutliches revolutionäres Fühlen freisetzt.
Oskar Kokoschka leidet unter Gleichgewichtsstörungen aufgrund seiner schweren Kriegsverwundung, er bleibt Patient im Sanatorium von Dr. Teuscher. Gleichzeitig malt er seine Mitbewohner und Freunde aus der »Felsenburg« – die Schauspieler Käthe Richter und Ernst Deutsch, Walter Hasenclever und den lungenkranken und geheimnisvollen Mediziner Dr. Fritz Neuberger, von dem gemunkelt wird, er habe mitgeholfen, Lenin durch Deutschland nach Schweden zu schleusen. Auf jeden Fall hat er dazu beigetragen, dass Walter Hasenclever endlich vom Militär freigestellt wird. In der »Felsenburg« bildet sich eine kleine Gruppe politisch und künstlerisch engagierter Pazifisten.
Wie so viele dem Tod Entronnene lebt auch Oskar Kokoschka in einer doppelten Welt – in einer, die gerade untergeht, und einer, die in ihm und um ihn herum entsteht. Wird er die noch mitgestalten können? Er malt und arbeitet an seinem Bühnenstück »Hiob«, das in einer Kombination mit zwei früheren Einaktern im Juni 1917 ebenfalls im Albert-Theater zur Premiere kommt, wieder mit den Stars des Theaters in der Hauptrolle: Käthe Richter und Ernst Deutsch.