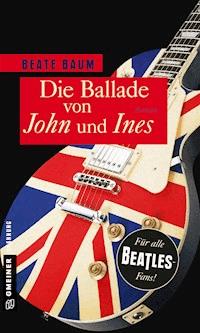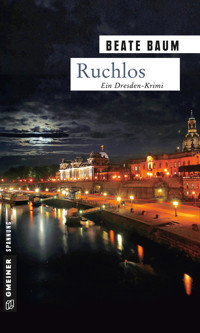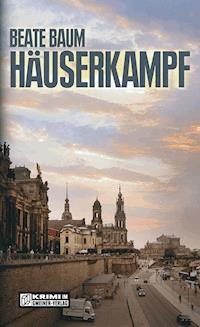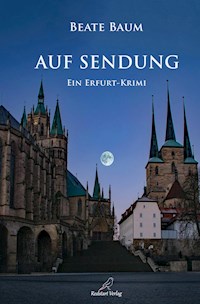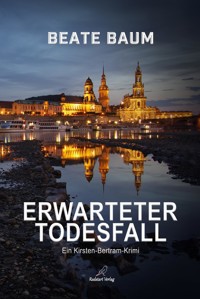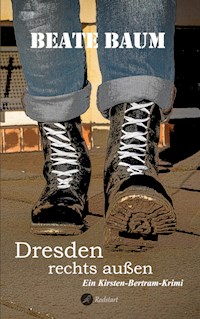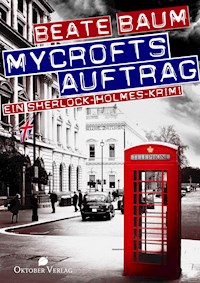4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Redstart Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kirsten Bertram ist geschockt, als sie ihren Ex-Freund, den Privatdetektiv Dale Ingram, bewusstlos auffindet. Sie gibt sie sich die Schuld an dem versuchten Suizid. Andreas Rönn, ihr neuer Freund, glaubt nicht an einen Selbstmord. Er beginnt zu recherchieren und findet heraus, dass Dales letzter Auftraggeber durch eine Überdosis jener Schlaftabletten ums Leben gekommen ist, die auch der Privatdetektiv im Magen hatte. Die beiden Journalisten durchleuchten die Machenschaften von Geschäftsleute und Altersheimbetreibern. Und geraten dabei selbst in Gefahr. Dresdner Geschäfte erschien erstmals 2005 als Aufbau-Taschenbuch. »Beate Baum beherrscht jenen lakonischen Stil, der gute Krimis auszeichnet«, befand Tomas Gärtner in den Dresdner Neuesten Nachrichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Beate Baum
Dresdner Geschäfte
Ein Kirsten-Bertram-Krimi
Journalistin Kirsten Bertram hat den Privatdetektiv Dale Ingram verlassen und ist mit ihrem Kollegen Andreas Rönn zusammengezogen. Dann findet sie ihren Ex ohnmächtig in seinem Büro. Wollte er sich umbringen?Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorwort
»Dresdner Geschäfte«: Diese Episode der Kirsten-Bertram-Reihe ist die bislang erfolgreichste. 2005 als Aufbau-Taschenbuch herausgekommen, 2011 vom Leipziger fhl Verlag neu aufgelegt, gab es bereits zwei Ebook-Ausgaben, bevor nun die digitale ebenso wie die Print-Version unter meinem eigenen Redstart-Label erhältlich sind. Sehr schnell nach Erscheinen wurde der Roman auch als Hörbuch produziert. Das erfuhr ebenfalls bereits eine Neuauflage durch den Saga Egmont Verlag. Damit nicht genug, existiert mit »Afaceri La Dresden« eine rumänische Ausgabe.
Ich selbst habe lange Zeit mit diesem Buch und seinem Erfolg ein wenig gefremdelt. So vieles würde ich heute ganz und gar anders schreiben. Immerhin geht es um eine menschliche Extremsituation: zu denken, man sei Schuld daran, dass ein Mensch aus dem Leben treten wollte. Meinem eigenen Gefühl nach hatte ich das nicht wirklich schriftstellerisch bewältigt.
Dennoch gehört auch dieser Roman zu meinem Oeuvre und sollte deshalb in meinen Augen auch dauerhaft erhältlich sein. Eine Überarbeitung war für mich ausgeschlossen – dann wäre es schließlich nicht mehr das gleiche Buch. Und beim Durchgehen des Textes bemerkte ich dann, was wohl so vielen an »Dresdner Geschäfte« gefällt, warum auch ein Kritiker schrieb, ich würde den »lakonischen Stil, der gute Krimis ausmacht«, beherrschen: Der Text bewegt sich so nah am gesprochenen Deutsch wie nur möglich. Ich denke – so seltsam es ist, das eigene Schreiben zu analysieren und zu bewerten – dadurch erhält der Krimi eine große Unmittelbarkeit.
Vielleicht liege ich damit aber auch falsch. Weniges ist so schwierig, wie das eigene Schreiben einzuschätzen. In jedem Fall freue ich mich, falls Sie die Lektüre genießen. Lassen Sie es mich gern wissen – auch, wenn das nicht der Fall sein sollte.
Dresden, Oktober 2022, Beate Baum
1. Kapitel
Ich schaute noch einmal auf meine Armbanduhr. Viertel nach acht durch. Verärgert trank ich einen Schluck Bier. Das sah Dale nicht ähnlich. Er war immer pünktlich gewesen. Und er wusste, dass ich es hasste, allein in einer Kneipe – selbst in einem Café wie dem »Lloyds« – zu warten.
Entschlossen klappte ich die Speisekarte zu, ging in den Nachbarraum an die Theke und fragte, ob ich telefonieren könne. Zehnmal ließ ich es klingeln, dann legte ich auf und bezahlte mein Bier.
Die Luft draußen war wunderbar mild für einen Dresdner Abend Anfang April. Auf dem Martin Luther-Platz saßen bereits einige Jugendliche in der Dämmerung und lebten ihre Frühlingsgefühle aus, vor dem »Raskolnikoff« standen etliche Fahrräder.
Ich ging die Böhmische Straße entlang, vorbei an meiner neuen Bleibe, erreichte über die lebhafte Alaunstraße den Albertplatz. Den Schlüssel zu Dales Haus hatte ich dabei, ich wollte ihn fragen, ob ich ihn bereits heute zurückgeben sollte oder erst, nachdem ich meine Sachen abgeholt hatte. Dennoch zögerte ich nun, als ich vor dem Gartentor angekommen war. Die Bäume und die Wiese sahen friedlich aus, das alte Gebäude wirkte verlassen.
Als ich vor der Haustür stand, sah ich durch die hölzernen Fensterläden vor Dales Büro einen Lichtschimmer. Auf mein Klingeln rührte sich jedoch nichts, also steckte ich schließlich doch den Schlüssel ins Schloss. Es war nicht abgeschlossen. Auf einmal beschlich mich ein mulmiges Gefühl. Ich atmete tief durch und schob mich leise in den Flur. Ohne das Licht anzuknipsen, blieb ich einen Moment stehen, starrte in die Dunkelheit und horchte. Dann öffnete ich die Tür zum Büro.
Er saß vornüber gesunken an seinem Schreibtisch, eine Hand hing an der Rückwand herunter. Der auf der Seite liegende Kopf wurde von der Halogenlampe scharf beleuchtet. Die schwarzen Haare sahen feucht aus, die Augen waren geschlossen, der Mund stand leicht offen. Der linke Arm lag angewinkelt neben einem Glas mit etwas trüber Flüssigkeit.
Einen Moment lang konnte ich mich nicht rühren. Dann stürzte ich nach vorn und strich ihm über die Wange.
»Dale! Dale, was ist denn, was ist los?« Gehörte diese hysterische Stimme mir? Ich versuchte, seinen Puls zu tasten, spürte jedoch nichts. Während ich mit den Tränen kämpfte, rief ich den Rettungsdienst an. Neben dem Aschenbecher sah ich erst jetzt ein Tablettenröhrchen.
»Luminaletten« buchstabierte ich der professionell ruhigen Stimme am anderen Ende der Leitung.
*
»Costa Bananen« stand auf dem großen Karton, den ich nun schon seit fast einer Stunde anstarrte. Die Schwestern der Intensiv-Station hatten mich nach Hause geschickt, nachdem ich sie immer und immer wieder gefragt hatte, ob Dale durchkäme. Sie wüssten es nicht, lautete die stets gleiche Antwort. Sie hätten seinen Magen mehrfach gespült, ein Gegengift gespritzt und versuchten nun, Atmung und Kreislauf zu stabilisieren.
»Morgen früh wissen wir schon mehr. Gehen sie doch heim. Sie können hier doch nichts tun.« Noch nicht einmal zu ihm gelassen hatten sie mich – und ich fühlte mich kaum in der Position, darum zu kämpfen. »Sind Sie seine Frau? Verwandt?«
Nein, ich war seine Ex-Freundin, und ich war der Grund für die Tabletten. Das hatte ich auch den Kripobeamten gesagt, die bereits kurz nach unserer Ankunft in der Uni-Klinik erschienen. Die Schutzpolizisten, die eine Sekunde nach dem Notarztwagen in der Antonstraße eingetroffen waren, hatten sie nach einem kurzen Blick auf die Szenerie benachrichtigt.
Vier Jahre waren Dale und ich befreundet gewesen, fast ein Jahr hatten wir zusammen gelebt. Ich hatte ihn verlassen, nachdem Andreas in Dresden aufgetaucht war. Andreas, mit dem ich jetzt diese drei Zimmer in der Böhmischen Straße mitten im Szeneviertel Neustadt bewohnte, der noch mit einem alten Freund unterwegs war, und wegen dem ich mich in das noch nicht eingerichtete Wohnzimmer inmitten der Umzugskartons auf den Boden gesetzt hatte.
Vor zwei Tagen erst waren wir in die restaurierte Altbau-Wohnung eingezogen, er mit seinem gesamten Hausrat, ich vorerst mit den zwei Reisetaschen, aus denen ich seit drei Wochen lebte. Voller Elan hatten wir uns ans Einrichten gemacht. Schließlich war es das erste Mal, dass wir zusammen wohnten, und es sollte perfekt werden.
Zwischen meinen Füßen stand ein Wasserglas und eine Flasche Rum, die ich aus einem der Kartons gezogen hatte. Fast ein ganzes voll hatte ich bereits getrunken, nun endlich begannen die Tränen zu fließen. Verschwommen blickte ich durch das große Fenster auf den vollmondhellen Himmel, versuchte, die Gedanken abzustellen und unterdrückte mein Schluchzen, als ich die Wohnungstür hörte. Ich wollte Andy jetzt nicht sehen. Er ging in die Küche, ich hörte, wie er eine Flasche Mineralwasser aus dem Kasten zog und ins Schlafzimmer mitnahm.
Erst, als ich sicher sein konnte, dass er schon schlief, lange nachdem die Glocken der Martin-Luther-Kirche Mitternacht geschlagen hatten, wankte ich betrunken und völlig erledigt nach nebenan, zog mich im Dunkeln aus, legte mich neben Andreas und starrte zur Decke.
*
»Nein, wir können immer noch nichts sagen.« Der dunkelhaarige Arzt sah zu jung aus, um etwas über Leben und Tod zu wissen. »Herr Ingram spricht nicht auf das Gegengift an.«
Wir standen auf dem Flur vor der Intensiv-Station. Ich war nach wenigen Stunden unruhigen Schlafs um sieben Uhr wieder aufgestanden und ohne zu frühstücken direkt ins Krankenhaus gefahren. Nun kämpfte ich gegen Übelkeit, meine Beine wollten wegsacken, ich schwitzte. Der Arzt fasste mich am Arm.
»Kommen Sie! Der Automaten-Kaffee hier ist erstaunlich gut.«
Ohne mich zu fragen, zog er nach den beiden Bechern noch einen Schokoriegel und drückte ihn mir in die Hand. Ich hatte meinen alten Anorak ausgezogen und mich auf einen der scheußlichen orangefarbenen Stühle gesetzt. Vorsichtig trank ich einen Schluck Kaffee, riss dann die Verpackung des Riegels auf und biss ein großes Stück ab.
»Und was heißt das jetzt?« fragte ich.
Er schob die linke Hand in die Tasche seines Kittels, zog sie leer wieder heraus: »Herr Ingram ist noch immer im Koma. Die Nieren- und Leberwerte sind sehr bedenklich.« Abrupt brach er ab, setzte dann neu an: »Sie haben ihn gefunden, nicht wahr?«
Ich konnte bloß nicken, erwartete die Anklage.
»So etwas ist immer fürchterlich. Aber sie haben sehr umsichtig gehandelt. Ich bin sicher, dass er früh genug hier war, und dass wir ihn durchkriegen. Eigentlich muss das Gegengift in den nächsten Stunden wirken. Warum gehen Sie nicht nach Hause und ruhen sich etwas aus? Ich rufe Sie an, sobald sich etwas an seinem Zustand verändert.«
*
Ich ging nicht nach Hause, sondern lief die Fetscherstraße hinunter in Richtung Elbe. Die Uferwiesen waren hier schier endlos. Durch viele matschige Stellen stolperte ich über den Radweg hinaus bis ans Wasser. Auf der anderen Seite sah man die drei prachtvollen Schlösser. Ich nahm sie kaum wahr. Auch den Regen, der irgendwann einsetzte, registrierte ich erst, als ich meine nassen Haare aus der Stirn strich. Es war kälter als gestern.
Ein altes Paar führte unbeeindruckt vom Wetter seinen Cockerspaniel aus. Der Hund tobte fröhlich herum, die beiden sahen glücklich aus. Ich stand so lange am Fluss, bis ich völlig durchnässt war. Dann zwang ich mich, in Richtung Innenstadt zurückzugehen. Ich blieb an der Elbe, blickte auf das schmutzig aussehende Wasser und überlegte, wie tief es wohl war. Hinter der Carolabrücke ließ ich mich mit den Touristen zwischen Albertinum und Frauenkirche in Richtung Schloss treiben, setzte mich schließlich erschöpft in eines der Restaurants mit den bunten, dreisprachigen Speisekarten und bestellte einen Kakao mit Weinbrand und eine Bratwurst, die ich dann unberührt liegen ließ.
Es war früher Nachmittag, als ich in die Böhmische Straße zurückkehrte. Ich ging sofort ins Arbeitszimmer, um den Anrufbeantworter zu überprüfen. Kaum hatte ich einen Blick darauf geworfen, als Andreas auch schon im Türrahmen stand, in einer fleckigen Jeans und einem langärmeligen, ehemals weißen Opa-Unterhemd, mit einer Zange in der Hand.
»Hat jemand angerufen?« fragte ich, bevor er etwas sagen konnte.
»Allerdings. Deine Chefin wollte wissen, wo du bleibst. Was ist denn los? Du siehst ja fürchterlich aus.«
Ich schob mich an ihm vorbei in die Küche, setzte einen Kessel mit Wasser auf.
»Dale hat versucht, sich umzubringen.«
»Was?! Aber …« Er machte einen Schritt auf mich zu, ich hob die Arme, trat zurück. Bis der Kessel zu pfeifen begann, rührten wir uns beide nicht. Ich stellte das Gas ab und griff über die Spüle nach oben, dahin, wo Dale und ich im Haus in der Antonstraße die Teebeutel aufbewahrt hatten. Ich fasste ins Leere und bekam einen Weinkrampf.
Andy strich mir leicht über den Rücken. Als er mich in den Arm nehmen wollte, stieß ich ihn weg. Ich setzte mich auf einen Küchenstuhl und zog die Beine hoch. Andreas ging zu zwei unter dem Fenster stehenden Kartons, öffnete den oberen und kramte eine Weile herum, bis er eine Packung Tee in der Hand hielt. Fragend blickte er mich an, ich nickte, und er brühte ihn in einem großen Becher auf. Ich erhob mich noch einmal und holte die Flasche Rum aus dem Wohnzimmer, gab einen großen Schluck hinein.
*
Als ich erwachte, schien wieder die Sonne. Von der anderen Seite des Flurs hörte ich Andys Stimme am Telefon. Elektrisiert sprang ich auf und stürzte in Unterwäsche ins Arbeitszimmer.
»Das Krankenhaus?«
»Ja, aber ich habe angerufen. Nichts Neues.«
Wortlos drehte ich mich um und ging zurück ins Schlafzimmer, zog Jeans und Pulli über, setzte mich wieder in die Küche, goss etwas von dem noch dort stehenden Rum in den Becher.
»Kirsten, meinst du, es hilft Dale, wenn du jetzt ständig trinkst?« Andy wollte mir den Becher aus der Hand nehmen, ich hielt ihn jedoch fest.
»Ihm nicht, aber mir. Wie soll ich das denn sonst ertragen? Dir ist wohl nicht klar, dass er sich wegen mir umbringen wollte!«
»Zuerst habe ich das auch gedacht. Aber – »
»Was, aber? Kurz bevor wir definitiv die Gütertrennung klären wollen, schluckt er eine Packung Barbiturate – das ist doch wohl eindeutig!« Ich trank einen großen Schluck und setzte den Becher auf den Tisch, von wo Andy ihn zusammen mit der Flasche nahm und hinter sich auf die Spüle stellte.
»Glaubst du, Dale würde dir das antun? Er musste schließlich damit rechnen, dass du ihn findest – gerade weil ihr verabredet wart. Einen Abschiedsbrief gibt es auch nicht, oder?«
»Nein. Aber vielleicht wollte er mir gerade das antun! Was hab ich ihm denn angetan? Ich komme aus dem Urlaub und weiß immer noch nicht, mit wem ich zusammen sein will. Ich ziehe wieder bei ihm ein, aber kaum haben wir beide wieder Kontakt, ist alles aus und ich verlasse ihn endgültig!« Mir schossen die Tränen in die Augen. »Dann rufe ich ihn nach zwei Wochen an und will bloß klären, wer jetzt das Sofa behält und wer die Waschmaschine. Du – du kannst dir natürlich nicht vorstellen, dass ihm das so weh getan hat. Du bist ja zu so was nicht in der Lage.«
»Doch, das bin ich.« Andreas klang ruhig und überlegt. »Trotzdem glaube ich nicht, dass er riskiert hätte, dass du ihn findest.«
»Dann war es ein Hilfeschrei. So was gibt es doch ständig. Und jetzt hau ab! Lass mich alleine!« Ich stand auf und wollte den Rumbecher von der Spüle nehmen. Andy hielt jedoch meinen Arm fest.
»Nicht, so lange du so drauf bist. Für einen Hilfeschrei war die Dosis zu hoch. Und du sagst, es waren Barbiturate. Also starke Schlaftabletten.« Ich nickte. »Die sind doch bestimmt verschreibungspflichtig. Wo soll er die denn hergehabt haben?«
»Sie fallen sogar unters Betäubungsmittelgesetz.« Andreas hatte meinen Arm losgelassen, ich stand noch vor ihm, erschöpft jetzt. »Danach hat der Kommissar auch gefragt, aber ich habe ihm gesagt, dass Dale als Privatdetektiv garantiert irgendwen kennt, der ihm das besorgen konnte.«
Andy schüttelte den Kopf, schob mich mit sanfter Gewalt zurück zu dem Stuhl, schüttete den Rum aus, stellte die Flasche noch weiter nach hinten und bückte sich, um die auf dem Boden stehende Kaffeemaschine in Gang zu setzen.
»Während du schliefst, habe ich deine Chefin angerufen und gesagt, du wärst davon ausgegangen, dass du heute noch überstundenfrei hast. Du hättest dich gerade erst aus dem Baumarkt gemeldet«, erzählte er in lockerem Plauderton, während er Brot und Butter auf den Tisch stellte, Aufschnitt und Käse aus dem Kühlschrank holte. Er schob ein benutztes Holzbrett und ein Messer auf meine Seite des Tisches, schenkte uns beiden Kaffee ein.
»Woher weißt du, dass es kein Mordversuch war?«
*
Die Kripo hatte den Fall anscheinend bereits abgeschlossen. Die Haustür war nicht versiegelt, ich konnte ohne Probleme aufschließen. Als wir in den Flur traten, wurde mir auf einmal so übel, dass ich wieder in den Garten hinausstürzte und mich neben der alten Buche übergab. Andy tauchte neben mir auf und gab mir ein Papiertaschentuch.
»Sollen wir es lassen?«
Ich schüttelte den Kopf und ging voran, geradewegs in das Büro. Das Tablettenröhrchen hatten die Sanitäter mitgenommen, das Glas wahrscheinlich die Beamten der Mordkommission. Auch die Papiere, die Dale sonst immer ordentlich zu zwei Stapeln auf dem Schreibtisch geschichtet hatte, und der Terminkalender fehlten. Die Fläche des alten Nussbaumtisches war nun bis auf den Computer, eine Schreibunterlage und das Whiskeyglas, in dem er Stifte aufbewahrte, leer. Ansonsten sah der Raum aus wie immer: Ein Regal voller Aktenordner in Reih und Glied, ein weiteres mit Gesetzestexten, Lexika und sonstigen Nachschlagewerken. An der dem Fenster gegenüberliegenden Wand hing sein altes Laura Nyro-Poster – ein Plattencover-Motiv; hinter dem Schreibtisch ein Foto von mir, in Erfurt an einem Tag aufgenommen, an dem das Wetter wie heute zwischen Sonne und Regen schwankte, wodurch das Bild etwas Verschwommenes und Rätselhaftes bekam. Ich schluckte und blickte weg. Die Luft roch nach abgestandenem Qualm, Dales Zigaretten und Feuerzeug lagen noch auf dem Regal hinter dem Schreibtischstuhl. Andreas nahm die Schachtel in die Hand, öffnete sie und ließ die Zigaretten darin hin- und herrollen. Ich zog die unterste Schreibtischschublade auf. Im hinteren Teil des Fachs lag Dales »Smith & Wesson«, wie immer in dunkelblaues Samttuch eingeschlagen.
»Beschreib doch mal genau, wie es hier gestern Abend aussah.«
Ich konzentrierte mich und begann mit dem Besucherstuhl vor dem Schreibtisch und dem Sessel am Fenster, die in meiner Erinnerung genau dort gestanden hatten, wo sie immer standen, beschrieb dann den Schreibtisch mit dem Glas und dem Tablettenröhrchen, schließlich Dale selbst. Hier hakte Andreas nach:
»Wieso nasse Haare? Gestern hat es doch nicht geregnet.«
»Nass, feucht – so, als hätte er geduscht«, überlegte ich laut.
»Und? Meinst du, jemand duscht, bevor er sich umbringen will? Was hatte er an?«
Ich schloss die Augen, um das Bild entstehen zu lassen, verdrängte den auf der Tischplatte liegenden Kopf.
»Ein dunkelgrünes Leinenhemd und eine schwarze Jeans.«
»Also durchaus Sachen zum Weggehen.«
Ich nickte, mir wurde schon wieder übel.
»Zu dumm, dass der Terminkalender fehlt. Dann könnten wir sehen, ob er für nachmittags noch etwas eingetragen hatte.« Andy begann, im Raum herumzulaufen und in alle Ecken zu sehen, ich ging in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen.
Im Kühlschrank stand Grapefruit-Saft, den Dale häufig nach dem Joggen trank, und eine Flasche Mineralwasser, was mich wunderte, da er in der letzten Zeit, die wir zusammengelebt hatten, wegen Magenproblemen kein zu kaltes Wasser mehr getrunken hatte. Meist hatte er sogar die Saftflaschen auf dem Büfett stehen lassen. Aber das war jetzt über drei Wochen her, vielleicht hatte sich sein Magen ja wieder beruhigt. Ich goss mir ein Glas Wasser ein und trank mit kleinen Schlucken. Nein, schoss es mir durch den Kopf, jetzt im Moment ging es seinem Magen wahrscheinlich überhaupt nicht gut. Meine Hand zitterte und umklammerte das Glas so fest, dass sich die Fingerspitzen taub anfühlten.
Andy kam in die Küche und blickte mich an, nahm mir das Glas aus der Hand.
»Keine Angst, es war Wasser«, sagte ich.
»Ich will bloß nicht, dass du gleich die Scherben in der Hand hast.« Er öffnete die Spülmaschine, um es hineinzustellen.
Ich wollte gerade sagen, dass wir es mit der Hand spülen sollten, da wir nicht wussten, wann die Maschine jemals wieder in Betrieb genommen würde, als ich stutzte. In der oberen rechten Ecke standen ein anderes Glas und eine Kaffeetasse. In diesen Bereich kam jedoch aufgrund eines Defektes zu wenig Wasser, so dass wir dort nie etwas hingestellt hatten – und das schon seit Monaten.
»So etwas vergisst man doch nicht auf einmal«, murmelte ich, während ich die Tasse vorsichtig herausnahm. Ganz schwach waren offensichtlich abgewischte Lippenstiftspuren am oberen Rand erkennbar.
*
»Das ist nicht gerade viel.« Hauptkommissar Hantzsche war, seit ich vor fünf Monaten einmal mit ihm zu tun gehabt hatte, noch dicker geworden. Sein Kugelbauch stieß gegen die Schreibtischplatte, auch wenn er in einigermaßen entspanntem Abstand dazu saß. »Eine Mineralwasserflasche entgegen sonstigen Gepflogenheiten im Kühlschrank und zwei Teile an der falschen Stelle in der Spülmaschine. Herr Ingram hat die Spülmaschine aber schon noch benutzt – als quasi Alleinstehender?«
Ich nickte. »Den Oberkorb, ja.« Hantzsche bemühte sich, entgegenkommend zu sein, wollte helfen. Er hatte sich sofort die Akte von seinen Kollegen geholt, schien nun aber auch keine Notwendigkeit zu sehen, den Fall neu aufzunehmen.
Wie auch, ich zweifelte ja selbst daran. Am Vorabend hatte Andy mich überzeugt, dass es sich um einen Mordversuch handelte, er hatte mich soweit beruhigt, dass ich früh ins Bett gegangen war und sogar tief, fest und traumlos bis acht Uhr geschlafen hatte. Nun saßen wir gemeinsam hier, und ich merkte, wie die Verzweiflung wieder in mir hochstieg. Ich wollte aufstehen und weglaufen, nur fort von hier, von allem.
»Schauen Sie, die Kollegen haben keine verdächtigen Spuren gefunden, keinerlei Hinweis auf Fremdeinwirkung«, Hantzsche las den Bericht sehr aufmerksam. »Der Wirkstoff in Herrn Ingrams Magen entsprach dem der aufgefundenen Tabletten, und auf dem Röhrchen waren nur seine Fingerabdrücke. Es tut mir leid, aber es sieht alles danach aus, als habe Herr Ingram freiwillig die Tabletten geschluckt.«
Ich starrte die Schlieren auf der Fensterscheibe an. Andy legte mir die Hand auf den Oberschenkel.
»Und sein Terminkalender? War jemand bei ihm vorgestern Nachmittag?« fragte er.
Hantzsche schüttelte den Kopf: »Offensichtlich nicht. Der einzige Eintrag war die Verabredung mit Ihnen, Frau Bertram.«
Ich nickte mechanisch, schaute zu Andreas, wollte endlich gehen. Der fuhr sich jedoch noch einmal nachdenklich durch seine kurzen blonden Haare. »Können Sie uns denn dann die Unterlagen geben, die Ihre Kollegen mitgenommen haben, wenn Sie nichts mehr machen wollen?«
»Sie wollen sich wohl wieder eigenmächtig in die Polizeiarbeit einmischen?«
»Wenn der Fall für Sie abgeschlossen ist, ist es doch wohl keine Polizeiarbeit mehr, oder? Was würde denn sonst mit den Unterlagen passieren?«
Hantzsches Blick war fest: »Die bleiben noch eine Zeit lang hier. Und Sie lassen die Finger von der Geschichte. Gehen wir doch mal davon aus, dass wir Herrn Ingram in ein paar Tagen selbst fragen können, warum es zu solch einer Kurzschlusshandlung gekommen ist.«
»Oder wer ihm da übel mitgespielt hat«, sagte Andreas.
Ich schwieg.
*
Renate Markward, von der niemand wusste, wie sie es ohne jegliche journalistische Qualifikationen geschafft hatte, Chefin der Lokalredaktion Dresden zu werden, ließ es sich nicht nehmen, mir vorzuhalten, wie unzuverlässig mein gestriges Verhalten gewesen sei.
»Ich kann mir denken, wie enttäuscht Sie sind, dass Sie nach der Mutterschaftsvertretung nicht bleiben können, aber so geht es nicht! Von Rechts wegen könnte ich verlangen, dass Sie nun am Freitag noch arbeiten.«
Trotz meiner depressiven Stimmung unterdrückte ich nur mit Mühe ein Lächeln. Die Markward musste schockiert gewesen sein, als sie erfahren hatte, dass der Chefredakteur mir einen unbefristeten Vertrag angeboten – und ich abgelehnt hatte. Trotz ungewisser Aussichten wollte ich mir einen alten Traum erfüllen und mit Andreas zusammen frei arbeiten. Ab nächster Woche. Wie hatte ich mich darauf gefreut …
Renate Markward strich ihre untadelige blassgraue Kostüm-Jacke glatt: »Aber gut, nehmen Sie es als Abschiedsgeschenk: Wir verrechnen den Tag mit Ihren Überstunden. Heute widmen Sie sich dann bitte den Polizeistatistiken für das erste Quartal. Die Unterlagen liegen in der Ablage im Sekretariat.«
Eine kleine Rache musste also bei aller Gnade sein. Sie wusste, dass ich Statistiken hasste. Dennoch war ich heute sogar froh über die stupide Arbeit. Wenigstens zeitweise konnte ich so meinen Gedanken entkommen.
Geradezu widerstrebend beendete ich gegen sechs die Arbeit mit den letzten aktuellen Meldungen und machte mich auf den Weg, um Andreas am Haus in der Antonstraße zu treffen. Nach dem Besuch bei Hantzsche am Morgen hatte er mich überredet, noch einmal Dales Büro zu durchsuchen. Nun erschien mir diese Idee wieder idiotisch.
»Was sollen wir finden, was die Bullen übersehen haben?« fragte ich ihn. Beim Anblick des Schreibtisches wurde mir schon wieder heiß und kalt. »Dale wollte sich umbringen – und ich muss damit fertig werden, so einfach ist das. Und das würde ich wirklich lieber in einer anderen Umgebung versuchen.«
Andy hatte sich jedoch schon an den Computer gesetzt und ihn hochgefahren. Kurz darauf blickte er mich fragend an: »Passwort?« Er stand auf und überließ mir den Platz.
Ich mochte mich nicht auf den Schreibtischstuhl setzen, sondern blieb stehen und tippte »Margery«, den Vornamen von Dales toter Mutter, ein. Als der Rechner arbeitete, trat ich zur Seite.
Andreas klickte die zuletzt abgespeicherten Seiten an, fand jedoch lediglich eine Rechnung, eine Spesen-Aufstellung sowie einen Brief an einen Neffen des Vorbesitzers seines Hause, in dem Dale noch einmal ruhig darlegte, dass die Vererbung vor zweieinhalb Jahren rechtens gewesen sei.
»Dale arbeitet kaum am Rechner«, sagte ich. »Er hält sowieso wenig schriftlich fest, und wenn, dann per Hand. Erst, wenn er etwas abgeben muss, tippt er es.«
Andreas nickte ungläubig, die Reaktion eines Journalisten, der alles am Computer verfasste. Selbst der Liebesbrief zu meinem Geburtstag im Februar, der uns wieder zusammengeführt hatte, war getippt gewesen.
»Also werden seine aktuellen Notizen komplett bei der Kripo liegen«, überlegte er laut und blickte sich noch einmal in dem ordentlichen Büro um. »Oder?«
Ich starrte ihn einen Moment lang nachdenklich an, dann stand ich auf und ging in den Flur, kniete vor dem Pappkarton nieder, in dem wir immer das Altpapier gesammelt hatten. Seine »Sicherheitsablage« hatte Dale das einmal genannt, nachdem ich sie unwissend entsorgt hatte.
Ich holte nacheinander jede Zeitung, jede Zeitschrift, jedes Blatt Papier aus der Kiste. Gerade diese einzelnen Blätter schaute ich mir genau an, bis ich endlich, ziemlich genau in der Mitte des Stapels, auf einige zusammengeheftete, handbeschriebene Seiten stieß, die anscheinend nicht zur Entsorgung bestimmt waren. Andreas, der mir gefolgt war, blickte über meine Schulter, während ich las.
Die erste Seite hatte entfernte Ähnlichkeit mit den Statistiken, die ich heute Vormittag bearbeitet hatte. Hier ging es um Einbrüche in ganz Sachsen, wobei Dale das bestohlene Geschäft und die Stadt jeweils nur in Klammern hinter die gestohlene Ware geschrieben hatte. Das Ganze war auch nicht geografisch, sondern chronologisch geordnet. In seiner klaren Handschrift hatte er vierzehn Daten der vergangenen zwei Monate aufgelistet, dann folgten Aufstellungen der entwendeten Waren – unglaublich detailliert, dann erst kamen die bestohlenen Opfer.
Ich überlegte, ob die Dresdner Geschäfte auch in der Polizeistatistik aufgetaucht waren, konnte mich jedoch nicht erinnern. Warum hatte Dale hier einzeln Menge und Marken von Ringordnern und Lochern, Shampoo-Flaschen und Körperlotionen, von Katzenstreu-Säcken und Hundefutter-Dosen aufgelistet? Ratlos blickte ich darauf, als Andy nach den Blättern griff, die nun zuoberst in dem Karton lagen.
»Sieh mal hier!« Er hielt mir einige Werbezettel entgegen. Sie stammten ebenfalls aus ganz Sachsen und priesen Waren diverser Billigmärkte an. Dale hatte auf jedes Blatt ein Datum geschrieben. Ich überflog die Blätter, schüttelte dann den Kopf.
»Die tauchen in der Liste der Bestohlenen nicht auf.«
»Aber irgend einen Sinn muss es haben, dass er sie auch hier versteckt hat«, sagte Andy und legte die Zettel zur Seite. Sorgfältig sichteten wir den restlichen Kartoninhalt, fanden jedoch nichts mehr, was uns wichtig erschien. Schließlich beschlossen wir, die Unterlagen mitzunehmen und irgendwo eine Kleinigkeit zu essen.
*
Ich trank einen großen Schluck Whisky. Andy hatte darauf gedrängt, zum Inder zu gehen, obwohl das eine der teuersten Möglichkeiten war, in der Neustadt essen zu gehen. Er wollte nicht, dass ich Alkohol trank und setzte darauf, dass sich indisches Essen damit nicht vertrug. So hatte er für sich auch eine Mango-Lassi bestellt, ich hingegen hatte gleich den Whisky und ein Bier geordert. Er hatte Angst, dass ich abstürzte, das war mir klar, dabei spielte er aber eine Rolle, die Dale oft eingenommen hatte, womit ich nie klar gekommen war: die des Beschützers, desjenigen, der Entscheidungen für mich traf. Früher hatte es zwischen Andy und mir so etwas nie gegeben.
Ich blickte ihn über den Tisch hinweg an. Wenigstens sagte er jetzt nichts, sondern studierte aufmerksam die Speisekarte. Er sah so verdammt gut und gesund aus. Zwar schien er ständig leicht zuzunehmen, seine Wangenknochen aber waren noch immer so markant wie damals, vor fast zehn Jahren, als wir uns in der Redaktion des »Tageskurier« in Erfurt kennengelernt hatten; seine Augen, die mich jetzt über den Rand der Karte hinweg anschauten, hatten dieses intensive grüne Strahlen, das mich schon damals fasziniert hatte.
Ich wollte abstürzen. Ich wollte vergessen können, dass ich mit meiner Entscheidung für Andy so oder so an Dales Zustand schuld war. Hätten wir uns nicht getrennt, wäre ich schließlich dort gewesen – und, falls es ein Mordversuch gewesen war, hätte ich ihn viel früher gefunden und den Besucher möglicherweise gesehen.
Unfug, sagte eine rationale Stimme in mir. Du hättest genauso gut noch einen beruflichen Termin haben können, du hast in den seltensten Fällen Dales Klienten gesehen, da er sie immer direkt von der Tür in sein Büro geleitete. Und dennoch … Ich trank den Whiskey aus.
»Gar keine feste Nahrung für dich?« fragte Andreas.
Ich zuckte die Schultern. »Ich nehme eine Vorspeisen-Portion Tandoori, das reicht mir. Ich dachte, du wolltest auch mal wieder etwas weniger essen«, schob ich gehässig hinterher.
»Ja, eigentlich«, entgegnete er ruhig und winkte dem Kellner, der stilecht ein weißes Gewand und einen großen Turban trug, bestellte die Vorspeise für mich und eine große Portion Lamm im Tontopf mit einem Extra-Brot für sich. Dann breitete er Dales Papiere auf dem Tisch aus, holte einen Kuli aus der Innentasche seiner Kordjacke und fuhr damit über die Zettel. Abwesend betrachtete ich ihn, wie er die Blätter hin und her schob, die Augenbrauen zusammenzog, wobei eine tiefe senkrechte Falte über der Nasenwurzel entstand.
Ich war direkt nach meinem Volontariat im Ruhrgebiet nach Erfurt gekommen. Andreas, ein halbes Jahr jünger als ich und damals erst 26, hatte nicht nur studiert und volontiert, sondern auch bereits ein Jahr als Redakteur bei einer Berliner Zeitung gearbeitet. Er schien mir soviel erfahrener, gleichzeitig so lebendig und unternehmungslustig. Fast auf Anhieb verliebten wir uns ineinander. Dann lernte ich auf einem Termin Dale kennen …
»Ich hab’s! Natürlich!«
Da genau in diesem Moment der Kellner unser Essen brachte, hatte ich eine Minute Zeit, wieder in der Gegenwart anzukommen. Als die geheimnisvoll duftenden Teller und Schüsseln angerichtet waren, brach ich ein Stück von Andys Weißbrot ab, tunkte es in seine Soße, und fragte nach.
Er lächelte leicht, hielt mir dann Dales Aufstellung und die Flugblätter hin. »Es ist eigentlich ganz einfach. Vergleich mal die Daten: Hier wurden einem Schreibwarenhändler in Görlitz unter anderem zehn Kartons à fünfzig Leitz-Ordner gestohlen – und nur drei Tage später tauchen bei ›Gutes Günstig‹ in Pirna ›Marken-Ordner‹ im Angebot auf. Hier hat ein Meißner Drogerie-Markt 250 Flaschen Nivea-Shampoo eingebüßt – und in der nächsten Woche gibt es bei ›Mac Billig‹ hier in Dresden Kinder-Shampoo.« Er brach sich ebenfalls ein Stück Brot ab und fuhr damit in die Soße. »Ich bin nicht sofort drauf gekommen, weil die Termine nicht alle so nah beieinander liegen, und«, er nahm einen Bissen und fuhr mit vollem Mund fort, »die Billigläden selten die Marken angeben, aber das muss die Verbindung sein, die Dale gesehen hat.«
»Hmm«, ich spülte den Bissen Brot mit einem Schluck Bier hinunter. »Diese Billig-Märkte haben aber doch immer ungefähr das gleiche Sortiment. Schreibwaren und Drogerieartikel kannst du da doch eigentlich immer kriegen.«
»Na ja«, Andy widmete sich seinem Lamm, »vielleicht haben sie immer genug Nachschub. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Dale da einen Hehlerring ausgemacht hat.«
2. Kapitel
Er sah unglaublich schmal aus, wie er da in diesem weißen Krankenhaushemd im Bett lag. Schläuche, wohin ich guckte. Ich bemühte mich, unter dem blaugrünen Mundschutz flach zu atmen, den Desinfektionsgeruch zu ignorieren, von dem mir übel wurde. Seine Haut schimmerte noch immer leicht getönt, gesund, der Mund hingegen war fast farblos.
Damals, bei unserem ersten Treffen in Erfurt, hatte Dale sehr blass ausgesehen. Es war Ende November gewesen, kaltes Schmuddelwetter; und die bulgarische Gaststätte in einem heruntergekommenen Viertel der Domstadt wirkte nicht besonders anziehend. Hierhin bestellte Dale seine Klienten, da er nicht das Risiko eingehen wollte, sie in seine Wohnung einzuladen. Damals war er ziemlich vorsichtig gewesen …
Schon für mich war so kurz nach der so genannten Wende das ganze Leben im Osten Deutschlands fremd – für ihn, der erst vor einem halben Jahr Amerika verlassen hatte, war es ein komplett anderes Universum, das wenig mit dem zu tun hatte, was er auf der deutschsprachigen High-School gelernt hatte.
Mit ihm war es von Anfang an ganz anders gewesen als mit Andy. Da gab es keine sprühenden Funken, keine unwiderstehliche Anziehungskraft, dafür war da eine ganz andere Tiefe, eine Faszination, die seine Persönlichkeit auf mich ausübte. Ich wollte mehr über ihn erfahren – und hatte ja auch einen Grund dafür, redete ich mir ein, schließlich wollte ich ein Porträt über den ersten Privatdetektiv Erfurts schreiben.
Deshalb saßen wir damals über drei Stunden in dem Restaurant, »Mehana Trakia« hieß es, das wusste ich noch immer. Wir aßen und tranken wenig, rauchten viel, redeten noch mehr, und am nächsten Tag wusste ich nicht, wie ich Andreas begegnen sollte – obwohl überhaupt nichts passiert war …
Ich spürte, wie mir schon wieder das Schluchzen in der Kehle hochstieg, während ich neben Dales Bett saß und ins Leere starrte. Ich konnte mit der Situation noch schlechter umgehen, als ich gedacht hatte. Am Vorabend hatte Andreas mich irgendwann angeraunzt, ich solle mich nicht so in meinem Elend aalen, und vielleicht würde es mir helfen, wenn ich Dale einmal sehen würde. Schließlich würde er noch leben – auch wenn ich schon um ihn zu trauern schien.
Meinen Einwand, dass die Ärzte mich nicht zu ihm lassen würden, wies er zurück – und er hatte Recht. Doktor Lorenz, der freundliche junge Arzt von vorgestern, stimmte sofort zu, als ich ihm sagte, dass Dale keine Angehörigen mehr hatte – weder hier noch in den USA, und ich ihm noch immer sehr nahe stand.
Tatsache war, dass ich die ganze Zeit auch Angst vor diesem Moment gehabt hatte, und jetzt meine Hilflosigkeit noch stärker spürte. Das Gegengift hatte nicht gewirkt, der Arzt erschien ziemlich ratlos.
Ich zwang mich zu reden, da Dr. Lorenz gesagt hatte, es sei durchaus möglich, dass ein Komapatient alles mitbekäme. Ich sagte ihm, wie Leid es mir tue, wie sehr ich ihn doch noch immer lieben würde, auch wenn – hier wusste ich nicht weiter, und ich hörte fast seine Entgegnung »auch wenn du mal wieder nicht weißt, was du willst« – dass die Situation mich fertig machen, und ich ihm so gern helfen würde.
»Ich bin ziemlich verkatert heute, weil ich gedacht habe, es hilft mir zu vergessen, wenn ich mich betrinke, weißt du? Aber es wurde dann nur noch schlimmer dadurch. Und jetzt muss ich heute Nachmittag noch mit den Kollegen Sekt trinken. Auf meinen letzten Tag.«
Falls er irgendetwas mitbekam, zeigte er jedoch keine Regung. Die Augen waren fest geschlossen, nur einmal meinte ich, ein winziges Flattern der Lider zu sehen. Die Apparate rauschten und tickten, mein eigenes Herz schlug heftig und schnell; ich beugte mich noch einmal über ihn und sagte, wie sehr ich mir wünschte, alles ungeschehen machen zu können.
*
In der Redaktion hatte ich mich kaum mit einer Tasse Kaffee an meinen Schreibtisch gesetzt, als Andreas anrief und mir mitteilte, dass wir um zwölf Uhr einen Termin mit Ria Meyerhof, der Inhaberin von »Rias Schnäppchenmarkt« auf der Königsbrücker Straße, hätten.
»Wieso wir? Das kannst du doch auch alleine machen.«
»Bist du im Stress? Oder haben die Aspirin noch nicht gewirkt?« Während ich noch eine passende Antwort suchte, fragte er sehr viel sanfter: »Wie war es bei Dale?«
»Schrecklich«, sagte ich leise.
»Also komm. Dann wird dir ein kleiner Spaziergang und ein bisschen Detektivarbeit gut tun.«
Er holte mich um Viertel vor zwölf ab, und tatsächlich war ich froh, an die frische Luft zu kommen. Die Chefin war ganz begeistert gewesen, dass ich an meinem letzten Tag noch eine Geschichte machen wollte. Sogar zu einem »Lassen Sie es aber langsam angehen, Sie sehen ein bisschen blass aus«, hatte sie sich hinreißen lassen. Wahrscheinlich stimmte die Aussicht auf meinen Abschied sie milde.
»Glaub bloß nicht, dass es leicht war, den Termin zu bekommen.« Andy hatte mich in den Arm genommen und wir schlenderten in der warmen Frühlingssonne über den Albertplatz, wo zahlreiche Menschen auf Straßenbahnen warteten, Kinder sich an einem der großen runden Brunnen gegenseitig nass spritzten, und eine alte Frau kleine, bunte Wiesensträußchen verkaufte. Vögel zwitscherten in den Bäumen, und ich dachte auf einmal, dass doch noch alles gut werden konnte. »Bei ›Mac Billig‹ und ›Geizig & CO‹ war überhaupt nichts zu machen, und bei der guten Frau Meyerhof musste ich auch erst bitten und betteln und auf den Werbeeffekt hinweisen.«
»Als was hast du dich angekündigt?« Unter seiner offenen Jacke legte ich ihm den Arm um die Hüfte.
»Ganz real als freier Journalist. Ich hoffe, ich kann daraus auch was machen. Die Läden gibt es ja in allen Städten und so langsam muss ich nach dem Umzug mal wieder ans Geldverdienen kommen.«
Ich nickte. Andys bisherige Erfahrungen als Freiberufler ermutigten eigentlich kaum dazu, die Möglichkeit einer festen Anstellung in den Wind zu schießen.
Wenige Minuten später standen wir auch schon in »Rias Schnäppchenmarkt«, einem riesigen Laden, in dem ich selbst schon häufig Putzmittel und Duschlotion eingekauft hatte. Wir fragten an der Kasse nach Frau Meyerhof und wurden an eine Verkäuferin verwiesen, die uns in ein Hinterzimmer geleitete, das offensichtlich als Aufenthaltsraum für die Angestellten diente. Zwei Frauen saßen dort und blätterten in Zeitschriften, die Ältere aß ein belegtes Brötchen, die Jüngere Instant-Suppe aus einer Plastikschale.
»Guten Appetit«, wünschte ich.
Die Grauhaarige nickte freundlich, die andere blickte kaum von ihrer Lektüre auf. Da erschien Ria Meyerhof auch schon in der Tür zu ihrem Büro und bat uns hinein. Sie war knapp Fünfzig und wirkte sehr elegant in ihrem schlichten Hosenanzug und dem perfekten Make-up. Mit einer Handbewegung wies sie auf zwei Stühle vor ihrem Schreibtisch, der fast den gesamten Raum einnahm.
»Darf ich ihnen einen Kaffee anbieten?«
Als wir nickten, ging sie noch einmal in den Aufenthaltsraum und kehrte mit zwei Tassen zurück, schob Milch und Zucker auf unsere Seite des Tisches.
Nach einem Schluck Kaffee räusperte ich mich und sagte, dass mein Kollege ihr wohl schon am Telefon erklärt hätte, dass wir über das starke Aufkommen der Billig-Märkte schreiben würden.
»Wir bevorzugen den Ausdruck ›Discount-Shops‹«, begann Frau Meyerhof mit einem feinen Lächeln. »Die Erklärung ist ganz einfach – auch wenn immer wieder schlimme Gerüchte über uns in die Welt gesetzt werden: Wir bekommen Ladenlokale zu guten Konditionen, kaufen unsere Ware in großen Mengen günstig ein und haben wenig Unkosten. Das so eingesparte Geld können wir an unsere Kunden weitergeben.«
Ja, Tarif wird hier wohl keiner zahlen, dachte ich, fragte jedoch laut nach den Möglichkeiten, so große Läden wie ihren Markt günstig zu mieten.
»Sie werden doch wissen, dass es in Dresden einen Gebäudeüberschuss gibt. Als Gewerbetreibender ist man da in einer guten Verhandlungs-Situation.«
Das stimmte natürlich. Auch wir bezahlten für unsere Wohnung nur etwa achtzig Prozent dessen, was wir in anderen Städten ausgeben müssten.
»Die Unkosten halten Sie mit geringen Personalkosten niedrig?« fragte Andreas höflich.
Frau Meyerhof nickte: »Ja, ich beschäftige nur Aushilfen auf 325-Euro-Basis. Und viel Personal brauchen Sie in solch einem Shop nicht.«
»Gut, kommen wir zu der Ware. Woher beziehen Sie die?«
»Aus Lagerauflösungen, Transportschäden, Konkursmasse. Da gibt es viele gut eingespielte Wege.« Sie wirkte sehr sicher, trank gelassen einen Schluck Kaffee.
»Aber Sie haben doch in etwa immer das gleiche Sortiment«, hakte ich nach. »Wie können Sie das bewerkstelligen?«
»Es gibt da gut eingespielte Verbindungen, Zwischenhändler, die schon wissen, wer an welchen Waren Interesse hat, und die sich dann mit uns in Verbindung setzen.«
»Das ist ja spannend«, Andy richtete sich in seinem Stuhl auf. »Könnten Sie uns wohl einen solchen Zwischenhändler nennen, damit wir ihn auch für den Artikel befragen können?«
Ria Meyerhof blickte auf eine zierliche Armbanduhr: »Nicht ohne vorher zu fragen. Und jetzt, zur Mittagszeit, erreiche ich niemanden. Aber wenn Sie mir Ihre Karte da lassen, setze ich mich nächste Woche mit Ihnen in Verbindung.«
Andreas fragte, ob sie für ein Photo im Laden posieren würde und hoffte wohl, sie würde mich allein im Büro lassen. Daraus wurde jedoch nichts, sie machte deutlich, dass sie uns danach gleich loswerden wollte. So konnte ich mich bloß ein wenig im Geschäft umblicken, wo die beiden Frauen, deren Pause vorbei war, nun Regale auffüllten. Die Kartons, aus denen sie die Waren holten, waren die Originalverpackung.
»Das war ja wohl ziemlich durchsichtig – so ein Zwischenhändler hat doch auf jeden Fall ein Handy«, sagte ich, sobald wir wieder auf der Königsbrücker Straße standen.
»Und keine geregelten Arbeitszeiten«, ergänzte Andy.
*
»You know I can’t let you slide through my hands«, dröhnte es aus dem Wohnzimmer, als ich nach Hause kam. »Wild horses couldn’t drag me away.«
Andy trat aus dem Arbeitszimmer, in der Hand eine Flasche Bier. »Ich hab erst mal die Anlage aufgebaut. Dann ist das Rumschrauben nicht ganz so stupide. Ich habe sowieso schon richtigen Muskelkater.« Er massierte mit der linken Hand seinen rechten Oberarm. »Ich krieg kaum noch die Bierflasche hoch.«
Ich lachte: »Ein bisschen Training tut dir bestimmt ganz gut«, ging dann aber lieber in Deckung, als er sich einen Hammer griff. »Okay, jetzt übernehme ich das Schrauben.« Dann berichtete ich, dass ich am Nachmittag noch mit der Polizeipressesprecherin telefoniert hatte, in der Hoffnung, etwas über die Zwischenhändler zu erfahren, von denen Ria Meyerhof gesprochen hatte.
»Besonders ergiebig war das nicht. Sie hat mir bestätigt, dass es sich da durchaus um einen grauen Markt handeln kann – da die Polizei jedoch immer nur einem konkreten Verdacht nachgeht, und es den bislang wohl noch nicht gab, wissen sie auch nichts.«
Andreas gab ein nachdenkliches Geräusch von sich, kramte einige Schrauben und Dübel aus einer Kiste in der Küche, drückte sie mir in die Hand und bugsierte mich ins Arbeitszimmer, wo noch etliche Regale aufgebaut werden mussten.
Ich zog meinen Seidenpullover aus und ein altes Hemd von ihm, das über einem Stuhl hing, über, und begann zu arbeiten. Er ging ins Wohnzimmer, wo die Musik verstummt war. Anscheinend hatte er seine ganzen alten »Stones«-Platten aus einem Umzugskarton gezaubert, denn kurz darauf erklang »Rocks Off«. Mit Dales Aufzeichnungen in der Hand kehrte er zu mir zurück.
»Falls ich Recht habe, und diese Geschichte etwas mit dem Anschlag auf Dale zu tun hat«, vorsichtig blickte er mich an, als ob er erwartete, dass allein die Nennung des Namens mich wieder ins Bodenlose fallen lassen würde. Ich nickte nur. »Dann muss da auf jeden Fall mehr dahinter stecken. Dale hat ja auch die Diebstähle und die Discount-Märkte aus ganz Sachsen hier aufgelistet.«
Ich nickte wieder und setzte den Akkuschrauber an. Die leichte Sektlaune, in der ich nach Hause gekommen war, verflog allmählich, und die dunkle Stimmung lauerte wieder im Hinterkopf. Was für einen Sinn sollte es haben, Dales Fall nachzugehen, wenn er sich umbringen wollte?
»Kennst du die bestohlenen Geschäfte hier in Dresden eigentlich? Also, wie sie gelegen sind, wo sie Lagerräume haben?«
Als er begann, die Namen vorzulesen, hielt ich inne:
»Warte mal, die gehören doch alle zu diesem relativ neuen ›Cityring‹.«
*
Frauke Pistorek hatte einmal mehr kostenlose Werbung verfasst. Ihr Artikel über die erste Versammlung des ›Cityrings‹ vor sechs Monaten beschrieb eingehend die Leistungen der Altstadt-Einzelhändler sowie ihre Sorgen und Probleme, zu denen auch die Billig-Märkte gehörten.
Wir saßen an dem Schreibtisch in der Redaktion, den ich bis vor wenigen Stunden »meinen« genannt hatte, vor uns auf dem Schirm der Archiv-Text. Zum Glück hatte ich heute Nachmittag, als ich nach dem Sektumtrunk den Generalschlüssel zurückgeben wollte, in der Verwaltung niemanden mehr angetroffen. Mein Magen knurrte. Nachdem mir der Zusammenhang aufgefallen war, waren wir sofort losgelaufen, nun war es schon gleich halb neun, und ich hatte, abgesehen von einem belegten Brötchen nach unserem Besuch bei Ria Meyerhof, den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich schickte den Artikel auf den Drucker.
»Da, hast du das gesehen?« Andy tippte auf den Monitor: »›Um Fixkosten einzusparen, unterhält der Cityring ein gemeinsames Zwischenlager an der Breitscheidstraße.‹ Das erklärt natürlich einiges. Weißt du, wo das ist?«
*
»Dale würde sich vermutlich da nächtelang auf die Lauer legen, oder?« fragte Andy.
Wir saßen in dem großen, gutbürgerlichen Restaurant »An der Rennbahn«. Hier draußen hatte Dresden nichts Barockes oder Gründerzeitliches, es dominierten nichtssagende, nach dem Krieg erbaute Häuser. Das Restaurant allerdings war ein schöner alter Bau mit einem bereits jetzt, obwohl die Zweige noch kahl waren, herrlich anzusehenden Lindengarten vor dem Eingang. Hinter dem Gelände der Rennbahn begann rechter Hand das Gewerbegebiet Breitscheidstraße, wo wir jedoch im Dunkeln absolut nichts hatten erkennen können. Da mir mittlerweile schlecht vor Hunger gewesen war, hatte ich Andys alten Golf kurz entschlossen gegenüber der festlich beleuchteten Gaststätte geparkt und saß nun vor einem Cordon Bleu mit Pommes Frites und Salat her, während Andreas nur eine Soljanka bestellt hatte. Ich betrachtete das Essen und zwang mich, ein Stück Fleisch in den Mund zu schieben.
»Ja«, begann ich, nachdem ich den Bissen hinunter geschluckt hatte. »Er sagt immer, Detektivarbeit ist neunzig Prozent Geduld und Sitzfleisch und zehn Prozent Kombinationsgabe.« Ich trank einen Schluck Bier, schloss für einen Moment die Augen und sprach dann endlich meine Bedenken an dem Sinn unserer hektischen Aktivität aus.
»Er wollte sich nicht umbringen, Kirsten. Verdammt, darauf würde ich wirklich mein letztes Hemd verwetten!« Besorgt schaute Andreas mich an. »Warum versuchst du nicht wenigstens, daran zu glauben?«
Ich nahm mir noch eine Gabel Pommes Frites, schob dann den Teller weg. »Also gut, ich versuche es.«
»Kirsten, ich denke, wir sind uns einig, dass Dale ein sehr gründlicher Mensch ist, oder?« Zögernd nickte ich. »Warum glaubst du dann nicht, dass er auch seinen Selbstmord richtig angepackt hätte? Wenn er sich hätte umbringen wollen, dann wäre er jetzt auch tot – das ist meine Überzeugung.«
Ich schnappte nach Luft. »Du machst es dir ja einfach! Wirklich klasse!« Gleichzeitig spürte ich, dass es falsch war, auf Andreas wütend zu sein. Eigentlich hörte sich das gar nicht so dumm an. Ich trank noch einen großen Schluck Bier und drängte die Tränen zurück, fixierte die hölzerne Tischplatte.
»Kennst du denn eigentlich keine Freunde von Dale, mit denen du mal sprechen könntest?«, fragte Andy ruhig nach. Er hatte seine Suppe aufgegessen und schaute grübelnd auf das Cordon Bleu.
Ich zuckte die Achseln. »Doch, Martin.« Ich hatte nie begriffen, was Dale an dem farblosen Englischlehrer fand.
»Dann ruf diesen Martin doch gleich mal an«, drängte Andreas und zog kurz entschlossen meinen Teller zu sich hin. »Und um die Einbrüche kümmern wir uns auf jeden Fall noch. Da kann schließlich auch eine spannende Geschichte für uns drin sein. Ein Hehlerring, der in ganz Sachsen arbeitet, das ist doch was. Von irgend etwas müssen wir in Zukunft ja unsere Miete zahlen.«
*
»Hey! Was wollen Sie hier?« Die laute Stimme gehörte einem großen, schlanken Mann Anfang Zwanzig in schwarzer Uniform. Als er näher herankam, konnte ich die Aufnäher »City-Wachdienst« lesen.
»Nichts«, begann Andreas. »Wir – »
»Wir machen demnächst eine kleine Boutique in der Prager Straße auf«, fiel ich ihm ins Wort, »und überlegen, ob wir dem Cityring beitreten.«
Der junge Mann nickte nur. Ich hätte wohl eher Buchladen sagen sollen, nach Boutique sahen wir beide in unseren Jeans und T-Shirts wirklich nicht aus. Andys Kordjacke wies außerdem noch deutliche Spuren von unserem Besuch in der Holzabteilung des Baumarkts auf. Schnell fuhr ich fort:
»Das hat ja auf jeden Fall Vorteile, aber wir haben von den Einbrüchen hier in dem gemeinsamen Lager gehört und wollten uns deshalb mal umschauen.« Ich taxierte das schwere Metalltor.
»Was für Einbrüche?« Der Wachmann zog eine Schachtel Zigaretten aus der Uniformjacke, riss das Cellophan ab und zündete sich umständlich eine an, während er uns misstrauisch betrachtete.
»Ist denn nicht in den letzten zwei Monaten hier mehrmals eingebrochen worden?« Ob der Wachdienst Anweisungen hatte, nichts darüber zu sagen? »Wir verstehen natürlich, wenn Sie das nicht an die große Glocke hängen wollen.«
»Also, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber wenn Sie das Gelände hier für einen Einbruch ausspionieren wollen, dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse.«
*
»So viel zu ›auf die Lauer legen‹«, sagte ich, als wir wieder im Auto saßen. »Das ist garantiert so ein Fall, wo Dale etliche Nächte hier war.«
Andy steckte den Schlüssel ins Zündschloss, drehte ihn jedoch noch nicht herum.