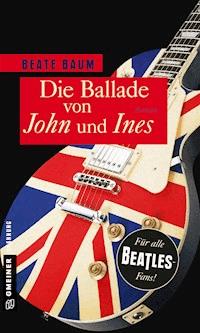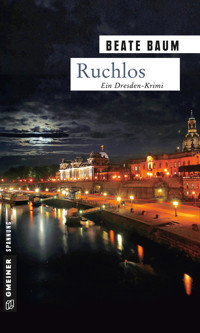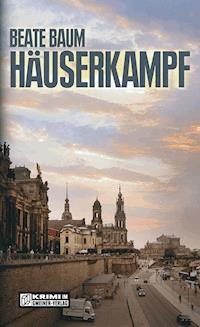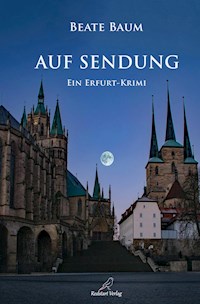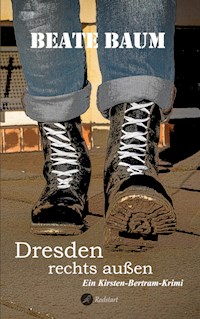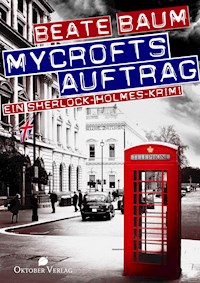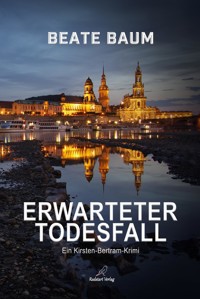
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Redstart Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wem spielt der Tod des Rentners Manfred Haase in die Hände? Dem Jazzmusiker Janosch, der seinen Lebensunterhalt als Altenpfleger bestreitet, jedenfalls nicht. Journalistin Kirsten Bertram ist sicher, dass er zu unrecht unter Mordverdacht steht, und recherchiert bei Pflegediensten und der Verwandtschaft des Opfers. Vielleicht ist sie aber auch nicht objektiv: Während eines Interviews war sie dem Musiker näher gekommen als geplant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
1. Kapitel
»Lecker! Selbstgebacken?« Mit einem Stück Butterkuchen in der Hand stand ich am Schreibtisch der Lokalredakteurin Christina. Ich war vor einem Jahr ins Feuilleton der Dresdner Zeitung gewechselt, wurde aber noch immer in den ersten Stock eingeladen, wenn es etwas zu feiern gab.
»Ehrensache«, meinte die Kollegin. »Geburtstag ist schließlich nur einmal im Jahr!«
»Also, ich finde, gefühlt wird es immer häufiger.«
Christina lachte. Wir waren gleich alt – ich hatte die 50er Marke, die sie an diesem Tag beging, vor zwei Monaten überschritten – und machten häufig Witze über unsere verflossene Jugend. Sie wandte sich einer Praktikantin zu und nötigte ihr ein riesiges Stück Kuchen auf. Für die knapp besetzte Redaktion hatte sie viel zu viel mitgebracht.
Ich sah auf Christinas Bildschirm. Gerade blinkte eine neue Pressemitteilung auf. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Dresden ermitteln nach Tod von 83-jährigem Mann, stand da. Darunter hieß es, der Pflegebedürftige sei gegen elf Uhr 30 in seiner Wohnung im Preußischen Viertel gefunden worden, nachdem er dem Essen-Lieferdienst nicht geöffnet hatte. Um 15.30 Uhr wurde der 25-jährige Angestellte eines mobilen Pflegedienstes, Janosch V., vorläufig festgenommen.
»Was?« Ich musste es laut gerufen haben, denn auch die weit versprengt am anderen Ende des Großraumbüros sitzenden Kollegen sahen zu mir herüber.
Christina fragte, was los sei. Bevor ich antworten konnte, hatte sie die Polizeimeldung überflogen. »Ist das der Jazzmusiker, den du letzte Woche porträtiert hast?«
»Wenn es nicht zwei 25-jährige Janosch V. in Dresden gibt, die bei einem Pflegedienst arbeiten …« Ich war fassungslos. Der charismatische Keyboarder hatte mir erzählt, dass er nach wie vor stundenweise in seinem erlernten Beruf als Altenpfleger arbeitete, weil die Einkünfte aus Auftritten und CD-Verkäufen für seinen Lebensunterhalt nicht ausreichten. »Er hat gesagt, dass er das gern macht, weil es so was ganz anderes ist. Und dass er die alten Leute wirklich mag, die meisten jedenfalls.«
Janosch hatte kein Menschenleben auf dem Gewissen, ganz bestimmt nicht! Er war jemand, der das Leben genoss, es feierte, nicht auslöschte.
Hatte er nicht ausdrücklich von einem betagten Herrn am Rand der Neustadt gesprochen, den er besonders in sein Herz geschlossen hatte? Das Preußische Viertel lag am Rand der Neustadt. Ich musste mir sofort meine Notizen anschauen! Zum Glück kritzelte ich immer alles akribisch mit.
»Kirsten? Kirsten!« Ich hatte noch nicht einmal bemerkt, dass der Redaktionsleiter Martin Alex den Raum betreten hatte, geschweige denn, dass er direkt vor mir stand. »Kannst du das übernehmen – wenn du schon Hintergrundinfos hast? Ich weiß beim besten Willen nicht, wer von uns es machen könnte, so knapp, wie wir besetzt sind – und nur die Pressemitteilung abzudrucken wäre eine Bankrotterklärung.«
Ich hatte in der Kulturredaktion, für die ich an diesem Tag allein zuständig war, mehr als genug zu tun. Dennoch sagte ich sofort zu. Ich wollte unbedingt wissen, was es mit dieser Meldung auf sich hatte. Was mit Janosch war.
*
Eine Pressekonferenz war nicht vorgesehen, informierte mich die Kripo-Pressesprecherin Valerie Gehre. Sehr gern würde sie mir jedoch weiterhelfen, wenn ich Fragen hätte.
Immer häufiger sehnte ich mich nach den alten Zeiten zurück, als Journalisten offen abgebügelt wurden, wenn sie etwas in Erfahrung zu bringen versuchten. Anstatt einen mit falscher Freundlichkeit am langen Arm verhungern zu lassen. Nein, den Nachnamen des Festgenommenen könnte sie mir nicht nennen, auch nichts dazu sagen, ob es sich um den Jazzmusiker Janosch Voigt handelte. Ob der Verdächtige nur Teilzeit als Altenpfleger arbeite, wisse sie nicht. Nein, leider sei auch der Name des Opfers noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, es täte ihr sehr leid.
»Können Sie bestätigen, dass es sich um Manfred Haase handelt?« Den Namen hatte ich in meinen Notizen gefunden. Diesen alten Herrn hatte Janosch ausdrücklich erwähnt – dass er souverän mit seinen diversen Einschränkungen umging, aber auch, dass er sich für Janoschs Musik interessiere.
»Bedaure, dazu bin ich nicht befugt.«
»Sie haben mir bis jetzt überhaupt keine Informationen gegeben, Frau Gehre! Ist das Ihr Verständnis von Pressearbeit?« Amüsiert registrierte ich, dass ich wie mein Mann klang. Nein, Andreas wäre vermutlich noch deutlicher geworden.
Die Sprecherin reagierte professionell höflich. »Sobald es neue Fakten gibt, erhalten Sie eine Mitteilung.«
Sehr knapp verabschiedete ich mich und rief die Internetseite des Dresdner Telefonbuchs auf. Ein Haase, Manfred war in der Bautzner Straße verzeichnet. Das war im Preußischen Viertel, und die Tatsache, dass es überhaupt einen Festnetzeintrag gab, sprach dafür, dass es sich um einen älteren Mann handelte.
Ich schnappte mir meine Umhängetasche und lief die Treppen hinunter, schloss mein Fahrrad auf und schwang mich in den Sattel, rollte langsam über die Fußgängerzone Prager Straße. Sobald ich den Radweg entlang der Petersburger erreicht hatte, trat ich kräftig in die Pedale.
An solch einem herrlichen Frühlingsnachmittag war Radfahren die angenehmste Fortbewegungsart. Außerdem ging es schnell. Ich sauste an den Autokolonnen vorbei, ließ die Altstadt links liegen und überquerte wenige Minuten später die Elbe.
Auf der Neustädter Seite erhöhte sich die Frequenz an Radfahrern und Fußgängern, sodass ich auf dem Radweg nicht mehr komplett freie Fahrt hatte. Das kannte ich aus den langen Jahren, die ich nun schon in dem Gründerzeitviertel mit dem irritierenden Namen lebte. Die Bautzner Straße, auf der ich mich aus dem quirligen Teil der Neustadt hinausbewegte, zog sich, und dank der stetigen Steigung war ich ziemlich außer Atem, als ich die Nummer 49 erreichte.
Bei Manfred Haases Adresse handelte es sich um eine der imposanten Villen, mit denen das Preußische Viertel reich gesegnet war. Wie fast alle einstmals herrschaftlichen Häuser war auch dieses in Wohnungen aufgeteilt worden; an der seitlich gelegenen, dunklen Haustür gab es sechs Klingelschilder.
Ich versuchte mein Glück bei Haase, ohne eine Reaktion zu erwarten. Entsprechend erstaunt war ich, als mir gleich darauf Franziska Stolpner gegenüberstand, die Hauptkommissarin, mit der wir es im vergangenen Herbst zu tun gehabt hatten – und die mit Dale zusammen war, meinem ehemaligen Partner.
Mit dem für sie typischen, leicht spöttischen Lächeln begrüßte sie mich: »Kirsten! Das hätte ich mir ja denken können.« Ihr sächsischer Dialekt ließ den Satz sehr gutmütig klingen, obwohl die Abwehr eindeutig war. Wieder einmal registrierte ich, wie gut sie aussah mit ihrer sportlichen Figur und der aufrechten Haltung. Sie trug eine farbenfrohe Strickjacke, die ihre grauen, sehr kurz geschnittenen Haare silbern in Szene setzte.
»Ich habe mich letzte Woche lange mit Janosch Voigt unterhalten«, sagte ich und versuchte, an Franziska vorbeizuschauen. Meine Schlussfolgerungen in Bezug auf das Mordopfer waren offenbar richtig gewesen. »Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Mörder ist!« Die Tür der linken Erdgeschosswohnung stand offen, zu erkennen war allerdings nichts. Die Spurensicherung musste ihre Arbeit schon abgeschlossen haben. Franziska trug keine Schutzkleidung, noch nicht einmal Handschuhe.
»Da wolltest du wieder Detektiv spielen?« Das klang reichlich von oben herab. Ich dachte daran, wie gut wir uns vor weniger als einem Monat bei Dale unterhalten hatten. Und dass sie Andy und mir bei ihrem Fall um die Rechtsextremen wichtige Hinweise verdankte.
»Ich bin als Journalistin hier«, entgegnete ich kühl. Immerhin hatte Franziska mir indirekt bestätigt, dass der festgenommene Janosch V. »mein« Janosch Voigt war. Dass mich nicht ausschließlich journalistisches Interesse antrieb, ging die Kommissarin gar nichts an.
Da müsste sie mich an die Pressestelle verweisen, lautete Franziskas Antwort. Sie machte eine winzige Pause. »Tut mir leid, Kirsten, aber das sind die Regeln.« Wenigstens hörte es sich aufrichtig bedauernd an.
»Ach komm: ein oder zwei Sätze?«, probierte ich einen überredenden Tonfall.
Sie schüttelte den Kopf. »Keine Ausnahmen. Lass mich meine Arbeit machen, dann gibt’s demnächst auch Infos.«
Ich verzog das Gesicht. Aber klar, täte sie mir den Gefallen, würde sie gegen sämtliche Regeln verstoßen. Für meinen Artikel hatte ich schon einen ordentlichen Vorsprung im Vergleich zu den Kollegen. Ansonsten musste ich auf eigene Faust weitersehen.
»Okay«, sagte ich gespielt gleichmütig. »Dann mach mal weiter. Wie ist Haase überhaupt zu Tode gekommen?«
Nun war Franziska genervt. »Netter Versuch«, sagte sie nur und machte einen Schritt zurück in den Hausflur, schloss die Tür, bevor ich noch etwas sagen konnte.
Ich setzte mich wieder auf mein Rad, fuhr so schnell wie möglich zurück in die Redaktion. Martin wollte mir Platz auf der lokalen Eins freihalten, und die Kulturseite war auch noch längst nicht fertig.
*
Anrufe auf Janoschs Mobiltelefon führten ins Leere. Natürlich, wenn er in Untersuchungshaft saß, würde man ihm das Telefon abgenommen haben. Ich versuchte mir den schmalen, jungenhaften Musiker in einer Zelle vorzustellen. Es gelang mir nicht. Was ich stattdessen sah, waren seine zerwühlten dunkelblonden Haare auf dem Kopfkissen in seinem WG-Zimmer, der verträumte Blick seiner braunen Augen.
Unwillig schüttelte ich den Kopf. Dass mir dieser Ausrutscher passiert war, begriff ich immer noch nicht. Aus dem Alter solcher Eskapaden war ich lange heraus, verheiratet mit einem Mann, den ich liebte und begehrte, der mich zum Lachen bringen und zur Weißglut treiben konnte.
Ich probierte den Festnetzanschluss in Janoschs Wohngemeinschaft und erreichte eine Frau, der Stimme nach sehr jung. Nein, sie hatte keine Ahnung, was mit ihrem Mitbewohner war. Aber er würde auch oft vom Dienst aus gleich noch woanders hinfahren. »Er ist irgendwie ständig unterwegs. Soll ich etwas ausrichten?«
Ich bedankte mich und sagte möglichst locker, er könnte mich ja mal anrufen, wenn er nach Hause käme. »Kirsten Bertram, er hat meine Nummer.«
»Okay.« Sie beendete das Gespräch.
Ratlos starrte ich auf die schmuddelig-weiße Bürowand. Das Kulturressort bestand lediglich aus meiner Chefin Marlen Pawlak und mir, und der Raum war winzig. Unsere beiden Schreibtische, die dazugehörigen Stühle, ein wackeliges, altes Regal und ein vorsintflutlicher Aktenschrank füllten ihn nahezu aus.
Mit einem leisen Pling traf eine Meldung der Semperoper ein. Die Premiere der Zauberflöte wurde verschoben. Ich seufzte. Das war wichtig, da musste ich noch einmal nachfragen und ein paar Zeilen dazu schreiben.
Ich machte mich an die Arbeit, doch ein Teil meines Gehirns beschäftigte sich weiter mit Janosch. Wen könnte ich noch anrufen? Die beiden Musiker, mit denen er zusammen in einem klassischen Trio spielte? Seine Eltern? Ich hatte keinerlei Telefonnummern. Einfacher wäre der Pflegedienst.
In dem Moment, in dem ich die Nummer der Sorgenfrei GmbH & Co KG wählen wollte, meldete sich Martin jedoch mit der Nachfrage, wann mein Text fürs Lokale käme, und ich gab weitere Recherchen für diesen Tag auf, schrieb meinen Artikel mit den Fakten, die ich hatte.
*
»Na ja, der Druck bei diesen Pflegediensten ist schon enorm«, meinte Andreas beim Abendessen.
Ich hatte ihm von der Geschichte erzählt. Die Verhaftung beschäftigte mich so sehr, dass ich es nicht für mich hätte behalten können. Zumal er am kommenden Morgen meinen Artikel lesen und sich dann fragen würde, warum ich nichts davon gesagt hatte. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, reinen Tisch zu machen und ihm alles zu sagen, dachte ich und holte tief Luft, da fuhr er auch schon fort:
»Ich hab doch gerade mit der Recherche zu den Arbeitsbedingungen in der ambulanten Pflege begonnen.«
»Stimmt ja!« Ich vertagte mein Geständnis. Es würde andere Gelegenheiten geben.
Kurz bevor ich von der Lokalredaktion ins Feuilleton gewechselt war, hatte Andy sich als freier Journalist selbstständig gemacht. Seitdem war er stets auf der Suche nach spannenden Themen, die er großen Zeitungen und Magazinen anbieten konnte. Es war peinlich, aber ich hatte komplett vergessen, dass er mir am Wochenende von der geplanten Reportage über mobile Pflegedienste erzählt hatte.
Zum Glück nahm er es mir nicht krumm. »Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand da durchdreht«, meinte er.
Skeptisch verzog ich das Gesicht. Für meinen Geschmack klang das sehr dramatisch. Janosch hatte jedenfalls nichts in der Richtung anklingen lassen.
»Die Mitarbeiter haben eine Viertelstunde für die so genannte große Toilette – das heißt von oben bis unten waschen, Zähne putzen, eincremen, Inkontinenzmaterial anlegen und anziehen. Noch Fragen?«
»Jede Menge«, antwortete ich. »Wie das gehen soll, zum Beispiel.« Das hörte sich wirklich absurd an.
»Eigentlich gar nicht, das sagen alle.« Mein Liebster schob seinen Teller in die Tischmitte und lehnte sich zurück. Er versuchte, ein paar Pfund abzunehmen, und hatte sich bloß eine Schnitte mit magerem Schinken gegönnt. Sogar sein übliches Feierabendbier verkniff er sich. »Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch in dem Musikerporträt geschrieben, dass der Keyboarder den Job auch anstrengend findet.«
»Na ja, er sagte, dass kaum Zeit bleibt, einfach mal mit den Menschen zu reden.« Sehr treuherzig hatte Janosch betont, wie wichtig ihm der Kontakt mit den zu Pflegenden über die Arbeit hinaus war.
Andy hatte offensichtlich nicht aus meinem Artikel herausgelesen, dass ich diesen Mann, der halb so alt war wie ich, anziehend gefunden hatte. Dabei dachte ich nach wie vor, dass mein Text schwärmerisch klang – obwohl ich nichts weiter von Janosch wollte! Weder hatte ich mich in ihn verliebt, noch hätte ich unser sexuelles Abenteuer wiederholen wollen. Es war einfach schön gewesen, schön und unerwartet, so begehrt zu werden, so wahrgenommen. Und ja, unabhängig davon mochte ich ihn. Seine Hingabe an die Musik gefiel mir, wie überhaupt seine Begeisterungsfähigkeit.
Andreas war in seinem Element: »Solch ein Luxus wie Reden ist nicht vorgesehen. Nein, stopp!« Er verzog die Mundwinkel zu einem zynischen Grinsen. »Ich will ja nichts Falsches sagen: Es gibt unterschiedliche Pakete mit verschiedenen Leistungskomplexen.« Mit erhobenen Händen setzte er das letzte Wort in Anführungszeichen. »Gut möglich, dass da eines dabei ist, bei dem persönliche Gespräche eingeschlossen sind, mal einen Kaffee trinken, oder so etwas. Kann bloß vermutlich kaum jemand bezahlen.«
»Das ist grässlich.« Ich nahm eine Apfelsine aus der Obstschale und begann sie zu schälen. »Da will man echt nicht alt und pflegebedürftig werden.«
Wir saßen in der großen, gemütlichen Küche unserer Wohnung im zweiten Stock eines Gründerzeithauses. In einem jener Gebäude, in denen es sich wunderbar lebte, solange man die Treppen ohne Probleme bewältigte und sich die in den vergangenen Jahren heftig gestiegenen Mieten leisten konnte. Für uns war das kein Problem – mein Gehalt war ordentlich, und bislang hatte auch Andreas als freier Journalist gut verdient –, viele Menschen waren jedoch aus der Nachbarschaft verschwunden.
Als ich nach Dresden gezogen war, hatten auch ärmlich gekleidete Ältere, alleinerziehende Mütter und offensichtliche Lebenskünstler zum Bild der Neustadt gehört. Aber damals waren viele der herrlichen Häuser in einem abenteuerlichen Zustand gewesen. Mit fortschreitender Sanierung der Straßenzüge waren andere Bewohner gekommen, und heutzutage kannte man seine Nachbarn häufig kaum. Das Paar, das auf unserer Etage lebte, war erst nach der jüngsten Mieterhöhung eingezogen, davor hatte dort eine Familie gewohnt – die ihrerseits die drei jungen Frauen abgelöst hatte, die wir bei unserem Einzug kennengelernt hatten.
»Aber Janosch meinte, dass er das gern macht«, beharrte ich, »und dass er die meisten seiner Schützlinge mag.« Ich hielt Andy ein Stück Apfelsine hin. »Er ist ein großartiger Musiker – er könnte ja auch unterrichten, um Geld zu verdienen.«
Andreas zupfte an dem Orangenstück herum, entfernte die weiße Haut. »Da gibt’s nicht unbegrenzt Stellen«, sagte er. »Und bei all den Musikern hier in der Stadt werden die auch gefragt sein.« Er schob sich das Stück in den Mund und fragte mit vollem Mund, ob ich eine CD des Keyboarders hätte.
Natürlich hatte Janosch mir die bislang einzige Veröffentlichung des JV Trios mitgegeben. Wir gingen ins Wohnzimmer und ich schob Somewhere across the Elbe in den CD-Player, bevor ich mich zu Andy aufs Sofa setzte und das verbliebene Viertel Apfelsine mit ihm teilte.
»Er hatte als kleines Kind bereits Klavierunterricht«, sagte ich, während die ersten zarten Töne aus den Lautsprechern kamen.
»Gutbürgerliche Herkunft?«, vermutete Andy mit vollem Mund.
»Ja. Die Eltern haben eine Apotheke. Wieso, kommt dir das bekannt vor?« Während mein Vater Arbeiter in einem Dortmunder Stahlwerk gewesen war, stammte Andreas aus einer alteingesessenen Hamburger Unternehmerfamilie.
»Oh, ja. Weder mein Bruder Frank noch ich hatten irgendeine Begabung, geschweige denn Lust, aber die Stunden waren Pflicht.«
Ich drehte mich um, sodass meine Beine über der Armlehne baumelten, und ich meinen Kopf in Andys Schoß legen konnte, gönnte mir einen kurzen Gedanken an unseren geplanten Irland-Urlaub. Ende Juni wollten wir zwei Wochen lang die Grüne Insel erkunden, worauf ich mich sehr freute.
Die Klänge aus den Boxen wurden kräftiger. Lauter und sehr eindringlich. »Also, bei Janosch war es komplett anders«, kam ich auf den jungen Musiker zurück. »Er war von Anfang an begeistert. Hat mit 12, 13 schon das klassische Repertoire draufgehabt und angefangen, sich für Jazz zu interessieren.«
»Das ist ungewöhnlich.«
Ich lachte leise und, wie ich bemerkte, liebevoll. »Das ist ihm heute auch bewusst. Damals war bloß klar, dass er mit gleichaltrigen Freunden nichts anfangen konnte.«
»Vermutlich waren die Eltern nicht gerade begeistert über seinen Werdegang.«
»Ich habe gar nicht danach gefragt«, gab ich zu. »Es ging ja um seine Musik. Ob sie lieber gesehen hätten, dass er Pharmazie studiert und die Apotheke übernimmt – keine Ahnung.«
Andy rutschte ein Stück nach hinten. Er strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn. »Vielleicht sind die Eltern auch anders drauf, als meine es waren. Ist ja ein paar Jährchen her.«
»Du warst bestimmt kein einfacher Sohn. Als wir uns kennenlernten, hattest du was von einer Zeitbombe mit all deinem Zorn.«
Nun lachte er auf: »Du meinst, mir hättest du damals einen Mord zugetraut?«
Das stritt ich energisch ab, obwohl wir genau solch eine Situation gehabt hatten, in der mein Vertrauen auf eine arge Probe gestellt worden war.
»Schöne Lügnerin«, sagte Andy denn auch bloß und gab mir einen Kuss auf die Stirn.
Bei Andreas war mein Vertrauen gerechtfertigt gewesen. Bestimmt lag ich bei Janosch auch richtig.
Schweigend lauschten wir einer ausgedehnten Interpretation von »Somewhere Over the Rainbow«, für die Janosch einen befreundeten Saxofonisten gewonnen hatte, und die für den Titel der CD verantwortlich war.
»Wirklich gut!«, befand Andreas. »Warum hat er nicht Musik studiert?«
Eine naheliegende Frage in einer Stadt mit der angesehenen Hochschule Carl Maria von Weber, die ich Janosch auch gestellt hatte.
»Er wollte etwas, Zitat: Richtiges, machen«, gab ich Auskunft.
»Ob er wirklich wusste, was das dann im Endeffekt bedeutet? Was für einen Stress?«
Noch immer in Andys Schoß liegend, zuckte ich die Achseln. Letztendlich hatten wir auch das Thema seines Jobs bei dem Pflegedienst in unserem Gespräch nur gestreift. Janosch brannte für die Musik, und die Tatsache, dass in der Zeitung ein Porträt über ihn erscheinen sollte, hatte das Feuer noch weiter angefacht. Ich war kaum in der Lage gewesen, seine Begeisterung zu kanalisieren – bis wir uns auf einmal in seinem Bett wiederfanden.
»Wenn es dich interessiert: Ich habe sämtliche Vorgaben für die Pflegenden im Block«, bot Andreas an. »Da ist alles durchgetaktet. Und die Zeiten müssen eingehalten werden, sonst kippt der ganze Plan, und die Letzten werden gar nicht mehr versorgt.«
Er machte eine Pause, in der ich etwas Zustimmendes murmelte.
»Aber ich vermute, du versuchst erst einmal, Dale anzuspitzen, damit Franziska dir doch etwas zu ihrer Ermittlung erzählt?«
Er kannte mich gut. »Ich gebe zu: Ich habe an die Möglichkeit gedacht.« Ich grinste ihn an.
Andy wünschte mir viel Glück dabei.
Natürlich hatte er recht: Bei all unseren gemeinsamen Abenteuern hatte Dale mir nie bereitwillig Informationen beschafft. Umso weniger würde er seine Freundin drängen, mir welche zu geben. Aber einen Versuch war es wert.
2. Kapitel
Am nächsten Morgen fuhr ich gleich nach dem Frühstück auf dem Elberadweg nach Pieschen, wo Dale seit Jahresbeginn eine Zweiraumwohnung in einem unsanierten Haus bewohnte. Prinzipiell ein Glücksfall, solch eine Unterkunft auf dem gegenwärtigen Wohnungsmarkt zu finden, war es für ihn ein Abstieg. Immerhin hatte er, bevor er in die Staaten zurückgezogen war, in einem Haus mit Garten mitten in der Neustadt gelebt. Die Immobilie war vor vielen Jahren ein üppiges Dankeschön eines Klienten gewesen, und ihr Verkauf hatte es Dale möglich gemacht, seine Übersiedlung in die USA und den Neuanfang dort zu finanzieren. Vermutlich besaß er noch immer einige Rücklagen, aber er war in finanziellen Angelegenheiten vorsichtig und würde das Geld nicht leichtfertig für hohe Mieten ausgeben.
Es war herrlich, in der Kühle des Frühlingsmorgens mit der Sonne im Rücken den Weg entlangzufahren. Links glitzerte hinter breiten Elbwiesen der träge dahinfließende Fluss, rechts war mittlerweile die meiste Fläche bebaut. Wehmütig dachte ich an die Zeit zurück, als es zwischen der Neustadt und Pieschen noch Schrebergärten gegeben hatte. Nun standen dort die hohen Häuser der »Hafencity«, in denen kaum jemand sich eine Wohnung leisten konnte.
Etliche andere Radfahrer kamen mir entgegen – Pendler in die Innenstadt –, während ich nur gelegentlich eine Mutter oder einen Vater mit Kindern im Anhänger überholte oder Sportler in enganliegenden Hosen und Trikots auf ihren Rennmaschinen an mir vorbeizischten. Auch einige Jogger waren an der Elbe unterwegs, und ich beäugte jeden Einzelnen genau, um nicht an Dale vorbeizufahren, der regelmäßig morgens lief.
Am Ende des Pieschener Hafens ging es über die elegant geschwungene Molebrücke mit der Undine-Stahlfigur auf die Leipziger Straße, und kurz darauf stand ich vor dem mit Brettern vernagelten Schaufenster eines leerstehenden Ladenlokals. Kurz zögerte ich, dann klingelte ich bei Ingram. Kein Hinweis auf Dales Privatdetektei. Er hatte mir erzählt, dass er noch nach einem geeigneten Büro außerhalb seiner Wohnung suchte und vorerst mit potentiellen Klienten Zoom-Meetings abhielt oder sie an neutralen Orten traf.
Ziemlich lange stand ich vor der hohen Tür mit ihrem abblätternden Lack und dachte schon, dass Dale tatsächlich joggen war. Dann wurde jedoch der Öffner betätigt, und ich betrat den feucht-muffig riechenden Hausflur, stieg in den ersten Stock.
In der geöffneten Wohnungstür stand Franziska. Eine spärlich mit Slip und T-Shirt bekleidete Franziska, die Lippen zu einem Grinsen verzogen.
»Guten Morgen! Dale wollte wetten, dass du es bist, aber ich hab mich nicht drauf eingelassen. War ja nur logisch.«
Ich bildete mir ein, dass es nicht allzu leicht war, mich aus der Fassung zu bringen. Franziska hatte es geschafft. Nicht, dass ich überrascht gewesen wäre, weil sie die Nacht mit Dale verbracht hatte, und die beiden offensichtlich um neun Uhr noch im Bett gewesen waren, oder weil sie sich ohne Scheu in Unterwäsche zeigte. Es war vielmehr die Einmütigkeit, die hinter ihren Worten lag; vielleicht auch einfach die Tatsache, dass sie über mich gesprochen hatten.
»Nun komm schon rein!« Franziska trat einen Schritt zurück. »Du kennst dich ja aus. Ich zieh mir schnell was über. Dale ist noch im Bad.«
Ich war erst einmal in der Wohnung gewesen, bei Dales kleiner Einweihungsfeier vor etwa einem Monat, als ich mich so gut mit ihr unterhalten hatte. Aber natürlich war es nicht schwer, sich zurechtzufinden, und ich ging in die Küche, setzte Kaffee auf.
Als die ersten Tropfen in die Kanne fielen, kam Dale in den Raum. Sein graues Haar war nass von der Dusche, sein sehniger Körper steckte in Jeans und T-Shirt.
»Guten Morgen!« Wir umarmten uns. Ein kaum wahrnehmbarer Duft umgab ihn. Er benutzte seit Ewigkeiten das gleiche Deo.
»Keine Wette gewonnen«, sagte ich mit ein wenig Verspätung.
»Keine Wette zu gewinnen«, antwortete er. »Scheint, als wenn Fran dich in solchen Situationen schon ganz gut einschätzen kann.«
Trotz der strahlenden Sonne reichte das Licht, das durch das Fenster fiel, kaum aus, um die Küche zu erhellen. Alle Räume der Wohnung lagen nach hinten hinaus, und der Hof war eng. Dennoch schufen die schlichten, hellen Holzmöbel eine freundliche Atmosphäre.
Dale fragte, ob ich mit ihnen frühstücken wollte, und begann den Tisch zu decken.
»Soll ich schnell Brötchen holen?«, fragte Franziska, als sie in die Küche kam. Sie trug die gleiche Strickjacke, in der ich sie am Vortag gesehen hatte.
»Meinetwegen nicht«, sagte Dale. »Es dauert noch, bis ich deutsches Vollkornbrot über habe.«
Ich winkte ab. »Ich trink nur einen Kaffee mit.«
»Gut, dann gibt’s gesundes Frühstück.«
Franziska sah auch angekleidet genauso durchtrainiert aus wie Dale. Ich wusste, dass sie regelmäßig Taekwondo betrieb. Spontan musste ich an Andys immer neue Anläufe denken, nach jahrelanger Pause wieder einmal in einen Karate-Kurs zu gehen. Meine eigenen sportlichen Aktivitäten beschränkten sich auf das Radfahren, waren also ebenfalls eher gering.
»Tut mir leid, Kirsten, aber ich werde dir auch privat nichts zu dem Fall sagen«, verkündete Franziska, kaum, dass wir zu dritt um den Tisch saßen.
Ich hielt die Kaffeetasse vor meinem Gesicht, während ich überlegte, wie ich sie umstimmen könnte. »Und wenn ich verspreche, nichts darüber zu schreiben?«, startete ich einen Versuch.
Dale grinste. Solche Gespräche kannte er gut.
Franziska schüttelte den Kopf. »Auch dann nicht.« Sie bestrich eine Scheibe Brot mit Kräuterquark und begann zu essen.
»Aber ernsthaft«, setzte ich neu an. »Es ist nicht nur meine journalistische Neugierde –«
»Ich habe gestern schon verstanden, dass du Janosch Voigt nicht für fähig hältst, einen Mord zu begehen«, fiel sie mir ins Wort.
»Er hat Manfred Haase gemocht!«
»Ich weiß, das hat er mir gesagt.«
Wie war ihr Gesichtsausdruck zu deuten? Sie war allemal intelligent genug, Zweifel zuzulassen. »Wieso steht er überhaupt unter Verdacht?«, hakte ich nach. »Nur weil er als Letzter bei dem Mann war? Ich nehme doch an, dass es so war, oder?«
»Nicht nur deshalb«, antwortete sie.
Immerhin, ein Puzzleteilchen hatte ich damit.
Dale grinste. Die beiden hatten sich wirklich gesucht und gefunden! Bis heute wusste ich nicht, ob Franziska den Ausschlag für seine Rückkehr nach Dresden gegeben hatte. Dass er in Trenton nicht mehr glücklich und seine Beziehung mit der Amerikanerin Jess am Ende war, hatte er bereits im Herbst angedeutet. Mit einem derart schnellen Umzug hätte ich damals aber nicht gerechnet.
Ich glaubte nicht, dass Franziska noch etwas preisgeben würde, und fragte Dale, wie sein beruflicher Neustart in Dresden geklappt habe.
»Durchwachsen«, meinte er. »Aber heute Nachmittag habe ich einen Termin bei der Secura – du weißt schon, die Versicherung, für die ich früher viele Nachforschungen erledigt habe.« Er goss reihum Kaffee nach.
»Prima, die waren doch immer zufrieden mit dir. Da wirst du doch bestimmt wieder beauftragt.«
»Abwarten. Wo heutzutage Ermittler gebraucht werden, das ist Cyberkriminalität. Und davon habe ich überhaupt keine Ahnung.«
Bevor mir eine aufmunternde Antwort einfiel, wandte Franziska sich unvermittelt an mich: »Willst du mit Janosch Voigt reden? Ohne etwas darüber zu schreiben?«
»Ja, auf jeden Fall«, sagte ich sofort. Im selben Moment wurde mir klar, dass sie hoffte, so von dem jungen Musiker etwas in Erfahrung zu bringen, was er ihr nicht sagte. »Du würdest das Gespräch überwachen, nehme ich an.«
»Yep. Die Bedingung wäre, dass ich Mäuschen spiele.«
Ich stimmte zu.
*
Ich fuhr mit Franziska im Auto und ließ mein Fahrrad in Pieschen. Während der Fahrt tätigte sie einen Anruf und kündete in der JVA ihr Kommen »mit einer Zeugin« an, ansonsten plauderte sie locker über den Verkehr und befragte mich zu meinen Arbeitszeiten. Ich antwortete, dass die sehr flexibel waren, es im Wesentlichen darum ging, das stets reichliche Pensum zu schaffen.
Was manchmal schon ohne Exkurse wie diesen fast unmöglich war. Das sagte ich nicht.
Die Justizvollzugsanstalt Dresden war ein riesiger Komplex am äußeren, nördlichen Rand der Neustadt, schräg gegenüber vom Wertstoffhof Hammerweg. Es handelte sich um eine eigene Welt hinter der Stauffenbergallee. Während auf deren südlicher Seite die prachtvollen, uralten Grabstätten des St. Pauli-Friedhofs Spaziergänger innehalten ließen, herrschten hier die gesichtslosen Fassaden diverser Ämter, das Hauptquartier der Polizei und eben die JVA.
Durch eine schlichte Tür in der massigen Fassade wurden wir sofort nach dem Klingeln eingelassen und standen in einer Schleuse. In die Leere hinein nannte Franziska unsere Namen und ihren Dienstgrad, gleich darauf öffnete sich die Tür ins Innere des Gebäudes und wir wurden von zwei uniformierten Justizvollzugsbeamtinnen in Empfang genommen. Franziska legte ihren Ausweis vor und übergab ihr Handy, ich folgte ihrem Beispiel, fühlte mich dabei seltsam ausgeliefert. Immer mal wieder hatte ich es mit Verbrechen in Dresden zu tun gehabt, aber in der JVA war ich noch nie gewesen. Und dachte schon jetzt, dass ich das Erlebnis nicht wiederholen wollte.
»Bitte einmal Beine auseinander und Arme heben!« Der Tonfall der Frau war eher gelangweilt als herrisch, sie hatte »Bitte« gesagt – dennoch fand ich das Folgende fürchterlich. Denn sie tastete mich ab. Gründlich. Hieß: Ihre Hände fuhren bis in meinen Schritt hoch.
Franziska neben mir wirkte unbeeindruckt, obwohl an ihr die gleiche Prozedur vollzogen wurde. Natürlich, sie musste das schon unzählige Male erlebt haben.
»Vernehmungsraum zwei«, hieß es danach. Der Untersuchungshäftling würde dorthin gebracht.
Wir gingen einen langen, tristen Gang entlang zu dem Verhörraum, wo ich mich beklommen an den Tisch setzte. Franziska verschwand. Sie würde hinter der Scheibe im angrenzenden Raum alles mitverfolgen, unsichtbar für Janosch und mich.
Es dauerte nicht lange, dann wurde der junge Musiker von einem Beamten zu dem einzelnen Stuhl mir gegenüber geführt. Irritiert und offensichtlich erfreut begrüßte er mich. Vermutlich war ihm nicht gesagt worden, wer die »Zeugin« war, die auf ihn wartete. Er sah elend aus, die Strahlkraft seiner jugendlichen Attraktivität war erloschen, das linke Augenlid zuckte nervös.
»Hallo Janosch! Es gab die Gelegenheit, mit dir zu sprechen über das, was passiert ist. Und da –« Ich brach ab, wusste nicht weiter.
»Ich hab niemanden umgebracht!«, stieß er hervor. Seine Stimme war heiser, ich hörte, dass er geweint hatte. Ob ihm klar war, dass eine Journalistin normalerweise keinen Zugang zu einem Untersuchungshäftling erhielt? Ich wünschte, er würde mich nicht so vertrauensvoll anschauen. Offensichtlich hoffte er auf meine Hilfe. »Der Manfred – ich hab doch sogar von dem gesprochen …«
Ich musste schlucken. »Vielleicht erzählst du einfach«, begann ich, da fiel er mir auch schon ins Wort:
»Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut hab! Dass es idiotisch war, abzuhauen!« Er knetete seine langen, feingliedrigen Hände.
»Okay«, sagte ich gedehnt. »Du bist weggerannt, als Fran – als die Kommissarin mit dir sprechen wollte?«
Mit gesenktem Kopf nickte er. »Nu.«
»Warum?«
»Hatte Schiss«, kam es sehr leise von der anderen Seite des Tisches.
»Schon klar. Aber wovor?«
Janosch sah auf und ließ seinen Blick über die Betonwände gleiten. Er drehte sich auch um und starrte auf die von dieser Seite blinde Scheibe hinter sich, murmelte dann, das könne er nicht sagen.
Ich unterdrückte ein Seufzen. Hatte er einen Joint dabeigehabt und deshalb Angst vor der Polizei? Unsinn, deswegen machte sich heute niemand mehr ins Hemd. Aber was war es dann?
»Wo warst du denn, als die Kommissarin mit dir sprechen wollte?« Zu dem in der Pressemitteilung genannten Zeitpunkt musste sein Feierabend schon in greifbarer Nähe gewesen sein.
»Ich kam grade bei meinem letzten Job an.«
»Und was wollte sie – die Kommissarin?«, fragte ich.
Janosch zog die Schultern zusammen. »Über Manfred reden.«
»Und das wolltest du nicht?« Wie sollte ich ihm helfen, wenn er nichts sagte?
»Ich war zu spät«, sagte er, anstatt auf meine Frage zu antworten. Der Blick aus den großen, braunen Augen warb um Verständnis. »Manfred ist – war – immer mein erster Termin morgens, und gestern war ein Stau auf der Carolabrücke. Ein Idiot hat versucht, mit Anhänger mitten auf der Brücke zu wenden und alles blockiert.« Er hielt inne, ich sagte nichts. »Ja, und dann ging es ein bisschen hoppla hopp mit Aufstehen, Waschen und so.«
Wieder fiel mir nichts anderes als »Okay« ein.
Janosch, der merkte, dass ich mit seinen Worten nichts anfangen konnte, holte tief Luft: »Also ich war zu spät und hatte viel zu wenig Zeit für ihn.«
»Ja, ist klar.«
»Und dann hat der Manfred gesagt, ich soll ruhig wieder losmachen, weil ich ja zusehen musste, dass ich halbwegs im Plan bleibe. Und dass er schon klarkommt.«
»Du bist also dort weg, bevor du alles erledigt hattest.«
»Nu.« Wieder der um Mitgefühl heischende Blick. »Das hätte ich nicht tun dürfen. Deshalb –« Er brach ab.
Für mich ergab das wenig Sinn. Lief man deswegen vor der Polizei weg? Ich schickte einen deftigen, lautlosen Fluch in Richtung des Raums, in dem Franziska saß, weil sie mir noch immer nicht verraten hatte, wie Manfred Haase ums Leben gekommen war.
»Wie ist er denn gestorben?«, probierte ich es bei Janosch. »Ist er hingefallen?« Wohl kaum, dachte ich gleich darauf. Franziska gehörte zur Mordkommission. Es musste Totschlag oder Mord gewesen sein.
»Ich weiß es nicht«, sagte der junge Mann tieftraurig. »Das hat man mir nicht gesagt.«
»Aber es war alles in Ordnung, als du weg bist?«
»Natürlich!«, brach es aus ihm hervor. »Sonst wär ich doch nicht gegangen.«
Ich nickte. In Janoschs Augen zeigten sich Tränen, das linke Lid zuckte heftig.
»Aber warum hast du das der Kommissarin nicht gesagt?«
Er zuckte nur die Achseln, den Blick wieder auf den Tisch gerichtet.
»Hast du einen Anwalt?«
Das Kopfschütteln war kaum sichtbar.
»Soll ich einen für dich anrufen? Oder deinen Eltern Bescheid sagen?« Ich kannte keine Anwälte, also wäre mir Letzteres lieber gewesen.
Janosch wehrte das jedoch ab, während er schüchtern auf mein erstes Angebot einging.
Na prima, nun musste ich mich neben meiner Arbeit darum kümmern, dem armen Kerl einen guten Rechtsbeistand zu besorgen. Franziska würde ich nicht fragen – die nannte mir garantiert einen, der in ihrem Sinne agierte. Andy hatte bei einer Recherche Anfang Januar mit einem Anwalt zu tun gehabt, vielleicht kam der in Frage.
Wie ein gehorsamer Schuljunge ließ Janosch sich von dem Beamten aus dem Raum führen.
*
»Es ist schon gestern ein Pflichtverteidiger benachrichtigt worden«, sagte Franziska, als wir uns in dem deprimierenden Betonflur trafen. »Gleich nachdem er sagte, dass er keinen Anwalt hat. Das ist das normale Vorgehen.«
Ob der sich genügend Mühe geben würde? Aber damit konnte ich mich später noch beschäftigen. »Du hast Janosch festgenommen, weil er weggelaufen ist, als du mit ihm sprechen wolltest«, stellte ich fest.
»Nicht nur.«
»Und weshalb noch?« Ich funkelte sie an. »Ich will jetzt endlich wissen, was los ist!« Natürlich wüsste ich auch gern, warum Janosch geflüchtet war, das brauchte ich sie aber nicht zu fragen.
Sie berührte meinen Ellenbogen. »Lass uns rausgehen.«
Meine Wut auf sie war irrational und hatte viel mit dieser deprimierenden Umgebung zu tun, das war mir klar, dennoch konnte ich sie kaum im Zaum halten. Aber natürlich verstand ich, dass sie keinesfalls im Knast über so etwas sprechen wollte – und war selbst froh, als wir mit unseren Ausweisen und Telefonen wieder im Freien standen.
»Es fehlte auch Geld in der Wohnung«, sagte Franziska, und steuerte auf ihr Auto zu.
»Viel?«
Sie schüttelte den Kopf. »Genau wissen wir das nicht, aber wohl nicht mehr als 300 Euro.«
Auf meinen fragenden Blick hin erklärte sie, dass Manfred Haase immer Geld in einem Briefumschlag in einer Schublade aufbewahrt habe. Als sie in die Wohnung gekommen sei, habe die Lade offen gestanden und der Briefumschlag war leer.
Mit einem leisen Klicken sprang die Türverriegelung des Autos auf.
»Aber dafür –«, begann ich, besann mich dann eines Besseren. Ich sollte die Gelegenheit, mit Franziska zu reden, nicht für solche Diskussionen nutzen, sondern mehr in Erfahrung zu bringen versuchen. Wir stiegen ein.
»Er war als Letzter bei dem Mordopfer, das Geld ist weg, und er ist vor mir abgehauen. Das reicht für einen Anfangsverdacht.«
Ich registrierte, dass sie sich auf Mord festlegte, was Rückschlüsse auf die Art und Weise der Tat zuließ, und probierte es noch einmal mit der gleichen Frage wie am Vortag: »Wie ist Haase zu Tode gekommen?«
Franziska seufzte. »Na gut, aber wenn ich davon was in der Zeitung lese, rede ich nie wieder mit dir: Die Obduktion hat einen tödlichen Giftcocktail ergeben.«
»Vergiftet … Aber – «
Franziska brachte mich mit einem Blick zum Schweigen: Keine weiteren Informationen, und erst recht keine Diskussionen.
3. Kapitel
Ich musste mich schleunigst um meinen Job kümmern. Ich fuhr mit Franziska direkt in die Altstadt, trotzdem traf ich erst kurz vor der Hauptkonferenz um 12 Uhr im Verlagsgebäude am Ende der Prager Straße ein. Da Marlen noch frei hatte, musste ich für die Kultur in die Besprechung und klickte mich in Rekordgeschwindigkeit durch Termine, Pressemitteilungen und eingegangene Mails, damit ich dem Chefredakteur und den versammelten Ressortchefs Themen für die morgige Ausgabe nennen konnte.
Als ich den großen Raum betrat, war die Kritik am aktuellen Blatt bereits in vollem Gange. Ich registrierte einen mitfühlenden Blick von Martin Alex, der mich misstrauisch machte.
»Frau Bertram! Schön, dass Sie die Zeit finden.« Wenn der Boss Hartmut Müller ironisch sein wollte, wirkte das immer unbeholfen.
Ich verzog die Mundwinkel zu einem schwachen Grinsen und setzte mich.
»Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie für die Lokalredaktion Ihrer alten Leidenschaft nachgegangen sind und sich mit einem Mordfall beschäftigt haben.« Er machte eine Kunstpause, in der mir nichts anderes einfiel, als zu nicken. »Allerdings gab es gleich am Morgen Beschwerden der Familie des Opfers, dass der tragische Fall an die Öffentlichkeit gezerrt wurde.«
Nun war meine Reaktion ein Kopfschütteln. »Ich habe nichts –«
»Reicht Ihre Fantasie, sich vorzustellen, wie man sich als Angehöriger eines Mordopfers fühlt?« Müllers Stimme war schneidend.
Mark Eisold, der Ressortleiter der Sachsenredaktion, mit dem mich eine herzliche Abneigung verband, betrachtete mich wie ein hässliches Insekt.
Die Familie sei sehr beruhigt gewesen, dass die öffentliche Mitteilung der Kriminalpolizei so knapp gehalten war, fuhr der Chefredakteur fort.
»Wieso kannten sie die Pressemeldung der Polizei?«, fragte ich nach und nahm mir vor, die Familie sobald wie möglich unter die Lupe zu nehmen. Diese Reaktion war seltsam. Ich hatte sehr sachlich über den ungeklärten Todesfall geschrieben, mich sogar gegen die Nennung des Namens des Opfers entschieden, jedoch angeführt, dass der alte Mann pflegebedürftig gewesen war und von einem mobilen Dienst versorgt wurde.
Die Angehörigen würden von Haases Tod profitierten – falls er nicht sein Geld einer Wohltätigkeitsorganisation vermacht hatte. Noch ein Grund, sich mit ihnen zu befassen!
»Das hat Sie überhaupt nicht zu interessieren!«, drang Müllers Stimme in mein Bewusstsein.
Um die Familie würde Franziska sich bestimmt auch kümmern. Sie war nicht so dumm, auf Biegen und Brechen an Janosch als Verdächtigen festzuhalten. Den ich ebenfalls in meinem Artikel nicht namentlich erwähnte, ich hatte nur von einem Angestellten des Pflegedienstes geschrieben.
»Was für unsere Zeitung noch gravierender ist als Ihr Vorpreschen in dieser Angelegenheit«, fuhr der Chef fort, »sind Ihre Versäumnisse in Ihrem eigenen Ressort.«
Nun hatte er meine Aufmerksamkeit. Die Feuilleton-Seite hatte ich eher nebenher erstellt, da konnte ich Fehler nicht ausschließen.
»Für den Kulturteil unseres Mitbewerbers hatten Sie wohl heute noch keine Zeit?« Wieder ein Ironie-Versuch. Dazu wedelte Müller mit einer Ausgabe der Dresdner Rundschau in der Luft herum.
»Leider nein«, sagte ich förmlich.
»Dann wissen Sie also immer noch nicht, was hinter der verschobenen Zauberflöte-Premiere steckt? Nachdem Sie bloß die Antwort der Pressesprecherin abgedruckt haben?«
Diese Ironie fand ich sehr amüsant: dass er mir hier vorwarf, mich mit der offiziellen Auskunft zufrieden gegeben zu haben. Etwas, was ich im Mordfall Manfred Haase seiner Meinung nach hätte tun sollen. Ich verkniff es mir, ihn darauf hinzuweisen.
»Anscheinend war es für Ihren Kollegen bei der Rundschau nicht allzu schwer, herauszufinden, dass Regisseur Kwia –« Er musste den Namen im Artikel nachlesen. »Kwiatkowski« auf einer extrem modernisierten Version der Oper besteht, was der Geschäftsführung der Semperoper nicht recht ist.«
Mist!, dachte ich. Das war wirklich eine Geschichte! Vor kurzem hatte die Unternehmensleitung der renommierten Oper gewechselt, und es hatte bereits Hinweise gegeben, dass es im kommenden Spielplan überwiegend gefällige Produktionen – man sprach von »klassischen Inszenierungen« – geben sollte. Aber dass die Geschäftsführung nun versuchte, in bereits geplante Produktionen dieser Spielzeit einzugreifen, war eine andere Hausnummer. Ich ärgerte mich enorm, dass ich mich mit den Worthülsen aus der Pressestelle hatte abspeisen lassen.
»Es geht hier um viel Geld – um die bereits langfristig gebuchten Tickets der Touristen, für die der Besuch einer schönen, klassischen Oper zu einem Dresden-Besuch dazugehört«, schwadronierte Müller.
Er hatte keine Ahnung, worum es ging! Um eine geforderte Marktfähigkeit der Kunst, um Verkäuflichkeit, um Einflussnahme. Ohne den Artikel in derKonkurrenzzeitung gelesen zu haben, wusste ich, dass deren Text in die Richtung gehen würde, die auch unserem Chefredakteur vorschwebte.
»Das hat Auswirkungen auf die ganze Stadt, auf Hotellerie, Gastronomie, lokale Händler«, entblödete Eisold sich nicht, anzufügen.
Martin probierte es wieder mit einem mitleidigen Lächeln in meine Richtung.
Früher hatten wir immer sicher sein können, dass Müller sich hinter seine Redaktion stellte, auch wenn es gerade zwischen Andy und ihm oft genug geknallt hatte. Im Zweifelsfall gab es stets Rückendeckung aus der Chefredaktion. Seitdem jedoch sowohl die Abonnentenzahlen als auch die Anzeigenerlöse stetig weiter zurückgingen, kuschte Müller immer häufiger vor der Geschäftsführung des Verlags. Und dieser unseligen Union klarzumachen, dass die Art Journalismus, die ihnen vorschwebte, nur noch mehr Leser kostete, war hoffnungslos.
»Sie bringen das ausführlich in der morgigen Ausgabe!«, wies der Boss an und wandte sich dem Wirtschaftsteil zu.
Das würde ich, auf jeden Fall.
*
»Du hörst dich gestresst an«, stellte Andy fest.
»Ich bin gestresst!«, gab ich zurück. Ich hielt den Telefonhörer zwischen Kinn und Schulter geklemmt und redigierte den Text eines freien Autors, der versuchte, die schlechten Zeilenhonorare durch extrem lange Artikel zu kompensieren. Fast alle guten Mitarbeiter hatten sich angesichts der Bedingungen mittlerweile verabschiedet. »Du hast ja keine Ahnung, was hier heute mal wieder los ist!«
»Also ich sitze gerade mit einem Milchkaffee vor dem Café Genuss in der Sonne. Das Leben als freier Autor kann doch sehr entspannt sein.«
Ich sagte, ich würde ihn daran erinnern, wenn er sich das nächste Mal über zu wenige Aufträge und gekürzte Honorare beschwerte, und fragte dann nach dem Anwalt, mit dem er es Anfang des Jahres zu tun gehabt hatte.
»Condèste? Der ist spezialisiert auf Cyberkriminalität. Ich nehme doch an, du fragst wegen des Musikers?«
»Ja.« Ich löschte eine weitschweifige historische Betrachtung aus dem Text.
»Da dürfte der kaum der richtige sein. Er ist auch nicht ganz billig.«
»Aber kann man sich darauf verlassen, dass ein Pflichtverteidiger einen ordentlichen Job macht?«
Mein Liebster lachte auf. »Kein Vertrauen in unser Rechtssystem? Oder wenigstens in Franziska?«
Nein, dreimal barockes Kleinod in einem Absatz war zu viel. Wieder betätigte ich die Lösch-Taste.
»Tja, ich weiß nicht. Muss ich dann wohl. Wenn ich Janosch jetzt irgendeinen Anwalt aus den Gelben Seiten raussuche, ist ihm auch kaum geholfen.«
Speichern und fertig.
»Erzähl mir mal was Schönes«, wünschte ich mir. »Ist der Kuchen im Café Genuss immer noch so gut?«
»Woher soll ich das wissen?«, gab Andy entrüstet zurück. »Ich übe mich natürlich weiterhin in Selbstdisziplin! Aber es dürfte dich amüsieren, dass ich auch deswegen hier sitze, weil die jungen Leute von heute einem nur noch Grünen Tee anbieten, während ich dringend Koffein brauchte.«
Ich lachte.
»Und dann hab ich vielleicht noch was für dich.«
»Lass hören!«
»Ich war hier in Trachenberge bei einer Art Selbsthilfegruppe für geschundene Altenpfleger – nichts Offizielles, ein paar Freunde, die sich gegenseitig Tipps geben. Und die sind sich einig, dass die Sorgenfrei, wo dein Janosch angestellt ist, eine ziemlich üble Organisation ist.«
Ich zog mit dem Cursor eine Meldungsspalte im digitalen Layout der Zeitungsseite auf. »Er ist nicht mein Janosch!«, wehrte ich ab. »Und keine Ahnung, wie das in die Geschichte passt, aber was sagen sie denn?«
»Dass die sich überhaupt nichts davon annehmen, wenn mal Klagen kommen, sondern für alles und nichts sind die Pflegerinnen und Pfleger verantwortlich. Außerdem beschäftigen sie fast nur Teilzeitkräfte, die sie nicht versichern müssen. Und es gibt eine sehr hohe Ausländerquote.«
»Da vermuten deine Grüne-Tee-Jünger, dass die gar nicht richtig angemeldet sind?«
»Genau. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen wie das abrechnungstechnisch gehen soll.«
Ich starrte auf die Meldungen, die ich in die Spalte hineinkopiert hatte, und die noch gekürzt werden mussten. »Keine Ahnung. Aber es würde sich lohnen, mal nachzuforschen.« Wobei ich keinen Zusammenhang zu »meinem« Janosch und dem Mord an Manfred Haase sah.
Wir verabschiedeten uns, und ich arbeitete konzentriert am Kulturteil. Den Artikel über die Zauberflöte-Inszenierung hatte ich fertig – inklusive Zitat von Kwiatkowski, dass er für Kommerz nicht zur Verfügung stehe, und der Semperoper das hätte klar sein müssen. Hartmut Müller würde nicht amüsiert sein, aber ich konnte weiterhin in den Spiegel gucken.
Als die Seite fertig war, gönnte ich mir eine Pause und ging hinunter in den ersten Stock, wo nicht nur die große Lokalredaktion saß, sondern auch der Leserservice. Hier trafen Briefe, Mails, Anrufe ein.
Dummerweise kannte ich den dicklichen, jungen Mann, der Dienst hatte, nicht. Er sah mich fragend an.
»Hallo, ich bin Kirsten Bertram.« Ich dachte, mein Name würde erklären, weshalb ich dort war. Er reagierte jedoch nicht darauf, also führte ich aus, dass ich wissen wollte, wer sich über meinen Artikel beschwert hatte.
»Ach, das!« Er grinste und gab etwas in seine Tastatur ein. »War gleich das Erste heute Morgen, als ich angefangen hab. Ich tippe auf Oberstudienrat.« Mit einer Handbewegung lud er mich ein, auf seinen Monitor zu schauen.
Der Absender hieß Leander Mehrendt, der Betreff lautete: Artikel betr. Tod Manfred Haase. In der Mail beschwerte er sich, dass … die Dresdner Zeitung den Tod meines geliebten Onkels Manfred Haase vor der Öffentlichkeit ausbreitet, während die Nachricht der Kriminalpolizei diskret zurückhaltend ist.
»Onkel«, murmelte ich.
»Ich muss solche Nachrichten an die Chefredaktion weiterleiten«, sagte der Mann entschuldigend. »Er droht ja auch mit Abokündigung, das wird zurzeit sehr ernst genommen.«
»Kein Problem, war ja mein Fehler«, sagte ich leichthin und fragte, ob er mir die Mail weiterleiten könnte.
»Logisch, mach ich sofort!« Meinen Namen hatte er sich gemerkt, schnell hängte er die Verlagsadresse an und schickte die Nachricht los.
Ich bedankte mich und stieg wieder die Treppe hoch, ohne im Lokalen auch nur Hallo zu sagen.
Leander Mehrendt. Im Telefonbuch stand er nicht, das wäre auch zu schön gewesen. Ich gab den Namen samt »Dresden« in die Maske der Onlinesuche ein – und hatte tatsächlich Glück. Zumindest gab es einen Leander Mehrendt in der Stadt, der Vorsitzender des Basketballvereins »Löbtauer Körbe e.V.« war. Und nun? Unter dem Kontaktlink fand ich eine Handynummer. Bei solchen kleinen Vereinen standen die Chancen nicht schlecht, dass es die des Vorsitzenden war. Ich wählte, hörte gleich darauf ein sonores »Mehrendt«.
Nervös räusperte ich mich und stellte mich vor, entschuldigte mich dann für den Artikel. Es sei mir nicht klar gewesen, dass er als Angehöriger die Lektüre als schmerzhaft empfinden würde. »Also, mein Beileid, und ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an.«
Anscheinend hatte ich ihn überrumpelt. Er murmelte, es sei in Ordnung.
Ich versuchte einen Vorstoß: »Ich habe gehofft, ich könnte mit dem Artikel dazu beitragen, dass das Verbrechen aufgeklärt wird.« Nach einer Pause, in der er nichts sagte, hängte ich an, das müsse doch auch in seinem Interesse sein.
»Selbstverständlich ist das in meinem Interesse! Ich würde es jedoch vorziehen, das der Polizei zu überlassen, zu der ich großes Vertrauen habe.«
Die Polizei. Leander Mehrendt hatte auch die Pressemeldung der Polizei gekannt. »Sind Sie – entschuldigen Sie bitte, aber: Stehen Sie mit der Kriminalpolizei in Verbindung?«
»Ich habe keine Ahnung, was Sie das angeht, aber in der Hoffnung, dass Sie mich in Ruhe lassen: Ja, das tue ich!«
Damit legte er auf. Frustriert starrte ich den Hörer an, als das Klingelgeräusch meines Handys in mein Bewusstsein drang. Ungehalten meldete ich mich.
»Kirsten?« Eine atemlos klingende, jugendliche Stimme. »Ich bin’s, Janosch.«
Sofort war ich wie elektrisiert. »Janosch, Hallo! Wie geht es dir?«
»Gut, super! Deshalb ruf ich an: Der Anwalt hat es sofort geschafft, dass die mich freilassen mussten. Ich bin so froh. Dank dir!« Hörte ich da einen Kuss durch die Leitung, oder hatte ich Halluzinationen?
Ich überlegte noch, ob ich sagen sollte, dass das ein Pflichtverteidiger war, und ich gar nichts gemacht hatte, da sprach er schon weiter: »Ich bin auf dem Weg nach Hause, ich muss jetzt dringend unter die Dusche. Aber ich wollte mich wenigstens kurz bei dir melden!«
Straßenbahngeräusche drangen bis zu mir; wir verabschiedeten uns, und ich saß wieder ratlos an meinem Schreibtisch. Janosch war also frei. Wobei er anscheinend selbst nicht wusste, warum. Oder doch?
Ausgerechnet heute hatte ich eine zweite Kulturseite zu füllen. Ich sichtete das Arbeitsaufkommen dafür. Wenn ich das Aufmacherfoto schön großzog, sollte ich in einer halben Stunde fertig sein. Für die Lokalredaktion hatte Martin nichts über den Mordfall eingeplant, aber natürlich sollten wir bringen, dass Janosch entlassen war.
Keinesfalls wollte ich Franziska in Schwierigkeiten bringen, indem ich öffentlich machte, dass ich in der JVA gewesen war, also schrieb ich nur eine Mini-Meldung, dass Janosch V. aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, und schickte sie Martin mit dem Hinweis: Falls ich noch was zu den Hintergründen erfahre, melde ich mich.
Ich griff nach meiner Tasche und lief die Treppen hinunter. Bis ich in seiner WG in der Johannstadt ankam, würde Janosch aus der Dusche sein. Für einen Sekundenbruchteil hatte ich seinen jungen, nackten Körper vor Augen. Schnell schob ich den Gedanken beiseite.
*
Erst, als ich vor dem Redaktionsgebäude stand, fiel mir ein, dass mein Fahrrad noch bei Dale in Pieschen stand – was in der Gegenrichtung zur Johannstadt lag. Kurz überlegte ich, ob ich nach einem Dienstwagen fragen sollte, dachte dann, dass ich mit den Öffentlichen schneller sein würde.
Der Plattenbau, in dem Janosch lebte, lag gleich um die Ecke der Bushaltestelle Gutenbergstraße. Er öffnete direkt nach dem Klingeln und empfing mich in der Wohnungstür. Noch immer waren ihm der fehlende Schlaf und die geweinten Tränen anzusehen, anders als am Morgen strahlte er voller Energie.
»Hallo, komm rein!« Für ihn schien mein Auftauchen in der Wohngemeinschaft das Normalste der Welt zu sein, und damit half er mir, nicht daran zu denken, was bei meinem letzten Besuch passiert war. »Ich mach mir gerade Suppe warm, willst du mitessen?«
Warum nicht, dachte ich. »Gern.« Ich folgte ihm, wobei an der Garderobe mein Blick in den Spiegel fiel und ich unwillkürlich registrierte, wie durchzogen mit grauen Fäden meine rotbraunen Haare mittlerweile waren.
Die Küche sah sehr sauber und ordentlich aus. Aus dem Topf auf dem Herd, neben dem noch die verschmierte, offene Konservendose stand, blubberte jedoch genau in diesem Moment rote Flüssigkeit.
»Mist! Die werden sich wünschen, ich wäre zurück im Knast, wenn ich hier gleich wieder alles einsaue!« Janosch grinste gewinnend und strich seine nassen Haare hinter die Ohren. »Setz dich!«
Kurz darauf löffelten wir die Tomatensuppe. Sie schmeckte entsetzlich laff. Ihn schien das nicht zu stören, er aß wie ein Verhungernder. »Im Gefängnis hab ich nichts runtergekriegt«, sagte er zwischen zwei Löffeln. »Mann, war das ein Albtraum!«
»Warum bist du freigelassen worden?«
Er zuckte die Achseln. »Keine Fluchtgefahr oder so. Ich muss mich auch täglich auf der Polizeiwache in der Altstadt melden. Vorbei ist es also noch nicht.« Der Gedanke verschattete seine Augen für einen kurzen Augenblick, gleich darauf blitzten sie jedoch wieder freudig. »Egal! Gleich geht’s zur Probe. Endlich wieder Musik machen!«
Unschlüssig, wie ich ihn dazu bringen konnte, noch ein bisschen zu bleiben, griff ich nach einer auf dem Tisch stehenden Pfeffermühle und würzte ausgiebig nach. »Warum bist du gestern weggelaufen?«, fragte ich ohne Umschweife.
Janoschs Teller war leer, er nahm den Topf und fuhrwerkte mit seinem Löffel darin herum. »Ich hab mal Scheiß gebaut«, sagte er wie nebenher. »Und da hatte ich Schiss, dass die mir einen Strick draus drehen.«
»Was für einen Scheiß?«
Aber er winkte ab, stand auf und stellte seinen Teller in die Spüle. »Sorry, aber ich muss los. Florian und Lukas warten bestimmt schon.« Ich könnte in Ruhe aufessen und dann einfach die Wohnungstür hinter mir zuziehen. Er verschwand in den Flur.
»Und was war mit dem Geld?«, rief ich ihm hinterher.
»Welches Geld?«, fragte er zurück.
»Das in Haases Wohnung fehlte!«
Er machte sich nicht die Mühe, wieder in der Küche aufzutauchen. »Ich weiß es nicht!«, tönte es herüber. Er klang beleidigt, als hätte ich ihm unterstellt, es genommen zu haben. »Das war immer in der Schublade.« Danach hörte ich, wie die Wohnungstür zufiel.
Mein erster Reflex war, ihm hinterherzulaufen. Dann aber dachte ich, ich sollte die Gelegenheit nutzen und sein Zimmer unter die Lupe nehmen. Zwar kam mir das selbst grenzwertig vor, aber wenn Janosch sich so seltsam verhielt …
Ich stellte meinen noch halb vollen Teller ebenfalls ins Spülbecken. Interessierte Janosch Haases Tod überhaupt nicht mehr? Und was hatte er auf dem Kerbholz? Wenn er vorbestraft war, gab es eine Akte. Ich musste unbedingt noch einmal mit Franziska sprechen.
Als ich in die Wohnung gekommen war, hatte der Flur ebenso ordentlich ausgesehen wie die Küche. Nun lag ein Paar Turnschuhe im Weg, und die Schublade einer Kommode war herausgezogen. Gegen meinen Willen musste ich grinsen. Ich ging in Janoschs Zimmer.
Für mein Porträt war ich vormittags hier gewesen. Nun schickte die Spätnachmittagssonne ihre Strahlen durch das verschmutzte Fenster und heizte den Raum auf. Dadurch wurde der typische Kunststoffgeruch verstärkt, den ich seit meiner Erfurter Zeit mit Plattenbauten verband. Ansonsten sah alles so aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Das breite Bett war ungemacht, und natürlich blitzten die Bilder von dem jungen Musiker darin wieder in meinem Kopf auf.
Eine Wand wurde von einem Regal eingenommen, in dem Janosch seine Habseligkeiten untergebracht hatte. Kleidung und Musikzubehör von Plektrum bis zu Drumsticks lagen aber auch sonst überall herum, in einem abgewetzten Lehnsessel wartete eine Gitarre.
Ich hatte keine Ahnung, nach was ich suchte.
Über dem Sessel hing eine Magnettafel voller Zettel und Fotos. Ein Bild des Zentralwerks fiel ins Auge, wo Janosch mit seinem JV Trio probte, mit Kontrabassist Florian Lohmann und Schlagzeuger Lukas Petz. Beide hatten an der renommierten Dresdner Hochschule für Musik studiert, und sie waren sehr gut – dennoch stach Janosch mit seiner Kreativität, seinem Ideenreichtum und seiner ganzen musikalischen Persönlichkeit heraus. Es hatte seinen Grund, dass der Trio-Name aus seinen Initialen bestand.
Über der Sessellehne hing eine Jeans, aus deren hinterer Tasche ein Zettel hervorlugte. Neugierig zog ich ihn heraus. Eine Carla hatte Janosch ihre Handynummer gegeben. Ich hätte gedacht, der Austausch fände nur noch elektronisch statt, mit diversen Emojis, aber Carla hatte sich mit Kuli auf Papier verewigt, dazu ein Herzchen gemalt. War sie ein Fan oder steckte mehr dahinter?
Ich notierte mir die Nummer, sichtete dann das Regal. Kleidungsstücke, ein paar Ordner, Bücher, ein Laptop. Eine Kiste voller Somewhere Across the Elbe-CDs für den Verkauf bei Konzerten. Eine der wenigen Einnahmemöglichkeiten, wie Janosch mir erzählt hatte.
Als ich überlegte, ob es Sinn ergab, den garantiert passwortgeschützten Laptop zu starten, hörte ich die Wohnungstür. Ich setzte ein harmloses Gesicht auf und ging in den Flur, traf dort auf einen jungen Mann.
»Hallo«, grüßte ich. »Ich hatte mich mit Janosch getroffen, und er musste weg. Da hab ich noch schnell –«
»Ja, er muss immer weg.« Das klang sehr schlechtgelaunt. »Sonst hätten wir ja auch mal eine Gelegenheit, ihm zu sagen, dass wir ihn bald vor die Tür setzen.«
»So schlimm?«, fragte ich leichthin.
»Kennst du ihn näher?« Der vielleicht 20-Jährige zog seine Schuhe aus und stellte sie ordentlich hin, wobei er Janoschs Sneaker mit einer unwirschen Bewegung zur Seite schob. »Kannst ihm gerne sagen, wenn er jetzt nicht endlich die Miete überweist, ist finito! Dann fliegt sein Plunder auf die Straße. Einen Nachmieter für das Zimmer haben wir schon.«
»So gut kenne ich ihn nicht«, räumte ich ein. »Aber ich weiß, dass er ein paar Probleme hat zurzeit.«
Der junge Mann ging in die Küche, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. »Klar hat er Probleme. Er hat immer Probleme.« Offensichtlich hatte er den verschmutzten Herd und das benutzte Geschirr in der Spüle gesehen, denn er hielt inne und seufzte laut.
4. Kapitel
Die App der Verkehrsbetriebe verriet mir, dass ich mit einmaligem Umsteigen nach Pieschen kam. Zwar würde ich eine halbe Stunde unterwegs sein, aber das gab mir Zeit zum Nachdenken.
Janosch war also dermaßen klamm, dass er seine Miete nicht zahlte – und anscheinend schon länger. Sprach das fehlende Geld aus Manfred Haases Wohnung doch gegen ihn? Wenn er richtig pleite war, konnten 300 Euro ihm schon ein wenig weiterhelfen. Andererseits hatte er immer so geredet, als interessiere Geld ihn überhaupt nicht. Und seine Eltern hatten eine Apotheke. Warum griffen sie ihm nicht unter die Arme?
Der Bus rollte an die Haltestelle, die hintere Tür öffnete sich direkt vor mir. Ich stieg ein und setzte mich auf einen der erhöhten Einzelsitze. Viel zu sehen gab es an der Pfotenhauer Straße nicht, und ich schloss die Augen, dachte zurück an meine erste Begegnung mit Janosch. Was ihn so anziehend machte, war sein Leben im Hier und Jetzt, wie begeisterungsfähig und in der Lage, andere zu begeistern er war. Flippig, chaotisch. Es passte, dass er Geldprobleme hatte. Und sich nicht groß davon beeindrucken ließ. Er war Andy – dem jungen Andy der Erfurter Zeit – ähnlicher, als ich bislang realisiert hatte.
Als ich die Augen wieder öffnete, fuhren wir am Trinitatisfriedhof vorbei. Von meiner Sitzposition aus sah ich viel Grün, dazwischen die Grabsteine. Wo würde Manfred Haase beerdigt werden? Und wann? Die Obduktion war ja anscheinend schon abgeschlossen.
Ob ich auf dem Weg zu Dale am Zentralwerk, wo Janosch mit seinen beiden Mitmusikern probte, vorbeischauen sollte? Oder eher versuchen, Florian und Lukas zu sprechen, wenn er nicht dabei war? Vielleicht eher Letzteres.
Das St. Benno-Gymnasium war ein echter Hingucker. Einmal hatte man in Dresden keine Angst vor moderner Architektur gehabt. Was wollte ich überhaupt herauskriegen über Janosch?, fragte ich mich. Wenn ich ehrlich war, ging es mir um eine Bestätigung meiner Einschätzung. Denn mittlerweile keimten da Zweifel an seiner Aufrichtigkeit. Denen musste ich nachgehen, ansonsten würde ich nicht ruhig schlafen können.
Mit der 13 fuhr ich über die Elbe. Auch nach all den Jahren hatte der Blick auf das Altstadtpanorama seinen Reiz für mich nicht verloren, und ich genoss die freie Sicht auf die Brühlsche Terrasse mit der Kunsthochschule. Dahinter ragte die gewaltige Kuppel der Frauenkirche auf, seitlich ging es mit der Hofkirche genannten Kathedrale weiter. Die jahrhundertealte Pracht hatte wie stets eine beruhigende Wirkung. Ich seufzte leise auf. Alles würde gut werden. Bestimmt war Janosch unschuldig.
*
»Ich sollte wohl eifersüchtig sein, dass du immer nur herkommst, wenn du Franziska sprechen willst«, meinte Dale. Wieder saßen wir in seiner Küche und hatten bereits ein wenig Smalltalk gemacht, bevor ich möglichst nebenher die Frage gestellt hatte, ob er sie noch erwartete. »Ich weiß nicht, ob sie noch vorbeikommt«, lautete seine Antwort.
So richtig eng war die Beziehung der beiden also nicht, registrierte ich, und erschrak ein wenig darüber, dass mir der Gedanke gefiel. Schnell erkundigte ich mich, was sein Termin bei der Secura gebracht habe.
»Ganz okay«, sagte er. »Ich habe sogar direkt einen Auftrag bekommen.«
»Na, siehst du! Ich wusste doch, dass sie nur die besten Erinnerungen an dich haben.«
Während er von Versicherungsangestellten erzählte, die er noch von früher kannte, merkte ich, wie schwer es mir fiel, bei der Sache zu bleiben.
»Janosch ist freigelassen worden«, platzte ich heraus, als er eine Pause machte. »Weißt du etwas davon?«
Dales Lächeln sollte wohl bedeuten, dass er mein Zurückkommen auf das Thema vorhergesehen hatte. »Nein, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Aber zum Abendessen kann ich dich einladen. Ich wollte mir gerade Pasta Verdure machen.«
Ich hatte den Eindruck, er wollte gern noch Zeit mit mir verbringen und freute mich darüber. Seit er wieder in Deutschland war, hatten wir kaum in Ruhe zu zweit gesprochen. Kurz darauf standen wir nebeneinander an der Arbeitsfläche und schnippelten Aubergine, Zucchini und Paprika, hackten Knoblauch und Zwiebeln. Nach all den Jahren waren wir in solchen Situationen vertraut miteinander; fast ohne Worte koordinierten wir die Abläufe.
»Lecker!«, meinte ich, als wir uns schließlich gegenübersaßen und zu essen begonnen hatten. »Um mich mit Tomatensuppe aus der Dose zufriedenzugeben, bin ich eindeutig zu alt – oder zu versnobt.« Ich erzählte ihm von meinem Besuch in Janoschs WG, schloss damit, dass seine Mitbewohner ihn herauswerfen wollten, weil er die Miete nicht gezahlt hatte.
»Da erscheint das Geld, das aus der Wohnung weggekommen ist, vielleicht doch in einem anderen Licht«, hängte ich an.
Dale sah skeptisch aus. Kannte er die Hintergründe? Wusste er doch mehr als ich – etwas, was Janosch entlasten könnte? Natürlich durfte Franziska auch ihm eigentlich nichts über ihre Ermittlungen sagen, aber vielleicht hatte sie ja eine Andeutung gemacht.
»Janosch sagt, er sei spät dran gewesen und deswegen früher als sonst bei Haase weg«, fuhr ich fort. »Demnach müsste jemand den alten Herrn danach vergiftet haben.«
Es klingelte. Dale murmelte eine Entschuldigung und stand auf, ging in den Flur. Gleich darauf kam er mit Franziska zurück in die Küche. Falls sie überrascht war, mich zu sehen, ließ sie es sich nicht anmerken, sondern grüßte nur knapp und setzte sich. Mit einem leisen Stöhnen streckte sie ihre langen Beine aus.
»Magst du etwas mitessen? Eine Portion ist auf jeden Fall noch da«, bot Dale an.
»Ja, gern. Und hast du einen Wein?« Das klang absolut neutral, an Dales Blick erkannte ich aber, dass es keine übliche oder auch nur häufige Frage war.
»Klar«, sagte er.
Wir hatten uns während des Kochens auf Mineralwasser verständigt. Nun stellte er drei Weingläser auf den Tisch, bevor er eine Flasche Barbera aus einem kleinen Gestell zog und öffnete.
Ich holte Franziska einen Teller und fragte mich, ob sie es wohl seltsam fand, dass ich so selbstverständlich in der Wohnung ihres Freundes hantierte. Sie schien mich jedoch gar nicht zu bemerken. Umstandslos beförderte sie die restlichen Rigatoni aus dem Durchschlag auf ihren Teller, löffelte die Beilage aus der gusseisernen Pfanne und gab Parmesan über alles, begann zu essen.