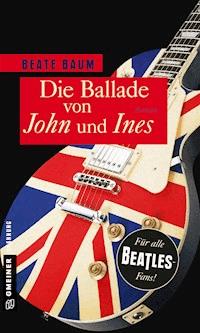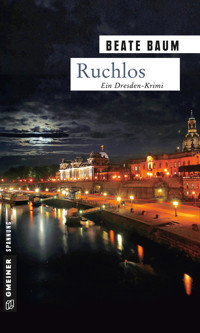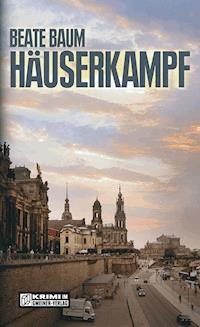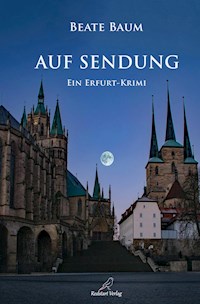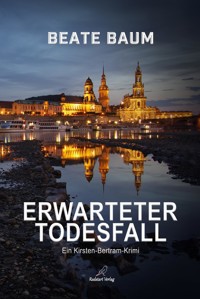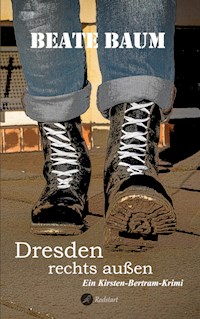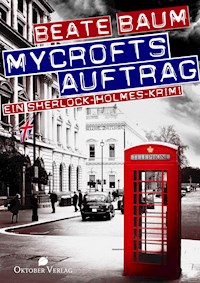Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Winter in Dresden. Journalistin Kirsten Bertram liegt im Krankenhaus. Dort lernt sie Marianne „Ännchen“ Kulka kennen, die von der Familie Erich Kästners abstammt und einer freikirchlichen Gemeinde angehört. Als Ännchen aus der Klinik entlassen wird, beschließt sie ihr Leben radikal zu ändern. Sie schließt sich einer Initiative an, die im Namen Kästners den Ausbau der Königsbrücker Straße in der Dresdner Neustadt verhindern will. Doch dann wird ein Praktikant des Erich Kästner Museums ermordet und Ännchen ist die Hauptverdächtige. Kirsten ist hingegen von ihrer Unschuld überzeugt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Beate Baum
Weltverloren
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/Korrekturen: Julia Franze / Doreen Fröhlich
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: timbec / photocase.com
ISBN 978-3-8392-3516-4
Vorbemerkung
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Während alle Informationen über Erich Kästner und die Familie seines Onkels Franz Augustin Kästners Buch ›Als ich ein kleiner Junge war‹ (Atrium Verlag Zürich 1996) und der anerkannten Sekundärliteratur (vor allem: Sven Hanuschek: Erich Kästner, rororo monographie, Reinbek 2004) entnommen wurden, ist die Familie Marianne Kulkas frei erfunden.
Ebenso ist die Dresdner Adventistengemeinde ein Produkt der Fantasie der Autorin. Was die Glaubensgrundsätze dieser christlichen Gemeinschaft angeht, so sind sie aus diversen seriösen Quellen zusammengestellt.
1. Kapitel
Ich konnte nicht weinen. Vielleicht lag es an den Medikamenten, die man mir gegeben hatte. Keine Schmerzen und keine Tränen. Vermutlich sollte ich froh darüber sein. Die etwa 30-jährige Frau im Bett neben mir schluchzte pausenlos. Ich wusste nicht, was ihr zugestoßen war, bislang hatte ich nur das Nötigste mit den Ärzten und Schwestern gesprochen. Keine Konversation, bloß das nicht.
Draußen schien eine blasse Morgensonne; die Luft, die durch das gekippte Fenster hereindrang, war eisig kalt. Ich steckte beide Arme unter die Decke und legte die Hände auf meinen Unterleib, wie so oft in den vergangenen 23 Wochen. Die Wölbung war fast verschwunden, der Bauch fühlte sich wieder nahezu flach an. Mit vorsichtigen Bewegungen streichelte ich den Baumwollstoff des Nachthemds, starrte dabei an die Neonröhre über mir.
»Was machst du denn für Sachen, Kicki?« Dale war neben meinem Bett aufgetaucht. Ich hatte nicht bemerkt, dass er das Zimmer betreten hatte. Er sah müde aus. Als er sich herabbeugte und mir einen Kuss auf die Wange gab, roch ich den kalten Qualm, der ihm anhaftete wie eine zweite Haut. Übelkeit stieg in mir auf wie eine Erinnerung.
Wieso war er hier? Warum nicht Andy?
»Es war ein Junge.« Ich räusperte mich, war nicht sicher, ob ich die Worte gesagt hatte, wiederholte sie.
Dale nickte. »Ich weiß. Es tut mir so leid.« Seine dunklen Augen schimmerten.
»Es war alles in Ordnung. Immer. Bei jeder Kontrolle. Die Fruchtwasseruntersuchung haben wir nicht machen lassen. Ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken, mich gesund ernährt, ich hatte keinen Stress. Alles war wunderbar.« Ich brach ab, als meine Stimme schrill wurde. Dabei hatte ich das Gefühl, etwas Schreckliches zu berichten, das jemand anderem passiert war. Meine Augen blieben trocken. »Gestern Morgen dann auf einmal diese Krämpfe. Ich war noch zu Hause. Krämpfe und Blut und –«
Dale setzte sich auf die Bettkante.
»Ich hab gleich den Rettungsdienst angerufen und Andy in der Redaktion. Und wir waren superschnell hier. Aber …« Ich drehte den Kopf weg. »Wo ist Andy jetzt? Warum ist er nicht hier?«
»Andreas kommt gleich. Alles in Ordnung.«
»Aber was – wieso?« Ich bemerkte, dass das junge Mädchen in dem Bett mir gegenüber den Blick vom Fernseher abgewandt hatte und fasziniert zu uns herschaute.
»Reg dich nicht auf. Die Ärzte haben ihn gestern irgendwann weggeschickt.« Ich nickte. Halb unterbewusst hatte ich noch mitbekommen, wie Andy die Tränen über die Wangen liefen, als er mich umarmte, bevor er den Raum verließ. »Danach hat er sich fürchterlich besoffen, ist zurück hierher und wollte unbedingt wieder zu dir.« Dale strich über meinen Arm. »Als es ihm verweigert wurde, hat er so lange randaliert, bis sie die Polizei gerufen haben.«
»Was?«
»Auf der Wache hatte er einen lichten Moment und hat darum gebeten, mich anzurufen.«
»Aber warum dich?«, unterbrach ich ihn. Dale war mein Exfreund, und das Verhältnis der beiden Männer nicht unproblematisch.
»Wegen meiner Kontakte zur Polizei?« Er zuckte die Schultern. »Weil ihm niemand sonst eingefallen ist mitten in der Nacht? Auf jeden Fall hat es funktioniert. Ich durfte ihn mitnehmen, weil ich versprochen habe, dass er erst wieder im Krankenhaus auftaucht, wenn er nüchtern ist.«
»Verstehe.« Die Frühstückstabletts waren schon vor Dales Ankunft abgeholt worden. Es musste fast neun sein. Wieder traf mein Blick den neugierigen des Mädchens und ich hätte sie am liebsten zusammengeschrien. »Schön, dass du gekommen bist«, wandte ich mich stattdessen wieder an den Mann, den ich vor vier Jahren für meinen chaotischen Kollegen verlassen hatte.
»Andreas wird auch gleich hier sein«, entgegnete er. »Ich hab ihn dazu verdammt, erst noch zu duschen und sich zu rasieren, damit die Schwestern ihn reinlassen. Aber er ist bestimmt schon auf dem Weg.«
*
Es dauerte noch über eine Stunde, bis Andy kam. In der Zwischenzeit hatte Dale sich verabschiedet und der Oberarzt mir bei der Visite versichert, dass ich den Abortus körperlich gut überstanden hatte. Dem jungen Mädchen war eingeschärft worden, nicht aufzustehen, und die Frau neben mir sollte eine höhere Dosis irgendwelcher Tropfen bekommen – vermutlich Beruhigungsmittel. Meine Frage, wann ich nach Hause konnte, war vage mit »in ein paar Tagen« beantwortet worden.
Wirklich nüchtern schien Andreas noch immer nicht zu sein. Seine grünen Augen waren nicht halb so strahlend wie sonst, die Bewegungen wirkten fahrig. Geduscht hatte er, rasiert war er auch. Er verströmte den frischen Zitrusduft seines Shampoos und den herb-süßlichen des Rasierwassers, aber als er mich küsste, meinte ich, durch die Zahnpasta hindurch Whisky zu schmecken. Trotz der Kälte draußen sandte seine Haut fiebrige Hitze aus.
»Ich wollte nicht gehen gestern«, war das Erste, was er sagte.
»Ich weiß. Komm her.« Ich zog ihn wieder zu mir herunter, hielt ihn ganz fest. Er drückte sein Gesicht an meins, und ich fühlte seine Tränen auf meiner Haut.
»Warum bloß? Warum? Warum? Warum!« Die Worte waren ein einziger Schmerzenslaut.
Ich streichelte seine noch feuchten, kurzen Haare und musste auf einmal daran denken, wie ich ihm gesagt hatte, dass er Vater werden würde. Zuerst war er geschockt gewesen, dann unendlich glücklich. In den folgenden Wochen und Monaten war er mit mir schwanger. Aß viel zu viel, verzichtete aber ebenfalls auf den Alkohol. Wurde fast so dick wie ich. Erst vorgestern hatte ich ihn – halb im Spaß, halb im Ernst – daran erinnert, dass bei mir ein Großteil des Gewichts nach der Geburt verschwunden sein würde. Er hatte etwas von ›Ungerechtigkeit‹ gemurmelt und am nächsten Morgen– gestern – auf das Frühstück verzichtet.
Vermutlich hatte er anschließend den ganzen Tag nichts gegessen, sondern nur getrunken. Dabei hatte er zunächst so schnell und umsichtig gehandelt, wie es nur möglich war, und die ganze Zeit sehr gefasst gewirkt. Erst als er gehen musste, war sein tiefer Schmerz zum Vorschein gekommen.
Jetzt, nachdem alles zu spät war, wusste ich nicht, wie ich ihn trösten sollte. Wie, wenn ich selbst nichts fühlte?
Keine Schmerzen und keine Tränen.
*
»Sie sind Journalistin?« Das Mädchen hatte die Lehne seines Bettes hochgestellt und blickte mich mit großen braunen Augen an.
»Bei der Dresdner Zeitung«, antwortete ich bloß.
Ich hatte keinen anderen Weg gewusst, Andreas zu beruhigen, als über unsere Arbeit zu sprechen, die Lokalredaktion, die er leitete und zu der er nun auf dem Weg war. Er musste sich in den Job stürzen, so würde er wieder Boden unter den Füßen spüren, da war ich mir sicher.
Die Jugendliche hatte – natürlich – unser Gespräch mitbekommen.
»So etwas würde ich auch gerne machen«, sagte sie mit einem kleinen dramatischen Seufzer. »Ich habe schon immer gern geschrieben.«
»Dann tun Sie es doch«, entgegnete ich und griff nach der Zeitschrift, die Andy mir auf meinen Wunsch hin noch gekauft hatte. Ich hatte keine Arbeit, um mich abzulenken, ich hatte diesen Teenager, der mit mir redete, auch wenn ich nichts als Ruhe wollte. Die Frau im Bett nebenan schlief jetzt, nachdem sie ihre erhöhte Medikamentendosis bekommen hatte. Nur ab und zu stöhnte sie noch auf.
»Daraus wird nichts.« Das Mädchen ließ sich nicht abschrecken. Mit einer Geste, die mir selbst so vertraut geworden war, strich sie sich über ihren bislang kaum gewölbten Bauch. »Ich bekomme das Kind und wenn es da ist, werde ich mich darum kümmern.«
»Aber –« Zum Glück wurde in diesem Moment der Wagen mit den Mittagessen hereingerollt. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht wissen, warum das junge Ding keine andere Zukunft für sich sah, als ihr Kind zu versorgen.
Ich stocherte in dem Kochfisch herum, aß den grünen Salat. Wieder traf mein Blick den des Mädchens.
»Sie mögen wohl keinen Fisch? Bei uns gibt es ganz oft welchen.«
»Soll ja gesund sein.«
»Ich mag ja auch lieber Broiler, oder«, sie kicherte albern, »Bratwurst. Aber Mami sagt, dass Schweinefleisch unrein ist. Fisch nicht. Fisch ist rein.«
Unrein? Rein? War sie Muslimin? Oder Jüdin?
»Hmm«, machte ich, in der Hoffnung, dass sie das ruhigstellen würde. Ein paar Minuten lang schien sie sich auf ihr Essen zu konzentrieren. Als sie den größten Teil verdrückt hatte, begann sie jedoch von Neuem.
»Sind Sie mit dem blonden Mann verheiratet?«
»Nein. Mit dem dunkelhaarigen auch nicht. Ich bin nicht verheiratet.« Ich begann, den Pudding zu essen.
»Oh.«
Sie guckte tatsächlich irritiert. Das konnte doch nicht wahr sein, dass es heute noch Menschen gab, die davon ausgingen, dass man verheiratet war, wenn man ein Kind bekam – Menschen, die halb so alt waren wie ich.
»Und denken Sie –« Das Mädchen brach ab.
Der Arzt hatte gesagt, ich könnte versuchen aufzustehen. Vielleicht schaffte ich es bis in die Cafeteria, um dort einen Kaffee zu trinken. Oder etwas Stärkeres …
»Denke ich was?«
»Sie haben doch Ihr Kind verloren, oder?« Wie ein verschrecktes Kaninchen schaute sie mich an.
»Ja.«
Die Frau neben mir stöhnte laut auf und begann nun doch wieder zu schluchzen.
»Dass es Gottes Wille war, dass Sie es nicht bekommen, weil Sie in Sünde –«
Wieder verstummte sie und ich fragte nicht nach, sondern drückte mich entschlossen aus dem Bett. Ich wankte, der Kreislauf spielte verrückt und jetzt schmerzte auch der Unterleib, aber es war auszuhalten. Bloß raus hier!
Einer der Schränke musste meiner sein, dort sollte ein Bademantel hängen. Andy hatte irgendwann am Vortag eine Tasche mit dem Nötigsten von zu Hause geholt. Während ich nach dem gelben Frotteestoff griff, schossen mir endlich die Tränen in die Augen.
»Es tut mir leid, hören Sie! Bitte – soll ich eine Schwester rufen?«
Die Schwester stand in diesem Moment schon im Zimmer, wahrscheinlich wollte sie die Tabletts abräumen.
»Was machen Sie denn da? Müssen Sie auf die Toilette?«
Ich nickte, drängte die Tränen zurück.
»Warum haben Sie nicht geklingelt? Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
Im Bad ließ ich mich auf das Klo sinken und heulte wie ein Schlosshund. Vergeblich versuchte ich, die Laute zu unterdrücken, beugte mich schließlich vor und drehte den Wasserhahn auf. Nach einiger Zeit klopfte es an der Tür und ich hörte die Stimme der Krankenschwester.
»Brauchen Sie noch Zeit?«
Das klang erstaunlich einfühlsam. Ich gab ein zustimmendes Geräusch von mir, legte das Kinn auf die kühle Keramik des Waschbeckens, hielt eine Hand unter den kalten Strahl. Vergeblich fragte ich mich, warum ausgerechnet diese dumme Äußerung des Teenagers den Schmerz freigelegt hatte. Ich wusste nicht, ob es einen Gott gab oder nicht, war mir jedoch sehr sicher, dass es ihm – falls er existierte – egal war, ob Menschen verheiratet waren, solange sie anständig miteinander umgingen.
Ich wollte zurück ins Zimmer gehen und dieses dumme Kind schütteln, sie fragen, woher sie solche Ideen hatte. Ich wollte weg, weg von ihr und aus diesem Krankenhaus heraus. Ich blieb sitzen.
Ein weiteres Klopfen an der Tür, die danach, ohne meine Antwort abzuwarten, einen Spalt weit geöffnet wurde. Das schmale, hübsche Gesicht des jungen Mädchens erschien, umrahmt von blonden Locken. Sie sah regelrecht verzweifelt aus.
»Entschuldigen Sie, bitte! Ich hätte das nicht sagen dürfen. Glauben Sie mir, ich wollte nicht –«
»Du sollst doch im Bett bleiben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe«, sagte ich müde. Wann hatte ich eigentlich damit begonnen, diesen seltsamen Teenager zu duzen?
Ich stand langsam auf und griff nach einem Handtuch, das ich als meines erkannte, trocknete meine Hand ab. Beim unbeabsichtigten Blick in den Spiegel registrierte ich, wie gesund meine rotbraunen Haare glänzten, wie voll mein Gesicht war. Nur die Augen wirkten so, als hätte ich nicht wenige Minuten, sondern viele Stunden geweint. Ich drehte mich um und machte einen Schritt auf die Kleine zu, schob sie zurück in das Krankenzimmer.
»Verzeihen Sie mir?« Sie wand sich unter meinem Griff hervor, und ich bemerkte, dass sie ein Hello-Kitty-Nachthemd trug, ganz in Pink. Sie sah aus wie 12.
»Ja, alles in Ordnung«, konnte ich gerade noch sagen, als die Tür geöffnet wurde und ein Paar Anfang, Mitte 40 den Raum betrat.
»Ännchen, du musst doch im Bett bleiben!«
Die Frau beschleunigte ihren Gang, als sie uns vor dem Badezimmer bemerkte. Sie trug Jeans und eine modische enge Strickjacke und ähnelte Nicole Kidman. Der Mann neben ihr fühlte sich unwohl in dieser Umgebung, das spürte man. In seinen Jeans und dem Holzfällerhemd wirkte er wie ein durchtrainierter Cowboy. Beide sahen ebenso wie ihre Tochter nicht im Entferntesten so aus, wie ich mir Menschen vorstellte, für die eine Partnerschaft ohne Trauschein Sünde war.
»Mami! Papi! Ich wusste gar nicht, dass ihr heute kommt.« Ännchen fiel ihrer Mutter um den Hals, ließ sich von ihr zum Bett geleiten.
Ich schaffte die wenigen Schritte zu meinem ohne Probleme.
»Wir können dich doch nicht so lange alleine lassen. Dann siehst du dir ja nur lauter dumme Dinge im Fernsehen an.«
Der Tonfall war der einer strengen Gouvernante, seltsam allemal bei einer so jungen Mutter einer Teenager-Tochter. Mit einem leisen Seufzer ließ ich mich auf mein Bett fallen, zog die Decke über mich und schloss die Augen, versuchte, das Gespräch wenige Meter entfernt auszuklammern. Was natürlich nicht gelang.
Ich bekam mit, dass der Vater – anscheinend ein Tischler – Vertriebswege für seine Möbel suchte; erfuhr, dass die Adventjugend Ännchen herzlich grüßen ließ und ihr ein selbstgemachtes Heft mit Losungen mitschickte. Hörte mir den Spruch für diesen verfluchten Donnerstag an: ›Glaubt Ihr nicht, so bleibt Ihr nicht‹. Konnte nicht umhin, darüber nachzudenken, was das bedeuten sollte, während Ännchens Mutter erzählte, dass sie für den Bibelkreis am nächsten Tag etwas über die Zerstörung von Sodom und Gomorrha vorbereitet habe.
Die Großmutter litt unter dem ungewöhlich kalten Winter, weshalb sie ihre Enkelin bislang noch nicht besucht hatte. Ein Sven tauchte auf, der jedoch keine besondere Rolle zu spielen schien. Endlich dämmerte ich weg und wurde erst wieder wach, als Ännchens Eltern aufbrachen. Danach stellte ich mich schlafend, um weiteren Gesprächen zu entgehen.
Abendessen um halb sechs – ich hatte vergessen, wie früh die Mahlzeiten in Krankenhäusern verabreicht wurden. Noch immer hatte ich kaum Appetit, aß eine halbe Scheibe Brot und wollte den Fernseher einschalten, was aber nicht ging.
»Sie müssen sich erst anmelden. Für Fernsehen und Telefon«, informierte Ännchen mich.
»Was?«
»Sie können es der Schwester sagen. Die erledigt das.«
»Ach, nicht so wichtig.«
Ich lehnte mich zurück und wollte wieder die Welt durch das Schließen meiner Augen ausblenden. Doch das Mädchen plapperte weiter: »Zu Hause haben wir gar keinen Fernseher, und hier hat Mami immer Angst, dass ich etwas sehe, was mich verdirbt. Sie wissen schon –« Ich wusste nicht und ich reagierte nicht. »Aber anmelden durfte ich es, sonst ist es ja auch zu langweilig.«
Ich nickte kaum merklich und nahm meine Zeitschrift zur Hand. Ännchen schwieg eine Weile, dann fragte sie leise, ob ich ihr wirklich nicht mehr böse sei.
»Nein«, murmelte ich.
Die Frau neben mir war zum Essen kurz wach gewesen, jetzt schien sie wieder zu schlafen. Hin und wieder schluchzte sie noch auf. Ännchen sah fern, mit Kopfhörern, sodass es halbwegs ruhig war im Raum. Hinter den Fenstern herrschte tiefste Dunkelheit, ein Spiegelbild meines Innern. Ich wusste nicht, ob Andy heute noch einmal zu Besuch kommen würde. Ich hätte es mir gewünscht, war auch davon ausgegangen; es konnte aber gut sein, dass er das Krankenhaus nicht mehr ertragen konnte. So wie ich ja auch.
Es war schon kurz nach acht, als eine vierte Frau in das Zimmer geschoben wurde, mit einem Tropf an ihrer Seite durch einen Schlauch verbunden. Sie schien noch narkotisiert zu sein, dennoch stöhnte sie laut und anhaltend. Ich lag in meinem Bett und starrte an die Decke, schließlich fasste ich einen Entschluss und stand mühsam auf.
Im Bademantel ging ich zum Schwesternzimmer. Dort saß ein junger Mann über eine Akte gebeugt. Ich teilte ihm mit, dass ich auf eigene Verantwortung entlassen werden wollte. Er schaute mich unwillig an, wies auf einen Stuhl am Kopfende des Schreibtisches und sagte, er würde den diensthabenden Doktor holen.
»Sie könnten sterben. Sie könnten nie wieder Kinder bekommen«, herrschte die ältere Ärztin mich an, die kurz darauf das Schwesternzimmer betrat, und musterte mich streng.
Ich dachte, dass sie diese Schreckens-Szenarien der Dramaturgie halber in umgekehrter Reihenfolge hätte anführen müssen, war aber alles andere als stolz auf mich. Solche Aktionen passten zu Andy, nicht zu mir. Mein Wunsch nach Alleinsein war jedoch so übermächtig, dass er alle Vernunft übertönte. Ich erwiderte nichts, sondern wartete nur darauf, die Papiere zu unterzeichnen. Anschließend bat ich darum, einen Anruf machen zu dürfen. Die Ärztin verschwand ohne weiteren Kommentar.
Bei uns zu Hause sprang der Anrufbeantworter an, in der Redaktion meldete sich Jonas, der hörbar unfähig war, zu reagieren. Er stammelte, wie leid es ihm tat, und dass Andreas bereits vor einer Stunde Feierabend gemacht hätte.
»Martin meinte, er sollte lieber zu dir ins Krankenhaus fahren. Ist er, ich meine – ?«
»Er kommt bestimmt gleich«, beruhigte ich den jungen Kollegen, lächelte den Pfleger vage an und wählte nochmals neu, bestellte mir ein Taxi.
*
Böhmische Straße. Im Herzen der Dresdner Neustadt. Gruppen junger Leute zogen über den Bürgersteig, auf dem Weg in die nächste Kneipe, ein Kino, einen Club. Ich bezahlte den Taxifahrer und schloss die Haustür auf, machte mich daran, das zweite Stockwerk zu erklimmen.
Die Wohnung war still, der Flur bis auf das durch die offen stehende Küchentür fallende Licht der Straßenlaterne dunkel. Ich stellte meine Tasche ab, zog den Mantel aus und lehnte mich an die Wand, um kurz Luft zu holen, schaute dann ins Wohnzimmer.
Es sah aus wie ein Schlachtfeld. Die Bücher über Schwangerschaft und Geburt, die ich in den vergangenen Wochen gelesen hatte, lagen auf dem Parkett verstreut, bei den Taschenbüchern waren Einbände zerrissen, die gebundenen Ausgaben anscheinend mit aller Kraft gegen die Wand geworfen worden. Dabei war eine gerahmte Fotografie – eine von mir gemachte Nachtaufnahme von London – herunter gefallen, die Glasscherben sprenkelten den Boden. Vor dem Sofa lag eine leere Whisky-Flasche.
Die Küche war unberührt. Im Arbeitszimmer – das in den nächsten Wochen zum Kinderzimmer hatte umgestaltet werden sollen – saß Andreas vor seinem Rechner und starrte auf einen Text. Er reagierte nicht, als ich hineinkam. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Ich wollte kommen, aber ich muss doch auch endlich mal die Reportage über die Arbeitsbedingungen in Kitas fertig kriegen«, sagte er, ohne mich anzublicken.
»Du musst dich nicht entschuldigen.«
»Ich hab nichts getrunken.«
Trotz der geschlossenen Fenster drang ein lautes Johlen von der Straße herein.
»Gut. Aber ich brauche jetzt etwas.«
Endlich stand er auf und nahm mich in den Arm. Zitterte er oder ich?
»Leg dich hierhin. Im Wohnzimmer sieht es grässlich aus.«
Ich ließ mich auf das Sofa sinken, auf dem wir unsere Übernachtungsgäste unterbrachten. Andy holte eine Wolldecke, hielt mit der linken Hand fragend eine Flasche Cognac hoch.
»Der Whisky ist alle.«
Ich nickte bloß, er verschwand noch einmal und kehrte mit einem Schwenker zurück, goss mir ein. Dann hockte er sich vor das Sofa auf den Boden, drehte mir den Rücken zu. Das einzige Licht im Raum war der Bildschirm, auf dem der Cursor blinkte. Ich nippte an dem Weinbrand. Nach den Monaten ohne Alkohol erschien mir der Geschmack beißend scharf, aber ich genoss die Wärme, die sich nach dem ersten richtigen Schluck in mir ausbreitete.
»Du solltest nicht gerade über Kitas schreiben.«
Er nickte bedrückt. »Vermutlich nicht.«
Lange Zeit schwiegen wir beide. Ich lauschte auf die Geräusche der Stadt und das leichte Surren des Rechners, spürte Andys Schultern an meinen Knien und war froh, hier zu sein. Der Bildschirmschoner schaltete sich ein und schickte den Cartoon eines Rockgitarristen in die Endlos-Schleife.
»Wir können es wieder versuchen«, sagte ich schließlich.
»Ja«, antwortete Andreas nach einer ganzen Weile.
2. Kapitel
Ich schlief bis weit in den Vormittag des nächsten Tages hinein und wäre wahrscheinlich noch länger im Reich des Vergessens geblieben, wenn ich nicht irgendwann registriert hätte, dass Andreas wiederholt ins Schlafzimmer kam.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!