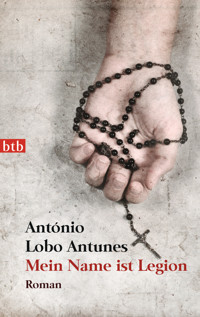9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sammlung Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Weise und leicht, traurig und poetisch, erbarmungslos und ironisch
António Lobo Antunes ganz privat: In 69 kleinen Geschichten, Phantasien und Reflexionen spricht der Autor von Kindheits- und Lebenserinnerungen, von Krankheit und Tod, von der Literatur und seiner Sicht auf die Welt. Er denkt über Sherlock Holmes und Virginia Woolf nach, über die Verbindung von Geld und Seele, die Harmonie der Welt, über die portugiesische Landschaft und über die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Ähnliche
António Lobo Antunes
Drittes Buch der Chroniken
Aus dem Portugiesischen vonMaralde Meyer-Minnemann
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem TitelTerceiro Livro de Crónicas bei Publicações Dom Quixote, Lissabon.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2005 António Lobo Antunes und Publicações Dom Quixote Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
ISBN 978-3-641-32183-3V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
Für meinen Onkel João Maria Machado d’Almeida Lima, der weiß, wie sehr ich ihn liebe.
Inhalt
Sie, im Garten
Gastarbeitertango
In der Hand eine Apfelsine
Irgendwann ist es so weit
Die Stille im Haus
Liebeschronik
Der Mechaniker
Der Knochen
Provinzbräutigam
Über das Leben der Marionetten
Auch das kleinste bisschen bringt was, sagte die Maus und pinkelte ins Meer
D.
Und das war’s
Aus dem Betttuch baumelt ein nackter Fuß
Ein schreckliches, verzweifeltes und glückliches Schweigen
Niemand ist ärmer als die Toten
Wer kein Geld hat, hat keine Seele
Augen, nicht glasklar, in der Farbe von Moos auf alten Bäumen
Das Herz & andere bittere Früchte
Ein Brief an Sherlock Holmes
Augusto Abelaira: Schriftsteller
Schokoladenmäuschen
Júlio Pomar: Maler
!
078 902 630RH+
Kleiner António, rote Nelke
Eine den Tauben zulächelnde Biegung des Flusses
Sie
Die Uhr
Geständnis des Lumpensammlers
Wie ich durch deine Hände starb
Eine Vase im Gegenlicht, darin ein kleiner Akazienzweig
Der Tod und andere Nichtigkeiten
Zwei und zwei
Virginia Woolf, die Uhren, Claudio & Bessie Smith
Traktat über die Dämmerungen
Weihnachtschronik
28.12.03
Erklärung für Hinz und Kunz
Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock
Ohey Silver
Chronik für Liebhaber von Jagdgeschichten
Unser fröhliches Häuschen
Dinge, die ich, wie ich beim Kofferauspacken bemerkte, aus Rom mitgebracht habe
Epistel des heiligen Antonius Lobo Antunes an die Leser
20. Februar, alle Freude der Welt
Chronik, die nicht nachts gelesen werden sollte
Mein Onkel Roby
Letzter Sonntag im Oktober
Eine Milchstraße aus Hähnen
Die Harmonie der Welt
Der Himmel ist auf dem Grund des Meeres
Das nächste Buch
Herz des Tages
Nur die Toten kennen Mafra
Chronik, bei der es mich einen feuchten Kehricht interessiert, wie sie geworden ist
Das gute Mitglied
Chronik für Tomar
Lokalkolorit
Der Tod eines Traums ist nicht weniger traurig als der Tod
Dalila
Gibt es ein Leben vor dem Tod?
Frohe Weihnachten, Senhor Antunes
Ein glückliches neues Jahr, Senhor Antunes
Wo die Frau eine glückliche Liebe erlebt hat, ist ihre Heimat
Hospital Miguel Bombarda
Die Vergangenheit ist ein fremdes Land
Es sollte Tränen regnen, wenn das Herz sehr schwer ist
Abrechnung
Glossar
Sie, im Garten
Von diesem Foto ist nicht viel übrig geblieben, die Szenerie hat sich fast vollständig aufgelöst, die Menschen beginnen zu verschwinden. Die Szenerie: die Ecke eines Gartens mit einer Steinmauer, weiter im Vordergrund links etwas, das wie Büsche oder Bäume anmutet, etwas, das wie Blumen aussieht, früher war alles schwarzweiß, jetzt braun und grau. Die Menschen: meine Großmutter, im Alter von fünf oder sechs Jahren auf dem Schoß ihres Vaters, ihre Mutter stehend, zu beiden heruntergebeugt. Meine Großmutter wirkt beinahe blond, hat wasserhelle Augen, trägt ein weißes Kleidchen, sitzt auf dem Schoß ihres Vaters, der seinerseits mit steifem Kragen und Schnurrbart auf besagter Steinmauer sitzt. Man kann erkennen, dass sein Haar schütter wird, man kann ein paar Falten erkennen, das Männern im mittleren Alter eigene Fehlen der Taille. Die Mutter meiner Großmutter hat eine Art Dutt oder so, und zwischen dem, was vermutlich das Kinn ist, und dem, was vermutlich die Nase ist, liegt der Schatten eines bemühten Lächelns. Ihre Pupillen haben standgehalten, sind deutlich zu sehen, ähneln den Plastikkreisen, mit denen uns die Plüschtiere anstarren. Keiner von ihnen späht zum Fotoapparat. Meine auf dem Foto durchscheinende Großmutter hat etwas von einer Vision oder einem Traumbild. Ihr fehlt jene wissende, freundliche Perversität, die artigen Kindern und den Figuren von Henry James gemein ist, wie ihr auch die Hälfte der rechten Hand und ein Teil des Armes fehlen. Der Kragen des weißen Kleidchens wird aus Spitze gewesen sein. Die Finger ihres Vaters ruhen auf ihrer Schulter. Als ich sie kannte, war sie die einzige Überlebende des Fotos, und ihr fehlte keine Hand. Die Eltern gab es weiterhin in getrennten Bilderrahmen, ernst, unerbittlich, mein Urgroßvater mit einem Ausdruck des Staunens. Ich habe immer mit seinen in einem Schrank verwahrten Orden gespielt. Er spielte abends mit seiner Tochter Billard
(damals gab es in den Häusern Billardzimmer)
während mein Großvater in der Uniform eines Kadetten der Escola de Guerra hoffnungsvoll unter dem Fenster aufund abging. Meine Großmutter sagte, dass sie die Gardine mit dem Queue wegschob, damit er sie sehen konnte. Ich habe meinen Großvater nie in Uniform gesehen: er trug ein Leinenjackett und las die Zeitung auf der Veranda. Ich erinnere mich immer an ihn, wie er auf der Veranda in Beira Alta die Zeitung las oder den Gewittern über dem Gebirge zusah. Er starb, als ich zwölf Jahre alt war. Ein schweigsamer Mann
(ich erinnere mich nicht an seine Stimme)
der dem Gewitter zusah oder Zeitung las. Was ich wohl von ihm geerbt habe, von seinem Blut? Er nahm überhaupt keine Notiz von mir, ich nahm überhaupt keine Notiz von ihm, und so waren wir quitt. Dann erfuhr ich, dass er gestorben war, und ich fing wahnsinnig an zu zittern: er war der erste mir bekannte Mensch, der gestorben war. Noch heute weiß ich nicht, was Sterben bedeutet. Wenn ich es recht bedenke, dann haben wir durchaus etwas
(nicht viel, selbstverständlich nicht viel)
Notiz voneinander genommen. Zumindest ist es mir lieber, zu glauben, dass es so war. Nach so vielen Jahren ist meine Mutter noch immer in ihn verliebt. Ich bin noch immer in meine Großmutter verliebt: sonntags aß ich immer bei ihr zu Mittag, sie nahm über dem Tischtuch mein Handgelenk. Noch heute kenne ich ihre Ringe in- und auswendig. Großmütterchen. Wie albern, Großmütterchen, sie hatte nichts von einem Großmütterchen. Wenn sie sich langweilte, ging sie im Zimmer auf und ab, groß, gerade, ernst. Sie redete uns mit
– Mein Sohn
an, gab mir aus einer Schatulle Geld, die, warum auch immer, auf dem Tisch des Hausaltars stand. Die Münzen kamen in Papierrollen. Und neulich bin ich unvermittelt auf Sie gestoßen, Großmutter, auf dem Foto, auf dem die Szenerie fast vollständig verschwunden ist. Auf der Rückseite kein Datum, kein Wort, diese lila Tinte, mit der die Verstorbenen in einer geneigten, preziösen Schönschrift mit feinen Aufstrichen und starken Abstrichen schreiben. Nur ein fünfoder sechsjähriges Kind auf dem Schoß des Vaters, und die Mutter stehend zu beiden heruntergebeugt, mit langen Ärmeln, einem langen Rock, etwas an der Frisur, das die Zeit verschlungen hat. In einer der oberen Ecken ein Baumwipfel, ein Vordach. Ein Baumwipfel. Nein, ein Vordach. Oder weder ein Baumwipfel noch ein Vordach, ein Jodfleck. Dem Vater meiner Großmutter sind, glaube ich, ein Schuh, die Fußknöchel und ein Drittel der Hose abhandengekommen. Drei ferne, aus Vergessen und Schweigen gemachte Gespenster. Vor allem aus Schweigen, und sie lösen sich langsam, gleichgültig in einer undeutlichen Wolke auf, ziehen sich jenseits der Erinnerung zurück, wo ich sie nicht erreichen kann. Die Steinmauer wird auch nicht mehr da sein, die Villa, zu der die Mauer gehörte, die Straße, in der die Villa lag, ebenso wenig. Aber das Mädchen ist immer noch da, blond, mit wasserhellen Augen und im weißen Kleidchen. Und keiner von ihnen lächelt, man hört die Billardkugeln im oberen Stockwerk nicht, es gibt keine Kadetten unter dem Fenster, keinen Queue, der den Vorhang wegschiebt. Mir fällt es schwer, mir meinen Großvater vorzustellen, wie er mit Ihnen flirtet, die Zeitung und die Gewitter aufgibt, um Ihnen den Hof zu machen. Das gezwungene Lächeln der Dame verfliegt allmählich, in ein paar Monaten werden vielleicht nicht einmal die Umrisse mehr da sein. Und irgendwann höre auch ich auf zu sein: interessiert es niemanden mehr, ist das für das Foto das Ende: der Kragen des weißen Kleidchens, der aus Spitze gewesen sein wird, die Finger, die auf ihrer Schulter ruhen. Irgendein Mann hat einen Fotoapparat mit einem Stativ in die Ecke des Gartens getragen, hat den Kopf unter ein schwarzes Tuch gesteckt, auf einen Knopf gedrückt. Er ist der Einzige, der nicht auf dem Foto erscheint, der Einzige, von dem ich nicht weiß, wer er war. Er setzte die Kunden in Szene, hat sie gebeten
– Machen Sie dies, machen Sie das
wahrscheinlich hat er die Haltung von jemandem korrigiert, sich des Lichts versichert, auf der anderen Seite des Apparats ein unscharfes, auf den Kopf gestelltes Bild überprüft, ist unter dem schwarzen Tuch wieder hervorgekommen
– Achtung
und er hat die Arbeit nicht einmal signiert. Dann hat er die Beine des Stativs zusammengeklappt, die Objektive in einem Kasten verstaut und ist gegangen. Außer der Szenerie gibt es hinter den Büschen oder Blumen oder Bäumen ein Stück leeren, nutzlosen, fernen Himmel. Es könnte der Himmel sein. Oder das Meer. Aber es könnten ebenso gut die Tränen des Fotografen sein.
Gastarbeitertango
Wann ist es so weit, dass ich zurück nach Hause, zurück zu dir fahren werde? Wird es das Haus noch geben? Wird es dich noch geben? Das Haus am Ende der kleinen Stadt
(fast am Ende der kleinen Stadt)
hinter der Eisenbahn? Wird es den Neger aus Ton mit der Melone noch geben, der auf der Kommode Saxophon spielt, neben ihm das Foto deines Vaters auf einer Seite und das Foto deiner Mutter auf der anderen, die mich beide, zum Glück im Rahmen gefangen, ernst, zornig anschauen wie einen Fremden? Den kleinen Clown aus Wäscheklammern, der den Fernseher ziert? Die gerüschte Überdecke, mitten auf dem Kissen mit ausgebreiteten Armen die Puppe, die mich hasst? Den undichten Wasserhahn? Tagsüber fiel es nicht auf, erst wenn wir ins Bett gingen, durchquerten diese monotonen, regelmäßigen, riesigen Tropfen die Dunkelheit, um mit gemächlicher Würde in der Spüle zu zerplatzen: Wird es die Tropfen noch geben? Das Getöse der Tropfen? Den Topf mit den Tüllbegonien? Ich habe nicht gesagt, ich würde für immer weggehen, ich sagte
– Fünf oder sechs Monate in Deutschland und dann komme ich wieder
und dein Gesicht wie das der Puppe, mit Pausbacken, jede Wimper einzeln für sich, Zähnchen
(zwei Zähnchen)
die aufblitzen, und, das frage ich mich jetzt, hasstest du mich ebenfalls, genau wie sie? Fünf oder sechs Monate in Deutschland in einer Fabrik arbeiten, und dann würden wir das Haus ausbauen, neue Möbel kaufen, die verglaste Veranda verlängern, den schrecklich schweren, schrecklich alten Schrank deiner Eltern durch eine Bambusvitrine mit Rauchglasscheiben ersetzen können, deren Türchen sich schließen lassen, und deine Eltern darin, nach hinten geschoben, fast unsichtbar, sie würden mich nicht mehr anschauen, will heißen, sie könnten mich nicht anschauen, da zwischen uns Gott sei Dank freundlich schützend ein Satz roter Gläser mit vergoldetem Fuß stehen würde. In fünf oder sechs Monaten
(oder neun oder elf)
würdest du etwas fülliger, hübscher sein, eine andere Frisur haben, den Mund leicht mit Lippenstift schminken, Ohrringe tragen, die mir gefallen, ein neues Auto anstelle dieser Rostlaube, ein kleiner Ring
(den hast du verdient)
mit einem Stein, der nicht unecht ist. Ich schreibe nicht viel, um bei den Briefmarken zu sparen, und die Worte
(sie sind so absonderlich)
sagen nicht, was ich dir sagen möchte, was du zu hören verdient hast. Im Oktober habe ich dich angerufen, und du wirktest fremd, gleichgültig, ein Satz hier, ein Satz da, als wäre jemand bei dir
– Ich kann jetzt nicht sprechen
und dann das Besetztzeichen, was mir
(nimm es mir nicht übel)
eigenartig vorkam, ich habe es Ulli erzählt
(einer deutschen Freundin, wir brauchen doch jemanden, mit dem wir gut auskommen, nicht wahr?)
und sie fand das auch eigenartig, riet mir
– Lass gut sein
(in etwa, aber auf Deutsch)
während sie zur Seite rückte, damit ich neben ihr auf ihr Korbsofa passte
(Ulli ist etwas korpulent)
und mit ihr eine Sendung über siamesische Zwillinge ansehen konnte, die am Bauch zusammenklebten, was ihnen das Gehen erschwerte; ich habe es mit Ulli versucht, und es ist tatsächlich beschwerlich, man läuft schräg, stößt gegen die Möbel, Ulli umarmte mich, damit wir uns besser aufeinander einstellen konnten, und nachdem wir aufgehört hatten, uns aufeinander einzustellen, holte Ulli zwei Dosenbier aus dem Kühlschrank, wir versuchten es noch einmal, nun schon etwas geübter, weniger angespannt, wir brauchten nicht den Chirurgen, der die siamesischen Zwillinge getrennt hatte, um uns voneinander zu lösen, Ulli behauptete irgendwas über die Latinos, was mir gut gefiel, ihr Doppelkinn zitterte ein wenig, sie wohnt über einem Tierarzt, und ich besuche sie sonnabends, bahne mir den Weg zwischen räudigen Hunden
(Ulli schwört, dass es in Deutschland keine Räude gibt)
und bis zum dritten Bier frage ich mich, wann ist es so weit, dass ich zurück nach Hause, zurück zu dir fahren werde, frage mich, wird es das Haus noch geben, wird es dich noch geben? Dich wird es sicher geben, auch wenn du jetzt gerade nicht sprechen kannst, der Neger mit dem Saxophon wird auf der Kommode warten, deine Eltern, jeder in seiner Ecke, der Wasserhahn stumm, weil irgendwer ihn repariert hat, Ulli zu mir
– Vergiss den Wasserhahn Nelson
und mit ihrer Hilfe und nach dem achten Bier denke ich nicht mehr an den Wasserhahn, der Wasserhahn soll zum Teufel gehen, jetzt sind es schon zwei Jahre
(neunundzwanzig Monate)
seit ich hier angekommen bin, und der Vertrag ist abgelaufen, ich fahre am Mittwoch zurück, es gibt einen Direktflug von München nach Lissabon, dann der Zug, und im Nu bin ich in Seia, der kleine Clown aus Wäscheklammern begrüßt mich
– Hallo
du mit einer Häkelarbeit im Wohnzimmer, aber du hast dich nicht verändert, bist weder etwas fülliger noch hübscher, die Frisur wie gehabt, der einzige Unterschied ist, dass du keinen Ehering trägst, du teilst mir mit
– Eine Kiste mit deinen Sachen steht unter dem Vordach
eine Kiste, die seit Ewigkeiten da steht, und meine Sachen sind hinüber, riechen eindeutig muffig, falls ich nach Deutschland zurückgehe
(sag mal ganz ehrlich)
glaubst du, dass Ulli mich wiederhaben will, auch wenn es nur einmal in der Woche ist, mit etwas Glück gibt es eine neue Sendung über siamesische Zwillinge, mit etwas Glück ein paar Dosenbiere, an denen man sich beim Öffnen die Nägel kaputtmacht, die Hunde in der Praxis, ein Gewusel aus Schwänzen, nicht Hunde wie bei uns, ein paar riesige Monster, und ich auf dem Korbsofa habe Sehnsucht nach den Tropfen, nach einer gerüschten Überdecke, nach der Puppe mit den ausgebreiteten Armen, die anfangs weinte, jetzt aber gleichmütig ist, ich muss hier eine Puppe kaufen
(besser, als niemanden zu haben)
und hin und wieder rufe ich dich an, denn man weiß ja nie, und vielleicht kommt irgendwann der Tag
(mit etwas Glück)
an dem du mit den Tüllbegonien allein bist, dein Gesicht wie das der Puppe mit runden Wangen ist, jede Wimper einzeln für sich, Zähnchen blitzen auf
(zwei Zähnchen)
und du mit mir reden kannst.
In der Hand eine Apfelsine
So. Will heißen, eine Hand hier, die andere etwas weiter unten. Beide Hände hier. Beide Hände weiter unten. Die Hand, die etwas weiter unten war, hier, die Hand, die hier war, etwas weiter unten. Dann nimmst du mein Gesicht, dann schließt du die Augen, dann küsst du mich. Dann rückst du von mir ab. Dann lächelst du. Dann wartest du darauf, dass ich lächle. Dann hörst du auf zu lächeln, weil ich nicht lächle. Dann so etwas wie Angst auf deinem Gesicht. Dann wirklich Angst. Dann
– Ist was mit dir?
und dann lassen mich die Hände los, zögern bei der Packung Zigaretten, geben die Packung Zigaretten auf, nehmen mich wieder. Will heißen, nicht eine Hand hier und die andere weiter unten, beide an meiner Taille
– Luísa
die Stimme wird kräftiger
– Ich habe dich gefragt ob was mit dir ist hast du das nicht gehört?
das Zipfelchen eines Lächelns in der Hoffnung, dass meines, das Zipfelchen eines Lächelns stellt fest, dass meines nicht, und erlischt, kein Erschrecken, Zorn und Angst
– Luísa
nur Zorn, einer der Finger fängt an, mir zwischen den Rippen und der Taille wehzutun
– Luísa
ich hatte diesen Mitesser auf dem Nasenflügel vorher nicht gesehen, der Mitesser macht mich neugierig, ich rücke näher, um ihn genauer zu untersuchen
– Wie konnte ich diesen Mitesser durchgehen lassen?
du verständnislos
– Was?
den Mund fast an meinem, atmest du zu mir herauf
– Machst du dich über mich lustig Luísa?
der Finger hört auf, mir wehzutun, bittet den Daumen, ihm zu helfen, mein Kinn zu halten
– Manchmal jagst du mir einen Schrecken ein, ehrlich
dein Mund an meinem, und meine Zähne schließen sich sofort, die Lippen schrumpfen, die Brust zieht sich zusammen, meine geöffneten Augen an deinen geschlossenen Augen, meine geöffneten Augen an deinen geöffneten Augen, wirklich merkwürdig, dein trichterförmig vorgestreckter Mund, der Trichter verschwindet
– Lachst du über mich?
der Mitesser ist wieder da und jetzt nur noch der Mitesser, nicht du
– Lachst du über mich?
gekränkt, wütend, der Mitesser macht dem Gesicht Platz und das Gesicht nur Augenbrauen
– Lachst du über mich?
ich möchte dich bitten, die Augenbrauen zu glätten, in denen Haare struppig abstehen, eines nach oben, zwei zur Seite, das längere der beiden, die zur Seite abstehen, grau, eine Art graue Locke, die Locke
– Ich hoffe es tut dir leid Luísa
fast ein Raunen, und zwar am Rande eines Schreis, der Schrei tritt an die Stelle des Raunens
kein richtiger Schrei, eine heisere Warnung
– Das wird dir noch leidtun Luísa
die Tür zum Flur knallt zu, ferner Lärm
(Schritte, eine Schublade oder so)
die Schlafzimmertür und Stille, ich in Frieden, ein Baum im Fenster, in dem es dunkel wird, die Wolken nicht mehr weiß, rosa, ziegelfarben, rot, der Baumwipfel wiegt sich gemächlich nach rechts und nach links, der dicht über den Dächern liegende Teil des Himmels lila, bald schon der Mond hinten bei der Brücke, wäre ich klein und meine Mutter hier
– Der Mond Luísa
wäre mein Vater hier, würde er sich hinter der aufgeschlagenen Zeitung verstecken, er Zeitung und Beine, die sich übereinanderschlagen, sich wieder nebeneinanderstellen, ein Stück Haut zwischen Strumpf und Hose, die Stimme hinter der Zeitung
– Was soll denn am Mond interessant sein?
und das Rascheln der Seiten, was soll denn am Mond interessant sein, tatsächlich, wen interessiert der Mond, meine Mutter pikiert
– Was soll denn am Mond interessant sein, sagt der da
und verstrubbelt mir das Haar mit einer Liebkosung, um mich zu ihrer Komplizin zu machen, und ihre Fingernägel machen den Vorschlag
– Wir beide gegen deinen Vater Luísa wir beide gegen deinen Vater
wir beide gegen die schlechte Laune, wir beide gegen die Zeitung, wir beide gegen Sie, Vater, verzeihen Sie mir, die Mutter hat mich gebeten, verstehen Sie, die Stimme hinter der Zeitung
– Sagt der da, so nicht, mehr Respekt, Isabel
meine Mutter ist Isabel, mein Vater João, ich bin Luísa, die Haushaltshilfe Adelaide, alle haben einen Namen, mein Gott, der ältliche Nachbar heißt Senhor Castanho, alle haben einen Namen, meine Großmutter, die im letzten Jahr gestorben ist, hieß Antónia, alle haben einen Namen, ich strecke mich auf dem Sofa aus, ziehe eines der Kissen zu mir, um den Nacken bequemer zu betten, ich erinnere mich an den Mitesser
– Wie konnte mir dieser Mitesser entgehen?
erst kommt der Mitesser und dann der Talg, und wenn der Talg kommt, ich
– Sag Bescheid wenn es dir wehtut
und wenn ich den Mitesser ausquetsche, dann quetsche ich dich aus, du ganz auf meinem Zeigefinger, ich zu dir, indem ich ihn dir zeige
– Der ist riesig nicht wahr?
fast so groß wie der Mond, fast so groß wie der Baum
– Was soll denn am Mond interessant sein?
fast so groß wie die rosa, ziegelfarbenen, roten Wolken, die die Dunkelheit allmählich verschluckt, und es gibt das Wohnzimmer nicht mehr, es gibt die Wohnung nicht mehr, es gibt keine Namen mehr, es gibt keine Luísa, es gibt mich, die ich auf dem Sofa liege, mich, schweigend, mich als Kind im Garten mit Zöpfen, in der Hand eine Apfelsine.
Irgendwann ist es so weit
Und irgendwann ist es so weit, dann beginnt man, mit dem Tod zusammenzuleben wie mit einem alten Freund: jemand sitzt dort auf irgendeinem Stuhl herum, freundlich, beinahe sympathisch, ohne uns zu stören, schaut uns, eine Zeitung auf den Knien, über die Brille hinweg an. Irgendwann ist es so weit, dann ist der Tod ein Familienmitglied, ein nicht besonders enger Verwandter, den man einlädt, wenn es am Tisch noch einen freien Platz gibt: wir nehmen ihn am anderen Ende des Tischtuches wahr, bescheiden, unauffällig, er isst mit uns, lächelt, wenn wir lächeln, stimmt beiläufig zu, geht als Erster
– Lasst euch bitte nicht stören
und wenn wir am Fahrstuhl angelangt sind, finden wir ihn dort nicht mehr vor, versuchen, uns an seinen Namen zu erinnern, und haben ihn vergessen
– Er liegt mir auf der Zunge
wir sehen im Album nach, und er ist die Person in der letzten Reihe auf den Gruppenfotos, von der Zeit halb ausgelöscht oder mit zu viel Schatten im Gesicht, man erkennt ein kleines Stückchen Hemd, die ordentliche Frisur, fast nichts. Irgendwann ist es so weit, dann lebt der Tod mit uns zusammen, wird alltäglich, eng vertraut, ist im Rasierspiegel, in unserem Tun, in der Art, wie wir den Schlüssel ins Schloss stecken, in die Wohnung treten, das Licht anmachen, plötzlich sind das Sofa und die Möbel da, und der Tod sitzt neben uns, schön still, er benutzt unseren Körper, unseren Husten, unsere Stimme, wiegt schwer in uns
– Irgendetwas, das ich heute Mittag gegessen habe, liegt mir im Magen
irgendwann ist es so weit, dann ist der Tod das Wasser in einem Abfluss, das Knacken einer Kommode, ein Winken oben hinter den Fensterscheiben, eine Art November, der die Nachmittage traurig macht, das Lächeln, mit dem man auf Fragen antwortet, die Fremden im Café, die so fern sind, ein Mädchen, dessen Blick durch uns hindurchgeht, das Alter, das plötzlich da ist
(– Ich bin tatsächlich alt, nicht zu fassen)
der Zucker im Blut, die Leberbeschwerden, das Cholesterin, das Bilirubin, die Seele, die, weiß der Himmel, Beulen bekommen hat, heftig pocht, wenn wir eine Jacke im Schrank finden, die uns nicht mehr passt, eine Jacke, die wir erst gestern
(oder, besser gesagt, vor zwanzig Jahren)
noch getragen haben, irgendwann ist es so weit, dann klingelt es an der Tür am Hauseingang
(– Wer das wohl ist?)
und niemand an der Gegensprechanlage, niemand im kleinen Quadrat, in dem in Schwarzweiß das Miniaturbild dessen erscheint, der klingelt, wir denken
– Wer das wohl ist?
und in dem Augenblick begreifen wir, suchen ein Eckchen im Sessel
(nicht den ganzen Sessel, ein Eckchen)
aus Furcht, dass die Dielen, obwohl niemand da ist, sich unter einem Gewicht biegen, die Teppichfransen verrutschen, das Gefühl, da waren Worte, doch da war kein Wort, irgendwann ist es so weit, dann sagt der Tod nicht einmal mehr
– Hallo
denn man sagt nicht
– Hallo
zu sich selber, anstelle von
– Hallo
wird es dunkel, wir stehen vor dem Rasierspiegel, und im Spiegel nichts als die Kacheln gegenüber, das Bord mit ein paar Flakons, die wir nicht mehr benutzen werden und die vielleicht der Mann der Putzfrau haben möchte, womit er uns hilft, Platz im Müllbeutel zu sparen, irgendwann ist es so weit, dann ist der Tod dies hier unter den Augenlidern, diese Falten, dieser Hals, kleine, unvermittelt äußerst wichtige Erinnerungen, Reminiszenzen, die Außenstehende zu Spott verleiten, aber für uns so süß sind, irgendwann ist es so weit, dann schreit man nicht, protestiert nicht, dann bleibt man stumm, unterwürfig, abwartend, in sich selbst verharrend wie ein Storch, der ein Bein anhebt, irgendwann ist es so weit, dann stellen wir nicht einmal mehr Fragen, täten wir es, würde keine Stimme antworten, irgendwann ist es so weit, dann heiße ich António Lobo Antunes und António Lobo Antunes zu heißen ergibt keinen Sinn, wer ist das, wer war das, der hat doch geschrieben, nicht wahr, was hat er noch geschrieben, er ist in einem Haus mit einer Akazie aufgewachsen, eines Tages verschwunden, nicht mehr zurückgekehrt, er muss irgendwo sein, egal, irgendwann ist es so weit, dann kommt nichts, nur sein Körper, was einmal sein Körper war, auf einem Krankenhausflur auf dem Weg zum Operationssaal oder so, womöglich so voller Leiden, dass er das Leiden nicht mehr spürt, nehmt nicht seine Hand, redet nicht mit ihm, lasst ihn, woran wird er dann denken, was sich wünschen, irgendwann ist es so weit, meine Damen und Herren, dann ist der Tod kein Familienmitglied mehr, nicht jener nicht besonders nahe Verwandte, den man einlädt, wenn es noch einen freien Platz am Tisch gibt, irgendwann ist es so weit, dann sind wir selber jener Verwandte am anderen Ende des Tischtuches, der als Erster geht
– Lasst euch bitte nicht stören
dann stehen wir auf Gruppenfotos in der letzten Reihe, von der Zeit ausgelöscht, mit zu viel Schatten im Gesicht, irgendwann ist es so weit, da sind wir nicht das Gesicht, sondern der Schatten im Gesicht, irgendwann ist es so weit, dann ist das Gesicht am Ende, der Schatten am Ende, irgendwann ist es so weit, dann ist die Wohnung leer, ein Buch halb ausgelesen, der Kugelschreiber liegt nutzlos auf dem Tisch, das Telefon läutet hartnäckig, verzweifelt, die Augen sind trocken, irgendwann ist es so weit, dann gibt es keine Zeit, dann hört der Infusionsbeutel auf zu tropfen, dann ist der Schrecken noch nicht zu Enttäuschung geworden, da tritt etwas an meine Stelle, wird etwas, bekleidet mit meinen Sachen, in einem Sarg zugeschraubt, irgendwann ist es so weit, dann scheint, nachdem man den überfahrenen Hund an den Straßenrand geschoben hat, die Sonne ohne mich.
Die Stille im Haus
Jetzt ist mir die Stille im Haus unheimlich. Seit ich es kenne, hat sich nichts verändert: nicht einmal die Bäume. Das heißt, meine Mutter hat den Brunnen abdecken lassen, und es gab, glaube ich, noch einen Feigenbaum, der näher am Fenster meines Zimmers stand, außerdem den Stall für die Hühner und den Truthahn direkt an der Mauer. Von diesen drei Dingen einmal abgesehen, ist der Rest wie immer, nur der Garten müsste gepflegt werden. Dieselben Steinstufen. Die Möbel. Die Betten sind selbstverständlich verschwunden, weil die Kinder verschwunden sind. Und es gibt auch den Schuster nebenan nicht mehr, Senhor Florindo mit seinen erhabenen Räuschen. Aber die Akazie
(wie hoch sie ist)
spricht immer noch dieselbe Sprache.
Nach dem Abendessen pinkle ich gern draußen gegen den steinernen Wasserfall, und mir ist dabei vollkommen bewusst, dass ich ein Terrain markiere: das hier ist meins. Es ist immer noch meins. Und durch die Zweige der Akazie der Himmel aus poliertem Basalt. Das Haus
(irgendwie eigenartig)
kommt mir mal groß, dann wieder klein vor. Von außen gesehen groß, ja, drinnen ist mir so, als wären Teile geschrumpft. Mein Zimmer beispielsweise. Das damalige Besuchszimmer, das fast nie geöffnet wurde. Aber das Zimmer meiner Eltern ist, warum auch immer, größer geworden. Meine Erinnerung an dieses Haus ist eine glückliche Erinnerung. Und ich fühle mich darin immer noch wohl, fühle, dass ich dort hingehöre. Ich schaue meine Töchter und die Töchter und Söhne meiner Brüder misstrauisch an
– Was machen die hier?
– Wer sind die da?
denn selbst die Jüngsten sind älter als ich. Unbekannte, Eindringlinge. Das Haus hört in unserem Innern auf, aber ein Teil von uns spielt immer noch im Garten Ball, daher
– Wer sind die da?
– Was machen die hier?
diese fremden Wesen, in denen unsere Gesichtszüge und unser Gebaren fortbestehen und die nicht nur wir, sondern unvollständige Puzzleteile von uns sind, die mit Teilen anderer Spiele vermischt sind und deren Selbstverständlichkeit mich überrascht, mit der sie so tun, als gehörte das Haus auch ihnen. Ich sage nichts, aber es gehört ihnen nicht die Bohne. Und ich bin nicht damit einverstanden, dass sie mit uns Ball spielen, ebenso wenig bin ich damit einverstanden, dass sie gegen den Wasserfall pinkeln: das Terrain ist bereits von mir markiert, also haut ab. Im Übrigen erschreckt mich der Tisch mit so vielen Tellern und Gläsern: Haben sie heute jemanden eingeladen? Wer ist hier im Haus? Falls die Puzzleteile die Frechheit besitzen, sich auf die Stühle zu setzen, schnappe ich mir meine Brüder, und wir essen in der Küche. Ehrenwort. Wo wir, das Ohr zu den Schritten meines Vaters gespitzt, rauchen könnten, dicht am Fenster, um bei der geringsten Gefahr die Kippe in die Gasse zu werfen und eine Unschuldsmiene aufzusetzen.
Ich sagte ja bereits, dass mir die Stille im Haus unheimlich ist: wenn ich es recht überlege, hat sich die Stille nicht verändert, und die Blütentrauben der Bougainvillea blühen immer noch über der Mauer. Es fehlt das laute Rufen der Mütter, die blinden Fadosänger, die Sackpfeife des Scherenschleifers, aber dafür kann das Haus nichts. Auch, dass der Milchmann nicht mehr mit dem Pferdewagen kommt. Aber vielleicht kommt er ja, wenn ich nicht da bin. Jeder Blinde hatte einen Besitzer, der ihn am Arm führte, die Liedtexte verkaufte und sehr ernst das Geld einsammelte, während der Blinde mit hochgerecktem Kinn hinter den dunklen Brillengläsern niemanden anlächelte. Ich stellte mir immer vor, dass die Blinden Geheimnisse kannten, zu denen ich keinen Zugang hatte, und dass sie desgleichen in Vierzeilern schaurige Verbrechen kannten, Frauen, die Monster gebaren
(auf dem Papier mit dem Text das Monster mit Fühlern, darüber Vater und Mutter des Monsters vollkommen normal, die traurige Geschichte des Monsters schreiend, vom Akkordeon rot unterstrichen, erzählt)
Frauen, die dem kommunistischen Russland, das die Heilige Jungfrau schmähte, Monster gebaren. Wenn meine Neffen so freundlich wären, den Mund zu halten, könnten wir in Ruhe diese Ungeheuerlichkeiten hören, ich würde die Sackpfeife des Scherenschleifers, an der kaputte Regenschirme hingen, noch beim Poço do Chão hören. Und falls der Wind günstig stand, würde man mitbekommen, wie der Schwan im Park schluchzte.
Also, ein für alle Mal, die Stille ist dieselbe. Das Haus ist dasselbe. Die Bilder sind dieselben. Das Leben ist dasselbe. Also, ein für alle Mal, das Haus gehört mir, und ich gehöre zu ihm. Ich erkenne die Gerüche, die Lichtspiele der Sonne, jedes Dielenbrett, jede Treppenstufe. Und wenn ich sage, dass ich die Gerüche erkenne, dann weiß ich, wovon ich spreche: vom Geruch des Bohnerwachses, der Flüssigkeit, mit der man die Türgriffe polierte, der Akazie, dem des anderen Baumes, der größer war, keinen Namen hatte. Ich möchte wetten, dass gleich der Hund der Gerberei bellen wird. Dass gleich die Bougainvillea beginnen wird, sich zu bewegen. Dass Senhor Manuel mitten in der Nacht vor Schmerzen jammern wird. Dass das Licht in den Fenstern ausgeht. Keine einzige Stimme mehr. Nur der rot-weiße Stock des Blinden
(tock, tock)
auf der Straße. Der Stock riesig, das Almosenkästchen mit einem Schloss. Das Akkordeon, das er über die Schulter gehängt getragen hat, wird auf die Brust gerückt. Die Finger tippen die Tasten auf der Suche nach einem Ton leicht an. Die Nase hochgereckt. Noch mehr Tasten. Der Besitzer des Blinden wird ungeduldig
– Na, was ist?
dann wird ein Mund, dem Zähne fehlten, unvermittelt riesig, und die Frau, die ein Monster gebar, rührt mich mit ihrem schlimmen Schicksal.
Ich frage mich heute noch, warum habe ich, verdammt noch mal, nicht das Glück gehabt, mit der Fähigkeit geboren zu werden, solche Gedichte zu schreiben anstatt Romane? Nein, keineswegs, wieso Ironie, ich meine das absolut ehrlich, Herrschaften: Warum habe ich, verdammt noch mal, nicht das Glück gehabt, mit der Fähigkeit geboren zu werden, solche Verse zu schreiben?
Liebeschronik
Jetzt beginnt die Zeit, in der sich der Tag, wenn es dunkel wird, in einer Art Licht fortsetzt, das lange braucht, bis es sich in den Bäumen, auf den Dächern, sogar in mir auflöst. Eine zarte, sanfte Helligkeit, selbst nachdem in den Fenstern das Licht angegangen ist, die Autos auf der Straße weniger werden, mein Sohn im Bett liegt. Die Augen meiner Frau sind anders. Ihre Gesten lockerer. Und dann sage ich
– Eunice
nicht zu ihr, zu mir, und ich bin zufrieden, finde, dass ich Glück habe, und bin zufrieden. Sage
– Eunice
sie, da ich leise gesprochen habe und sie es nicht richtig verstanden hat
– Wie bitte?
ich
– Ich habe gerade deinen Namen wiederholt
dies auf dem Sofa im Wohnzimmer, glücklich über die besagte zarte, sanfte Helligkeit, über diesen Tagesrest in den Bäumen
(eigenartig, wie die Sonne noch da ist, obwohl sie nicht da ist, wie die Sechsuhrnachmittagsbrise im Dunkeln bleibt)
ich klopfe mit der Hand auf das Kissen neben mir, lächle sie an
– Setz dich hierher, Eunice
denn ich bin zufrieden, finde, dass ich Glück habe, und bin zufrieden, der Arm meiner Frau an meinem Hals, ich frage mich, ob der Kleine wohl schon schläft, die Finger meiner Frau an meinem Ohr helfen mir, zu dem Schluss zu kommen, dass es so ist, ich drehe mich etwas zu ihr hin, und ihr Zeigefinger und ihr Daumen drücken mein Ohrläppchen
– Du Schlingel, du Schlingel
nach dem Zeigefinger und dem Daumen pflegt eine Zunge zu kommen, und sie kommt tatsächlich, die Zungenspitze ersetzt den Zeigefinger und den Daumen
– Du Schlingel, du Schlingel
ein Teil von mir verflüssigt sich, ein anderer belebt sich, ich fühle mich tatsächlich wie ein Schlingel, ein richtiger Schlingel, und die Teile, die sich beleben, beleben sich noch mehr, während die Zungenspitze den Daumen und den Zeigefinger ersetzt, und der Daumen und der Zeigefinger kneifen mich an der Nasenwurzel
– Du großer Schlingel
der große Schlingel ist weiterhin ihr zugewandt, die Hand, die auf das Kissen geklopft hatte, tastet jetzt ihr Knie ab, erreicht den Saum des Kleides, breitet sich auf dem Schenkel aus, meine Frau
– Ganz schön frech
gibt das Ohr auf, lehnt den Nacken ans Sofa, wird mit geschlossenen Augen auch ganz schlaff
– Mach schlimme Sachen mit mir du großer Schlingel
die Hand entdeckt geheimnisvolle Zonen, Länder, deren Ränder der Rasierapparat enthaart hat, meine Frau sagt schon nichts mehr, haucht nur noch, und im Hauchen
– Mein Gott
ich habe nie verstanden, was Gott hiermit zu tun hat, aber denke, dass jetzt nicht der Augenblick ist, das zu diskutieren
– Mein Gott
haucht sie, was ist schon daran, vor allem solange sie mit der Handfläche leicht über meine Hose streicht, wo eines der Teile, die sich belebt hatten, dermaßen belebt ist, dass ich Schwierigkeiten habe, es zurückzuhalten, vielleicht sollte ich etwas abrücken, um vorzeitige Konsequenzen zu vermeiden, vielleicht sollte ich ihr vorschlagen
– Warte
oder aber an den Zahnarzt denken, der, die Zange in der Luft, verkündet
– Dieser Backenzahn kommt raus
die Wirkung des Zahnarztes war so fulminant, dass jetzt nichts mehr belebt ist, meine Frau ohne
– Mein Gott
und ohne Hauchen, richtet sich auf dem Sofa auf
– Was ist los, Beto?
und statt
– Was ist los, Beto?
ein riesiges, fleischverschlingendes Lächeln, der Zeigefinger und der Daumen, die sich an meinem Ohr, an meiner Nase vergnügt hatten, in diesem Augenblick nicht aus Fleisch, aus Metall, gekrümmt
– Dieser Backenzahn kommt raus
ich weiche mit ausgestreckten Handflächen auf dem Sofa zurück
– Nein
ein
– Nein
bei dem es sich um ein Brüllen aus im Voraus gefühltem Schmerz, um Beklemmung, um Angst handelt, ich halte ihr Handgelenk fest
– Nein
mich überrascht, dass es sich letztlich nicht um eine Zange, sondern um ihre Finger handelt, ich berühre ihre Finger, und es sind wirklich ihre Finger, wie dumm von mir, meine Frau reibt ihr Handgelenk
– Du hast mir wehgetan, Blödmann
ihr Mund zittert, sie zieht ihr Kleid herunter, schiebt mich weg, sucht eine Zeitschrift auf dem, was sie einen Stütztisch nennt, eine Bezeichnung, die mich an Krücken erinnert, der Tag hat sich auf den Dächern, in den Bäumen vollends aufgelöst, die zarte, sanfte Helligkeit ist weg, ich ziehe ihr Kinn zu mir
– Komm her
und nichts, meine Frau in der Zeitschrift, ihre Stimme aus dem Inneren der Seiten
– Sei so gut und lass mich los
und wenn sie
– Sei so gut
sagt, bedeutet das, dass die Dinge nicht gut stehen, also sage ich
– Eunice
wiederhole
– Eunice
und die Zeitschrift zwischen uns, ich recke den Hals, um mich ihrem Gesicht zu nähern, gurre
– Bin ich nicht mehr dein kleiner Schlingel?
und Stille, ich lasse nicht locker
– Bin ich nicht mehr dein kleiner Schlingel, Eunice?
und eine noch längere Stille, nach der noch längeren Stille wechselt die Zeitschrift die Seite und knurrt
– Ein Esel bist du, verstehst du?
und eine neue Seite, eine neue Stille, diese Stille ist übrigens so lang, dass die Form des Sofas sich verändert, meine Beine sind zusammengepresst, ich habe die Lehnen eines verchromten Stuhles mit den Fingernägeln gepackt, jemand hat mir eine Art Lätzchen umgehängt, jemand beugt sich zu mir herunter
– Dieser Backenzahn kommt raus
und ich mit aufgerissenem Maul, schutzlos, leide Qualen, bemerke, dass meine Frau das Taschentuch aus der Handtasche gezogen hat, bemerke, dass sie die Tränen in der herausnehmbaren Beilage Wirtschaft & Finanzen zu verbergen versucht, wie zehn Minuten zuvor hauchend murmelt, nur ist es jetzt kein Hauchen, es ist schniefende Enttäuschung, meine Frau, während ich mir vorstelle, dass die Zange mein Zahnfleisch zerreißt, schluchzt
– Mein Gott.
Der Mechaniker
Als Picasso nach seiner Arbeitsmethode gefragt wurde, antwortete er
– Zuerst einmal setze ich mich hin
und auf ein Verblüfftes
– Ich wusste nicht, dass Sie im Sitzen malen
erklärte Picasso
– Nein, nein, ich male im Stehen.
In ebendieser Lage befinde ich mich jetzt mehr oder weniger, wo ich mir ein Pult besorgt habe und seit dem letzten Roman im Stehen schreibe. Ich sitze hier herum und warte, durchlebe die seltsame und irgendwie magische Zeit, in der das Buch sich fast gegen meinen Willen allein zu formen beginnt, angedeutete Fasern, zufällige Substantive schweben aufs Geratewohl hier und dort herum, Gerüche, Gestalten, die mal Schatten, mal Licht sind, Belangloses, das an Umfang zunimmt und am Ende doch nichts ist, etwas, was ich gehört, was ich erlebt, was ich erahnt habe. Im August habe ich Guten Abend ihr Dinge hier unten beendet und will in diesem Dezember einen neuen Roman beginnen: seltsam – noch nie ist es mir passiert, dass ein Roman angefangen hat, mir im Bauch Fußtritte zu versetzen, bevor ich die vorangegangene Geburt abgeschlossen hatte, und noch seltsamer ist es, weil es mir noch nie passiert ist, dass ich wie jetzt von außen durch eine wahre Geschichte befruchtet wurde, die ein Arzt mir erzählt hat. Der Arzt heißt Pedro Varandas und ist ein Mann, den ich achte und bewundere
(ich mag keine Menschen, die ich nicht achten und bewundern kann)
er sagte
– Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, die Sie vielleicht interessiert
setzte sich vor mich hin und schenkte mir das unverschämt schönste Liebesabenteuer, das ich je gehört habe. Das war im Juni, und seither haben mich seine Worte unablässig verfolgt, werden größer, werden kleiner, verändern sich, gruppieren sich mal so, mal so, fordern mich heraus
– Du kriegst uns nicht
laufen vor mir weg und erwarten mich weiter vorn, spotten
– Du kriegst uns nicht, oder?
kommen beinahe mitleidig zurück
– Na gut, hier nimm
und stieben wieder amüsiert, mit hämischem Gekicher davon, während ich Guten Abend ihr Dinge hier unten den letzten Schliff gab, so tat, als merkte ich es nicht, das Gekicher aber leise warnte
– Du wirst schon sehen.
Tatsache ist, dass ich nicht weiß, ob das Gekicher es schon sehen wird. In technischer Hinsicht ist das Material, das Pedro mir geschenkt hat, sehr schwierig, es verlangt eine feinfühlige Hand, und ich weiß nicht, ob ich sie habe, so intensive Gefühle, dass sie von der Rückseite her bearbeitet werden müssen, mit der Genauigkeit eines Uhrmachers, eine affektive Dichte, die eine zumindest glasklare Schreibweise verlangt. Wahrscheinlich nerve ich Sie mit diesem