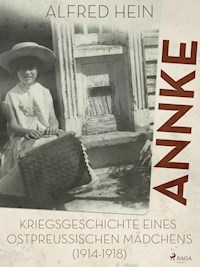Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Constanze Dornbühl hat es durch die Mithilfe ihres musikalisch hochbegabten guten Freundes Stefan Klodwig geschafft, in die Klavierklasse der Berliner Hochschule für Musik aufgenommen zu werden. Und dann spricht sie auch noch der große Dirigent Tasso Sempach an und verspricht ihr, sich für ihre musikalische Laufbahn einzusetzen. Constanze ist davon überzeugt, dass nun ihr großes Schicksalsjahr vor ihr liegt, das über ihr gesamtes weiteres Leben entscheiden wird. Doch was wird das Schicksal ihr bringen? Nur Gutes? Aber was wird wohl aus ihrem Bruder Egbert werden, der irgendwo im hohen Norden verschollen ist? Als ein geheimnisvoller Fremder im Frack Constanze zum Tanzen auffordert, spürt sie, wie sie seinem Zauber auf immer erliegt. Er heißt Wolfram Düwall, wie sich herausstellt, und ist der Flugzeugführer einer Nordpolexpedition ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Hein
Du selber bist Musik
Roman
Saga
Hauptpersonen:
Constanze Dornbühl
, Musikstudenten
Stefan Klodwig
, Musikstudenten
Charlo (Charlotte) Wildhofer
, Musikstudenten
Mirko Machaczek
, Musikstudenten
Wolfram Düwall
, Flugzeugführer einer Nordpolexpedition
Egbert Dornbühl
, Theaterintendant a.D., Constanzes Vater
Tasso Sempach
, Dirigent
Ilse Frühauf
, Constanzes Freundin
Egbert Dornbühl
, Constanzes verschollener Bruder
Die Handlung spielt in Berlin, Würzburg, bei Meersburg am Bodensee, in der Schwäbischen Alb, auf einem Gut in Thüringen und in der Arktis.
Erster Teil
I
Endlich — nach titanenwildem Ringen mit den immer wieder niederziehenden Mächten der Finsternis erklommen die nichts mehr vom Alltag wissenden Töne jene firnreine Höhe, von der hernieder man nur noch jauchzen konnte —: da ließ auch Constanze, dem Taktstockwink des Dirigenten gehorchend, mit dem ganzen Chor das Lied an die Freude aus ihrer Kehle jubeln!
Nach dem unirdischen Adagio-Ausklang des dritten Satzes schrieen noch einmal grell die Trompeten auf. Die Kontrabässe tobten die leisen Sehnsuchtstimmen nieder. Das Adagio wurde immer wieder flügellahm im Sturm der düsteren Stimmen aus der Tiefe. Dann — mit einem Male — begannen nur erst die Geigen leise zu singen: Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium — —
Sooft Constanze die Neunte Sinfonie Beethovens früher schon gehört hatte, immer stieg ihr die alles überwältigende Rührung in den Hals hoch, immer kamen ihr dann die Tränen, wenn also die Geigen zu flüstern begannen. Bis dann endlich Chor und Orchester aufjubelten —!
Und diesmal sang sie es selbst, das mitreißende Lied an die Freude! Sie entwich auf den Klängen, von Geigen und Flöten getragen, in die wie eine Nordlichtglorie aufstrahlende Verklärung, zu der Beethoven sich selbst mit dieser Sinfonie empor trug. Constanze fühlte: höher konnte kein irdischer Geist entrücken, wie es hier geschah.
Sie spürte plötzlich den Blick des Dirigenten auf sich gerichtet. Er sah, daß sie weinte. Ja, die Tränen rannen ihr die Wangen herunter, während sie ihrem kleinen Sopran die immer mächtiger anschwellenden Jubeltöne entlockte. Tasso Sempach dirigierte. Die Berliner Hochschule für Musik hatte ihn, den weit Gerühmten, als Gast von Hamburg herübergeholt; mit der Neunten Sinfonie sollten die Hochschüler, die im Orchester und Chor mitwirkten, das neue Jahr unter seiner sicheren Stabführung begrüßen. Constanze fühlte die Weihe des Augenblicks mit ganzer Macht.
Seid umschlungen, Millionen,
diesen Kuß der ganzen Welt.
Brüder, überm Sternenzelt
muß ein guter Vater wohnen.
Tasso Sempach beschwichtigte die Bässe und lockte aus den Geigen die letzte Süße. Er pflückte von den singenden Mündern mit bebenden Händen die inbrünstigen Worte voll sieghaften Glaubens. Sein kühnes Profil mit der mächtigen Hakennase ragte aus dem hintüber gereckten Haupt mit dem glatt zurückgekämmten schwarz glänzenden Haar empor, als öffnete sich die Kuppel des Saales —: und alle Sterne tauten hernieder in die klare Winternacht.
Jetzt, da der Chor die Worte anstimmte „Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, stimm in unsern Jubel ein —” da traf die singende Constanze, die nun keine Tränen mehr wegzuwischen brauchte, denn die zu tiefst überwältigende Rührung war verwunden — ein andrer Männerblick —: Brillengläser funkelten auf, hinter denen zwei dunkle große Augen von den Noten weg aus dem tiefer sitzenden Orchester zu ihr emporschauten. Ein kurzes Lächeln umzuckte den Mund des zu ihr aufblickenden Cellospielers. Es war Stefan Klodwig, ihr thüringischer Landsmann und ihr hilfsbereiter Freund, dem sie vor allem zu danken hatte, daß sie hier überhaupt mitsang. Stefan stand schon vor der Abschlußprüfung; als Schüler der Meisterklasse würde er sie natürlich glänzend bestehen. Seine Lehrer sagten ihm als Klavierspieler eine glänzende Zukunft voraus. Nebenher meisterte er noch das Cello und manches andere Instrument. Auch mit dem Taktstock wußte er umzugehen. Constanze dagegen —: nie hätte sie die Forderungen der Aufnahmeprüfung geschafft, hätte sie Stefan Klodwig nicht in seine Zucht genommen. Sie hatte vorher ein privates Konservatorium in Berlin besucht; dort lernte sie Stefan kennen, als er einen Lehrer vertrat. Sie gestand ihm ihren heimlichen Ehrgeiz, in die Klavierklasse der Hochschule für Musik aufgenommen zu werden.
„Nichts leichter als das!” hatte Stefan gelacht. Aber es wäre sehr schwer für Constanze gewesen, hätte sich der gute Stefan nicht ihrer angenommen trotz der Überlastung mit dem eigenen Lernen und Üben. Nun war sie sogar Schülerin bei dem unerbittlich strengen Professor Ignatz Dämpfinger. Und durfte im Hochschulchor singen:
Freude! Freude — —
Sie nickte Stefan nur für ihn bemerkbar zu. Und Stefan lächelte, während er unermüdlich weiter sein Cello streichelte.
O wie die Töne erlösten! So ins Erhabene entrückt, hatte Constanze noch nie ein neues Jahr begonnen. Der Himmel öffnete sich: mit seinem jauchzenden Licht alles andre in den Schatten zwingend, verbrauste — Tasso Sempachs hocherhobener Stab vibrierte, als wäre er mit elektrisierenden Kräften geladen — das über Zeit und Raum hinausstrebende Finale.
II
Immer wieder mußte Tasso Sempach sich verneigen. Der Beifall erfüllte brausend und prasselnd das silberweiß getünchte Gewölbe des großen Konzertsaales der Hochschule für Musik. Unentwegt klatschten an die hundert Ergriffene weiter, während die andern schon hinaus zu den Garderoben drängten. „Sempach! Bravo! Sempach! Sempach!” riefen sie. Und Sempach, der schon durch eine Seitentür entschlüpft war, mußte wieder hervorkommen. Er machte die allen Kapellmeistern brauchtumartig eigene Gebärde mit beiden Händen, die bedeutete: das Orchester möge sich erheben und den Beifall mit ihm teilen.
Die jungen Musiker erhoben sich. Mancher war so voll Eifer bei der Sache gewesen, daß er sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn wischte. Mirko Machaczek, der die erste Geige gespielt hatte, verneigte sich allerdings schon ganz mit Virtuosenallüren.
Als Sempach zum vielleicht zwölften Male hervorgeklatscht wurde, kam er durch die kleine Tür in den Saal zurück, die neben den das Podium krönenden riesigen silbernen Orgelpfeifen fast ganz verschwand. Vor der Orgel stand der Chor.
Sempach wollte auch den Chor ehren, impulsiv ergriff er die Hand eines Sängers und einer Sängerin. Als er sich, während der Beifall erneut lostobte, die Sängerin ansah, erkannte er, daß es zufällig jenes zauberhafte Mädchen war, dessen zu Tränen gerührte Ergriffenheit während des Freudengesanges ihn selbst gerührt hatte. Sie sah wie einer der ranken großäugigen Engel von Botticelli aus.
Constanze errötete bis in den schlanken Hals hinein. Schon wieder kamen ihr die Tränen.
Wie gut, daß gerade Stefan sie angrinste und pompöse Gesten machte —: o, welche Ehre, Constanze Dornbühl Hand in Hand mit Tasso Sempach, der Koryphäe! Da mußte auch sie lächeln, und die Rührung wich.
Sempach spürte aber doch, wie die schmale Hand in seiner Rechten bebte, während die Männerhand des Sängers seine Linke fest umschloß. Du gehst noch an der ganzen Musik kaputt, Mädel, dachte er, wenn du dich so besinnungslos ergreifen läßt.
Schließlich verebbte auch dieser Triumph. Sempach hatte Constanze noch besonders zugenickt, als er durch die Tür neben der Orgel verschwand. Nun sprang Stefan die Stufen des Podiums zu Constanze empor: „Du, Stanzerl,” sagte er, als ob er der junge Mozart wäre, und sah dabei Constanze so glückselig an wie dieser seine Constanze auf der Reise nach Prag, „Du, Stanzerl, nun wird gebummelt. Wir gehen in den Zigeunerkeller — das neue Jahr begießen und begrüßen.”
„Begrüßt hab ich es — eben. Ach, Stefan, war das schön! War — das — schön! Was der Sempach aus uns herausgeholt hat —”
„Nu ja, und nach der Arbeit das Vergnügen —” lachte Stefan Klodwig mit seinem großen, gutmütigen Mund.
„Arbeit? Vergnügen?” Constanze verstand nicht. Aber sie vergaß es immer wieder: Stefan, Charlo, Mirko — gerade die Meisterschüler wurden, obwohl sie so mitreißend spielten, innerlich schnell fertig mit ihrer Ergriffenheit. Es machte ihnen gar nichts aus, nach der Neunten Sinfonie in den Zigeunerkeller zu gehen und die leichten Weisen mitzusingen. Das war nun keineswegs Blasphemie; diese durch und durch mit großer Musik Erfüllten brauchten dann und wann das jäh Gegensätzliche, um sich selbst überhaupt ertragen zu können. Denn in ihrem Hirn wirbelte es vor lauter Üben und Studieren Tag und Nacht von klassischen Noten.
Constanze dagegen hatte sich während der Neunten Sinfonie ganz der großen Stimmung hingegeben; sie ließ sich von dieser Stimmung immer noch tragen. So schien es auch jetzt, als sie die Treppen des Podiums herniederschritt, als wenn sie wie auf Wolkenstufen schwebte. „Du bist ja noch ganz weg, Stanzerl,” sagte Stefan. Er schüttelte mit fast väterlicher Besorgtheit schmunzelnd den Kopf und rückte seine Brille zurecht.
„Ja, ich bin noch ganz weg, Stefan! Und darum grüß die andern — ich geh nach Haus!”
„Aber — aber — Constanze! Ich hab mich doch gerade auf dich so gefreut. Du kannst doch so lustig sein. Weißt du noch, wie wir das letzte Mal im Zigeunerkeller waren, wie du alle Nachbartische mit deinem Lachen anstecktest —”
„Damals haben wir aber nicht vorher die Neunte Sinfonie gesungen.”
„Ist doch Neujahr —” sagte Stefan etwas kleinlaut. „Spiel dich doch nicht auf. Dem Beethoven schadt’s nichts, wenn wir nach brav getaner Arbeit lustig sind. Ist doch Neujahr —”
Sie schritten schon hinter dem Podium den Korridor entlang zu den Künstlergarderoben.
„Da kommen sie endlich wie zwei Verschworene —” schallte es ihnen aus einem lustigen Schwarm entgegen. Das war Charlo Wildhofer, die so rief.
Doch zum Erstaunen aller gab Constanze Stefan jetzt die Hand: „Sei nicht böse, ich geh lieber heim!” Sie winkte den andern mit einem mühsam erborgten forschen Lächeln zu, flüsterte noch der völlig sprachlosen Charlo, mit der sie ihr möbliertes Zimmer teilte, beim Vorübergehen ins Ohr: „Komm nicht zu spät! Treib’s nicht zu toll —” dann riß sie Hut und Mantel vom Haken.
„Stanzi! Bist du verrückt?” schrie Charlo. Sie hatte endlich die Sprache wiedergefunden. „Stanzerl! Stanzerl! Bleib doch!” Das war Stefan. Und noch dann, als sie die Treppenstufen heruntereilte, die zu einem Nebenportal in die Fasanenstraße hinausführten, hörte sie die andern vom Ausgang nach der Hardenbergstraße her rufen:
„Constanze! Constanze!!”
Das war Mirko Machaczeks hart akzentuierte Stimme. Er schrie’s durch die hohle Hand in den Neujahrstrubel hinein, der rund um die Gedächtniskirche lärmte und kreischte.
Constanze war wie auf der Flucht. Sie schlug den entgegengesetzten Weg ein, der nach der Kurfürstenallee und weiter hinein in den tief verschneiten Tiergarten führte. Auch hier traf sie manchen ausgelassenen Trupp und manches lustige Pärchen, aber sie hörte die Witze nicht, die man ihr nachrief. Und als ein junger Dachs sich von seinen ausgelassenen Kameraden trennte, um ihr nachzulaufen, da blieb sie entschlossen stehen und maß ihn von oben bis unten mit einem solch kalten verächtlichen Blick, daß der Zudringliche sich buchstäblich schütteln mußte, als hätte er eine eisige Dusche empfangen.
Als sie dann den Landwehrkanal entlang schritt, wurde es immer stiller. Fernab rauschte der Neujahrstrubel nun so rhythmisch verwogend, daß man meinen konnte, es wäre Meeresrauschen. Wie von frischem Gold geprägt hingen Sterne und Mondsichel am Firmament. Das Mondlicht überhauchte den Schnee auf Wegen, Bäumen und Sträuchern mit bläulichem Leuchten.
Nein, es war kein Getue von ihr gewesen, als sie die andern allein in den Zigeunerkeller gehen ließ. Ihr war wirklich noch immer feierlich zumute. Und sie wurde sich jetzt klar: das bewirkte nicht nur der Nachhall der Neunten Sinfonie, sondern sie spürte dunkel, daß mit diesem Jahr auf solch feierliche Weise ein Schicksalsjahr begann. Sie fragte sich selbst, wie sie dazu käme, auf das unbeschriebene Kalenderblatt des 1. Januar das Wort „Schicksalsjahr” zu schreiben (sie schrieb’s jetzt wahrhaftig mit dem Absatz in den Schnee), aber sie ahnte: in dem kommenden Jahre wird mich irgendetwas von Grund auf verwandeln. Die Musik? Wird sie’s schaffen, eine wirkliche Künstlerin zu werden? So wie es Charlo war? Vielleicht. Mit Stefans Hilfe.
Der gute Stefan. Sie hat ihn heut gekränkt. Aber sie wußte, er verzieh ihr’s, wie er zu allem Ja und Amen sagte, schon wenn sie nur andeutungsweise den Wunsch aussprach.
Schicksalsjahr.
Sie hatte mit dem Absatz des linken Schuhs die Hieroglyphen in den Schnee gerade zu Ende gemalt, als eine gütige Männerstimme, denn es war für andere kaum leserlich, fragte: „Was soll das heißen?”
„Herr Professor Sempach—” schrak Constanze zusammen.
„Ach, sieh da, der Botticelli-Engel! Ich dachte, Sie feiern auch das neue Jahr im Zigeunerkeller mit. Aber was haben Sie da hingemalt?”
„Ooh, nichts!”
Sempach lächelte: „Merkwürdig, ein junges Mädchen malt einsam Rätselbuchstaben in den Schnee, während die andern dem neuen Jahr zuprosten.”
„Sie tun’s ja auch nicht.”
„Was?”
„Zuprosten —”
„Nein. Mir war nicht danach zumute. Und wie ich sehe, Ihnen auch nicht. Darf ich Sie ein Stück begleiten. Wohin gehen Sie?”
„Ach, nur so —”
„Schön. Dann gehen wir nur so.”
Eine Weile schwiegen sie. Constanze vor Verlegenheit und Stolz. Sempach vor Wohlgefallen.
„Ach, wenn die Musik nicht wäre —” seufzte Sempach, das Schweigen brechend.
„Das sagen Sie, Herr Professor?”
„Ja. Ich. Dann wüßte ich, was ich jetzt täte —”
„Darf ich fragen?”
„Ja, Sie dürfen, Botticelli-Engel! Ich ginge dann mit Ihnen in ein kleines Weinlokal. Es heißt „Alte Liebe”, mit einem Auto wären wir schnell dort —”
„Aber wir gehen nicht dorthin?”
„Nein. Erstens: weil ich nicht will. Zweitens: weil Sie nicht können. Ich will nicht, weil ich einsam und kalt bleiben muß, um — na ja, um meine künstlerischen Ehrgeize zu befriedigen. Und zu einem flirthaften Spiel ist mir der Botticelli-Engel zu schade. Und Sie — Sie können nicht, weil Sie mit Beethovens Neunter in den siebenten Himmel entrückt sind.”
„Können Sie Gedanken lesen?”
„Nein. Aber in Ihrem Gesicht. Warum haben Sie geweint?”
„Ich — geweint —?”
„Ja, während des Hymnus an die Freude. Als es begann: „Freude, schöner Götterfunken —”
Sie schritten über die Löwenbrücke auf die Siegessäule zu. Manchmal fiel mit sanftem Gleiten ein zu schwer gewordener Schneeklumpen von einem niederhängenden Zweig. Siebenfarbig umrandete Wolken zogen am Mond vorbei. Die lärmende Stadt versank immer ferner.
„Ach so,” Constanze lächelte Sempach an. Ihre großen Augen glänzten. „Ich heul immer an der Stelle. Ob ich’s nun hör oder mitsinge —”
„So, so.”
„Sie sagen das bedenklich wie ein Arzt.”
„Ganz recht, Botticelli-Engel!”
„Warum nennen Sie mich Botticelli-Engel? Ich heiße Constanze Dornbühl.”
„O wie nett.”
„Was ist da nett?”
„Na — Constanze — so wie Mozarts capriciöse Frau —”
„Ich bin, glaub ich, nicht capriciös.”
„Na?”
„Nein, wirklich —”
Sie mußten beide lachen. Ein Eichhörnchen schreckte aus dem Schlaf und sprang Otto dem Faulen, denn sie schritten schon durch die Siegesallee, auf den Helm.
„Also Constanze —” sagte Sempach. Und nach einer nachdenklichen Pause: „Hören Sie, Constanze, was soll aus Ihnen werden?”
„So Gott will, eine Könnerin auf dem Klavier.”
„Also Klaviervirtuosin? Hm.”
„Sie glauben es nicht?”
„Doch, doch —”
Constanze blieb stehen und sah dem Professor fest in die Augen. Wer weiß, woher sie den Mut dazu nahm. „Herr Professor, Sie haben mich noch nie spielen hören und sind schon ungläubig — Warum?”
„Weil Sie’s zu sehr ergreift. Und —” Sempachs Habichtgesicht lächelte gütig, „weil Sie zu schade sind, an der Kunst kaputt zu gehen. Sie sind zu Schönerem geboren!”
„Gibt es etwas Schöneres als die Kunst?”
„Manchmal für manche — ja.”
„Da kommt der 3er! Mein Autobus! Ich möchte nach Haus!”
„Ich komme mit.”
Sie sprangen auf den schon losfahrenden Autobus.
„Ja, Herr Professor?” fragte Constanze. Sie verstand nicht, daß Sempach solches Interesse an ihr nahm.
„Ich wohne immer, wenn ich in Berlin bin, in einem Pensionat am Bayerischen Platz,” erklärte er, den Anlaß ihrer Verwunderung erratend.
„Ich wohne auch dort! In der Salzburgerstraße —” sagte Constanze. Und als sie die Fahrkarten gelöst hatten, fuhr sie fort: „Das Jahr beginnt schön für mich.”
„Für mich auch, Fräulein Constanze. Entschuldigen Sie, Ihren Familiennamen habe ich vergessen.”
Constanze, mit einem Arm am Haltestrang hängend — sie standen im vollbesetzten Wagen einander gegenüber — lächelte.
Als sie am Wartburgplatz ausstiegen und Sempach Constanze heimbegleitete, fragte sie: „Was meinten Sie vorhin im Tiergarten mit Ihrer Antwort: „Manchmal für manche ja?”
Sempach antwortete nicht sofort. Dann sah er sie mit einem kalten harten Blick an: „Wer für die Liebe geboren ist, ist für die Kunst verloren. Und wer für die Kunst geboren ist, ist für die Liebe verloren. Sie aber sind so sicher für die Liebe geboren wie ich für die Kunst. Leider — für die Kunst, sage ich, wenn ich Sie anschaue in Ihrer beseligenden Anmut —”
„Herr Professor!” wehrte Constanze ab. „Ich will aber eine Künstlerin werden und pfeif auf die Liebe!”
„Wie alt sind Sie?”
„Einundzwanzig.”
„Ein — und — zwan — zig —” Sempach kostete die Zahl wie einen feurigen Wein.
Constanze blieb stehen. Sie waren vor ihrem Haus angelangt. Salzburgerstraße 10.
„Es wird Ihnen nichts nützen.”
„Ich werd Ihnen schreiben, wennn ich’s schaffe —”
„Gut! Schreiben Sie! Aber wundern Sie sich nicht, wenn ich erst nach Wochen und Monaten antworte. Ich habe selten solche Stunden frei wie diese.”
Constanze wußte nichts darauf zu sagen. Sie ergriff nur Sempachs Hand.
„Nun möchte ich doch Ihren Familiennamen wissen.”
„Constanze Dornbühl. Weshalb?”
„Bei wem lernen Sie?”
„Bei Professor Dämpfinger.”
„Oha — bei Ignatz! Großartig. Er ist mein Freund. Ich werd ihn bitten, sich Ihrer besonders anzunehmen.”
„Herr Professor —!” jubelte Constanze auf. Am liebsten wäre sie ihm um den Hals gefallen. Sie schüttelte ihm wenigstens kräftig die Hand zum Dank.
„Nun gehen Sie schlafen. Schlafen Sie gut ins neue Jahr hinein.”
„Danke, Herr Professor. Ich weiß, es wird mir Glück bringen. Auch Ihnen soll es Glück bringen — Gute Nacht!”
„Gute Nacht, Constanze Dornbühl!”
Als Sempach allein zum Bayrischen Platz weiterschritt, hielt er sinnend den Blick am Boden. „Vielleicht wirst du Glück haben, süßer Botticelli-Engel. Vielleicht —” dachte er. „Aber anders als du meinst. In der Liebe. Vielleicht. In der Kunst —?”
III
Constanze erwachte am Neujahrsmorgen mit einem großen Glücksgefühl. Zuerst war ihr, als hätte sie nur einen glücklichen Traum gehabt, von dem sie im Aufwachen — seine Bilder vergessend — nur noch den Duft in sich spürte, aber dann wurde ihr klar: das Glück blühte aus wirklichem Erleben. Das Gespräch mit Tasso Sempach im Tiergarten und hier vor dem Haus klang so beglückend in ihr nach.
Sie knipste den kleinen Rundfunkapparat an, den sie auf dem Nachttisch stehen hatte; ja, sie war zu guter Stunde aufgewacht, obwohl die kleine Pendeluhr im Zimmer nebenan 2 Uhr schlug, als sie sich ins Bett legte und sofort einschlief, selig wie als Kind. Aus dem Radio schallten ihr die frischen Kommandos des Gymnastiklehrers entgegen. Sie sprang aus dem Bett, öffnete das Fenster, das nur einen Spalt offen hatte, ganz weit und zog den Tüllvorhang vor, warf den Pyjama ab und machte brav die befohlenen Kniebeugen, Armschwingungen und Körperdrehungen. Sie hüpfte kunstgerecht zwischen den Möbeln hin und her. Plötzlich blieb sie erstarrt vor Charlos Bett stehen, das hinter einer spanischen Wand ganz im Winkel des Zimmers stand, während Constanze in der Nähe des Fensters schlief. Sie brauchte die frische Luft; Charlo dagegen fror leicht und hatte sich daher in ihre „Kabüse”, wie sie ihren Bettwinkel nannte, zurückgezogen.
Doch Charlo war in der Kabüse nicht zu finden. Constanze knipste den Rundfunk aus, warf einen leichten hellblauen Seidenmantel über, und öffnete die Tür nach nebenan, wo die „unheilige Cäcilie” auf einer Couch schlief. Die unheilige Cäcilie erhielt von Stefan Klodwig diesen Spitznamen, weil sie im Gegensatz zu Constanze und Charlo, die diese möblierte Wohnung sich gemietet hatten und darin nun (endlich ohne Wirtin!) selber wirtschafteten, gänzlich unmusikalisch war. Dennoch war das Zimmer, in dem Cäcilie schlief, voller musikalischer Dinge: das Klavier stand hier und Charlos Saxophon, Notenpulte, Notenständer und in zwei Regalen eine kleine musikwissenschaftliche Bibliothek. Dazu ein Rundfunkapparat. Und zu alledem: Schnurri, der fröhlichste aller Kanarienvögel.
Von all diesen Dingen hatten eigentlich nur die Couch, auf der Cäcilie Stumpf schlief, und dieser lustige Schnurri, der ihr persönliches Eigentum war, etwas mit ihr zu tun. Ansonsten war Cäcilie völlig unmusikalisch, konnte mühsam „Fuchs, du hast die Gans gestohlen” richtig singen (allenfalls im Chor traf sie den rechten Ton) — gerade deshalb war sie die herrlichste Wohngenossin für die andern beiden. Oft, wenn Constanze und Charlo den ganzen Nachmittag abwechselnd geübt hatten, schmiß die temperamentvolle Charlo dann abends die Tür zu: „Ich kann den ganzen Schmeißdreck nicht mehr sehen!” (Charlo war nicht sehr wählerisch in ihren Ausdrücken.)
Dann lachte Cäcilies rundes frisches Bubengesicht so hell auf, daß ihre lustigen Augen, deren Iris immer in einem unbestimmbaren Grüngraublau schillerten, ganz klein wurden: „Mich stört der Kram nicht. Gegen den Maschinenlärm in unsrer Fabrik ist das, was ihr beiden Lämmerchen vollführt, ein lustiges Gequieke!”
Constanze fuhr dann mit gemachter Empörung auf: „Unerhört! Wenn Charlo Wildhofer — „die” Wildhofer, wie es schon in der Hochschule höchst prominent heißt — eine Beethovensonate spielt, daß man ganz elektrisiert ist, das nennt die unheilige Cäcilie „lustiges Gequieke”. Wie kam denn deine Mutter darauf, dich nach der Schutzpatronin der Musik Cäcilie zu taufen?”
„Sie hatte gerade einen Roman gelesen, in dem die Heldin Cäcilie hieß —”
„Ein neuer Beweis für die Verwerflichkeit aller Romanlektüre —” schrie Charlo dann; sie lag schon im Bett, knabberte Kekse und las einen so recht spannenden und blutrünstigen Kriminalroman.
Cäcilie aber gab es Charlo zurück, indem sie ein Lied anstimmte, das sie einmal hatte Constanze singen hören und das ihr sehr gefiel, weil es nach ihrer Meinung so schön traurig klang: „Die Sonne scheint nicht mehr” von Brahms.
Sie sang es so falsch, daß Charlo meinte, die Mitbewohner dieses ehrenwerten Gartenhauses, allwie man in Berlin die Hinterhäuser dezent bezeichnet, würden glauben, die „drei Cikaden” (so bezeichnete sie sich, Constanze und Cäcilie, weil aller dreier Namen mit „C” anfing) hätten sich einen kleinen Hund angeschafft, der besonders schön zu jaulen wüßte.
Cäcilie Stumpf hatte die Neujahrsnacht verschlafen. Sie war Laborantin in einer chemischen Fabrik und hatte die letzten Wochen mit Überstunden arg an ihre Arbeit herangehen müssen. So war ihr die Silvesternacht eine willkommene Ruhenacht gewesen.
„Ein gutes neues Jahr, Cillychen!” Constanze setzte sich mit diesen Worten behutsam auf die Couch und streichelte Cäcilie eine herabgefallene blonde Strähne aus der Stirn.
Cilly gähnte, dehnte ihre robusten Rekordschwimmerin-Arme und sagte schlaftrunken: „Prost Neujahr, Stanzi!”
„Wo mag Charlo stecken?” fragte gerade Constanze, da erhob sich auf der Treppe des Gartenhauses ein ziemlich toller Lärm. Bald darauf klirrten Schlüssel im Schloß und, von Stefan mit Vorsicht aufrecht gehalten, erschien Charlo auf der Szene, einen Luftballon am Hut und um den Bauch eine Girlande von bunten Papierschlangen gewunden.
„Da bist du ja endlich, Stanzi,” sprach Charlo etwas stockend und mühsam und sah ihr mit starr aufgerissenen Augen ins Gesicht. „Pupille!” schrie sie. „Pupille!”
„Aber Charlo —” versuchte Constanze zu lächeln. An sich tat ihr Charlo leid.
„Sie wollte nicht aufhören! Immer noch ein Glas Sekt —”
„Immer noch! Jawoll! Immer noch mal rum, du Kleine — Constanze, hör mal zu! Kennst du den? Hat Stefan erzählt. Dein kreuzbraver Stefan.”
Stefan winkte beschwichtigend ab: „Sie weiß ja kaum, was sie redet. Übermüdet.” Aber er war rot geworden, als Charlo zu Constanze mit eigentümlicher Betonung „Dein kreuzbraver Stefan” sagte.
„Stanzi, kennst du den? Hat Stefan erzählt,” begann Charlo von neuem; sie hatte sich in den großen Lehnsessel an der Balkontür geworfen. Draußen ging die Sonne auf. Der Schnee funkelte rot auf den Dächern. Also hör zu: Eine Grräfin, eine feine Grräfin fragte Max Reger bei einem Konzert, ob die Fagottbläser diese dunklen bizarren Tonfiguren — diese dunklen bizarren Tonfiguren, sagte sie — oho! — mit dem Mund vorbrächten. Worauf Max Reger verlautbaren läßt: „Das will ich stark hoffen.”
Charlo schlug eine riesige Lache an. Als sie von neuem „Stanzi, kennst du den?” immer schlaftrunkener lallte, packten Constanze und Cilly sie kurzerhand, transportierten sie ins Schlafzimmer, zogen sie aus und legten sie ins Bett.
Charlo schlief sogleich ein. Ohne ein Wort.
Als die beiden andern wieder ins Balkonzimmer zurückkamen, war Stefan fortgegangen.
„Der hatte auch ein schlechtes Gewissen,” sagte Cäcilie.
Constanze aber ging in die kleine Küche und bereitete das Frühstück. In dieser Woche hatte sie Küchendienst.
Nach dem Morgenkaffee lief Constanze allein durch den Schöneberger Park. So sehr sie sich auch über Charlos Schwips wunderte, wußte sie zu genau, daß Charlo in ihrem kleinen Finger mehr musikalisches Talent besaß als sie selbst in beiden Händen. Constanze mußte sich alles mühselig erringen. Gewiß, auch Charlo übte fleißig — doch sie konnte alles bald, was sie können sollte, und es waren sehr schwierige Musikstücke. Constanze konnte dagegen kaum das, was sie können mußte. Nun war ihr Probesemester um. Wird Professor Dämpfinger sagen: Sie dürfen bleiben? Oder wird sie bei Semesteranfang ein höfliches Schreiben des Hochschuldirektors vom Sekretär in Empfang nehmen müssen. „Da ihr Können den Anforderungen der Staatlichen Akademischen Hochschule für Musik nicht genügt, bitten wir Sie, Ihr Studium an der Hochschule aufzugeben.” Constanze scheuchte die bangen Gedanken fort. Ist ja Unsinn! Dann hätte Dämpfinger es ihr längst angedeutet, daß sie wieder lieber ins Privatkonservatorium gehen solle. Doch — mit Stefans Hilfe — hatte sie die aufgegebenen Sonaten und Etüden so gut geübt, daß sie sogar diese und jene ohne Noten vorspielen konnte. Und Dämpfinger hatte sie ja auch schon für das Schülerkonzert Mitte Januar üben lassen.
Nein, die Befürchtung war sinnlos. Und nun wollte noch Sempach, der Berühmte, Fürsprache bei Dämpfinger einlegen.
Constanze lächelte. Dieses Lächeln verklärte das in seinen Linien noch ganz weiche Oval ihres kindseligen Gesichtes so, daß ein alter Herr kopfschüttelnd auf dem Parkweg, der nach der Kaiserallee führte, stehen blieb und: „So viel entzückende Jugend! So undenkbar viel Jugend!” murmelte. Er sah ihr nach. Constanze merkte es gar nicht.
Hoch und hell stand die Sonne schon am Himmel, als sie die Kaiserallee überschritt und weiter in den Hindenburgpark hineinwanderte.
Die Hindenburgbüste, die dort stand, erinnerte sie an Dämpfinger, der auch einen solchen Schnurrbart trug wie der alte Feldmarschall.
Rein und weiß erstrahlte der Großstadtpark im Sonnenschneeglanz. Es schillerte rundum, als hätte es Perlmuttermuscheln geschneit. Im Winde sang’s wie Harfenklang.
Constanze grüßte einsamselig beglückt den ersten Tag eines Jahres, von dem sie mit Hoffen und Bangen Ungewöhnliches erwartete, sie wußte selbst nicht warum.
IV
Doch die ersten Tage des Jahres brachten nichts überwältigend Besonderes. Wie auf eine stillschweigende Vereinbarung hin kamen weder Constanze noch Charlo auf ihre so grundverschiedenen Erlebnisse der Neujahrsnacht zu sprechen. Sonst erzählte Constanze der ein Jahr älteren Mitschülerin, die aber einen für ihre Jahre noch viel reiferen Eindruck machte, gern von allem Seltenen, das sie erlebt hatte und das in ihr nachklang.
Charlo schwieg vielleicht nur, weil sie eine Art moralischen Kater hatte, den sie aber bald „spielend” überwand: sie übte wie eine Besessene. Immer wieder Fingerübungen. Immer wieder die gleichen drei Passagen.
Das Telefon schrillte fast jeden Tag ein paar Mal. Gewöhnlich klingelte zuerst der pensionierte Major, der unter ihnen wohnte, bei den „Cikaden” an, um sich mit seiner rabenkrächzigen Stimme unter vielem Geräusper, Gehuste und Gepuste über dieses zum Wahnsinnigwerden eintönige Geklimper zu beschweren. „Werden Sie doch wahnsinnig, wenn’s Ihnen Spaß macht!” murmelte Charlo seelenruhig in den Apparat und hängte ab.
Constanze war auf einem ihrer einsamen Parkspaziergänge; Cäcilie noch in ihrem Laboratorium. So fingerübte Charlo unverdrossen weiter. Jetzt klopfte es von oben gegen die Decke. Frau Stuhlreittner! Charlo ließ sich nicht stören. Frau Stuhlreittner ließ ihren Sechs-Röhren-Empfänger mit höchster Lautstärke Blechmusik dagegen blasen — und da Charlo mit Vehemenz weiter übte, gab das einen chaotischen Höllenlärm, der gewöhnlich erst ein Ende nahm, wenn Herr Konditoreibesitzer Senkbley drohte, die Polizei herbeizuholen, da dieser ruhestörende Lärm bis in die Räume seiner Konditorei hineinschallte, die sich im Erdgeschoß des Hauses Salzburgerstraße 10 befand.
Da hörte Charlo endlich auf. Sie nannte solch fingerübendes Toben „Rache am Schicksal nehmen”. Und sie nahm diese Rache, wenn sie mit ihrem Schicksal unzufrieden war.
Charlo liebte Stefan. Doch die Neujahrsnacht hatte ihr nicht Stefans Liebe offenbart, obwohl sie die Offenbarung aus ihm herauslocken wollte. Sie wußte eines seitdem ganz genau —: Stefan liebt Constanze. Deswegen hatte sie sich ganz bewußt den Schwips angetrunken. Um Dinge sagen zu dürfen, die sie im nüchternen Zustand nicht über die Lippen gebracht hätte.
Charlo war ein auffallend hübsches Geschöpf. Von eleganter Figur: schlank und mit lieblichen Rundungen; ihr etwas zu großer Mund wäre auch ohne Benutzung des Lippenstiftes verlockend genug gewesen; die in dünner Linie hochgezogenen Brauen überwölbten zwei dunkle Augen, deren schwarze Iris sich nur um eine lichtere Nuance von der dunklen Pupille abhob. Die langen Wimpern waren nach oben gebogen. In genialer Wildheit umwuschelte das zigeunerschwarze Haar die klare kluge Stirn. Die Läppchen der wohlgeformten Ohren waren mit zwei roten Korallen durchgeknöpft. Dazu zwei Hände, die mit ihren rosenrot polierten Fingernägeln eine Zauberwelt in Tönen entfesseln konnten. Wenn sie im Saal der Hochschule ein Konzert gab, dann hieß es in allen Klavierklassen und auch bei denen, die andere Instrumente erlernten: „Die Wildhofer spielt. Das ist zwanzig Pfennig wert.” Der Saal war immer überfüllt, wenn sie — gewöhnlich zusammen mit dem noch vollendeter spielenden Mirko Machaczek — ein Schülerkonzert gab. Bald würde sie ihr erstes öffentliches Konzert geben; Dämpfinger sagte kürzlich: „Wozu brauchen Sie noch die Abschlußprüfung zu machen, Wildhofer? Sie und der Mirko sind fertig.”
Ja — sie und der Mirko waren auch miteinander fertig. Charlo ließ die manikürten Hände in den Schoß sinken und kreiselte einmal auf dem Klavierstuhl rundherum. Sie schaute verbissen sinnend in den engen Hof hinaus, gegen die Fensterfronten der Vorderhäuser, die hier in einem Karree zusammenstießen. Kahl wie der alte Kastanienbaum, der aus der Hofmitte bis zum vierten Stock emporwuchs (die „Cicaden” wohnten im dritten), und ebenso von Winterstürmen gezaust sah ihre Seele aus. Mirko, ja, der hätte sie gern für immer an sich gerissen und nicht mehr losgelassen so wie in dem kleinen Tanzlokal, das sie zum Schluß am Neujahrsmorgen aufsuchten — in der „Lagune”, einer Künstlerschänke geradeüber vom Schöneberger Rathaus.
Die Ohrfeige aber, die Mirko von ihr erhielt, hatte gesessen. In der Minute war Charlo noch einmal ganz nüchtern gewesen. Am liebsten hätte sie ja Stefan auch eine Watschen verabreicht, weil er über das freche Zudringlichwerden Mirkos laut lachte, anstatt — eifersüchtig herbeizuspringen und an ihrer Stelle die Exekution vorzunehmen.
Mirko hatte daraufhin Hut und Mantel vom Garderobenständer gerissen und war mit unheildrohender Miene grußlos davongestürzt. „Der gibt’s dir zurück, Charlo,” hatte Sabine Wendt, die kleine Cellistin, ihr zugeflüstert. Aber Charlo hatte nur die Achseln gezuckt: Was ging sie Mirko an? — Stefan!
„Stefan —” flüsterte Charlo in die Abenddämmerung. So zärtlich, wie es ihr keiner zugetraut hätte.
Große Flocken kamen vom Himmel und überschütteten auch den Hinterhaushof, in den Charlo sinnend hinausschaute, mit einem besänftigenden Silberglanz.
„Constanze weiß ja gar nicht, was Liebe ist —” flüsterte Charlo vor sich hin. „Vielleicht aber lieben das gerade solche Männer wie Stefan.”
In diesem Augenblick rief Stefan Klodwig an: „Wo ist Constanze?” Natürlich — die erste Frage: wo ist Constanze?
„Stanzi geht spazieren im Park. Sicher hängt sie einer stillen Liebe nach.”
„Charlo, sei doch nicht gehässig. Habt ihr euch gezankt?” fragte Stefan besorgt. Natürlich war er nur um Constanze besorgt.
Charlo lachte. Ihr Lachen hatte viel Musik in sich wie alles an ihr Musik war: der Schritt, die Gesten, die Sprache. Ihre dunkle Stimme flog Stefan wie ein seltsamer Nachtfalter durchs Telefon an: „Aber keine Spur, lieber Stefan! Stanzi und ich zanken? Kommt gar nicht in Frage!”
„Also, Kinder, hört,” ließ sich der angehende Musikdozent von drüben vernehmen, Charlo sah ordentlich, wie er bei diesen Worten die Brille zurechtrückte und mit einer gewissen verlegenen Gebärde über seinen schon etwas sich lichtenden Scheitel fuhr, „wißt ihr, was passiert ist?”
„Nun, lieber Stefan —?”
„Die Spanier sind aus meinem Haus ausgezogen.”
„Die Spanier? Hurrah für dich, Stefan! Da brauchst du dir endlich nicht mehr alltäglich zur Nachmittagsschlummerstunde das disharmonische Harmonikagedudel anzuhören, das der Sprößling dieser ehrenwerten Torerofamilie vollführte. — Der Vater war kein Torero? Ganz gewöhnlicher Geschäftsreisender? Na, aber mit seinem Musterkoffer schritt er die Treppe immer hinab wie ein Torero in die Arena. Also — die sind fort. Ich gratuliere.”
„Und das muß gefeiert werden. Ich lade euch demzufolge huldvollst zu einer Tasse Kaffee ein. Kuchen bringt bitte von euerm Senkbley mit. Constanze hat ja da bei dem Bäckergesellen einen Stein im Brett. Der sucht ihr dann die schönsten Stücke aus. Ich bezahl ihn natürlich —”
„Den Bäckergesellen?”
„Den Kuchen!”
„Ach ich dachte den Bäckergesellen, damit er weiter der süßen Constanze Äugelchen macht.” Charlo biß sich auf die Lippen. Das hätte sie nicht sagen sollen. Es kam gereizter heraus als beabsichtigt. Bums — Stefan hat es auch richtig gemerkt:
„Du bist ungerecht gegen Constanze. Im übrigen —: Constanze ist nicht nur das zuckersüße Puttchen, als das du sie hinzustellen beliebst.”
„Woher die Wissenschaft?”
„Ich weiß es. Auch — ohne — Wissenschaft. Aber nun verdirb mir nicht die Freude, Charlo. Du kommst?”
„Natürlich, lieber Stefan.”
„Und sagst es Constanze?”
„Mit feierlichster Musikbegleitung. Was soll ich dazu spielen, wenn ich’s ihr verkünde: „Ich trage meine Minne voll Wonne stumm.... Oder: Ach, ihres Auges Zauberblick —”
„Das wirst du nicht tun, Charlo. Versprich mir’s!” Stefan wurde sehr ernst.
„Huch, wie offiziell! Gern, lieber Stefan. Ich gehorche dir immer aufs Wort. Das weißt du. Adjüs!”
„Auf Wiedersehen!”
V
Schließe mir die Augen beide
mit den lieben Händen zu!
Geht doch alles, was ich leide,
unter deiner Hand zur Ruh.
Und wie leise sich der Schmerz
Well’ um Welle schlafen leget,
wie der letzte Schlag sich reget,
füllest du mein ganzes Herz.
Stefan hatte die beiden Stormschen Liebesstrophen vertont. Es war sein erster Versuch einer Liedkomposition. Aber es war ihm schon meisterlich gelungen. Bisher hatte er solche „Spielereien” streng von sich abgewehrt, wenn die Versuchung ihn ankam, auch einmal dies oder jenes freischaffend zu probieren. Nur was in die Methodik seines Lernens paßte, übte er mit Eifer und Sorgfalt aus. Er galt als der begabteste Musiktheoretiker von allen Hochschülern, die augenblicklich die Hochschule für Musikerziehung besuchten. Denn dort hatte er auch bereits mehrere Semester belegt, um noch vor Ostern das staatliche Musikerzieherexamen zu machen. Dazu — welch Klavierspieler! Wie liebkoste er sein Cello! Wie feinfühlig dirigierte er schon den Hochschulchor! Gewiß — Charlo spielte entflammter, besessener, genialer —! Stefan aber diente mit mustergültiger Hingabe den Werken der Großen.
Weil er sich der erdrückenden Übermacht dieser klassischen Werke bewußt war, hatte er bisher nichts selbst zu komponieren versucht außer solchen Stücken, die für die Tonsatzlehre unerläßlich und von den Lehrern vorgeschrieben waren.
Nun hatte er’s gewagt!
In seinem schlichten möblierten Zimmer, das Beethovens Totenmaske an der Wand zierte, sonst kahl wie eine Mönchzelle neben dem Klavier nur Bett, Schrank, Tisch und ein paar Stühle enthielt, hatte er’s ihnen, Charlo und Constanze, vorgespielt. Kaffee und Kuchen zur Feier des „Auszugs der Spanier mit ihrem harmonikadudelnden Sprößling” waren verzehrt.
Mit leiser Stimme hatte er’s gesungen. Sein sich zärtlich einschmeichelnder Bariton zitterte vor innerer Erregung. Charlo merkte es. Constanze, der das Lied galt, hörte es kaum. Jedenfalls machte sie sich nicht die Gedanken, die sich Charlo sofort machte.
Stefan hatte beiden den Rücken gekehrt, als er am Klavier sein Liebeslied sang und sich selbst begleitete. Aber Charlo spürte deutlich, wie alle unsichtbaren Wellen seiner sehnenden Seele zu Constanze hinströmten. An ihr vorbei. Das tat weh.
Als Stefan sich jetzt langsam umwendete und die Gesichter der beiden Mädchen prüfte, wie das Lied auf sie gewirkt hätte, da lächelte Charlo und kam Constanzen mit ein paar fein und klug gewählten Lobesworten zuvor. Verglich das Lied mit Pfitznerschen und Richard Straußischen Vertonungen und pries seinen ureigenen Rhythmus.
„Constanze, und was sagst du?”
„Ich hab zugehört,” sprach Constanze stockend und leise. „Und ich glaube dir auch in der Musik jedes Wort. So wie du’s sagst, so ist es.”
Stefan lachte sie glücklich an. Charlos Stirn zeigte eine kleine Unmutfalte, als jetzt Stefan Constanzes Hand ergriff und so seltsam erregt sagte: „Ich danke dir, liebe Stanzi, für dieses Wort!”
Zum ersten Mal sagte er „liebe Stanzi” zu ihr. Verstand sie denn noch immer nicht?
Denn Constanze seufzte nur: „Das aber, was du kannst, werd’ ich nie können.”
Stefan: „Aber das brauchst du ja auch nicht. Dazu bin ja ich da. Mir genügte es, wenn meine zukünftige Frau soviel von Musik verstünde wie du, Stanzi —”
„Hollalah!!” Der Ausruf flog melodisch aus Charlos Mund.
„Wie ich?” lächelte Constanze Stefan ungläubig an und ihr sanftes Gesicht bekam einen kindlich hilflosen Ausdruck. Nur in den großen Augen leuchteten unerschlossene Tiefen eine Sekunde lang auf — „Was willst du mit einer solch unbegabten Frau? Du mußt eine wie Charlo haben —”