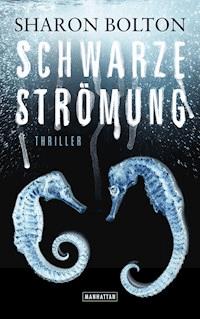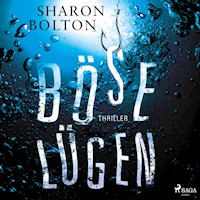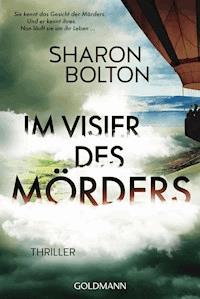7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lacey Flint
- Sprache: Deutsch
Die Opfer sind unschuldige Frauen. Der Killer ist ein Phantom. Und die Ermittlerin hat mehr als nur ein Geheimnis.
DC Lacey Flint ist eine junge Londoner Ermittlerin mit undurchsichtiger Vergangenheit und einem morbiden Interesse an Serienkillern. Mit einem echten Mord hatte sie bisher allerdings nie zu tun – bis jetzt, da eine aus zahlreichen Stichwunden blutende Frau an der Tür von Laceys Wagen lehnt und in ihren Armen stirbt. Lacey wird zunächst nur als Zeugin vernommen, doch bald wird klar, dass sie in dem Fall eine ganz besondere Rolle spielt: Ein blutiger Bekennerbrief ist unmissverständlich an sie adressiert. Unversehens findet sich Lacey im Mittelpunkt einer Mordserie, die in einem besonderen Zusammenhang mit ihr selbst stehen muss. Doch wie findet man einen Killer, der sich einen nie gefassten Serienmörder zum Vorbild genommen hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Sharon Bolton
Dunkle Gebete
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
Für Andrew, der meine Bücher als Erster liest,und für Hal, der es kaum erwarten kann, anzufangen.
Prolog
Vor elf Jahren
Blätter und Matsch und Gras dämpfen jedes Geräusch, selbst einen Schrei. Das Mädchen weiß das. Kein Laut, den sie von sich geben würde, könnte jemals bis zu den Autoscheinwerfern und den Straßenlaternen einen halben Kilometer weiter dringen, zu den erleuchteten Fenstern der hohen Gebäude, die sie hinter der Mauer gerade noch ausmachen kann. Die nahe Stadt kann ihr nicht helfen, und Schreien kostet nur unnötig Kraft, die zu verschwenden sie sich nicht leisten kann.
Sie ist allein. Eben war es noch anders.
»Cathy«, sagt sie. »Cathy, das ist nicht witzig.«
Es fällt ihr schwer, dem Ganzen etwas Witziges abzugewinnen. Warum kichert da also jemand? Dann ein anderes Geräusch. Ein kratzendes, schabendes Geräusch.
Sie könnte weglaufen. Die Brücke ist nicht weit. Vielleicht schafft sie es ja.
Wenn sie wegläuft, lässt sie Cathy zurück.
Eine Brise rührt sich in den Blättern des Baumes, neben dem sie steht, und sie merkt, dass sie schon die ganze Zeit zittert. Vor ein paar Stunden hat sie sich für einen stickigen Pub und eine Heimfahrt in einem geheizten Bus angezogen, nicht für diesen Ort im Freien um Mitternacht. Da ihr klar ist, dass sie möglicherweise jeden Augenblick losrennen muss, hebt sie erst den einen und dann den anderen Fuß und zieht ihre Schuhe aus.
»Mir reicht’s langsam«, verkündet sie mit einer Stimme, die nicht ihre ist. Sie tritt einen Schritt vor, weg von dem Baum, ein bisschen weiter auf den großen Felsbrocken zu, der vor ihr im Gras liegt. »Cathy«, sagt sie, »wo bist du?«
Nur das Schaben antwortet.
Bei Nacht sehen die Steine größer aus. Nicht nur größer, sondern schwärzer und älter. Und doch scheint der Kreis, den sie bilden, kleiner geworden zu sein. Sie hat das Gefühl, dass die Steine sich näher heranschleichen, mit ihr Ochs am Berg spielen. Dass sie nur noch einmal kurz weg- und dann wieder hinschauen müsste, schon wären sie nahe genug, um sie zu berühren.
Unmöglich, sich mit so einem Gedanken im Kopf nicht umzuschauen, nicht aufzustöhnen, als eine dunkle Silhouette eindeutig näher kommt. Einer der hohen Steine hat sich geteilt, als ob ein Felsstück von einer Klippe abbricht. Das Felsstück löst sich und tritt vor.
Da rennt sie los, aber es währt nicht lange. Eine weitere schwarze Silhouette verstellt ihr den Weg zur Brücke. Sie macht kehrt. Noch eine. Und noch eine. Dunkle Gestalten kommen auf sie zu. Fliehen ist unmöglich. Schreien ist sinnlos. Alles, was sie tun kann, ist, sich wie eine Ratte in einer Falle auf der Stelle zu drehen. Sie packen sie und zerren sie auf den großen, flachen Felsen zu, und zumindest eins wird ihr klar.
Das Schaben, das sie hört, ist das Geräusch einer Klinge, die an Stein gewetzt wird.
Teil 1Polly
»Die Brutalität des Mordes spottet jeglicher Vorstellung und jeder Beschreibung.«
Star, 31. August 1888
1
Freitag, 31. August
Eine Tote lehnte an meinem Auto.
Eine tote Frau, die es irgendwie schaffte, mit ausgestreckten Armen aufrecht dazustehen. Ihre Finger umklammerten die Kante, wo die Beifahrertür und das Dach aufeinandertrafen. Blut spritzte in rhythmischen Wellen auf meinen Wagen. Jeder Schwall ergoss sich über den davor, bis das Muster auf dem Lack einem Spinnennetz zu ähneln begann.
Gleich darauf drehte sie sich um, und ihr Blick begegnete dem meinen. Die Augen einer Toten. Eine tiefe Wunde klaffte in ihrer Kehle, und ihr Bauch war eine dunkelrote Masse. Sie griff nach mir. Ich konnte mich nicht rühren. Dann klammerte sie sich an mich, war verblüffend stark für eine Tote.
Ich weiß, ich weiß, sie stand auf den Beinen, sie bewegte sich, das Blut pumpte weiter, doch es war unmöglich, in diese Augen zu blicken und sie in Gedanken als irgendetwas anderes zu bezeichnen. Ihr Herz schlug noch, und sie hatte immer noch ein wenig Gewalt über ihre Muskeln. Doch das spielte letztlich keine Rolle mehr. Diese Augen wussten, dass das Spiel aus war.
Plötzlich war mir heiß. Bevor die Sonne untergegangen war, war es ein warmer Abend gewesen, einer von der Sorte, an denen die Gehsteige und Gebäude Londons sich an die Hitze des Tages klammern und einen mit einer Woge heißer Luft überfluten, wenn man ins Freie tritt. Das hier jedoch war etwas Neues, diese pumpende, klebrige Wärme. Diese Hitze hatte nichts mit dem Wetter zu tun.
Ich hatte das Messer nicht gesehen. Doch jetzt konnte ich den Griff fühlen, der sich gegen mich drückte. Sie hielt mich so fest umklammert, stieß sich das Messer selbst tiefer in den Leib.
Nein, tun Sie das nicht.
Ich versuchte, sie fortzuschieben, nur so weit, dass kein Druck mehr auf dem Messer war. Sie hustete, nur kam dieses Husten aus der Wunde in ihrer Kehle, nicht aus ihrem Mund. Etwas spritzte mir ins Gesicht, und dann drehte die Welt sich um uns.
Wir waren hingefallen. Sie sank zu Boden und ich mit, schlug hart auf den Asphalt und stieß mir die Schulter an. Jetzt lag sie flach auf dem Gehsteig, starrte in den Himmel hinauf, und ich kniete über ihr. Ihre Brust hob und senkte sich – aber nur noch ganz schwach.
Es ist noch nicht zu spät, dachte ich und wusste, dass das nicht stimmte. Ich brauchte Hilfe. Nichts zu wollen. Der kleine Parkplatz war verlassen. Hohe sechs- und achtstöckige Wohnblocks umgaben uns, und einen Moment lang bemerkte ich eine Bewegung auf einem der Balkone, dann nichts mehr. Es wurde von Sekunde zu Sekunde dämmriger.
Sie war erst vor wenigen Augenblicken angegriffen worden. Wer immer das getan hatte, war bestimmt noch in der Nähe.
Ich griff nach meinem Funkgerät, klopfte meine Taschen ab und fand es nicht, und die ganze Zeit sah ich in die Augen der Frau. Meine Tasche war ein kleines Stück entfernt zu Boden gefallen, und ich streckte mich danach, tastete darin herum und fand mein Handy. Ich zitierte Polizei und Rettungsdienst zum Parkplatz vor dem Victoria House der Wohnsiedlung Brendon in Kennington. Dann merkte ich, dass die Frau meine Hand ergriffen hatte.
Eine Tote hielt meine Hand, und es ging fast über meine Kraft, in diese Augen zu blicken und zu sehen, wie sie versuchten, sich auf meine zu fokussieren. Ich musste mit ihr sprechen, dafür sorgen, dass sie bei Bewusstsein blieb. Ich durfte nicht auf die Stimme in meinem Kopf hören, die mir sagte, dass es vorbei war.
»Ist ja gut«, sagte ich. »Es ist alles okay.«
Die Situation war eindeutig sehr weit davon entfernt, okay zu sein.
»Hilfe ist unterwegs«, versicherte ich und wusste, dass ihr nicht mehr zu helfen war. »Es wird alles gut.«
Wir belügen Sterbende, ging mir an jenem Abend auf, gerade als die erste Sirene in der Ferne ertönte.
»Hören Sie das? Da kommen sie. Halten Sie durch.« Sowohl ihre als auch meine Hand waren klebrig von Blut. Das Metallband ihrer Uhr drückte sich in meine Haut. »Kommen Sie, nicht aufgeben.« Die Sirene wurde lauter. »Hören Sie? Sie sind fast da.«
Rennende Schritte. Ich blickte auf und sah funkelndes Blaulicht, das sich in mehreren Fenstern spiegelte. Ein Streifenwagen hatte neben meinem Golf gehalten, und ein Constable in Uniform kam auf uns zugetrabt und sprach dabei in sein Funkgerät. Er erreichte uns und hockte sich hin.
»Halten Sie durch«, sagte ich. »Sie sind da, wir kümmern uns um Sie.«
Der Constable hatte eine Hand auf meiner Schulter. »Ganz ruhig«, sagte er, genauso wie ich es eben getan hatte, nur sagte er es zu mir. »Der Notarztwagen ist unterwegs. Ganz ruhig.«
Der Polizist war Mitte vierzig, untersetzt, mit schütterem grauem Haar. Es kam mir vor, als hätte ich ihn vielleicht schon einmal gesehen.
»Können Sie mir sagen, wo Sie verletzt sind?«, fragte er.
Ich wandte mich wieder der Toten zu. Jetzt war sie wirklich tot.
»Schätzchen, können Sie sprechen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Sagen Sie mir, wo Sie verletzt sind.«
Kein Zweifel. Die blassblauen Augen starr. Der Körper regungslos. Ich fragte mich, ob sie wohl irgendetwas von dem gehört hatte, was ich zu ihr gesagt hatte. Sie hatte wunderschönes Haar, fiel mir jetzt auf, ein ganz helles Aschblond. Es war um ihren Kopf ausgebreitet wie ein Fächer. In ihren Ohrringen spiegelten sich die Straßenlaternen, und irgendetwas daran, wie sie durch die Strähnen ihres Haares hindurchfunkelten, kam mir vertraut vor. Ich ließ ihre Hand los und machte Anstalten, mich vom Gehsteig hochzustemmen. Sanft hielt mich jemand zurück.
»Ich glaube, Sie sollten sich lieber nicht bewegen, Schätzchen. Warten Sie, bis der Notarztwagen da ist.«
Ich brachte es nicht übers Herz zu widersprechen, also starrte ich weiter die Tote an. Blut war über den unteren Teil ihres Gesichts gespritzt. Ihr Hals und ihre Brust waren blutüberströmt. Blut sammelte sich unter ihr auf dem Gehsteig zu einer Lache, fand winzige Spalten im Pflaster, um darin entlangzurinnen. In der Mitte ihrer Brust konnte ich gerade noch den Stoff ihrer Bluse erkennen. Weiter unten war das unmöglich. Die Wunde in der Kehle war nicht die schlimmste Verletzung, bei Weitem nicht. Mir fiel wieder ein, dass ich einmal gehört hatte, der weibliche Körper enthielte ungefähr fünf Liter Blut. Ich hatte mir allerdings nie Gedanken darüber gemacht, wie es wohl aussehen würde, wenn das alles auslief.
2
»Mir fehlt nichts, ich bin nicht verletzt. Das ist nicht mein Blut.«
Ich wollte aufstehen; sie ließen mich nicht.
Drei Rettungshelfer kauerten über der blonden Frau. Anscheinend drückten sie Kompressen auf die Wunde in ihrem Bauch. Ich hörte jemanden etwas von einer Tracheotomie sagen. Dann etwas von peripherem Puls.
Lassen wir’s gut sein? Ich glaube schon. Sie ist tot.
Jetzt wandten sie sich mir zu. Ich kam auf die Beine. Das Blut der Frau klebte auf meiner Haut, trocknete bereits in der warmen Luft. Ich merkte, wie ich schwankte, und sah überall Bewegung. Die Wohnblocks, die den Platz umgaben, hatten lange Balkone, die sich über die ganze Fassade erstreckten. Vor ein paar Minuten waren sie verwaist gewesen. Jetzt waren sie voller Menschen. Ich zog meinen Dienstausweis aus der Gesäßtasche meiner Jeans und hielt ihn dem am nächsten stehenden Polizisten hin.
»DC Lacey Flint«, sagte ich.
Er las den Ausweis und sah mir in die Augen, suchte nach Bestätigung. »Hab mir doch gedacht, dass Sie mir bekannt vorkommen. Sie arbeiten in der Wache in Southwark, nicht wahr?«
Ich nickte.
»CID – Kriminalpolizei«, sagte er zu den Rettungshelfern, die ihre Aufmerksamkeit mir zugewandt hatten, nachdem ihnen klar geworden war, dass sie nichts mehr für die blonde Frau tun konnten. Einer von ihnen kam auf mich zu. Ich trat zurück.
»Fassen Sie mich lieber nicht an«, sagte ich. »Ich bin nicht verletzt.« Ich blickte an meinen blutverschmierten Kleidern hinunter, fühlte, wie Dutzende von Augen mich anstarrten. »Ich bin Beweismaterial.«
Es wurde mir nicht gestattet, mich still und leise in die Anonymität des nächsten Polizeireviers davonzustehlen. DC Stenning, der Detective, der als Erster am Tatort eingetroffen war, hatte einen Anruf vom zuständigen Detective Inspector bekommen. Sein Boss war bereits unterwegs und wollte, dass ich mich nicht von der Stelle rührte.
Pete Stenning war in Southwark einer meiner Kollegen gewesen, bevor er zur Abteilung für Schwerverbrechen – zum Major Investigation Team oder MIT – des Bezirks gegangen war, die vom Revier in Lewisham aus operierte. Er war nicht viel älter als ich, vielleicht so um die dreißig, und einer jener Glückspilze, die bei fast allen beliebt sind. Männer mochten ihn, weil er hart arbeitete, aber nicht so hart, dass andere sich bedroht fühlten. Stenning stand auf bodenständige Arbeitersportarten wie Fußball, konnte sich aber auch in einem Gespräch über Golf oder Cricket behaupten. Er redete nicht übermäßig viel, doch alles, was er sagte, war vernünftig. Frauen mochten ihn, weil er groß und schlank war und lockiges dunkles Haar und stets ein freches Grinsen im Gesicht hatte.
Er nickte mir zu, war jedoch zu sehr damit beschäftigt, die Schaulustigen zurückzuhalten, um herüberzukommen. Inzwischen waren um den Leichnam der blonden Frau herum Sichtschutzwände aufgestellt worden. Da ihnen der erregendste Anblick verwehrt war, glotzten alle stattdessen mich an. Die Neuigkeit hatte sich herumgesprochen. Die Leute hatten per SMS ihre Freunde benachrichtigt, die eilends anrückten, um bei dem Spaß dabei zu sein. Ich saß hinten im Streifenwagen, mied aufdringliche Blicke und versuchte, meinen Job zu machen.
Die ersten sechzig Minuten nach einem schweren Verbrechen sind die wichtigsten, wenn die Beweise frisch sind und die Spur des Täters noch warm ist. Es gibt strikte Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Ich arbeitete nicht beim Morddezernat; zu meinem Berufsalltag gehörte es, die Besitzer von Diebesgut ausfindig zu machen. Das war sehr viel weniger aufregend, doch mir war klar, dass ich mir so viel wie möglich merken musste. Ich registrierte normalerweise jedes klitzekleine Detail, etwas, wofür ich nicht immer dankbar war, wenn ich unweigerlich die langweiligen Jobs bekam. Jetzt jedoch sollte ich froh darüber sein.
»Ich hab Ihnen einen Tee geholt, Schätzchen.« Der Constable, der sich zu meinem Aufpasser ernannt hatte, war wieder da. »Trinken Sie den lieber schnell«, riet er mir. »Der DI ist da.«
Ich folgte seinem Blick und sah, dass ein silberner Mercedes unweit von meinem Wagen gehalten hatte. Zwei Personen stiegen aus. Der Mann war hochgewachsen, und selbst aus einiger Entfernung konnte ich sehen, dass ihm das Fitnessstudio nicht fremd war. Er trug Jeans und ein graues Polohemd. Gebräunte Arme. Sonnenbrille.
Die Frau erkannte ich sofort von Fotos her. Schlank wie ein Model, mit glänzendem dunklem Haar, das zu einem kinnlangen Bob geschnitten war. Jeans von der Sorte, für die Frauen über hundert Pfund bezahlen. Sie war die neueste ranghohe Rekrutin der siebenundzwanzig Londoner MITs, und ihre Ankunft war ausführlich abgehandelt worden, in internen Kreisen ebenso wie in den diversen Polizei-Blogs. Für den Posten eines Detective Inspector war sie ziemlich jung, nicht viel mehr als Mitte dreißig, doch sie hatte gerade einen Fall in Schottland bearbeitet, der viel Aufsehen erregt hatte. Außerdem ging das Gerücht, dass sie sich besser als jeder andere Polizeibeamte in Großbritannien mit HOLMES 2 auskannte – dem Computersystem, das sämtliche Morddezernate im Land benutzten. Natürlich schadete es nicht, hatten ein oder zwei weniger wohlgesonnene Blogs bemerkt, dass sie eine Frau und nicht rein europäischer Abstammung war.
Ich sah zu, wie sie und der Mann hellblaue Schutzanzüge und Überschuhe anzogen. Sie stopfte ihr Haar unter die Kapuze. Dann gingen die beiden hinter die Abschirmung; der Mann trat im letzten Moment zur Seite, um ihr den Vortritt zu lassen.
Inzwischen liefen auf dem ganzen Parkplatz Gestalten in weißen Schutzanzügen herum. Die Leute von der Spurensicherung waren eingetroffen. Sie würden einen inneren Sperrbereich um den Leichnam und einen äußeren um den Tatort herum einrichten. Von jetzt an würde jeder, der diesen Bereich betrat oder verließ, sich an- oder abmelden müssen, und der genaue Zeitpunkt seines Kommens oder Gehens würde protokolliert werden. All das hatte ich erst vor ein paar Monaten bei der Ausbildung zum Detective gelernt, doch dies war das erste Mal, dass ich es in der Praxis erlebte.
Ein pavillonartiges Gebilde wurde über der Stelle errichtet, wo der Leichnam noch immer lag. Mit Planen bespannte Stellwände waren bereits aufgerichtet worden, und binnen kürzester Zeit hatten die Ermittler einen großen, geschlossenen Bereich, in dem sie arbeiten konnten. Polizei-Absperrband wurde um mein Auto herumgespannt. Lampen wurden aus einem Lieferwagen ausgeladen, gerade als der Detective Inspector und ihr Begleiter wieder herauskamen. Sie sprachen kurz miteinander, dann machte der Mann kehrt und ging davon; er stieg über das gestreifte Flatterband, das den Rand des Sperrbereichs markierte. Die Frau kam auf mich zu.
»Ich lass Sie dann mal«, meinte mein Aufpasser. Ich reichte ihm meine Tasse, und er verzog sich. Der neue DI stand vor mir. Selbst in dem Schutzanzug sah sie elegant aus. Ihre Haut hatte einen kräftigen, dunklen Cremeton, und ihre Augen waren grün. Ich erinnerte mich, gelesen zu haben, dass ihre Mutter Inderin gewesen sei.
»DC Flint?«, fragte sie mit weichem, schottischem Akzent. Ich nickte.
»Wir kennen uns noch nicht«, fuhr sie fort. »Ich bin Dana Tulloch.«
3
»Okay«, sagte DI Tulloch. »Schön langsam, und erzählen Sie weiter.«
Ich ging los. Meine Füße knisterten bei jedem Schritt auf dem Gehsteig. Tulloch hatte einen einzigen Blick auf mich geworfen und darauf bestanden, dass man mir einen Schutzoverall und Überschuhe brachte. Ich würde mich erkälten, hatte sie behauptet, trotz des warmen Abends, und ich würde viel weniger Aufmerksamkeit erregen, wenn die Blutflecke nicht zu sehen wären. Außerdem trug ich Latexhandschuhe.
»Ich war im dritten Stock«, sagte ich. »Wohnung 37. Ich bin die Treppe da runtergekommen und dann nach rechts gegangen.«
»Was haben Sie da oben gemacht?«
»Mit einer Zeugin geredet.« Ich hielt inne und verbesserte mich. »Mit einer potenziellen Zeugin. Ich komme jetzt schon seit ein paar Wochen jeden Freitagabend her. Das ist die einzige Zeit, zu der ich ziemlich sicher sein kann, dass ich ihre Mutter nicht antreffe. Ich versuche, sie dazu zu bringen, in einer Strafsache auszusagen, und ihre Mutter hält nicht viel davon.«
»Hatten Sie Erfolg?«, erkundigte sich Tulloch.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein«, gestand ich.
Wir erreichten das Ende des Fußwegs und konnten den Parkplatz wieder sehen. Die Streifenpolizisten versuchten, die Leute zu überreden, nach Hause zu gehen, und hatten nicht viel Glück damit.
»Heute Abend läuft wohl nicht viel im Fernsehen«, bemerkte Tulloch halblaut. »Was für eine Strafsache?«
»Gruppenvergewaltigung«, antwortete ich und wusste genau, dass ich wahrscheinlich mit Schwierigkeiten rechnen konnte. Für Sexualdelikte war ich nicht zuständig, und vorhin war ich in eigener Sache unterwegs gewesen. Vor ein paar Jahren hatte die Londoner Polizei eine Anzahl Spezialteams gegründet, die als Sapphire Units bekannt waren und sich mit sexuellen Übergriffen aller Art befassten. Für genau so etwas war ich in den Polizeidienst eingetreten, und ich wartete darauf, dass in einem der Teams ein Platz frei wurde. In der Zwischenzeit ermittelte ich auf eigene Faust. Ich konnte nicht anders.
»War der Fußweg leer, als Sie aus dem Treppenhaus gekommen sind?«, wollte Tulloch wissen.
»Ich glaube schon«, sagte ich, obwohl ich in Wahrheit nicht sicher war. Ich hatte mich über die Antwort geärgert, die ich von meiner potenziellen Zeugin Rona bekommen hatte, und hatte über meine nächsten Schritte nachgedacht, darüber, ob es überhaupt nächste Schritte für mich gab. Ich hatte nicht allzu genau darauf geachtet, was um mich herum geschah.
»Als Sie auf den Parkplatz gekommen sind, was haben Sie da gesehen? Wie viele Menschen?« Langsam rekapitulierten wir, wie ich das letzte Mal hier entlanggegangen war. Tulloch feuerte alle paar Sekunden Fragen auf mich ab. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil ich vorhin nicht besser aufgepasst hatte, und bemühte mich nach Kräften. Meiner Meinung nach war niemand da gewesen. Musik war zu hören gewesen, irgendein lauter Rap, den ich nicht kannte. Ein Hubschrauber war über mich hinweggeflogen, tiefer als gewöhnlich, denn ich hatte zu ihm hinaufgeschaut. Ich war mir sicher, dass ich die blonde Frau vor heute Abend noch nie gesehen hatte. Einen Augenblick lang war irgendetwas an ihr gewesen, irgendetwas, das mich stutzig machte, doch nein, es war weg.
»Hier habe ich mich umgedreht«, sagte ich, während ich kehrtmachte. »Hinter mir war ein lautes Geräusch.«
Mein Blick begegnete dem von Tulloch, und ich wusste, was sie dachte. Wahrscheinlich hatte ich den Überfall ganz knapp verpasst. Um Bruchteile von Sekunden.
»Wann haben Sie sie gesehen?«, fragte sie mich.
»Ich war noch ein bisschen näher dran«, antwortete ich. »Ich habe beim Gehen in meiner Tasche gekramt, ich dachte, ich hätte vielleicht meinen Autoschlüssel oben vergessen. Dann habe ich hochgeschaut und sie gesehen.«
Wir kamen zu der Stelle, wo es passiert war. Eine weiß gekleidete Gestalt fotografierte die Blutspritzer auf meinem Wagen.
»Weiter«, drängte Tulloch.
»Zuerst habe ich das Blut gar nicht gesehen«, berichtete ich. »Ich dachte, sie wäre stehen geblieben, um nach dem Weg zu fragen. Dass sie vielleicht gedacht hat, im Auto würde jemand sitzen.«
»Erzählen Sie mir, wie sie aussah. Beschreiben Sie sie.«
»Groß«, fing ich an. Mir war nicht ganz klar, wohin das hier führte. Sie hatte die Frau doch gerade selbst gesehen.
Sie seufzte. »Sie sind ein Detective, Flint. Wie groß?«
»Einsachtzig«, tippte ich. »Größer als wir beide. Und schlank.«
Ihre Augenbrauen klommen in die Höhe.
»Größe vierzig«, sagte ich rasch. »Von hinten habe ich sie für jung gehalten, wahrscheinlich weil sie schlank war und gut angezogen, aber als ich ihr Gesicht gesehen habe, hat sie älter gewirkt, als ich erwartet hätte.«
»Weiter.«
»Sie sah gut aus.« Wenn Tulloch endlose Details wollte, die konnte sie haben: »Sie war gut angezogen. Ihre Sachen sahen teuer aus. Schlicht, aber gute Qualität. Ihr Haar war von einem Profi gefärbt worden; so eine Farbe gibt’s nicht im Drogeriemarkt, und es war kein Ansatz zu sehen. Sie hatte gute Haut und gute Zähne, aber auch ein paar Fältchen um die Augen, und das Kinn war nicht mehr ganz straff.«
»Sie würden also sagen …«
»Ich würde sagen, gut erhaltene Mitte vierzig.«
»Ja, ich auch.« Überall um uns herum herrschte Bewegung, doch Tulloch wandte den Blick nicht von meinem Gesicht ab. Wir hätten ganz allein auf dem Parkplatz sein können.
»Hatte sie Papiere dabei?«, fragte ich. »Wissen wir, wer sie ist?«
»In der Handtasche war nichts«, ließ sich eine Männerstimme vernehmen. Ich drehte mich um. Tullochs Begleiter war zu uns gestoßen. Er schob die Sonnenbrille über die Stirn empor. Um das rechte Auge herum hatte er Narben, die noch recht frisch aussahen. »Kein Ausweis, keine Autoschlüssel, ein bisschen Bargeld und ein paar Make-up-Sachen«, fuhr er fort. »Ein Rätsel, wie sie hierhergekommen ist. Bis zur U-Bahn ist es ein ganzes Stück, und sie scheint mir nicht gerade der Typ zu sein, der Bus fährt.«
Tulloch betrachtete die großen Wohnblöcke, die den Platz säumten.
»Ihre Autoschlüssel könnten natürlich geklaut worden sein, zusammen mit ihrem Wagen. So eine Frau fährt bestimmt was Hübsches«, meinte der Mann. Er hatte einen ganz leichten Südlondoner Akzent.
»Sie hatte Diamantstecker in den Ohren«, wandte ich ein. »Das war kein Raubüberfall.«
Er sah mich an. Seine Augen waren blau, fast türkisblau. Das mit der Narbe drumherum war blutunterlaufen. »Könnte vorgetäuscht gewesen sein«, entgegnete er.
»Wenn ich jemandem die Kehle durchschneide und ihm den Bauch aufschlitze, um ihn auszurauben, dann würde ich doch sämtlichen sichtbaren Schmuck mitgehen lassen, Sie etwa nicht?«, erwiderte ich. »Und sie hatte auch eine hübsche Armbanduhr. Ich konnte das Metallband fühlen, als die Frau gestorben ist. Es hat mir in die Hand gedrückt.«
Das gefiel ihm nicht, das merkte ich. Er hob die Hand, um sein verletztes Auge zu reiben, und sah mich stirnrunzelnd an.
»Flint, das ist DI Joesbury«, sagte Tulloch. »Hat nichts mit den Ermittlungen zu tun. Er ist heute Abend nur mitgekommen, weil er sich langweilt. Das ist DC Flint. Lacey, glaube ich, richtig?«
»Da fällt mir ein«, bemerkte Joesbury, der die gegenseitige Vorstellung kaum zur Kenntnis genommen hatte, »die in Lewisham wollen wissen, wann du sie aufs Revier bringst.«
Tulloch betrachtete noch immer die Gebäude um uns herum. »Ich verstehe das nicht, Mark«, sagte sie. »Hier sind überall Wohnungen, und so spät ist es doch gar nicht. Dutzende von Leuten hätten sehen können, was passiert ist. Wieso bringt man hier jemanden um?«
Irgendwo in der Nähe konnte ich einen Hund bellen hören.
»Na ja, sie war bestimmt nicht zufällig hier«, erwiderte Joesbury. »Diese Frau gehört nach Knightsbridge, nicht nach Kennington. Dank DC Flints Kenntnissen in Sachen Schmuck wissen wir, dass ein Raubüberfall anscheinend unwahrscheinlich ist, allerdings müssen wir erst noch ihr Auto finden.«
»Die Kids hier würden wegen eines Autos niemanden umbringen«, sagte ich. Beide drehten sich zu mir um. »Oh, klauen würden sie es, gar keine Frage, aber die würden sich einfach den Schlüssel schnappen und der Frau einen kräftigen Schubs geben. Sie bräuchten ihr doch nicht …«
»Den Hals so tief aufschlitzen, dass die Luftröhre glatt durchtrennt wird?«, beendete Joesbury den Satz. »Ihr den Bauch vom Brustbein bis runter zum Schambein aufreißen? Nein, da haben Sie recht, DC Flint, das sieht wirklich nach Overkill aus.«
Okay, ich empfing definitiv keine guten Schwingungen von diesem Kerl. Ich trat einen Schritt zurück, dann noch einen. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich wegen des Schocks, hatte ich viel mehr geredet, als ich es normalerweise tun würde. Vielleicht musste ich mal eine Weile still sein. Mich zurückhalten.
»Und wie?«, fragte Tulloch.
»Bitte?« Joesbury hatte zugesehen, wie ich zurückgewichen war.
»Sie stand noch auf den Beinen, als DC Flint sie gesehen hat«, erklärte Tulloch. »Sie war noch am Leben, obwohl sie grauenhafte Verletzungen hatte. Das heißt, sie ist nur Sekunden zuvor überfallen worden. Wahrscheinlich sogar, als Flint hier herumgelaufen ist und in ihrer Handtasche nach ihren Schlüsseln gekramt hat. Wie hat der Täter das gemacht? Wie hat er ihr diese Verletzungen zugefügt und ist dann spurlos verschwunden?«
Herumlaufen und kramen? Tulloch hatte den Überfall dargestellt, als sei das Ganze meine Schuld. Fast hätte ich den Mund aufgemacht; gerade rechtzeitig fiel es mir wieder ein. Zurückhalten.
»Auf dem Parkplatz gibt es keine Überwachungskameras«, sagte Joesbury. »Aber bis zur nächsten größeren Straße ist es nur ein kleines Stück. Stenning ist los, um die Bänder aufzutreiben. Wenn unser Täter den Tatort verlassen hat, dann ist er auf einem der Bänder drauf.«
Vielleicht war es ja wirklich meine Schuld gewesen. Wenn ich aufgepasst hätte, dann hätte ich den Täter vielleicht gesehen, ehe er zuschlug. Ich hätte um Hilfe schreien, per Funk die nächste Streife herbeirufen können. Ich hätte den Überfall verhindern können. Scheiße, so eine Schuldgefühl-Nummer hatte mir gerade noch gefehlt.
»Derjenige, der das war, müsste von oben bis unten voll Blut sein«, meinte Joesbury und sah mich an. »Er müsste Spuren hinterlassen haben.« Er schaute nach hinten. »Hört sich an, als wären die Hunde da.«
Wir blickten zum Parkplatz hinüber. Zwei Polizeihunde waren eingetroffen. Deutsche Schäferhunde, jeder mit einem eigenen Hundeführer.
»Nicht unbedingt«, gab ich zu bedenken, bevor ich mich bremsen konnte. Beide wandten sich wieder zu mir um. »Wenn ihr die Kehle von hinten durchgeschnitten wurde, dann hat der Täter vermutlich nicht viel abbekommen. Das ganze Blut ist nach vorn gespritzt. Auf mein Auto.«
»Und dann auf Sie«, stellte Joesbury fest. Sein Blick löste sich von meinem Gesicht und wanderte abwärts, dorthin, wo die Blutflecke selbst durch den Overall hindurch noch zu erkennen waren.
»Sind wir hier fertig, Tully?«, fuhr er dann fort. »Du musst DC Flint wirklich aufs Revier bringen.«
Einen Moment lang wirkte Tulloch unsicher. »Ich will mich bloß vergewissern, dass Neil …«
»Anderson weiß genau, was er tut«, wehrte Joesbury ab. »Er lässt sechs Officers Zeugenaussagen aufnehmen, der Verkehr ist umgeleitet worden, und sie fangen an, von Haus zu Haus zu gehen und die Nachbarn zu befragen, sobald die Hunde fertig sind.«
»Kannst du sie aufs Revier bringen?«, fragte Tulloch. »Ich möchte mich gründlich umsehen, wenn hier Ruhe einkehrt.«
Joesbury sah aus, als sei er drauf und dran, Einspruch zu erheben, dann lächelte er sie an. Er hatte tolle Zähne. »Darf ich das Tully-Mobil fahren?«, fragte er.
Kopfschüttelnd zog Tulloch den Reißverschluss ihres blauen Overalls auf und wühlte in ihrer Tasche. Dann reichte sie ihm mit finsterem Blick ihren Autoschlüssel. »Wenn du das Ding verbeulst, verbeule ich dich«, warnte sie.
»Kommen Sie, Flint, bevor sie sich’s anders überlegt.« Joesbury hatte eine Hand an meinem Ellenbogen und lotste mich auf den silbernen Mercedes des DI zu.
»Und sorg dafür, dass sie den Anzug anbehält«, rief Tulloch, als Joesbury mir die Beifahrertür aufhielt und ich einstieg. Das Innere des Wagens sah brandneu aus. Ich sank in den Ledersitz und schloss die Augen.
4
Es war bereits nach neun Uhr, doch auf den Straßen war immer noch viel los, und wir kamen nicht besonders gut voran. Tullochs Bemerkung von wegen »herumlaufen und kramen« machte mir immer noch zu schaffen, also hielt ich die Augen geschlossen und überlegte, was ich hätte anders machen können. Joesbury schwieg.
Nach zehn, vielleicht auch fünfzehn Minuten schaltete er die Stereoanlage an, und die gespenstischen Klänge von Clannad erfüllten den Wagen.
»Oh, Mann, das soll wohl ein Witz sein«, knurrte er leise. »Ist noch irgendwas im Handschuhfach?«
Ich öffnete die Augen und zog, noch immer mit Latexhandschuhen, die einzige CD hervor, die in dem kleinen Fach lag. »Mittelalterliche gregorianische Choräle«, las ich von der Hülle ab.
Joesbury schüttelte den Kopf. »Wenn Sie Gelegenheit haben, mit ihr über ihren Musikgeschmack zu reden, dann nur zu«, meinte er. »Gestern Abend hat sie mir Westlife vorgespielt.«
Er versank abermals in Schweigen, als wir die Old Kent Road erreichten. Gelegentlich, wenn das Licht der Straßenlaternen im rechten Winkel auf die Windschutzscheibe traf, sah ich sein Spiegelbild. Nichts Außergewöhnliches. Ungefähr Ende dreißig, kurzes braunes Haar. Er hatte sich ein paar Tage nicht rasiert. Sein Gesicht und die bloßen Unterarme waren sonnengebräunt. Seine Zähne, das war mir schon aufgefallen, waren ebenmäßig und sehr weiß.
Weitere zehn Minuten vergingen, ohne dass einer von uns etwas sagte. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass er mich ebenfalls in der Windschutzscheibe betrachtete, so, wie er immer wieder den Kopf zur Seite neigte.
Herumlaufen und kramen.
»Wenn ich früher bei ihr gewesen wäre, wäre sie dann noch am Leben?«, fragte ich, als wir von der Lewisham High Street abbogen und auf den Parkplatz hinter dem Polizeirevier fuhren.
»Das werden wir wohl nie erfahren«, antwortete Joesbury. Es gab keinen freien Stellplatz mehr, also hielt er direkt hinter einem grünen Audi und parkte diesen komplett zu.
»Sie hat noch gelebt, ganz kurz bevor der Notarztwagen gekommen ist«, sagte ich. »Ich hätte irgendwas auf die Wunde drücken sollen, nicht wahr? Um die Blutung zu stoppen.«
Falls ich mir irgendwelchen Trost von diesem Mann erhoffte, das hätte ich mir sparen können. »Ich bin Polizist, kein Rettungshelfer«, erwiderte er und machte den Motor aus. »Sieht aus, als würden Sie erwartet.«
Der diensthabende Sergeant des Reviers, ein Beamter von der Spurensicherung und ein Arzt warteten auf uns. Zusammen gingen wir durch die vergitterte Hintertür des Polizeireviers von Lewisham, und meine Ankunft wurde offiziell zu Protokoll genommen. Ich arbeitete seit vier Jahren bei der Londoner Polizei, doch ich hatte das Gefühl, dass ich sie gleich aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen bekommen würde.
Einige Zeit später starrte ich auf schmutzige cremeweiße Wände und graue Fußbodenfliesen. Meine linke Schulter tat weh, weil ich vorhin draufgefallen war, und ich merkte, dass Kopfschmerzen drohten. Im Laufe der letzten Stunde hatte man mich gebeten, mich vollständig auszuziehen, bevor ich von einem Polizeiarzt untersucht worden war. Nach einer Dusche war ich abermals untersucht und auch fotografiert worden. Meine Fingernägel waren geschnitten, eine Speichelprobe genommen und mein Haar gründlich und schmerzhaft durchgekämmt worden. Dann hatte man mir einen orangeroten Overall ausgehändigt, wie ihn normalerweise Untersuchungshäftlinge bekamen.
Ich hatte an diesem Abend nichts gegessen, und ob es nun am niedrigen Blutzucker lag, am Schock oder einfach nur an dem kalten Zimmer, es fiel mir schwer, mit dem Zittern aufzuhören. Immer wieder sah ich blassblaue Augen vor mir, die mich anstarrten.
Ich hätte sie retten können. Wäre ich nicht in meiner eigenen kleinen Welt gewesen, würden wir jetzt vielleicht nicht gerade eine Mordermittlung in die Wege leiten. Und alle wussten das. Das würde mein Erbe sein, solange ich im Polizeidienst war. Die Kollegin, die zugelassen hatte, dass eine Frau direkt vor ihrer Nase erstochen wurde.
Die Tür ging auf, und DI Joesbury kam herein. In dem kleinen Raum wirkte er größer als vorhin auf der Straße oder sogar in DI Tullochs Wagen. DC Gayle Mizon, die Beamtin, die dem Polizeiarzt bei den Untersuchungen assistiert hatte, war bei ihm. Die beiden hatten draußen auf dem Flur gelacht, und er lächelte noch immer, als er ihr die Tür aufhielt. Er hatte ein tolles Lächeln. Dann wandte er sich mir zu, und das Lächeln verblasste.
»Langweilen Sie sich noch immer?«, fragte ich, bevor ich mich beherrschen konnte.
Genauso gut hätte ich auch nichts sagen können. Er zeigte keinerlei Reaktion.
Mizon war eine attraktive Blondine, ungefähr dreiunddreißig oder vierunddreißig. Sie hatte mir einen Kaffee mitgebracht. Ich legte die Hand um den Becher, um sie zu wärmen, wagte es jedoch nicht, ihn hochzuheben. Dafür zitterte ich zu sehr. Joesbury fuhr fort, mich zu betrachten; mein Haar, noch nass von der Dusche, mein Gesicht, rosig und trocken, weil es nicht eingecremt worden war, und meine Untersuchungshäftlingskluft. Beeindruckt sah er nicht aus.
»Okay«, meinte er. »Dann nehmen wir mal Ihre Aussage auf.«
Als er zum Ende kam, hatte ich kaum noch genug Kraft, um aufrecht auf meinem Stuhl zu sitzen. Hätte ich DI Joesburys Befragungstechnik taktvoll beschreiben wollen, so hätte ich gesagt, er sei gründlich. Hätte Ehrlichkeit auf der Tagesordnung gestanden, so hätte ich ihn als sadistisches Arschloch bezeichnet.
Bevor sie anfingen, erklärten sie, dass Gayle Mizon die Befragung durchführen würde, Joesbury sei nur in beratender Funktion dabei. Sie hatten mir sogar Gelegenheit gegeben zu verlangen, dass er das Zimmer verließ. Ich hatte die Achseln gezuckt und irgendetwas gemurmelt von wegen, das sei schon in Ordnung. Ein Riesenfehler, denn sobald es losging, übernahm er das Ruder.
Was darauf folgte, kam mir nicht vor wie irgendeine Zeugenaussage, bei der ich jemals beteiligt gewesen war. Es war mehr so, als sollte Anklage gegen mich erhoben werden. Er ließ mich jedes einzelne Detail mehrmals schildern, bis sogar Mizon aussah, als fühle sie sich unwohl. Und er kam immer wieder auf denselben Punkt zurück. Wie war es möglich, dass ich überhaupt nichts gesehen hatte? Wie konnte es sein, dass ich den Überfall nicht mitbekommen hatte, wo ich doch so nah am Geschehen war? Jeden Augenblick erwartete ich, dass er behaupten würde, die blonde Frau könnte noch am Leben sein, wenn ich keinen Mist gebaut hätte.
Endlich machte er Schluss und schaltete das Aufnahmegerät aus. Die Uhr an der Wand zeigte nach elf.
»Möchten Sie, dass wir irgendjemanden anrufen?«, erkundigte sich Mizon, während Joesbury die Disk aus dem Aufnahmegerät nahm und sie beschriftete.
Ich schüttelte den Kopf.
»Ist bei Ihnen jemand da, wenn Sie nach Hause kommen?«, fragte sie. »Mitbewohnerin? Freund? Sie haben einen ziemlich heftigen Schock, wahrscheinlich sollten Sie nicht allein sein.«
»Ich wohne allein«, sagte ich. »Aber ich komme schon zurecht« fügte ich hinzu, als sie ein besorgtes Gesicht machte. »Ist es okay, wenn ich jetzt gehe?«
»Verwandte?« So leicht gab Mizon nicht auf.
»Sie wohnen nicht in London«, erwiderte ich. Das stimmte zwar, war aber ein bisschen unaufrichtig. Sie wohnen nirgends. Ich habe keine Familie. »Hören Sie, ich bin müde, ich habe nichts gegessen, ich will einfach nur nach Hause und …«
Mit gefurchter Stirn blickte Joesbury auf. »Hat niemand Ihnen etwas zu essen angeboten?«, fragte er, und man musste ihn wirklich dafür bewundern, wie er das klingen ließ, als sei es meine Schuld.
»Ist wirklich kein Problem. Kann ich jetzt gehen?« Ich stand auf. »Sir«, fügte ich zur Sicherheit hinzu.
Joesbury wandte sich an Mizon. »Gayle, wenn wir den Mörder hier angeschleppt hätten, auf frischer Tat ertappt und das Messer zwischen den Zähnen, dann hätten wir ihm etwas zu essen gegeben. Und eine von unseren eigenen Leuten lassen wir hungern.«
»Ich dachte, jemand anderes hätte …«, setzte Mizon an.
»Es ist wirklich nicht …«, versuchte ich es.
»Entschuldigung«, sagte sie zu mir. Ich zuckte die Schultern, brachte ein Lächeln zustande.
Joesbury stand auf und schritt durchs Zimmer. »Kommen Sie«, sagte er und hielt die Tür auf.
»Wo geht’s denn jetzt hin?« Ich hatte nicht mehr die Energie, auch nur ansatzweise höflich zu sein. Nicht dass frühere Bemühungen großen Erfolg gehabt hätten.
»Ich sorge dafür, dass Sie was zu essen bekommen, dann bringe ich Sie nach Hause.« Mit einem Kopfnicken deutete er auf die Disk, die auf dem Tisch lag. »Können Sie das weiterleiten?«, fragte er die ziemlich verblüffte Mizon. Dann ging er mit mir hinaus.
Tullochs silberner Mercedes war bereits umgestellt worden, und Joesbury schloss den grünen Audi auf, den wir vorhin zugeparkt hatten. Er ließ den Motor an, legte den Gang ein und fing an, einen Stapel CDs durchzusehen.
»Haben Sie was von Westlife?«, erkundigte ich mich, als er rückwärts aus der Parkbucht fuhr und wendete. Als er nicht antwortete, machte ich mir im Geiste eine Notiz, dass Sinn für Humor nicht besonders weit oben auf der Liste der Eigenschaften dieses Mannes stand. Und dass ich fair und einfühlsam wahrscheinlich ebenfalls streichen konnte. Tatsächlich konnte ich eigentlich nur einen gesunden Respekt vor dem Hunger einer Frau bestätigen. Er schob eine CD in die Stereoanlage. Wieder auf der Lewisham High Street, drehte er die Lautstärke auf, und rhythmische Club-Musik erfüllte den Wagen. Botschaft empfangen und verstanden, DI Joesbury. Ich sollte die Klappe halten.
5
Der Garten ist lang und schmal. Und sehr dunkel. Hohe Mauern halten auf drei Seiten das Licht fern, während das dichte Laub wuchernder Büsche alles an Helligkeit aufzusaugen scheint, was trotzdem durchdringt. Etliche Fenster gehen auf den Garten hinaus, doch der Eindringling, der langsam den schmalen Kiesweg hinuntergeht, ist ganz in Schwarz gekleidet, und es ist unwahrscheinlich, dass er entdeckt wird.
Der Garten duftet. Der Eindringling bleibt einen Augenblick lang stehen und atmet tief durch, ehe er die Hand nach einer sternförmigen Blüte ausstreckt. Jasmin.
Am unteren Ende des Gartens ist ein kleiner, solide gebauter Holzschuppen, teilweise vom Pflanzenwuchs verborgen. Efeu rankt sich an den Wänden hinauf, und überhängende Äste ruhen auf dem Dach. Die Tür ist abgeschlossen. Der Eindringling überlegt einen Moment, ehe er den Arm nach oben streckt und mit der Hand am Rand des niedrigen Flachdachs entlangstreicht. Ein paar Augenblicke später findet die Hand, wonach sie sucht. Einen Schlüssel.
Die Tür lässt sich leicht öffnen. Mit einem unterdrückten Fluch fährt der Eindringling zurück.
Einen Augenblick lang scheint eine menschliche Gestalt in dem Schuppen zu hängen. Sie pendelt sanft hin und her, dreht sich auf der Stelle. Der Form nach menschlich, aber kein Mensch. Diese Gestalt hat einen weichen, zylindrischen Oberkörper; sie ist bekleidet, hat aber keine Gliedmaßen. Ihr Kopf – männlich – hat früher einmal aus einem Schaufenster geblickt.
Der Eindringling berührt sie leicht. Sie dreht sich an der Kette, an der sie vom Schuppendach hängt, und der Kopf pendelt wie der eines Betrunkenen. Oder eines Verrückten.
»Was für eine tolle Idee«, sagt der Eindringling. »Oh, Lacey, was für eine geniale Idee.«
6
»Sind Sie Vegetarierin, haben Sie eine Laktoseunverträglichkeit, oder sind Sie allergisch gegen Sesamkörner …?«, fragte Joesbury mich. Das waren praktisch die ersten Worte aus seinem Mund, seit wir das Revier verlassen hatten. Wir saßen in einem kleinen chinesischen Restaurant, nicht weit von dort, wo ich wohne. Ich glaube, es war mir noch nie aufgefallen. Der Besitzer, ein schlanker Chinese Mitte fünfzig namens Trev, hatte Joesbury begrüßt wie einen alten Freund.
»Wenn etwas lange genug still hält, esse ich es«, antwortete ich.
Joesburys Augen wurden ein bisschen größer. Er und Trev wechselten einen Blick, führten eine kurze, halblaute Unterredung, und dann verschwand der Chinese. Joesbury nahm mir gegenüber Platz, und ich wartete mit einigem Interesse ab. Jetzt würde er mit mir reden müssen.
Er nahm eine Gabel und fuhr mit den Zinken über eine Papierserviette, ehe er sich zurücklehnte und die vier schnurgeraden Linien bewunderte, die er gezogen hatte. Dann schaute er auf, begegnete meinem Blick und schaute wieder auf den Tisch hinab. Die Gabel fuhr abermals die Serviette hinunter, und es wurde geradezu schmerzhaft deutlich, dass DI Joesbury und ich nicht derselben Meinung waren, was das mit dem Reden betraf.
»Wenn Sie nicht zum MIT gehören, was machen Sie dann?«, erkundigte ich mich. »Verkehr?«
Wenn Sie bei der Polizei einen Kollegen beleidigen wollen, fragen Sie ihn, ob er für Verkehrsdelikte zuständig ist. Warum genau ich einen ranghöheren Officer beleidigte, dem ich gerade erst begegnet war, war natürlich eine gute Frage.
»Ich bin beim SO10«, antwortete er.
Ich überlegte einen Moment. SO heißt Special Operations. Die verschiedenen Abteilungen waren nach ihren jeweiligen Funktionen durchnummeriert. SO1 schützte Personen des öffentlichen Lebens, SO14 die königliche Familie. »SO10 arbeitet undercover, nicht wahr?«, fragte ich.
Er neigte den Kopf. »Heutzutage wird die Bezeichnung ›verdeckte Ermittlungen‹ bevorzugt.«
»Dann arbeiten Sie bei Scotland Yard?«, fragte ich, ein wenig ermutigt, weil ich einen ganzen Satz aus ihm herausgeholt hatte.
Ein weiteres kurzes Nicken. »Theoretisch schon.«
Was sollte das denn heißen? Entweder arbeitet man irgendwo oder nicht.
»Wie sind Sie dann heute Abend am Tatort gelandet?«
Er seufzte, als frage er sich, wieso ich ihn mit diesem lästigen Konversationsgetue langweilte. »Ich bin rekonvaleszent«, sagte er. »Hab mir bei einer Schlägerei die Schulter ausgekugelt und hätte fast ein Auge verloren. Offiziell bin ich noch bis November nicht voll einsatzfähig, aber wie sowohl Sie als auch DI Tulloch so deutlich angemerkt haben, ich langweile mich.«
Trev kam mit unseren Getränken. Er stellte eine Flasche südamerikanisches Bier vor jeden von uns. Ich war nicht gefragt worden, was ich gern hätte.
»Ihr Gesichtsausdruck sagt mir, dass Sie keine Biertrinkerin sind«, bemerkte Joesbury. Er griff über den Tisch und goss den Inhalt meiner Flasche in ein Glas. »Das weiß ich auch so. Sie sind viel zu dünn für eine Biertrinkerin, aber das Zeug ist gut gegen den Schock.«
Ich nahm mein Glas. Ich bin in der Tat keine Biertrinkerin, allerdings schien mir Alkohol in jeglicher Darreichungsform plötzlich genau das Richtige zu sein. Joesbury sah zu, wie ich fast ein Drittel des Glases leerte, bevor ich es absetzte und Luft holte.
»Wie sind Sie zur Polizei gekommen?«, erkundigte er sich.
»Durch ein frühkindliches Interesse an Serienmördern«, erwiderte ich. Das war die Wahrheit, obwohl ich diese Tatsache normalerweise nicht so unverblümt hinausposaune. Gewaltverbrechen und die, die sie begehen, haben mich fasziniert, seitdem ich mich erinnern kann, und das war es, was mich auf einem langen, verschlungenen Weg in den Polizeidienst geführt hatte.
Joesbury zog eine Braue hoch.
»Genau gesagt, sadistische, psychopathische Täter«, fuhr ich fort. »Sie wissen schon, die, die töten, um irgendein abwegiges sexuelles Verlangen zu befriedigen. Sutcliffe, West, Brady. Als Kind konnte ich gar nicht genug von denen kriegen.«
Die Braue blieb oben, während mir klar wurde, dass mein Glas jetzt mehr als halb leer war und dass ich es wirklich ein bisschen langsamer angehen lassen musste.
»Wissen Sie, wenn Sie sich langweilen, dann sollten Sie mal über Golf nachdenken«, sagte ich. »Viele Männer mittleren Alters finden, dass das ein recht netter Zeitvertreib ist.«
Joesburys Lippen wurden schmal, doch er war nicht bereit, eine so billige Stichelei einer Antwort zu würdigen. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen. Einen Vorgesetzten in Rage zu bringen, ganz gleich, wie unangenehm er war, passte wirklich nicht zu mir. Ich war die Zurückhaltung in Person.
»Sir, ich möchte mich entschuldigen«, sagte ich. »Ich hatte einen echt harten Tag, und …« Bewegung neben mir. Das Essen war da.
»Nennen Sie ihn bloß nicht Sir«, sagte Trev und stellte einen Teller mit Nudeln, Garnelen und Gemüse vor mich und einen mit Rindfleisch und schwarzen Bohnen vor Joesbury. »Es macht ihn total an, wenn junge Polizistinnen ihn Sir nennen.«
»Ich werd’s mir merken«, murmelte ich und dachte, dass das wahrscheinlich nicht allzu schwierig sein dürfte. Joesbury war definitiv nicht mein Typ. Eigentlich stand ich auf gar keinen besonderen Typ. Aber wenn doch, wäre er es nicht.
»Also, das hier ist für Dana«, fuhr Trev fort und stellte einen Plastikteller mit Deckel auf den Tisch. »Grüß sie von mir, sag ihr, sie soll bald mal wiederkommen, und wenn sie je …«
»Trev«, knurrte Joesbury. »Wie oft muss ich dir noch …?«
»Man darf als Mann ja wohl noch träumen«, gab Trev zurück, während er sich auf den Weg zurück in die Küche machte. Als ich aufschaute, war Joesbury eingehend mit seinem Essen beschäftigt.
»Woher wusste er, dass ich bei der Polizei bin?«, fragte ich, während ich nach meiner Gabel griff und eine Garnele auf dem Teller im Kreis herumschob.
»Sie tragen einen orangefarbenen Sträflingsoverall, und auf dem Kragen steht ›Eigentum der Polizei von London‹«, antwortete Joesbury, ohne aufzublicken.
»Ich könnte doch eine Verbrecherin sein«, gab ich zu bedenken und schob mir die Garnele in den Mund. Groß und trocken wie ein Stück Holz lag sie auf meiner Zunge.
»Ja«, meinte Joesbury. Er legte die Gabel hin und sah auf. »Der Gedanke ist mir auch schon gekommen.«
7
Ich wohne ganz in der Nähe der Wandsworth Road, keine fünf Minuten von Trevs China-Restaurant entfernt, im Untergeschoss eines viktorianischen Hauses. Der Makler, der mir die Wohnung vermietet hat, hatte sie als Gartenwohnung bezeichnet. In Wirklichkeit ist es der Keller, zugänglich über ein Dutzend Steinstufen, die gleich rechts neben der Haustür vom Gehsteig abwärtsführen. Aus reiner Gewohnheit warf ich einen prüfenden Blick in den kleinen Schattenbereich unter den Stufen. Wenn ich Pech hatte (und nicht aufpasste), könnte dort eines Nachts jemand warten. Noch war das nie passiert, und ich hoffte, heute Abend würde nicht das erste Mal sein, dafür war ich wirklich nicht in der richtigen Stimmung. Der Treppenschacht war leer, und das Vorhängeschloss an dem Verschlag, wo ich mein Fahrrad unterstellte, war nicht angerührt worden. Ich steckte den Schlüssel ins Türschloss und trat in die Wohnung.
Drinnen ging ich durchs Wohnzimmer, vorbei an der winzigen Küche und weiter ins Schlafzimmer. An diesem Morgen hatte ich das Bett neu bezogen, wie jeden Freitag. Die Bettwäsche war aus frischer weißer Baumwolle, eine der sehr wenigen Annehmlichkeiten, die ich mir zugestehe. Normalerweise gehört es für mich zu den Highlights der Woche, mich am Freitagabend ins Bett zu legen.
Doch ich wurde irgendwie das fürchterliche Gefühl nicht los, dass rote Flecken auf der Bettwäsche sein würden, wenn ich mich da hineinlegte, das Blut einer anderen Frau. Bescheuert, ich hatte geduscht, bis sich meine Haut ganz wund angefühlt hatte, aber trotzdem …
Ich ging weiter und trat durch eine Art angebauten Wintergarten in den Garten hinaus. Er ist lang und sehr schmal, wie viele Gärten hinter Londons Reihenhausstraßen, und bekommt so gut wie kein direktes Sonnenlicht. Doch zum Glück hat derjenige, der ihn angelegt hat, sich ausgekannt. Sämtliche Pflanzen gedeihen im Schatten, und der Garten ist voller kleiner Bäume und dichter Büsche. Hohe Ziegelmauern zu beiden Seiten sorgen für Abgeschiedenheit. Eine kleine Seitentür führt auf eine Gasse hinaus. Ich achte darauf, dass sie stets zugesperrt ist.
Ich schloss die Lider und sah blassblaue Augen, die starr in meine blickten.
DI Joesbury, so ätzend er auch war, hatte es tatsächlich geschafft, dass ich für eine Weile nicht mehr an die Ereignisse von vorhin gedacht hatte. Als ich mit ihm zusammengesessen hatte, war ich bemüht gewesen, ein Gesprächsthema zu finden und bloß nichts Unangebrachtes zu sagen. Er hatte mir etwas gegeben, worauf ich mich konzentrieren konnte. Jetzt jedoch, wo ich allein war, war plötzlich alles wieder da.
London ist niemals still, und sogar um diese Zeit konnte ich das unablässige Dröhnen des Straßenverkehrs hören, Menschen, die draußen auf der Straße vorbeigingen und schrilles Geschrei ganz in der Nähe.
Keine hundert Meter von meiner Wohnung entfernt ist ein Park. Wenn die Sonne untergeht, nehmen die Teenager aus South London ihn in Beschlag; sie turnen wie Affen auf dem Spielplatz herum und kreischen und heulen sich alles Mögliche zu. Heute Nacht waren sie groß in Form. Soweit ich es hören konnte, war da eine Art Verfolgungsjagd im Gange. Mädchen quietschten. Musik dröhnte. Sie ließen ordentlich Dampf ab.
Und das war genau das, was ich auch nötig hatte, erschöpft oder nicht. Und ich hatte meinen eigenen Spielplatz dafür.
8
Camden Town war schon lange eine der angesagtesten Gegenden von ganz London, besonders seit dem Ausbau des Camden Stables Market. Ehemals ein ausgedehntes Netzwerk aus Tunneln, Gewölben, Überführungen und schmalen Gängen, war der Markt vor einigen Jahren an einen Bauunternehmer verkauft und in einen riesigen Komplex mit Geschäften, Bars, Marktständen und Cafés verwandelt worden. Tagsüber ist es ein beliebter Ort zum Stöbern, Essen und einfach nur zum Abhängen. Abends strömen die Leute in Scharen hierher. Mindestens einmal in der Woche, für gewöhnlich am Freitag, gehöre ich auch dazu.
Mein Auto war von der Spurensicherung beschlagnahmt worden, also musste ich mit dem Bus fahren. Als ich auf das Horse Hospital zuhielt, früher ein Stall für kranke und ausgelaugte Arbeitspferde, zog ich meine Jacke aus und stopfte sie in den kleinen Rucksack, den ich über der Schulter trug.
Camden Market ist voll von Pferden, oder vielmehr Nachbildungen von Pferden. Damals, als die Eisenbahnen gebaut wurden, wurden im wahrsten Sinne des Wortes Hunderte von ihnen hier gehalten, um Waren und Ausrüstung hin und her zu transportieren. Das war eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch in Camden fristeten die Arbeitspferde ihr Leben weitgehend unter der Erde. Sie zogen durch Tunnel von einem Teil des Areals zum anderen, die extra dafür konstruiert worden waren, ihnen sicheren Durchlass zu gewähren. Eine Weile standen sie sogar in unterirdischen Ställen.
Heute sind die Arbeitspferde längst verschwunden, aber überall, wohin man sich wendet, sind Pferdebilder. Wandbehänge, gewaltige, freistehende Statuen, in Geländer, Laternenpfähle und selbst in Mülleimer eingearbeitete Pferdemotive. Ich mag Pferde, aber selbst ich finde, dass das Bauunternehmen es ein bisschen übertrieben hat.
Die Hitze prallte gegen mich wie eine Mauer, als ich durch den Haupteingang des Horse Hospital trat und dann weiter den Mittelgang hinunterging, vorbei an den Pferdeboxen und der Stallausrüstung von damals. Violette Lichter blinkten zu beiden Seiten. Selbst um diese Zeit war es hier voll, und der Geruch von Alkohol und Menschen hing dick in der Luft.
In einer der Boxen stieg eine Party, und ganz kurz erwog ich, uneingeladen dort aufzukreuzen. Dann bemerkte ich die roten Heliumballons am Eisengitter. Sie schwankten glänzend in der heißen Luft. Wie Blutstropfen. Ich ging weiter, drängte mich zur Bar durch und holte mir einen Bombay Sapphire auf Eis. Ich kann den Geschmack nicht ausstehen, deshalb trinke ich das Zeug sehr langsam, aber wenn ich eine schnelle Dröhnung brauche, ist es genau das Richtige. Die Uhr hinter der Bar verriet mir, dass es fünf vor eins war. Um zwei macht der Laden zu.
Noch ein paar Schritte, und ich war von dem sanften orangefarbenen Licht der Fotogalerie umgeben. Um mich herum glänzten goldene Gesichter vor Hitze. Vorhin hatte eine Band gespielt, und oben auf der Bühne packte jemand die Ausrüstung zusammen.
»Hey, Baby!« Vier Jungs, kaum alt genug, um in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, verstellten mir den Weg. Der, der mich angesprochen hatte, kam näher getorkelt, streckte die Hand nach mir aus.
»Wolln wir mal rausgehen?«, bot er an.
Die Hand hatte meine Hüfte erreicht. Er hatte Mühe, geradeaus zu schauen, und ich glaubte nicht, dass das nur vom Saufen kam.
»Na ja, das ist ’ne nette Idee«, erwiderte ich. »Aber die von der Klinik haben mir noch kein grünes Licht gegeben. Ich melde mich bei dir.«
Rasch lächelte ich einen großen, dunkelhaarigen Jungen an, der nüchterner zu sein schien als der Rest. Er grinste zurück, und ich schob mich an ihnen vorbei. Ein paar Schritte weiter fühlte ich eine Hand an meinem Ellenbogen. Der dunkelhaarige Junge war mir gefolgt.
»Lauf doch nicht weg«, sagte er.
Ich sah ihn an und überlegte. Jünger, als mir eigentlich lieb war, aber definitiv denkbar. Groß, fing gerade erst an, Muskeln aufzubauen. Er hatte ein markantes Kinn, und sein Gesicht hatte fast etwas Königliches. Sein Haar war lockig, halblang, und er hatte sehr helle Haut. Die Sorte Haut, die unheimlich weich ist.
»Wie heißt du?«, fragte ich.
»Ben«, antwortete er. »Und du?«
Drei Augenpaare beobachteten uns, spornten ihn an. Leg dich mit einer Gruppe Kumpels an, und du bekommst es mit einer Gang zu tun. Ich mochte Gangs nicht.
»Wir sehen uns ein andermal«, sagte ich. »Komm ohne deine Freunde.«
Damit wandte ich mich ab, ging durch die offenen Boxen des Horse Hospital zurück und trat ins Freie. Über eine breite, gewundene Rampe kommt man nach unten auf den Markt, vorbei an einer weiteren riesigen Pferdestatue. Die Nacht kühlte allmählich ab. Die meisten Stände im Freien hatten bereits zugemacht, bis auf die, an denen es was zu essen gab. Überall, wo ich hinschaute, standen Menschen in Gruppen zusammen, lehnten an Mauern und Geländern, wärmten sich unter Heizpilzen auf, aßen und tranken.
In der Mitte des Platzes führen breite Stufen zu weiteren Buden hinunter. Oben auf diesen Stufen hatte man einen guten Blick auf das Geschehen. Ungefähr auf halbem Weg die Treppe hinunter stand ein blonder Mann und beobachtete mich. Als ich seinen Blick erwiderte, schaute er nicht weg. Als ich lächelte, lächelte er ebenfalls.
Er lehnte an einer der metallenen Pferdestatuen und schien allein zu sein. So um die dreißig, schätzte ich, vielleicht auch ein bisschen älter, noch immer im Anzug. Er hatte die Krawatte abgenommen und den Hemdkragen aufgeknöpft. Wenn er direkt von der Arbeit gekommen war, war er schon lange hier, doch selbst auf diese Entfernung hatte ich nicht den Eindruck, dass er betrunken war.
Als ich die Stufen hinunterging, begriff er, dass ich auf ihn zukam. Sein Blick hielt den meinen die ganze Zeit fest, und ich glaubte nicht, dass er eine meiner schwierigeren Eroberungen sein würde. Dann ließ irgendetwas mich aufblicken, und ich blieb wie angewurzelt stehen.
Mark Joesbury stand auf der Empore, die sich um die Stufen herumzieht, genau gegenüber von mir. Er beugte sich über das Geländer, und sein Blick wanderte von mir zu dem Mann, auf den ich zuging. Als er merkte, dass ich ihn gesehen hatte, kniff er die Augen zusammen.
Ich ging weiter, ohne den blonden Mann zu beachten. Am Fuß der Stufen angekommen, wandte ich mich nach links und drängte mich durch dichte Menschenmassen, schubste ein in Leder gekleidetes Mädchen aus dem Weg, zwängte mich zwischen menschlichen Leibern hindurch. Ich konnte nur hoffen, dass Joesbury sich in Camden nicht so gut auskannte wie ich.
Die Menge lichtete sich, wurde jedoch weniger respektabel, als ich rasch an den Toiletten vorbeischritt. Hier gingen die Drogendeals über die Bühne. Rasch stieß ich die Schwingtür auf und rannte los, die Betonstufen hinauf. Ich musste mehrere Treppen hoch, um wieder auf der Straße herauszukommen.
Wenn Joesbury diesen Ausgang nicht kannte, konnte ich die Marktstände umgehen, durch Camden Lock Place sausen und die Treidelbrücke überqueren. Auf der anderen Seite musste ich nur noch ein paar hundert Meter laufen und konnte dann mit einem Nachtbus nach Hause fahren. In meinem Rucksack hatte ich flache Schuhe.
Als ich auf die Schleuse zuhielt, zitterte ich von Neuem und hätte diesmal wirklich nicht sagen können, ob das von der Kälte, einem verspätet einsetzenden Schock oder von der Riesenwut kam, die ich im Bauch hatte. Als ich den Kanal erreichte, hatte ich mich entschieden.
Was zum Teufel hatte Joesbury hier zu suchen? Ich komme aus einem ganz bestimmten Grund hierher, verdammt noch mal. Von da aus, wo ich wohne und arbeite, liegt Camden auf der anderen Scheißseite von London, und die Chance, jemandem zu begegnen, den ich kenne, ist minimal. Es konnte kein Zufall sein, dass er hier war. Er hatte mich abgesetzt, hatte vor meiner Wohnung gewartet und war mir hierhergefolgt. Wieso?
Es war nach zwei, als ich nach Hause kam. Ich marschierte geradewegs durch die Wohnung. Ganz hinten im Garten ist ein kleiner Schuppen. Ich habe den Boden mit Schaumgummimatten ausgelegt und in der Mitte des Schuppendachs einen großen Sandsack aufgehängt. Diesem hatte ich einen Kopf verpasst, der früher mal einer Schaufensterpuppe gehört hatte, und ihm Klamotten angezogen, so dass er aussah wie ein Mensch. Mit Handschuhen gab ich mich nur selten ab.
Ich drosch auf den Sandsack ein, so fest ich konnte; so fest, dass ein gellender Schmerz durch meine geprellte Schulter fuhr. Ohne darauf zu achten, schlug ich wieder zu, und wieder, bis ich so erschöpft war, dass ich das Gleichgewicht verlor und umfiel. Ich versetzte dem Sandsack einen letzten Tritt und überlegte, ob es mir wohl dieses eine Mal gelänge, aus vollem Hals loszuschreien. Stattdessen schloss ich die Augen.
Ich kann mich nie an meine Träume erinnern. Am nächsten Morgen habe ich keine Ahnung, was in den dunklen Stunden in meinem Kopf los war, und doch weiß ich immer, wenn ich schlecht geträumt habe. In jener Nacht mussten meine Träume besonders schlimm gewesen sein, denn ich erwachte kaum eine Stunde, nachdem ich eingeschlafen war, und stellte fest, dass ich schweißgebadet war und kaum Luft bekam. Hastig krabbelte ich rückwärts, bis ich gegen die Schuppentür stieß, und fand mich hellwach im Garten wieder.
Wach oder nicht, der Traum schien nicht weichen zu wollen. Ich konnte blassblaue Augen sehen, die Augen der Toten, die in meine starrten; etwas wie Wut lag darin. Nein, das stimmte nicht, die Augen waren starr vor Entsetzen gewesen. Nur dass es jetzt mein Entsetzen war. Und die Augen kamen die ganze Zeit näher …
Die kühle Nachtluft linderte die Hitze ein wenig. Mir fehlte nichts, das waren nur Nachwirkungen des Schocks. Bloß ein Traum, der erste seit sehr langer Zeit. Ich stolperte durch den Garten und blieb dann stehen.
Von irgendwoher ganz in der Nähe war Musik zu vernehmen, möglicherweise aus dem Park. Doch es war nicht der dröhnende, pulsierende Lärm, den ich nachts für gewöhnlich zu hören bekam. Dies war eine richtige Melodie, die sanft und leicht über die Dächer schwebte. Julie Andrews, aus The Sound of Music, das Lied, das sie singt, um die Kinder zu beruhigen, die sich vor dem Gewitter fürchten. »Raindrops and Roses«, so beginnt es. My Favorite Things.
Als Kind war ich von The Sound of Music völlig hingerissen gewesen. Dieses Lied hatte ich ganz besonders geliebt und selbst Listen von den Dingen gemacht, die ich am liebsten mochte. Wenn das Leben vollkommen beschissen war (was regelmäßig vorkam, als ich klein war), hatte ich dieses Spiel gespielt und mich ein bisschen besser gefühlt. Doch das war alles so lange her.
Ich machte noch einen Schritt auf das Haus zu.
Die Musik spielte immer noch, leise und lieblich, und durch die Klänge konnte ich auf der anderen Seite der Gartenmauer ein Scharren hören. Rasch warf ich einen Blick auf die Seitentür, die auf die kleine Seitengasse hinausführte. Der Riegel war vorgeschoben. Wieder rührte sich etwas, etwas streifte die Mauer. Normalerweise würde ich mich nicht als furchtsamen Menschen bezeichnen, doch ich verspürte ein plötzliches Bedürfnis, mich in die Wohnung zu verziehen.
Ich hastete durch den Garten und trat durch den Wintergarten ins Haus. Dann überprüfte ich die Schlösser sorgfältiger, als ich es sonst tue. Wahrscheinlich war das Ganze bloß einer dieser komischen Zufälle, doch als ich eine Decke aus dem Schrank zerrte und mich auf dem Sofa zusammenrollte, wunderte ich mich doch unwillkürlich, dass ausgerechnet heute jemand beschließen sollte, My Favorite Things zu spielen.
Ich erwachte davon, dass mein Telefon klingelte. Es war der diensthabende Sergeant vom Polizeirevier Southwark. Ich hatte Anweisung gegeben, dass man mich ausfindig machen sollte, wenn eine ganz bestimmte Person nach mir fragte. Diese Person wartete jetzt auf dem Revier auf mich. Also würde ich zur Arbeit gehen, freier Tag hin oder her.
9
Samstag, 1. September
»Sie warn zu dritt. Zuerst warn sie zu dritt. Dann sind noch mehr gekommen.«
Ich saß ganz still auf der Holzbank, wollte nichts tun, was sie ablenken könnte. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mir Notizen zu machen, doch das hatte sie mir nicht gestattet. Sie hatte mir auch nicht erlaubt, das kleine Aufnahmegerät einzuschalten, das ich mitgebracht hatte. Sie würde keine Aussage machen, hatte sie mehrmals wiederholt, bis sie ganz sicher sei, dass ich verstand. Sie war nicht einmal bereit gewesen, auf dem Revier zu bleiben. Also waren wir hinausgegangen und zum Fluss hinunterspaziert, dorthin, wo Shakespeares Globe Theatre am Südufer nachgebaut worden war.
Rona Dawson war fünfzehn Jahre alt, rundlich, mit strahlender Haut und geflochtenem Haar. Augen wie Bitterschokolade. Sie war ein hübsches schwarzes Mädchen wie Dutzende andere in South London. Und wie Dutzende andere war sie von ihrem Freund und mehreren seiner Kumpels vergewaltigt worden.