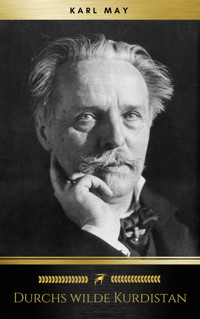
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oregan Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei den allseits verachteten "Teufelsanbetern" wird Kara Ben Nemsi mit seinen Begleitern freundlich aufgenommen. Amad el Ghandur, der Sohn von Scheik Mohammed Emin, ihrem Gastfreund aus dem ersten Band, wird aus einer Festung in Amadijah befreit. Und Kara Ben Nemsi lernt Marah Durimeh kennen - und einen geheimnisvollen Höhlengeist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Durchs wilde Kurdistan
Karl May
Copyright © 2018 by OPU
Kapitel1 Der Opfertod des Heiligen
Wir kehrten von dem Besuche des Häuptlings der Badinankurden zurück. Als wir auf der letzten Höhe ankamen und das Tal der Teufelsanbeter überblicken konnten, bemerkten wir ganz in der Nähe des Hauses, welches dem Bey gehörte, einen ungeheuren Haufen von Reisholz, der von einer Anzahl von Dschesidi immer noch vergrößert wurde. Pir Kamek stand dabei und warf von Zeit zu Zeit ein Stück Erdharz hinein. »Das ist sein Opferhaufen,« meinte Ali Bey. »Was wird er opfern?« »Ich weiß es nicht.« »Vielleicht ein Tier?« »Nur bei den Heiden werden Tiere verbrannt.« »Dann vielleicht Früchte?« »Die Dschesidi verbrennen weder Tiere noch Früchte. Der Pir hat mir nicht gesagt, was er verbrennen wird, aber er ist ein großer Heiliger, und was er tut, wird keine Sünde sein.« Noch immer ertönten von der gegenüberliegenden Höhe die Salven der ankommenden Pilger, und noch immer wurde denselben im Tale geantwortet; und doch bemerkte ich, als wir unten ankamen, daß dieses Tal kaum noch mehr Menschen zu fassen vermöge. Wir übergaben unsere Tiere und gingen nach dem Grabmale. An dem Wege, welcher zu demselben führte, lag ein Springbrunnen, der von Platten eingefaßt war. Auf einer derselben saß Mir Scheik Khan und sprach mit einer Anzahl von Pilgern, die in ehrerbietiger Haltung und Entfernung vor ihm standen. »Dieser Brunnen ist heilig, und nur der Mir, ich und die Priester dürfen auf diesen Steinen sitzen. Zürne also nicht, wenn du stehen mußt!« sagte Ali zu mir. »Eure Gebräuche werde ich achten.« Als wir uns nahten, gab der Khan den Umstehenden ein Zeichen, worauf sie Platz machten, so daß wir zu ihm kommen konnten. Er erhob sich, kam uns einige Schritte entgegen und reichte uns die Hände. »Willkommen bei eurer Rückkehr! Nehmt Platz zu meiner Rechten und Linken!« Er deutete dem Bey zur Linken, sodaß mir die rechte Seite übrig blieb. Ich setzte mich auf die geheiligten Steine, ohne daß ich bei einem der Anwesenden den geringsten Verdruß darüber bemerkt hätte. Wie sehr stach ein solches Verhalten gegen dasjenige ab, welches man bei den Mohammedanern zu beobachten hat. »Hast du mit dem Häuptling gesprochen?« fragte der Khan. »Ja. Es ist alles in der besten Ordnung. Hast du den Pilgern bereits eine Mitteilung gemacht?« »Nein.« »So wird es Zeit sein, daß die Leute sich versammeln. Gib den Befehl dazu!« »Ich bin der Regent des Glaubens, und alles andere ist deine Sache. Ich werde dir den Ruhm, die Gläubigen beschützt und die Feinde besiegt zu haben, niemals verkürzen.« Auch dies war eine Bescheidenheit, welche bei den mohammedanischen Imams niemals zu finden ist. Ali Bey erhob sich und schritt von dannen. Während ich mich mit dem Khan unterhielt, bemerkte ich eine Bewegung unter den Pilgern, welche mit jeder Minute größer wurde. Die Frauen blieben an ihren Plätzen stehen, die Kinder ebenso; die Männer aber stellten sich am Bache entlang auf, und die Anführer der einzelnen Stämme, Zweige und Ortschaften bildeten einen Kreis um Ali Bey, der ihnen die Absichten des Mutessarif von Mossul bekannt machte. Dabei herrschte eine Ruhe, eine Ordnung, wie bei der Parade einer europäischen Truppe, ganz verschieden von dem lärmenden Durcheinander, welches man sonst bei orientalischen Kriegern zu sehen und zu hören gewohnt ist. Nach einiger Zeit, in welcher die Anführer den Ihrigen die Mitteilung und die Befehle des Bey überbracht hatten, ging die Versammlung ohne Unordnung wieder auseinander, und ein jeder begab sich an den Platz, den er vorher inne gehabt hatte. Ali Bey kam zu uns zurück. »Was hast du befohlen?« fragte der Khan. Der Gefragte streckte den Arm aus und deutete auf einen Trupp von vielleicht zwanzig Männern, die den Pfad emporstiegen, auf dem wir vorhin herabgekommen waren. »Siehe, das sind Krieger aus Aïram, Hadschi Dsho und Schura Khan, welche diese Gegend sehr gut kennen. Sie gehen den Türken entgegen und werden uns von deren Kommen rechtzeitig benachrichtigen. Auch gegen Baadri hin habe ich Wachen stehen, so daß es ganz unmöglich ist, uns zu überraschen. Bis es Nacht wird, ist noch drei Stunden Zeit, und das genügt, um alles Ueberflüssige nach dem Tale Idiz zu bringen. Die Männer werden aufbrechen, und Selek wird ihnen den Weg zeigen.« »Werden sie bei dem Beginne der heiligen Handlungen zurückgekehrt sein?« »Ja; das ist sicher.« »So mögen sie gehen!« Nach einiger Zeit schritt ein sehr, sehr langer Zug von Männern, welche Tiere mit sich führten oder verschiedene Habseligkeiten trugen, an uns vorüber, wo sie, immer einer nach dem andern, hinter dem Grabmale verschwanden. Dann kamen sie über demselben auf einem Felsenpfade wieder zum Vorschein, und man konnte von unserem Sitz aus ihren Weg verfolgen, bis derselbe oben in den hohen dichten Wald verlief. Jetzt mußte ich mit Ali Bey gehen, um das Mahl einzunehmen. Nach demselben trat der Baschi-Bozuk zu mir. »Herr, ich muß dir etwas sagen!« »Was?« »Uns droht eine große Gefahr!« »Ah! Welche?« »Ich weiß es nicht; aber diese Teufelsmänner haben mich seit einer halben Stunde mit Augen angesehen, welche ganz fürchterlich sind. Es sieht grad so aus, als ob sie mich töten wollten!« Da der Buluk Emini seine Uniform trug, so konnte ich mir das Verhalten der von den Türken bedrohten Dschesidi sehr leicht erklären; doch war ich vollständig überzeugt, daß ihm nichts geschehen werde. »Das ist schlimm!« meinte ich. »Wenn sie dich töten, wer wird dann den Schwanz deines Esels bedienen?« »Herr, sie werden den Esel auch mit erstechen! Hast du nicht gesehen, daß sie die meisten Büffel und Schafe, die vorhanden sind, bereits getötet haben?« »Dein Esel ist sicher, und du bist es auch. Ihr gehört zusammen, und man wird euch nicht auseinanderreißen.« »Versprichst du mir dies?« »Ich verspreche es dir!« »Aber ich hatte Angst, als du vorhin abwesend warst. Gehst du wieder fort von hier?« »Ich werde bleiben; aber ich befehle dir, stets hier im Hause zu sein und dich nicht unter die Dschesidi zu mischen, sonst ist es mir unmöglich, dich zu beschützen!« Er ging, halb und halb getröstet, von dannen, der Held, den der Mutessarif mir zu meinem Schutze mit gegeben hatte. Aber es kam auch noch von einer andern Seite eine Warnung: Halef suchte mich auf. »Sihdi, weißt du, daß es Krieg geben wird?« »Krieg? Zwischen wem?« »Zwischen den Osmanly und den Teufelsleuten.« »Wer sagte es?« »Niemand.« »Niemand? Du hast doch wohl gehört, was wir heute früh in Baadri bereits davon gesprochen haben?« »Nichts habe ich gehört, denn ihr spracht türkisch, und diese Leute sprechen die Sprache so aus, daß ich sie nicht verstehen kann. Aber ich sah, daß es eine große Versammlung gab und daß nach derselben alle Männer die Waffen untersuchten. Nachher haben sie ihre Tiere und Güter fort geschafft, und als ich zu Scheik Mohammed Emin hinauf auf die Plattform kam, war er beschäftigt, die alte Ladung aus seinen Pistolen zu nehmen, um sie gegen eine neue zu vertauschen. Sind dies nicht genug Zeichen, daß man eine Gefahr erwartet?« »Du hast recht, Halef. Morgen früh beim Anbruch des Tages werden die Türken von Baadri und auch von Kaloni her über die Dschesidi herfallen.« »Und das wissen die Dschesidi?« »Ja.« »Wie hoch zählen die Türken?« »Fünfzehnhundert Mann.« »Es werden viele von ihnen fallen, da ihr Plan verraten ist. Wem wirst du helfen, Sihdi, den Türken oder den Dschesidi?« »Ich werde gar nicht kämpfen.« »Nicht?« erwiderte er getäuscht. »Darf ich nicht?« »Wem willst du helfen?« »Den Dschesidi.« »Ihnen, Halef? Ihnen, von denen du glaubtest, daß sie dich um das Paradies bringen würden?« »O Sihdi, ich kannte sie nicht; jetzt aber liebe ich sie.« »Aber es sind Ungläubige!« »Hast du selbst nicht stets jenen geholfen, die gut waren, ohne zu fragen, ob sie an Allah oder an einen andern Gott glauben?« Mein wackerer Halef hatte mich zum Moslem machen wollen, und jetzt sah ich zu meiner großen Freude, daß er sein Herz für ein ganz und gar christliches Gefühl geöffnet hatte. Ich antwortete ihm: »Du wirst bei mir bleiben!« »Während die andern kämpfen und tapfer sind?« »Es wird sich für uns vielleicht Gelegenheit finden, noch tapferer und mutiger zu sein, als sie.« »So bleibe ich bei dir. Der Buluk Emini auch?« »Auch er.« Ich stieg hinauf auf die Plattform zu Scheik Mohammed Emin. »Hamdullillah, Preis sei Gott, daß du kommst!« sagte er. »Ich habe mich nach dir gesehnt wie das Gras nach dem Tau der Nacht.« »Du bist stets hier oben geblieben?« »Stets. Es soll mich niemand erkennen, weil ich sonst verraten werden möchte. Was hast du neues erfahren?« Ich teilte ihm alles mit. Als ich geendet hatte, deutete er auf seine Waffen, welche vor ihm lagen. »Wir werden sie empfangen!« »Du wirst dieser Waffen nicht bedürfen.« »Nicht? Soll ich mich und unsere Freunde nicht verteidigen?« »Sie sind stark genug. Willst du vielleicht in die Hände der Türken, denen du kaum entgangen bist, fallen, oder soll dich eine Kugel, ein Messerstich treffen, damit dein Sohn noch länger in der Gefangenschaft von Amadijah schmachtet?« »Emir, du sprichst wie ein kluger, aber nicht wie ein tapferer Mann!« »Scheik, du weißt, daß ich mich vor keinem Feinde fürchte; es ist nicht die Angst, welche aus mir spricht. Ali Bey hat von uns verlangt, daß wir uns vor dem Kampfe hüten sollen. Er hegt übrigens die Ueberzeugung, daß es gar nicht zum Kampfe kommen werde, und ich bin ganz derselben Meinung wie er.« »Du denkst, die Türken ergeben sich ohne Widerstand?« »Wenn sie es nicht tun, so werden sie zusammen geschossen.« »Die Offiziere der Türken taugen nichts, aber die Soldaten sind tapfer. Sie werden die Höhen stürmen und sich befreien.« »Fünfzehnhundert gegen vielleicht sechstausend Mann?« »Wenn es gelingt, sie zu umzingeln!« »Es wird gelingen.« »So müssen wir also mit den Frauen nach dem Tale Idiz gehen?« »Du ja.« »Und du?« »Ich werde hier zurückbleiben.« »Allah kerihm! Wozu? Das würde dein Tod sein!« »Das glaube ich nicht. Ich bin im Giölgeda padischahnün, besitze die Empfehlungen des Mutessarif und habe einen Buluk Emini bei mir, dessen Anwesenheit schon genügend wäre, mich zu schützen.« »Aber was willst du hier tun?« »Unheil vermeiden, wenn es möglich ist.« »Weiß Ali Bey davon?« »Nein.« »Oder der Mir Scheik Khan?« »Auch nicht. Sie erfahren es noch immer zur rechten Zeit.« Ich hatte wirklich große Mühe, den Scheik zur Billigung meines Vorhabens zu überreden. Endlich aber gelang es mir. »Allah il Allah! Die Wege des Menschen sind im Buche vorgeschrieben,« meinte er; »ich will dich nicht bewegen, von diesem Vorhaben abzulassen, aber ich werde hier bei dir bleiben!« »Du? Das geht nicht!« »Warum?« »Sie dürfen dich nicht finden.« »Dich auch nicht.« »Ich habe dir bereits auseinandergesetzt, daß ich keine Gefahr laufe; dich aber, wenn du erkannt wirst, erwartet ein anderes Los.« »Das Ende des Menschen steht im Buche verzeichnet. Soll ich sterben, so muß ich sterben, und dann ist es gleich, ob es hier geschieht oder dort in Amadijah.« »Du willst in dein Unglück rennen, aber du vergissest, daß du auch mich darein verwickelst.« Dies schien mir der einzige Weg, seiner Hartnäckigkeit beizukommen. »Dich? Wieso?« fragte er. »Bin ich allein hier, so schützen mich meine Firmans; finden sie aber dich bei mir, den Feind des Mutessarif, den entflohenen Gefangenen, so habe ich diesen Schutz verloren und verwirkt. Dann sind auch wir verloren, du und ich, alle beide!« Er blickte nachdenklich vor sich nieder. Ich sah, was sich in ihm gegen den Rückzug nach dem Tale Idiz sträubte, aber ich ließ ihm Zeit, einen Entschluß zu fassen. Endlich sagte er mit halber, unsicherer Stimme: »Emir, hältst du mich für einen Feigling?« »Nein. Ich weiß ja, daß du tapfer und furchtlos bist.« »Was wird Ali Bey denken?« »Er denkt ganz so wie ich, ebenso Mir Scheik Khan.« »Und die andern Dschesidi?« »Sie kennen deinen Ruhm und wissen, daß du vor keinem Feinde fliehest. Darauf kannst du dich verlassen!« »Und wenn man an meinem Mute zweifeln sollte, wirst du mich verteidigen? Wirst du öffentlich sagen, daß ich mit den Frauen nach Idiz gegangen bin, nur um dir zu gehorchen?« »Ich werde es überall und öffentlich sagen.« »Nun wohl, so werde ich tun, was du mir vorgeschlagen hast!« Er schob resigniert die Flinte von sich fort und wendete sein Angesicht wieder dem Tale zu, das sich bereits in den Schatten des Abends zu hüllen begann. Gerade jetzt kamen die Männer zurück, welche vorher nach Idiz gegangen waren. Sie bildeten einen Zug einzelner Personen, der sich im Tale vor uns auflöste. Da erscholl vom Grabe des Heiligen her eine Salve, und zu gleicher Zeit kam Ali Bey herauf zu uns mit den Worten: »Es beginnt die große Feier am Grabe. Es ist noch nie ein Fremder dabei zugegen gewesen, aber der Mir Scheik Khan hat mir im Namen aller Priester die Genehmigung erteilt, euch einzuladen.« Das war nun allerdings eine sehr hohe Ehre für uns; aber Scheik Mohammed Emin lehnte sie ab: »Ich danke dir, Herr; aber es ist dem Moslem verboten, bei der Anbetung eines andern als Allah zugegen zu sein.« Er war ein Moslem; aber er hätte diese Abweisung doch in andre Worte kleiden können. Er blieb zurück, und ich folgte dem Bey. Als wir aus dem Hause traten, bot sich uns ein seltsamer, unbeschreiblich schöner Anblick dar. So weit das Tal reichte, flackerten Lichter unter und auf den Bäumen, am Wasser unten und auf jedem Felsen in der Höhe, um die Häuser herum und auf den Plattformen derselben. Das regste Leben aber herrschte am Grabmale des Heiligen. Der Mir hatte an der ewigen Lampe des Grabes ein Licht angebrannt und trat damit heraus in den innern Hof. An diesem Lichte zündeten die Scheiks und Kawals ihre Lampen an; von diesen liehen wieder die Fakirs ihre Flammen, und nun traten sie alle heraus in das Freie, und Tausende strömten herbei, um sich an den heiligen Feuern zu reinigen. Wer den Lichtern der Priester nahe zu kommen vermochte, fuhr mit der Hand durch die Flamme derselben und bestrich dann mit dieser Hand die Stirn und die Gegend des Herzens. Männer strichen dann zum zweitenmal durch die Flamme, um den Segen derselben ihren Frauen zu bringen. Mütter taten ganz dasselbe für ihre Kinder, welche nicht die Kraft besaßen, durch die dichte Menge zu dringen. Und dabei herrschte ein Jubel, eine Freude, die gar nichts Anstößiges hatte. Auch das Heiligtum wurde illuminiert. In jede der zahlreichen Mauernischen kam eine Lampe zu stehen, und über die Höfe hinweg zogen sich lange Girlanden von Lampen und Flammen. Jeder Zweig der dort befindlichen Bäume schien der Arm eines riesigen Leuchters zu sein, und Hunderte von Lichtern liefen an den beiden Türmen bis zu den Spitzen derselben empor, zwei riesige Girandolen bildend, deren Anblick ein zauberischer war. Die Priester hatten jetzt, zwei Reihen bildend, im inneren Hofe Platz genommen. Auf der einen Seite saßen die Scheiks in ihren weißen Anzügen und ihnen gegenüber die Kawals. Diese letzteren hatten Instrumente in der Hand, abwechselnd je einer eine Flöte und der andere ein Tamburin. Ich saß mit Ali Bey unter der Rebenlaube. Wo Mir Scheik Khan war, konnte ich nicht bemerken. Da ertönte aus dem Innern des Grabes ein Ruf, und die Kawals erhoben ihre Instrumente. Die Flöten begannen eine langsame, klagende Melodie zu spielen, wozu ein leiser Schlag auf das Tamburin den Takt angab. Dann folgte plötzlich ein lang ausgehaltener viertöniger Akkord; ich glaube, es war ein Terzquartsextakkord, zu welchem auf den Tamburins mit den Fingerspitzen getrillert wurde, erst pianissimo, dann piano, stärker, immer stärker bis zum Fortissimo, und dann fielen die Flöten in ein zweistimmiges Tonstück ein, für welches keiner unserer musikalischen Namen paßt, dessen Wirkung aber doch eine sehr angenehme und befriedigende war. Am Schlusse dieses Stückes trat Mir Scheik Khan aus dem Innern des Gebäudes heraus. Zwei Scheiks begleiteten ihn. Der eine trug ein hölzernes Gestell vor ihm her, das einem Notenpulte glich; dieses wurde in die Mitte des Hofes gesetzt. Der andere trug ein kleines Gefäß mit Wasser und ein anderes, offenes, rundes, worin sich eine brennende Flüssigkeit befand. Diese beiden Gefäße wurden auf das Pult gestellt, zu dem Mir Scheik Khan trat. Er gab mit der Hand ein Zeichen, worauf die Musik von neuem begann. Sie spielte eine Einleitung, nach welcher die Priester mit einer einstimmigen Hymne einfielen. Leider konnte ich mir ihren Inhalt nicht notieren, da dies aufgefallen wäre, und der eigentliche Wortlaut ist meinem Gedächtnisse entschwunden. Sie war in arabischer Sprache verfaßt und forderte zur Reinheit, zum Glauben und zur Wachsamkeit auf. Nach derselben hielt Mir Scheik Khan eine kurze Ansprache an die Priester. Er schilderte in kurzen Worten die Notwendigkeit, seinen Wandel von jeder Sünde rein zu halten, Gutes zu tun an allen Menschen, seinem Glauben stets treu zu bleiben und ihn gegen alle Feinde zu verteidigen. Dann trat er zurück und setzte sich zu uns unter den Weinstock. Jetzt brachte einer der Priester einen lebenden Hahn herbei, der mittels einer Schnur an das Pult befestigt wurde; zur Linken von ihm wurde das Wasser und zur Rechten das Feuer gestellt. Die Musik begann wieder. Der Hahn hockte in sich gekehrt am Boden; die leisen Klänge der Flöten schien er gar nicht zu beachten. Da wurden die Töne stärker, und er lauschte. Den Kopf aus dem Gefieder ziehend, blickte er sich mit hellen, klugen Augen im Kreise um und bemerkte dabei das Wasser. Schnell fuhr er mit dem Schnabel in das Gefäß, um zu trinken. Dieses freudige Ereignis wurde durch ein helles, jubelndes Zusammenschlagen der Tamburins verkündet. Dies schien das musikalische Interesse des Tieres zu erregen. Der Hahn krümmte den Hals und horchte aufmerksam. Dabei bemerkte er, daß er sich in einer gefahrvollen Nähe der Flamme befand. Er wollte sich zurückziehen, konnte aber nicht, da er festgehalten wurde. Darüber ergrimmt, richtete er sich auf und stieß ein lautes »Kik-ri-kih!« hervor, in welches die Flöten und Tamburins einfielen. Dies schien in ihm die Ansicht zu erwecken, daß man es auf einen musikalischen Wettstreit abgesehen habe. Er wandte sich mutig gegen die Musikanten, schlug die Flügel und schrie abermals. Er erhielt dieselbe Antwort, und so entwickelte sich ein Tongefecht, welches den Vogel schließlich so erzürnte, daß er unter einem wütenden Gallicinium sich losriß und in das Innere des Grabes floh. Die Musik begleitete diese Heldentat mit dem allerstärksten Fortissimo; die Stimmen der Priester fielen jubelnd ein, und nun folgte ein Finale, welches allerdings ganz geeignet war, sowohl die Musikanten als auch die Sänger zu ermüden. Am Schluß des Stückes küßten die Kawals ihre Instrumente. Sollte dieses laute, stürmische Finale auf irgend eine Weise einmal Gelegenheit gegeben haben, die Dschesiden mit den unlautern Cheragh Sonderan, oder wie es in kurdischer Sprache lautet, Tscherah sonderahn [1] zu verwechseln? Das religiöse Gefühl eines Christen sträubt sich allerdings gegen die Vorführung dieses Vogels, aber etwas Immoralisches habe ich dabei nicht beobachten können.
Jetzt sollte der Verkauf der Kugeln erfolgen, von denen ich bereits gesprochen habe. Vorher aber traten die Priester herbei und machten Ali Bey und mir ein Geschenk davon. Er erhielt sieben und ich sieben. Sie waren vollständig rund und mit einem arabischen Worte versehen, das man mit einem spitzigen Instrumente eingegraben hatte. Von meinen sieben Kugeln zeigten vier das Wort »El Schems«, die Sonne. Der Verkauf fand im äußeren Hofe statt, während im Innern des ummauerten Raumes die Instrumente und der Gesang noch ertönten. Ich verließ das Heiligtum. Ich dachte, daß das Tal von der Höhe aus einen wundervollen Anblick bieten müsse, und ging, um mir Halef zur Begleitung zu holen. Ich fand ihn auf der Plattform des Hauses bei dem Buluk Emini sitzen. Sie schienen sich in einem sehr animierten Gespräch zu befinden, denn ich hörte ihn sagen: »Was? Ein Russe wäre es gewesen?« »Ja, ein Russikow, dem Allah den Kopf abschneiden möge; denn wenn er nicht gewesen wäre, so hätte ich meine Nase noch! Ich haute wie wütend um mich; dieser Kerl aber holte nach meinem Kopfe aus; ich wollte ausweichen und trat zurück. Der Hieb, welcher den Kopf treffen sollte, traf bloß die - - -« »Hadschi Halef!« rief ich. Es machte mir wirklich Spaß, die berühmte Geschichte von der Nase auch einmal unterbrechen zu können. Die beiden sprangen auf und traten auf mich zu. »Du sollst mich begleiten, Halef; komm!« »Wohin, Sihdi?« »Dort hinauf zur Höhe, um zu sehen, wie sich die Illumination des Tales ausnimmt.« »O Emir, laß mich mit dir gehen!« bat Ifra. »Ich habe nichts dagegen. Vorwärts!« Wir stiegen die nach Baadri zu gelegene Höhe hin an. Ueberall trafen wir Männer, Frauen und Kinder mit Fackeln und Lichtern, und von allen wurden wir mit einer wirklich kindlichen Freude begrüßt und angeredet. Als wir die Höhe erreichten, bot sich uns ein geradezu unbeschreiblicher Anblick dar. Mehrere der Dschesidi waren uns gefolgt, um uns zu leuchten: ich aber bat sie, zurückzugehen oder ihre Fackeln zu verlöschen. Wer den Genuß vollständig haben wollte, mußte sich selbst im Dunkeln befinden. Da unten im Tale flutete Flamme an Flamme. Tausend leuchtende Punkte kreuzten, hüpften und schlüpften, tanzten, schossen und flogen durcheinander, klein, ganz klein tief unten, je näher aber zu uns, desto größer werdend. Das Heiligtum wallte förmlich von Glanz und Licht, und die beiden Türme leckten empor in das Dunkel der Nacht wie flammende Hymnen. Dazu ertönte von unten herauf zu uns das dumpfe Wogen und Brausen der Stimmen, oft unterbrochen von einem lauten, nahen Jubelrufe. Ich hätte stundenlang hier stehen und mich an diesem Anblicke weiden und ergötzen können. »Was ist das für ein Stern?« ertönte da neben mir eine Frage in kurdischer Sprache. Einer der Dschesidi hatte sie ausgesprochen. »Wo?« fragte ein anderer. »Siehe die Rea kadisahn [2]da rechts!«
»Ich sehe sie.« »Unter ihr flammte ein heller Stern auf. Jetzt wieder! Siehst du ihn?« »Ich sah ihn. Es ist der Kjale be scheri [3] Die vier Sterne, welche in unserm Sternbilde den Rücken des Bären bilden, heißen nämlich bei den Kurden »der Alte«. Sie meinen, daß sein Kopf hinter einer benachbarten Sternengruppe versteckt sei. Die drei Sterne, welche bei uns den Schwanz des großen Bären bilden [4], heißen bei ihnen die »zwei Brüder und die blinde Mutter des Alten«. »Der Kjale be scheri? Der hat doch vier Sterne!« meinte der erste Frager. »Es wird Kumikji schiwan [5]sein.« »Der steht höher. Jetzt leuchtet es wieder. Ah, wir sind irr; es ist ja im Süden! Es wird Meschin[6] sein.« »Meschin hat auch mehrere Sterne. Was meinst du, Herr, daß es ist?« Diese Frage war an mich gerichtet. Mir schien das Phänomen auffällig. Die Fackeln und Lichter unter uns warfen einen Schein in die Höhe, der es uns unmöglich machte, die Sterne genau zu erkennen. Der Glanz aber, welcher von Zeit zu Zeit da drüben aufblitzte, um sofort wieder zu verschwinden, war intensiv. Er glich einem Irrlichte, das plötzlich aufleuchtete und augenblicklich wieder verlöschte. Ich beobachtete noch eine Weile und wandte mich dann zu Halef: »Hadschi Halef, eile sofort hinab zu Ali Bey und sage ihm, daß er sehr schnell zu mir heraufkommen möge! Es handle sich um etwas Wichtiges.« Der Diener verschwand mit schnellen Schritten, und ich trat noch eine Strecke weiter vor, teils, um den vermeintlichen Stern besser beobachten zu können, teils auch, um allen weiteren Fragen zu entgehen. Glücklicherweise hatte Ali Bey gehört, daß ich heraufgegangen sei, und den Entschluß gefaßt, mir zu folgen. Halef traf ihn eine nur kleine Strecke unter uns und brachte ihn zu mir. »Was willst du mir zeigen, Emir?« Ich streckte den Arm aus. »Blicke fest dorthin! Du wirst einen Stern aufblitzen sehen. Jetzt!« »Ich sehe ihn.« »Er ist wieder fort. Kennst du ihn?« »Nein. Er liegt sehr tief und gehört zu keinem Bilde.« Ich trat an einen Busch und schnitt einige Ruten ab. Die eine davon steckte ich in die Erde und stellte mich dann einige Schritte vorwärts von ihm auf. »Kniee genau hinter dieser Rute nieder. Ich werde in der Richtung in welcher der Stern wieder blitzt, eine zweite aufstecken. - Sahst du ihn jetzt?« »Ja. Ganz deutlich.« »Wohin soll die Rute? Hierher?« »Einen Fußbreit weiter nach rechts.« »Hierher?« »Ja; das ist genau.« »So! Nun beobachte weiter!« »Jetzt sah ich ihn wieder!« meinte er nach einer kleinen Weile. »Wo? Ich werde eine dritte Rute stecken.« »Der Stern war nicht am alten Platze. Er war viel weiter links.« »Wie weit? Sage es!« »Zwei Fuß von der vorigen Rute.« »Hier?« »Ja.« Ich steckte die dritte Rute ein, und Ali Bey beobachtete weiter. »Jetzt sah ich ihn wieder,« meinte er bald. »Wo?« »Nicht mehr links, sondern rechts.« »Gut! Das war es, was ich dir zeigen wollte. Jetzt magst du dich wieder erheben.« Die andern hatten meinem sonderbaren Gebaren mit Verwunderung zugesehen, und auch Ali Bey konnte den Grund desselben nicht einsehen. »Warum lässest du mich dieses Sternes wegen rufen?« »Weil es kein Stern ist!« »Was sonst? Ein Licht?« »Nun, wenn es nur ein Licht wäre, würde es schon merkwürdig sein; aber es ist eine ganze Reihe von Lichtern.« »Woraus vermutest du dies?« »Ein Stern kann es nicht sein, weil es tiefer steht, als die Spitze des Berges, der dahinter liegt. Und daß es mehrere Lichter sind, hast du ja aus dem Experimente gesehen, das wir vorgenommen haben. Da drüben gehen oder reiten viele Leute mit Fackeln oder Laternen, von denen zuweilen die eine oder die andere herüberblitzt.« Der Bey stieß einen Ausruf der Verwunderung aus. »Du hast recht, Emir!« »Wer mag es sein?« »Pilger sind es nicht, denn diese würden auf dem Wege von Baadri nach Scheik Adi kommen.« »So denke an die Türken!« »Herr! Wäre es möglich?« »Das weiß ich nicht, denn diese Gegend ist mir unbekannt. Beschreibe sie mir, Bey!« »Hier grad aus geht der Weg nach Baadri, und hier weiter links der nach Aïn Sifni. Teile diesen Weg in drei Teile; gehe das erste Drittel, so hast du diese Lichter dann dir zur Linken nach dem Wasser zu, welches von Scheik Adi kommt.« »Kann man am Wasser entlang reiten?« »Ja.« »Und auf diese Weise nach Scheik Adi kommen?« »Ja.« »So ist ein großer, ein sehr großer Fehler vorgekommen!« »Welcher?« »Du hast Vorposten gestellt nach Baadri und Kaloni hin, aber nicht nach Aïn Sifni zu.« »Dorther werden die Türken nicht kommen. Die Leute von Aïn Sifni würden es uns verraten.« »Aber wenn die Türken nicht nach Aïn Sifni gehen, sondern bei Dscheraijah den Khausser überschreiten und dann zwischen Aïn Sifni und hier das Tal zu erreichen suchen? Mir scheint, sie würden dann dieselbe Richtung nehmen, in der sich dort jene Lichter bewegen. Siehe, sie sind bereits wieder nach links vorgerückt!« »Emir, deine Vermutung ist vielleicht die richtige. Ich werde sofort mehrere Wachen vorschicken!« »Und ich werde mir einmal diese Sterne näher betrachten. Hast du einen Mann, der diese Gegend genau kennt?« »Niemand kennt sie besser als Selek.« »Er ist ein guter Reiter; er soll mich führen!« Wir stiegen so schnell wie möglich hinab. Der letztere Teil der Unterredung war von uns leise geführt worden, so daß niemand, und besonders auch der Baschi-Bozuk nicht, etwas davon vernommen hatte. Selek war bald gefunden; er erhielt ein Pferd und nahm seine Waffen zu sich. Auch Halef mußte mit. Ich konnte mich auf ihn mehr als auf jeden Andern verlassen. Zwanzig Minuten später, nachdem ich den Stern zuerst gesehen hatte, jagten wir auf dem Wege nach Aïn Sifni dahin. Auf der nächsten Höhe blieben wir halten. Ich musterte das Halbdunkel vor uns und sah endlich das Aufleuchten wieder. Ich machte Selek auf dasselbe aufmerksam. »Emir, das ist kein Stern, das sind auch keine Fackeln, denn diese würden einen umfangreicheren Schein verbreiten. Das sind Laternen.« »Ich muß hart an sie heran. Kennst du die Gegend genau?« »Ich werde dich führen; ich kenne jeden Stein und jeden Strauch. Halte dich nur hart hinter mir, und nimm dein Pferd stets hoch!« Er wandte sich von dem Wasser nach rechts, und nun ging es über Stock und Stein im Trabe vorwärts. Es war ein sehr böser Ritt, aber bereits nach einer reichlichen Viertelstunde konnten wir genau mehrere Lichter unterscheiden. Und nach einer zweiten Viertelstunde, während welcher uns dieselben hinter einem vor uns liegenden Bergrücken verschwunden waren, langten wir auf dem letzteren an und sahen nun sehr deutlich, daß wir einen ziemlich langen Zug vor uns hatten. Von wem derselbe gebildet wurde, war von hier aus nicht zu unterscheiden; das aber bemerkten wir, daß er plötzlich verschwand und nicht wieder erschien. »Gibt es dort wieder einen Hügel?« »Nein. Hier ist Ebene,« antwortete Selek. »Oder eine Vertiefung, ein Tal, in welchem diese Lichter verschwinden können?« »Nein.« »Oder ein Wald - - -« »Ja, Emir,« fiel er schnell ein. »Dort, wo sie verschwunden sind, liegt ein kleines Olivenwäldchen.« »Ah! Du wirst mit den Pferden hier bleiben und auf uns warten. Halef aber begleitet mich.« »Herr, nimm mich auch mit,« bat Selek. »Die Tiere würden uns verraten.« »Wir binden sie an!« »Mein Rappe ist zu kostbar, als daß ich ihn ohne Aufsicht lassen dürfte. Und übrigens verstehst du auch das richtige Anschleichen nicht. Man würde dich hören oder gar sehen.« »Emir, ich verstehe es!« »Sei still!« meinte da Halef. »Auch ich dachte, ich verstände es, mich mitten in ein Duar zu schleichen und das beste Pferd wegzunehmen; aber als ich es vor dem Effendi machen mußte, habe ich mich schämen müssen, wie ein Knabe! Aber tröste dich, denn Allah hat nicht gewollt, daß aus dir eine Eidechse werde!« Wir ließen die Gewehre zurück und schritten voran. Es war gerade so licht, daß man auf fünfzig Schritte einen Menschen so leidlich erkennen konnte. Vor uns tauchte nach vielleicht zehn Minuten ein dunkler Punkt auf, dessen Dimensionen von Schritt zu Schritt zunahmen - das Olivenwäldchen. Als wir so weit heran waren, daß wir es in fünf oder sechs Minuten zu erreichen vermocht hätten, hielt ich an und lauschte angestrengt. Nicht der mindeste Laut war zu vernehmen. »Gehe genau hinter mir, daß unsere Personen eine einzige Linie bilden!« Ich hatte nur Jacke und Hose an, beide dunkel; auf dem Kopfe trug ich den Tarbusch, von dem ich das Turbantuch abgewunden hatte. So war ich nicht so leicht vom dunklen Boden zu unterscheiden. Mit Halef war ganz dasselbe der Fall. Lautlos glitten wir weiter. Da vernahmen wir das Geräusch knackender Aeste. Wir legten uns nun auf die Erde nieder und krochen langsam vorwärts. Das Knacken und Brechen wurde lauter. »Man sammelt Aeste, vielleicht gar, um ein Feuer zu machen.« »Gut für uns, Sihdi!« flüsterte Halef. Bald erreichten wir den hinteren Rand des Gehölzes. Das Schnauben von Tieren und Männerstimmen wurden hörbar. Wir lagen soeben hart neben einem dichten Buschwerke. Ich deutete auf dasselbe und sagte leise: »Verbirg dich hier, und erwarte mich, Halef.« »Herr, ich verlasse dich nicht; ich folge dir!« »Du würdest mich verraten. Das unhörbare Schleichen ist in einem Walde schwieriger als auf offenem Felde. Ich habe dich nur mitgenommen, um mir den Rückzug zu decken. Du bleibst liegen, selbst wenn du schießen hörst. Wenn ich dich rufe, so kommst du so schnell wie möglich.« »Und wenn du weder kommst noch rufest?« »So schleichst du dich nach einer halben Stunde vorwärts, um zu sehen, was mit mir geschehen ist.« »Sihdi, wenn sie dich töten, so schlage ich alle tot!« Diese Versicherung hörte ich noch, dann war ich fort; aber noch hatte ich mich nicht sehr weit von ihm entfernt, so hörte ich eine laute, befehlende Stimme rufen: »Et atesch - brenne an, mache Feuer!« Diese Stimme kam aus einer Entfernung von vielleicht hundert Fuß. Ich konnte also unbesorgt weiter kriechen. Da vernahm ich das Prasseln einer Flamme und bemerkte zugleich einen lichten Schein, der sich zwischen den Bäumen fast bis zu mir verbreitete. Das erschwerte mir natürlich mein Vorhaben bedeutend. »Taschlar atesch tschewresinde - lege Steine um das Feuer!« befahl dieselbe Stimme. Diesem Befehle wurde jedenfalls sofort Folge geleistet, denn der lichte Schein verschwand, so daß ich nun besser vorwärts konnte. Ich schlich mich von einem Stamme zum andern und wartete hinter einem jeden, bis ich mich überzeugt hatte, daß ich nicht bemerkt worden sei. Glücklicherweise war diese Vorsicht überflüssig; ich befand mich nicht in den Urwäldern Amerikas, und die guten Leute, welche ich vor mir hatte, schienen nicht die mindeste Ahnung zu haben, daß es irgend einem Menschenkinde einfallen könne, sie zu belauschen. So avancierte ich immer weiter, bis ich einen Baum erreichte, dessen Wurzeln so zahlreiche Schößlinge getrieben hatten, daß ich hinter denselben ein recht leidliches Versteck zu finden hoffte. Wünschenswert war dies besonders deshalb, weil ganz in der Nähe des Baumes zwei Männer saßen, auf die ich es abgesehen hatte, zwei türkische Offiziere. Mit einiger Vorsicht gelang es mir, mich hinter den Schößlingen häuslich niederzulassen, und nun konnte ich die Szene vollständig überblicken. Draußen vor dem kleinen Gehölze standen - vier Gebirgskanonen oder vielmehr zwei Kanonen und zwei Haubitzen, und am Saume des Gehölzes waren ungefähr zwanzig Maultiere angebunden, die zum Transporte dieser Geschütze erforderlich gewesen waren. Man braucht zu einem Geschütze gewöhnlich vier bis fünf Maultiere; eins muß das Rohr, eins die Lafette und zwei bis vier müssen die Munitionskästen tragen. Die Kanoniere hatten es sich bequem gemacht; sie lagen auf dem Boden ausgestreckt und plauderten leise miteinander. Die beiden Offiziere aber wünschten Kaffee zu trinken und ihren Tschibuk zu rauchen; darum war ein Feuer gemacht worden, über welchem ein kleiner Kessel auf zwei Steinen stand. Der eine der beiden Helden war ein Hauptmann und der andere ein Leutnant. Der Hauptmann hatte ein recht biederes Aussehen; er kam mir gerade so vor, als sei er eigentlich ein urgemütlicher, dicker, deutscher Bäckermeister, der auf einem Liebhabertheater den wilden Türken spielen soll und sich dazu für anderthalbe Mark vom Maskenverleiher das Kostüm geliehen hat. Mit dem Leutnant war es ganz ähnlich. Just so wie er mußte eine sechzigjährige Kaffeeschwester aussehen, die auf den unbegreiflichen Backfischgedanken geraten ist, in Pumphosen und Osmanly-Jacke auf die Redoute zu gehen. Es war mir ganz so, als müsse ich jetzt hinter dem Baume hervortreten und sie überraschen mit den geflügelten Worten: »Schön guten Abend, Meister Mehlhuber; 'pfehle mich, Fräulein Lattenstengel; 'was Neues? Danke, danke, werde so frei sein!« Freilich waren die Worte, welche ich zu hören bekam, etwas weniger gemütlich. Ich lag ihnen so nahe, daß ich alles hören konnte. »Unsere Kanonen sind gut!« brummte der Hauptmann. »Sehr gut!« flötete der Leutnant. »Wir werden schießen, alles niederschießen!« »Alles!« ertönte das Echo. »Wir werden Beute machen!« »Viel Beute!« »Wir werden tapfer sein!« »Sehr tapfer!« »Wir werden befördert werden!« »Hoch, äußerst hoch!« »Dann rauchen wir Tabak aus Persien!« »Tabak aus Schiras!« »Und trinken Kaffee aus Arabien!« »Kaffee aus Mokka!« »Die Dschesidi müssen alle sterben!« »Alle!« »Die Bösewichter!« »Die Buben!« »Die Unreinen, die Unverschämten!« »Die Hunde!« »Wir werden sie töten!« »Morgen früh gleich!« »Natürlich, das versteht sich!« Ich hatte nun genug gesehen und gehört; darum zog ich mich zurück, erst langsam und vorsichtig, dann aber rascher. Ich erhob mich dabei sogar von der Erde, worüber Halef sich nicht wenig wunderte, als ich bei ihm ankam. »Wer ist es, Sihdi?« »Artilleristen. Komm; wir haben keine Zeit!« »Gehen wir aufrecht?« »Ja.« Wir erreichten bald unsere Pferde, stiegen auf und kehrten zurück. Die Strecke nach Scheik Adi wurde jetzt natürlich viel schneller zurückgelegt, als vorhin. Wir fanden dort noch dasselbe rege Leben. Ich hörte, daß Ali Bey sich beim Heiligtum befinde, und traf ihn mit dem Mir Scheik Khan in dem inneren Hofe desselben. Er kam mir erwartungsvoll entgegen und führte mich zum Khan. »Was hast du gesehen?« fragte er. »Kanonen!« »Oh!« machte er erschrocken. »Wie viele?« »Vier kleine Gebirgskanonen.« »Welchen Zweck haben sie?« »Scheik Adi soll damit zusammen geschossen werden. Während die Infanteristen von Baadri und Kaloni angreifen, soll die Artillerie jedenfalls da unten am Wasser spielen. Der Plan ist nicht schlecht, denn von dort aus läßt sich das ganze Tal bestreichen. Es handelte sich nur darum, die Geschütze unbemerkt über die Höhen zu bringen; dies ist gelungen; man hat sich der Maultiere bedient, mit deren Hilfe die Kanonen in einer Stunde von dem Lagerplatze aus bis nach Scheik Adi gebracht werden können.« »Was tun wir, Emir?« »Gib mir sofort sechzig Reiter mit und einige Laternen, so siehst du binnen zwei Stunden die Geschütze mit ihrer Bedienung hier in Scheik Adi!« »Gefangen?« »Gefangen!« »Herr, ich gebe dir hundert Reiter!« »Nun wohl, gib mir sofort achtzig, und sage ihnen, daß ich sie unten am Wasser erwarte.« Ich ging und traf Halef und Selek noch bei den Pferden. »Was wird Ali Bey tun?« fragte Halef. »Nichts. Wir selbst werden tun, was getan werden soll.« »Was ist das, Sihdi? Du lachst! Herr, ich kenne dein Gesicht; wir holen die Kanonen?« »Allerdings! Ich möchte aber die Kanonen haben, ohne daß Blut vergossen wird, und darum nehmen wir achtzig Reiter mit.« Wir ritten dem Ausgange des Tales zu, wo wir nicht lange warten durften, bis die achtzig kamen. Ich sandte Selek mit zehn Mann voran und folgte mit den andern eine Strecke hinter ihnen. Wir erreichten, ohne einen Feind zu sehen, die Anhöhe, auf der Selek vorhin auf uns gewartet hatte, und stiegen ab. Zunächst sandte ich einige Leute aus, welche für unsere eigene Sicherheit zu wachen hatten; dann ließ ich zehn Mann bei den Pferden zurück und gebot ihnen, den Platz ohne meinen Befehl nicht zu verlassen, und nun schlichen wir andern auf das Wäldchen zu. In passender Entfernung vor demselben angekommen, wurde Halt gemacht, und ich ging allein vorwärts. Wie vorher gelangte ich auch diesmal ohne Hindernis zu dem Baume, unter dem ich bereits gelegen hatte. Die Türken lagen in einzelnen Gruppen beisammen und plauderten. Ich hatte gehofft, daß sie schliefen. Die militärische Wachsamkeit und die Erwartung des bevorstehenden Kampfes ließen sie jedoch nicht schlafen. Ich zählte mit den Unteroffizieren und den beiden Offizieren vierunddreißig Mann und kehrte zu den Meinen zurück. »Hadschi Halef und Selek, geht und holt eure Pferde! Ihr reitet einen Bogen und kommt an der andern Seite des Wäldchens vorüber. Man wird euch anhalten. Ihr sagt, daß ihr euch verirrt habt und zu dem Feste nach Scheik Adi kommen wollt. Ihr werdet so die Aufmerksamkeit der Osmanly von uns ab und auf euch lenken. Das übrige ist unsere Sache. Geht!« Die übrigen ließ ich zwei lange, hintereinander stehende Reihen bilden, die den Zweck hatten, das Gehölz von drei Seiten zu umfassen. Ich gab ihnen die nötige Anweisung, worauf wir uns zu Boden legten und vorwärts krochen. Natürlich kam ich am schnellsten voran. Ich hatte meinen Baum wohl bereits seit zwei Minuten erreicht, als laute Hufschläge erschallten. Das Feuer brannte noch immer; darum war es mir möglich, die ganze Szene leidlich zu überblicken. Die beiden Offiziere hatten wahrscheinlich während der ganzen Zeit meiner Abwesenheit geraucht und Kaffee getrunken. »Scheik Adi ist ein böses Nest!« hörte ich den Hauptmann sagen. »Ganz bös!« antwortete der Leutnant. »Die Leute beten dort den Teufel an!« »Den Teufel; Allah zerhacke und zerquetsche sie!« »Das werden wir tun!« »Ja, wir werden sie zerreißen!« »Ganz und gar!« Bis hierher konnte ich die Unterhaltung vernehmen, dann aber hörte man das erwähnte Pferdegetrappel. Der Leutnant hob den Kopf empor. »Man kommt!« sagte er. Auch der Hauptmann lauschte. »Wer mag das sein?« fragte er. »Es sind zwei Reiter; ich höre es.« Sie erhoben sich, und die Soldaten taten dasselbe. In dem Scheine, den das Feuer hinauswarf, wurden Halef und Selek sichtbar. Der Hauptmann trat ihnen entgegen und zog seinen Säbel. »Halt! Wer seid ihr?« rief er sie an. Sie waren sofort von den Türken umringt. Mein kleiner Halef betrachtete sich die Offiziere vom Pferde herunter mit einer Miene, welche mich erraten ließ, daß sie auf ihn den gleichen Eindruck machten, den sie auch auf mich hervorgebracht hatten. »Wer ihr seid, habe ich gefragt!« wiederholte der Hauptmann. »Leute!« antwortete Halef. »Was für Leute?« »Männer!« »Was für Männer?« »Reitende Männer!« »Der Teufel verschlinge euch! Antwortet besser, sonst erhaltet ihr die Bastonnade! Also wer seid ihr?« »Wir sind Dschesidi,« antwortete jetzt Selek mit kleinlauter Stimme. »Dschesidi? Ah! Woher?« »Aus Mekka.« »Aus Mekka? Allah il Allah! Gibt es dort auch Teufelsanbeter?« »Grad fünfmalhunderttausend.« »So viele! Allah kerihm; er läßt viel Unkraut unter dem Weizen wachsen! - Wohin wollt ihr?« »Nach Scheik Adi.« »Ah, habe ich euch? Was wollt ihr dort?« »Es wird dort ein großes Fest gefeiert.« »Ich weiß es. Ihr tanzt und singt mit dem Teufel und betet dabei einen Hahn an, der durch das Feuer der Dschehennah ausgebrütet worden ist. Steigt ab! Ihr seid meine Gefangenen!« »Gefangen? Was haben wir getan?« »Ihr seid Söhne des Teufels. Ihr müßt geprügelt werden, bis euer Vater von euch gewichen ist. Herunter von den Pferden!« Er griff selbst zu, und die beiden Männer wurden förmlich von den Pferden heruntergezogen. »Gebt eure Waffen her!« Ich wußte, Halef würde das nie tun, selbst unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht. Er sah suchend nach dem Feuer hin, und so hob ich den Kopf so weit empor, daß er mich erblickte. Nun wußte er, daß er sicher sein könne. Aus dem vielen leisen Rascheln hinter mir hatte ich bereits erkannt, daß die Meinen das Lager vollständig umschlossen hatten. »Unsere Waffen?« fragte Halef. »Höre, Jüs Baschi, erlaube, daß wir dir etwas sagen!« »Was?« »Das können wir nur dir und dem Mülasim mitteilen.« »Ich mag nichts von euch erfahren!« »Es ist aber wichtig, sehr wichtig!« »Was betrifft es?« »Höre!« Er flüsterte ihm einige Worte in das Ohr, welche den augenblicklichen Erfolg hatten, daß der Hauptmann einen Schritt zurücktrat und den Sprecher mit einer gewissen achtungsvollen Miene musterte. Später erfuhr ich, daß der schlaue Halef geflüstert hatte: »Euern Geldbeutel betrifft es!« »Ist das wahr?« fragte der Offizier. »Es ist wahr!« »Wirst du darüber schweigen?« »Wie das Grab!« »Schwöre es mir!« »Wie soll ich schwören?« »Bei Allah und dem Barte des - - doch nein, ihr seid ja Dschesidi. So schwöre es mir beim Teufel, den ihr anbetet!« »Nun wohl! Der Teufel weiß es, daß ich nachher nichts sagen werde!« »Aber er wird dich zerreißen, wenn du die Unwahrheit sagst! Komm, Mülasim; kommt, ihr beiden!« Die vier Männer traten zum Feuer herbei; ich konnte jedes ihrer Worte vernehmen. »Nun, so rede!« gebot der Hauptmann. »Laß uns frei! Wir werden dich bezahlen.« »Habt ihr Geld?« »Wir haben Geld.« »Wißt ihr es nicht, daß dieses Geld bereits mir gehört? Alles, was ihr bei euch führt, ist unser.« »Du wirst es nie finden. Wir kommen von Mekka her, und wer eine solche Reise macht, der weiß sein Geld zu verbergen.« »Ich werde es finden!« »Du wirst es nicht finden, selbst wenn du uns tötest und alles ganz genau durchsuchen lässest. Die Teufelsanbeter haben sehr gute Mittel, ihr Geld unsichtbar zu machen.« »Allah ist allwissend!« »Aber du bist nicht Allah!« »Ich darf euch nicht freilassen.« »Warum?« »Ihr würdet uns verraten.« »Verraten? Wie so?« »Seht ihr nicht, daß wir hier sind, um einen Kriegszug zu unternehmen?« »Wir werden dich nicht verraten.« »Aber ihr wollt nach Scheik Adi gehen!« »Sollen wir nicht?« »Nein.« »So sende uns, wohin es dir beliebt!« »Wolltet ihr nach Baaweiza gehen und dort zwei Tage warten?« »Wir wollen es.« »Wie viel wollt ihr uns für eure Freiheit zahlen?« »Wie viel verlangst du?« »Fünfzehntausend Piaster[7] für jeden.« »Herr, wir sind sehr arme Pilger. So viel haben wir nicht bei uns!« »Wie viel habt ihr?« »Fünfhundert Piaster können wir dir vielleicht geben.« »Fünfhundert? Kerl, ihr wollt uns betrügen!« »Vielleicht bringen wir auch sechshundert zusammen.« »Ihr gebt zwölftausend Piaster und keinen Para weniger. Das schwöre ich euch bei Mohammed. Und wollt ihr nicht, so lasse ich euch so lange prügeln, bis ihr sie gebt. Ihr habt gesagt, daß ihr Mittel besitzt, euer Geld unsichtbar zu machen; ihr habt also viel bei euch, und ich habe das Mittel, eure Piaster wieder sichtbar zu machen!« Halef tat, als erschrecke er. »Herr, tust du es wirklich nicht billiger?« »Nein.« »So müssen wir es dir geben!« »Ihr Schurken, jetzt sehe ich, daß ihr viel Geld bei euch habt! Nun werdet ihr nicht für zwölftausend Piaster frei, sondern ihr müßt das geben, was ich zuerst verlangte, nämlich fünfzehntausend.« »Verzeihe, Herr, das ist zu wenig!« Der Hauptmann sah den kleinen Hadschi Halef ganz erstaunt an. »Wie meinst du das, Kerl?« »Ich meine, daß ein jeder von uns mehr wert ist, als fünfzehntausend Piaster. Erlaube, daß wir dir fünfzigtausend geben!« »Mensch, bist du verrückt?« »Oder hunderttausend!« Der Bäckermeister-Jüs Baschi blies ganz ratlos die Backen auf, blickte dem Leutnant in das hagere Gesicht und fragte ihn: »Leutnant, was sagst du?« Dieser hatte den Mund offen und gestand freimütig: »Nichts, ganz und gar nichts! « »Ich auch nichts! Diese Menschen müssen ungeheuer reich sein!« Dann wandte er sich wieder zu Halef: »Wo habt ihr das Geld?« »Mußt du es wissen?« »Ja.« »Wir haben einen bei uns, der für uns bezahlt. Du kannst ihn aber nicht sehen.« »Allah beschütze uns! Du meinst den Teufel!« »Soll er kommen?« »Nein, nein, niemals! Ich bin kein Dschesidi, ich verstehe nicht, mit ihm zu reden! Ich würde tot sein vor Schreck!« »Du wirst nicht erschrecken, denn dieser Scheïtan kommt in der Gestalt eines Menschen. Da ist er schon!« Ich hatte mich hinter dem Baume erhoben, und mit zwei schnellen Schritten stand ich vor den beiden Offizieren. Sie fuhren entsetzt auseinander, der eine nach rechts und der andere nach links. Da ihnen aber meine Gestalt doch nicht ganz und gar schrecklich vorkommen mochte, so blieben sie stehen und starrten mich wortlos an. »Jüs Baschi,« redete ich sie an, »ich habe alles gehört, was ihr heute abend gesprochen habt. Ihr sagtet, Scheik Adi sei ein böses Nest!« Ein schwerer Atemzug erscholl als einzige Antwort. »Ihr sagtet, Allah möge dort die Leute zerhacken und zerquetschen.« »Oh, oh!« ertönte es. »Ihr sagtet ferner, ihr wolltet die Bösewichter, die Buben, die Unreinen, die Unverschämten, die Hunde niederschießen und große Beute machen!« Der Mülasim war halb tot vor Angst, und der Jüs Baschi konnte nichts als stöhnen. »Ihr wolltet dann befördert werden und Tabak aus Schiras rauchen!« »Er weiß alles!« brachte der dicke Hauptmann angstvoll hervor. »Ja, ich weiß alles. Ich werde euch befördern. Weißt du, wohin?« Er schüttelte den Kopf. »Nach Scheik Adi, zu den Unreinen und Unverschämten, die ihr töten wolltet. Jetzt sage ich zu euch das, was ihr vorhin zu diesen beiden Männern sagtet: Ihr seid meine Gefangenen!« Die Soldaten konnten sich den Vorgang nicht erklären; sie standen in einem dichten Knäuel beisammen. Der Wink, den ich bei meinen letzten Worten gab, genügte. Die Dschesidi brachen hervor und umringten sie. Nicht ein einziger dachte daran, Widerstand zu leisten. Alle waren ganz verblüfft. Die Offiziere aber ahnten nun doch den wahren Sachverhalt und griffen in den Gürtel. »Halt, keine Gegenwehr!« ermahnte ich sie, indem ich den Revolver zog. »Wer zur Waffe greift, wird augenblicklich niedergeschossen!« »Wer bist du?« fragte der Hauptmann. Er schwitzte förmlich. Der brave Fallstaff dauerte mich einigermaßen, und die Don Quixote-Gestalt neben ihm gleichfalls. Um ihre Beförderung war es nun geschehen. »Ich bin euer Freund und wünsche deshalb, daß ihr nicht von den Dschesidi niedergeschossen werdet. Gebt eure Waffen ab!« »Aber wir brauchen sie doch!« »Wozu?« »Wir müssen damit die Geschütze verteidigen!« Dieser beispiellosen Naivität war nicht zu widerstehen, ich mußte laut auflachen. Dann beruhigte ich sie: »Seid ohne Sorgen; wir werden die Kanonen behüten!« Es ward zwar noch einiges hin und her gesprochen, dann aber streckten sie doch die Waffen. »Was werdet ihr mit uns tun?« fragte jetzt der besorgte Jüs Baschi. »Das kommt ganz auf euer Verhalten an. Vielleicht werdet ihr getötet, vielleicht aber auch erlangt ihr Gnade, wenn ihr gehorsam seid.« »Was sollen wir tun?« »Zunächst meine Fragen der Wahrheit gemäß beantworten.« »Frage!« »Kommen noch mehr Truppen hinter euch?« »Nein.« »Ihr seid wirklich die einzigen hier?« »Ja.« »So ist der Miralai Omar Amed ein sehr unfähiger Mensch. In Scheik Adi halten mehrere tausend Bewaffnete, und hier schickt er dreißig Männer mit vier Kanonen gegen sie. Er mußte euch wenigstens einen Alai Emini mit zweihundert Mann Infanterie als Bedeckung mitgeben. Dieser Mann hat gemeint, die Dschesidi seien so leicht zu fangen und zu töten, wie die Fliegen. Welche Befehle hat er euch gegeben?« »Wir sollen die Geschütze unbemerkt bis an das Wasser schaffen.« »Und dann?« »Und dann an demselben aufwärts gehen, bis eine halbe Stunde vor Scheik Adi.« »Weiter!« »Dort sollen wir warten, bis er uns einen Boten sendet. Darauf müssen wir bis zum Tale vorrücken und die Dschesidi mit Kugeln, Kartätschen und Granaten beschießen.« »Das Vorrücken ist euch gestattet; ihr werdet sogar noch weiter kommen als nur bis zum Eingange des Tales. Das Schießen aber werden Andere übernehmen.« Nun es einmal geschehen war, ergaben sich die Türken als echte Fatalisten ganz ruhig in ihr Schicksal. Sie mußten zusammentreten und wurden von den Dschesidi eskortiert. Die Geschützstücke waren auf die Maultiere geladen worden und folgten unter Bedeckung. Natürlich machten wir uns wieder beritten, als wir bei den Pferden ankamen. Eine halbe Stunde vor dem Tale von Scheik Adi ließ ich die Kanonen unter dem Schutze von zwanzig Mann zurück. Es geschah dies um des Boten willen, welcher von dem Miralai erwartet wurde. Gleich an dem Eingange zum Tale trafen wir auf eine bedeutende Menschenmenge. Das Gerücht von unserer kleinen Expedition hatte sich sehr bald unter den Pilgern verbreitet, und man hatte sich hier versammelt, um das Ergebnis so bald wie möglich zu vernehmen. Infolgedessen war auch jedwedes Schießen im Tale eingestellt worden, sodaß nun eine tiefe Stille herrschte. Man wollte die Schüsse hören, falls es zwischen uns und den Türken zu einem ernstlichen Kampfe kommen sollte. Der erste, welcher mir entgegenkam, war Ali Bey. »Endlich kommst du,« rief er sichtlich erleichtert; dann setzte er besorgt hinzu: »aber ohne Kanonen! Und auch Leute fehlen!« »Es fehlt kein Mann, und auch kein einziger ist verwundet.« »Wo sind sie?« »Bei Halef und Selek draußen bei den Geschützen, die ich zurückgelassen habe.« »Warum?« »Dieser Jüs Baschi hat mir erzählt, daß der Miralai an die Stelle, wo die Kanonen stehen, einen Boten senden werde. Sie sollen dann vorrücken und Scheik Adi mit Vollkugeln, Kartätschen und Granaten beschießen. Hast du Leute, welche ein Geschütz zu bedienen verstehen?« »Genug!« »So sende sie hinaus. Sie mögen mit den Türken die Kleidung wechseln, den Boten gefangen nehmen und dann sofort einen Schuß lösen. Dies wird für uns das sicherste Zeichen sein, daß der Feind nahe ist, und diesen selbst wird es zu einem übereilten Angriff verleiten. Was tust du mit den Gefangenen?« »Ich schicke sie fort und lasse sie bewachen.« »Im Tale Idiz?« »Nein. Diesen Ort darf keiner sehen, der nicht ein Dschesidi ist. Aber es gibt eine kleine Schlucht, in der es möglich ist, die Gefangenen durch nur wenige Leute fest zuhalten. Komm!« In seinem Hause erwartete mich ein sehr reichliches Nachtessen, wobei mich seine Frau bediente. Er selbst war nicht zugegen, denn er mußte die Umkleidung der Gefangenen beaufsichtigen, welche dann abgeführt wurden. Diejenigen, welche die Uniformen der Türken erhielten, waren geschulte Kanoniere und rückten bald ab, um sich zu den Geschützen zu begeben. Die Sterne begannen bereits zu erbleichen, als Ali Bey zu mir kam. »Bist du bereit, aufzubrechen, Emir?« »Wohin?« »Nach dem Tale Idiz.« »Erlaube, daß ich hier bleibe!« »Du willst mitkämpfen?« »Nein.« »Dich uns nur anschließen, um zu sehen, ob wir tapfer sind?« »Ich werde mich euch auch nicht anschließen, sondern hier in Scheik Adi bleiben.« »Herr, was denkst du!« »Ich denke, daß dies das Richtige sein wird.« »Man wird dich töten!« »Nein. Ich stehe unter dem Schutze des Großherrn und des Mutessarif.« »Aber du bist unser Freund; du hast die Artilleristen gefangen genommen; das wird dir das Leben kosten!« »Wer wird das den Türken erzählen? Ich bleibe hier mit Halef und dem Baschi-Bozuk. So kann ich für euch vielleicht mehr tun, als wenn ich in euren Reihen kämpfe.« »Du magst recht haben, Emir; aber wenn wir schießen, kannst auch du verwundet oder vielleicht gar getötet werden!« »Das glaube ich nicht, denn ich werde mich hüten, mich euern Kugeln auszusetzen.« Da öffnete sich die Türe, und ein Mann trat herein. Er gehörte zu den Posten, welche Ali Bey ausgestellt hatte. »Herr,« meldete er ihm, »wir haben uns zurückgezogen, denn die Türken sind bereits in Baadri. In einer Stunde sind sie hier.« »Kehre zurück, und sage den Deinen, daß sie immer in der Nähe der Türken bleiben, sich aber von ihnen nicht sehen lassen sollen!« Wir gingen vor das Haus. Die Frauen und Kinder zogen an uns vorüber und verschwanden hinter dem Heiligtume. Da kam ein zweiter Bote atemlos gelaufen und meldete: »Herr, die Türken haben Kaloni längst verlassen und marschieren durch die Wälder. In einer Stunde können sie hier sein.« »Postiert euch jenseits des ersten Tales, und zieht euch, wenn sie kommen, zurück. Die Unserigen werden euch oben erwarten!« Der Mann kehrte zurück, und der Bey entfernte sich auf einige Zeit. Ich stand am Hause und sah auf die Gestalten, die an mir vorüberzogen. Als die Frauen und Kinder vorbei waren, schlossen sich ihnen lange Reihen von Männern an, zu Fuße und zu Pferde; aber sie verschwanden nicht hinter dem Heiligtume, sondern erstiegen die nach Baadri und Kaloni gelegenen Höhen, um den Türken das Tal freizugeben. Es war ein eigentümliches Gefühl, das ich beim Anblick dieser dunklen Gestalten empfand. Ein Licht nach dem andern wurde ausgeblasen; eine Fackel nach der andern erlosch, und nur das Grabmal mit seinen beiden Türmen streckte seine flammende Doppelzunge noch immer zum Himmel empor. Ich war allein hier. Die Angehörigen des Bey waren fort; der Buluk Emini schlief droben auf der Plattform, und Halef war noch nicht zurück. Da aber hörte ich den Galopp eines Pferdes. Halef sprengte heran. Als er absaß, erdröhnten von unten herauf zwei starke, krachende Schläge. »Was war das, Halef?« »Die Bäume stürzen. Ali Bey hat befohlen, sie zu fällen, um unten das Tal zu schließen und die Kanonen gegen einen Angriff der Türken zu schützen.« »Das ist klug gehandelt! Wo sind die andern von den zwanzig?« »Sie mußten auf Befehl des Bey bei den Geschützen zurückbleiben, und er hat außerdem noch dreißig andere Männer zu ihrer Bedeckung beordert.« »Also zusammen fünfzig Mann. Diese könnten schon einen Angriff aushalten.« »Wo sind die Gefangenen?« fragte Halef. »Bereits fort, unter Aufsicht.« »Und diese Männer hier ziehen schon zum Kampfe?« »Ja.« »Und wir?« »Bleiben hier zurück. Ich bin begierig, die Gesichter der Türken zu sehen, wenn sie bemerken, daß sie in die Falle geraten sind.« Dieser Gedanke schien Halef zu befriedigen, sodaß er nicht über unser Hierbleiben murrte. Er mochte sich auch sagen, daß dieses Bleiben wohl gefährlicher sei, als der Anschluß an die Streiter. »Wo ist Ifra?« fragte Halef noch. »Er schläft auf der Plattform.« »Er ist eine Schlafmütze, Sihdi, und darum wird ihm sein Hauptmann den Esel gegeben haben, welcher die ganze Nacht hindurch schreit. Weiß er bereits etwas von dem, was geschehen wird?« »Ich glaube nicht. Er soll auch nicht wissen, wie weit wir dabei beteiligt waren; verstehst du?« Da kam Ali Bey noch einmal zurück, um sein Pferd zu holen. Er machte mir noch allerlei Vorstellungen, die aber nichts fruchteten, und so war er gezwungen, mich zu verlassen. Er tat dies mit dem herzlichsten Wunsche, daß mir nichts Böses geschehen möge, und versicherte wiederholt, er würde alle fünfzehnhundert Türken niederschießen lassen, wenn ich von ihnen ein Leid erdulden müsse. Zuletzt bat er mich, das große weiße Tuch, das in der Stube hing, auf die Plattform des Hauses, die er von der Höhe ganz gut überblicken konnte, zu legen, zum Zeichen, daß ich mich wohl befinde. Sollte das Tuch fort genommen werden, so werde er schließen, daß ich mich in Gefahr befinde und sofort demgemäß handeln. Nun stieg er auf und ritt davon, der letzte von all den Seinen. Der Tag begann zu grauen; der Himmel lichtete sich, und wenn man zu ihm empor blickte, vermochte man bereits die einzelnen Aeste der Bäume zu unterscheiden. Droben an der gegenüberliegenden Talwand verhallten die Hufschläge von Ali Beys Pferd. Ich war nun, da auch mein Dolmetscher mich verlassen mußte, mit den beiden Dienern ganz allein in jenem viel besprochenen Tale eines geheimnisvollen und auch jetzt mir immer noch rätselhaften Kultus. Allein? Ganz allein? War es wirklich so, oder hörte ich nicht Schritte dort in dem kleinen El Schems geweihten Hause? Eine lange, weiße Gestalt trat hervor und blickte sich um. Da sah sie mich und kam auf mich zu. Ein langer, schwarzer Bart hing ihr über die Brust herab, während das Haupthaar schneeweiß über den Rücken wallte. Es war Pir Kamek; ich erkannte ihn jetzt. »Du noch hier?« fragte er, als er vor mir stand, mit beinahe harter Stimme. »Wann folgest du den andern nach?« »Ich bleibe hier.« »Du bleibst? Warum?« »Weil ich euch hier mehr nützen kann, als auf andere Weise. « »Das ist möglich, Emir; aber dennoch solltest du gehen!« »Ich richte dieselbe Frage an dich: Wann gehest du den andern nach?« »Ich bleibe.« »Warum?« »Hast du dort den Scheiterhaufen nicht gesehen?« antwortete er finster. »Er hält mich zurück.« »Warum er?« »Weil es nun an der Zeit ist, das Opfer zu bringen, wegen dessen ich ihn errichten ließ.« »Die Türken werden dich ja stören!« »Sie werden mir sogar das Opfer bringen, und ich werde heute den wichtigsten Tag meines Lebens feiern.« Fast wollte es mir unheimlich werden bei dem Klange dieser hohlen Stimme. Ich überwand jedoch dieses Gefühl und fragte: »Wolltest du nicht heute noch mit mir über dein Buch sprechen, welches mir Ali Bey geliehen hatte?« »Kann es dir Freude machen und Nutzen bringen?« »Gewiß!« »Emir, ich bin ein armer Priester; nur dreierlei gehört mir: mein Leben, mein Kleid und das Buch, von dem du redest. Mein Leben bringe ich dem Reinen, dem Mächtigen, dem Erbarmenden zurück, der mir es geliehen hat; mein Kleid überlasse ich dem Elemente, in welchem auch mein Leib begraben wird, und das Buch schenke ich dir, damit dein Geist mit dem meinigen sprechen könne, wenn Zeiten, Länder, Meere und Welten uns von einander trennen.« War dies nur eine blumige, orientalische Ausdrucksweise, oder sprach aus ihm wirklich die Ahnung eines nahen Todes? Es überlief mich ein Schauder, den ich nicht abschütteln konnte. »Pir Kamek, deine Gabe ist groß; fast kann ich sie nicht annehmen!« »Emir, ich liebe dich. Du wirst das Buch erhalten, und wenn dein Blick auf die Worte fällt, die meine Hand geschrieben hat, so denke an das letzte Wort, welches diese Hand schreiben wird in das Buch, darinnen verzeichnet steht die blutige Geschichte der Dschesidi, der Verachteten und Verfolgten.« Ich konnte nicht anders, ich mußte ihn umarmen. »Ich danke dir, Pir Kamek! Auch ich liebe dich, und wenn ich dein Buch öffne, so wird vor mich treten deine Gestalt, und ich werde hören alle Worte deines Mundes, die du zu mir gesprochen hast. Jetzt aber solltest du Scheik Adi verlassen, denn noch ist es nicht zu spät!« »Sieh dort das Heiligtum, in welchem Der begraben liegt, welcher verfolgt und getötet wurde. Er ist nie geflohen. Steht nicht auch in deinem Kitab, daß man sich nicht fürchten soll vor jenen, die nur den Leib töten können? Ich bleibe hier, da ich weiß, daß die Osmanly mir nicht zu schaden vermögen. Und wenn sie mich töteten, was wäre es? Muß nicht der Tropfen empor steigen zur Sonne? Stirbt nicht El Schems, die Glänzende, täglich, um auch täglich wieder aufzuerstehen? Ist nicht der Tod der Eingang in eine lichtere, in eine reinere Welt? Hast du jemals gehört, daß ein Dschesidi von einem andern sagt, daß er gestorben sei? Er sagt nur, daß er verwandelt sei; denn es gibt weder Tod noch Grab, sondern Leben, nichts als Leben. Darum weiß ich auch, daß ich dich einst wiedersehen werde!« Nach diesen Worten schritt er schnell davon und kam hinter der Außenmauer des Grabmales außer Sicht. Ich trat in das Gebäude und ging nach der Plattform. Droben vernahm ich Stimmen. Halef und Ifra redeten miteinander. »Ganz allein?« hörte ich den letzteren fragen. »Ja.« »Wohin sind die andern, die vielen, die Tausende?« »Wer weiß es!« »Aber warum sind sie fort?« »Sie sind geflohen.« »Vor wem?« »Vor euch.« »Vor uns? Hadschi Halef Omar, ich verstehe nicht, was du sagest!« »So will ich dir es deutlicher sagen: Sie sind geflohen vor deinem Mutessarif und vor deinem Miralai Omar Amed.« »Aber warum denn?« »Weil der Miralai kommt, um Scheik Adi zu überfallen.« »Allah akbar, Gott ist groß, und die Hand des Mutessarif ist mächtig! Sage mir, ob ich bei unserem Emir bleiben darf, oder ob ich unter dem Miralai kämpfen muß!« »Du mußt bei uns bleiben.« »Hamdullillah, Preis und Dank sei Allah, denn es ist gut sein bei unserm Emir, den ich zu beschützen habe!« »Du? Wann hast du ihn denn beschützt?« »Stets, so lange er unter meinem Schirme wandelt!« Halef lachte und erwiderte: »Ja, du bist der Mann dazu! Weißt du, wer der Beschützer des Emir ist?« »Ich!« »Nein, ich!« »Hat ihn nicht der Mutessarif selbst in meine Obhut gegeben?« »Hat er sich nicht selbst unter meinen Schutz begeben? Und wer gilt da mehr, der Sihdi oder dein Nichtsnutz von Mutessarif?« »Halef Omar, hüte deine Zunge! Wenn ich dieses Wort dem Mutessarif sage!« »Glaubst du, ich werde mich dann vor ihm fürchten? Ich bin Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah!« »Und ich heiße Ifra, gehöre zu den tapfern Baschi-Bozuk des Großherrn und wurde für meine Heldentaten zum Buluk Emini ernannt! Für dich sorgt nur eine Person, für mich aber sorgt der Padischah und der ganze Staat, den man den osmanischen nennt!« »Ich möchte wirklich wissen, welchen Vorteil du von dieser Fürsorge hast!« »Welchen Vorteil? - Ich will es dir auseinandersetzen! Ich erhalte einen Monatssold von fünfunddreißig Piastern und täglich zwei Pfund Brot, siebzehn Lot Fleisch, drei Lot Butter, fünf Lot Reis, ein Lot Salz, anderthalb Lot Zutaten nebst Seife, Oel und Stiefelschmiere!« »Und dafür verrichtest du Heldentaten?« »Ja, sehr viele und sehr große!« »Die möchte ich sehen!«





























