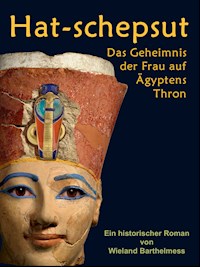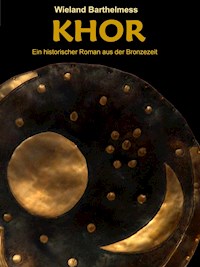Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von einem Tag auf den anderen findet sich Ani, ein Bauernbub, am Hof des Pharaos wieder. Er freundet sich mit Amenhotep, einem der Prinzen an. Als der Kronprinz ums Leben kommt, wird Anis Freund zum Thronfolger. Zum Pharao gekrönt, sieht Amenhotep, seine Aufgabe darin, die Welt besser zu machen. Eine bessere Welt. Ein Traum so alt wie die Menschheit. Vor fast 3400 Jahren wagte es der mächtigste Herrscher der damaligen Welt, diesen Traum zu verwirklichen: Amenhotep IV. der sich später Echnaton nannte. Das Dunkel sollte dem Sonnenlicht weichen, die Lüge der Wahrheit, das Böse dem Guten. Mitten in der Wüste errichtete er sein Utopia, um die Menschen davon zu überzeugen, dass ein anderes, ein friedliches, ein gerechtes Leben möglich ist. Er wollte den Menschen die Angst nehmen vor den Göttern der Finsternis und gab ihnen als Erster den einen, den einzigen Gott. Die Liebe sollte herrschen in seinem Reich, wie zwischen ihm und seiner Königin Nofretete, deren Schönheit und Klugheit legendär war. Kaum zehn Jahre dauerte der Traum. Der Autor hält sich an die neuesten archäologischen Erkenntnisse, zieht aber teilweise vollkommen andere Schlüsse daraus, die eine neue Sicht auf die viel diskutierte Amarna-Zeit ermöglichen. Vor allem wird ein Blick von innen auf die umwälzenden Ereignisse jener Jahre bis zu Tut-anch-amuns Tod geboten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1093
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wieland Barthelmess
ECHNATON
oder: Die Abschaffung des Bösen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog: Ein Tag im Leben des Ani, Sohn des Imenhotep
Malqata: Glanz des Aton, Haus des Jubels
Achmim: Weiße Schönheit in der Wüste
Das Sed-Fest: Die Macht Pharaos
Merit-amun: Das Licht der Sonne
Das Tal der Könige :Niemand kehrt wieder
Amenhotep, der Vierte: Gott und Herrscher von Waset
Echnaton: Der, durch den Aton wirkt
Achet-aton: Horizont des Aton
Neuanfang: Der Umzug der Tausende
Kija: Große geliebte Gemahlin des Königs
Tut-anch-aton: Lebendes Abbild des Aton
Götterdämmerung: Niemand nimmt dereinst mit sich, woran er gehangen.
Epilog: Achet-atons Ende
ANHANG
Echnaton: Der Große Sonnenhymnus
Stammbaum Echnaton und Nofretete
Glossar
Karte von Ägypten
Karte von Achet-aton
Impressum neobooks
Prolog: Ein Tag im Leben des Ani, Sohn des Imenhotep
Wer die Lüge vernichtet, fördert die gerechte Ordnung,
wer das Gute fördert, macht das Böse zunichte,
wie Sattheit den Hunger vertreibt,
Kleidung den Nackten bedeckt,
wie der Himmel heiter ist nach heftigem Sturm.
Die Klagen des Bauern
oder: Die Geschichte vom beredten Oasenmann
Ägypten, ca. 2000 v. Chr.
Der Charakter eines Mannes wird bestimmt durch seine Familie.
Altägyptische Weisheit
Breit und braun schob sich der Nil durchs Land.
Ani spürte einen Kloß im Hals. Würde er doch noch eine Zeit lang das mit ihm dahinrasende und dabei auch noch unberechenbar strudelnde Wasser unter sich ertragen müssen. Am frühen Morgen hatte ihn der Vater geweckt. Im Stall! Dorthin hatte man ihn zum Schlafen geschickt, weil Mutter schwer in den Wehen gelegen war. Anfangs hatte sie noch geschrieen, so dass Vater meinte, es sei besser, wenn Ani im Stall schliefe. Später hörte Ani nur noch ab und zu ein schwaches Wimmern, das er aber fast noch schlimmer fand als Mutters anfängliche Schmerzensschreie. Als der Vater ihn dann am Morgen sanft wachrüttelte, hatte Ani ihm nur ins Gesicht blicken müssen, um zu wissen, was geschehen war.
Kaum dass Ani ins Haus hinüberlaufen wollte, sah er das bereits ausgehobene Grab. Er erfror in seiner Bewegung und schlich sich schließlich langsam näher. Eine kleine zierliche Figur lag darin, eingewickelt in leinenen Tüchern. In ihren Armen ein ebenfalls in Leinen gewickeltes Bündel. Ani spürte wie sein Vater ihn von hinten fest umarmte. Er wäre sonst sicherlich gefallen.
Mit bloßen Händen hatten Vater und Sohn die trockene Erde in die Grube zurück gescharrt. Wie im ganzen Land war auch hier der Boden mehr Staub als Erde, wenn er denn nicht vom alljährlich herbeigesehnten fruchtbaren Nilschlamm bedeckt worden war. Zudem war er durchsetzt mit zahllosen Steinen, deren Geräusch, wenn sie auf die toten Körper fielen, Ani jedes Mal erschaudern ließ. Am Ende standen Vater und Sohn über und über mit Staub bedeckt und sahen aus wie graue Statuen aus Stein. Nur die Rinnsale, die aus ihren Augen drangen, schienen als Einziges auf Leben in diesen versteinerten Menschen hinzudeuten. Braun glänzte ihre feuchte Haut an den von den Tränen frei gewaschenen Stellen, die im Zickzack ihre Wangen hinunterliefen.
Seit zwei Tagen schon hatte Vater an dem Papyrusboot geflochten, das sie nun den Nil hinunter trug. Denn dass er würde fahren müssen, war klar: Entweder um der Göttin Mut für eine gesunde Geburt zu danken oder um Gott Amun zu besänftigen, der ihm in seinem Zorn Frau und Kind genommen hatte. So fuhren sie nun die etwas längere Strecke flussabwärts, um Amun ihr Opfer zu bringen. Ani hielt den Korb, in dem die dem Gott zugedachten Gaben verborgen waren, krampfhaft fest, damit sie nur nicht im Nil versanken. Der Fluss war in diesen Tagen derart reißend, dass Vater gemeint hatte, die Rückfahrt flussaufwärts sei ohne jeden Zweifel ausgeschlossen. Ihnen würde wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Papyrusboot schließlich gegen etwas Essbares einzutauschen und dann zu Fuß wieder nach Hause zurückzukehren.
Obwohl Ani schon oft auf dem Nil unterwegs gewesen war, sei es zum Fischen, um Verwandte zu besuchen oder um Besorgungen zu erledigen, so war er doch nie bis in die große Stadt gekommen. Er staunte, als an ihr vorüberfuhr, weit genug entfernt, um Einzelheiten zu erkennen, doch nah genug, um zu spüren, dass die Stadt brodelte. Der Gute Gott, der Pharao, lebte dort und wachte über seine Kinder. Doch seine Mutter, so dachte Ani trotzig, würde er ihm dennoch nicht zurückgeben können. Obwohl die Tempel, in deren Inneren die Götter wohnten, dort tatsächlich wie weiße Berge in den Himmel ragten.
Noch bevor Atons Scheibe am höchsten stand, sah Ani sie: Irgendwo in weiter Ferne, am Rand des überschwemmten Landes, umwimmelt von Häusern und Hütten ragten die Pylonen der Tempel empor, an denen lange Stangen mit schlanken Bannern angebracht waren, die in der nahenden Mittagsglut tanzten. Der Wind, der in großer Höhe steter wehte, wie sein Vater ihm erklärt hatte, ließ sie sich winden wie lange Schlangen, die das Heiligtum bewachten. Soeben glitt ihr Boot am Tempel der Mut vorbei, wie Vater einsilbig anmerkte. Welch prächtiger Bau! Ani hatte noch nie ein derart großes Gebäude gesehen, das überdies noch mit bunten Reliefs geschmückt war. Doch der nur ein weiteres kurzes Stück flussabwärts gelegene Tempelbezirk des Amun übertraf Muts Heiligtum noch bei Weitem an Wucht und schierer Größe. Ani blieb der Mund offen stehen. Die beiden vor Jahrhunderten errichteten Obelisken überragten die Anlage, so dass ihre goldenen Spitzen das Sonnenlicht fingen und gleißend widerspiegelten. Fast konnte man meinen, eine kleine Sonne throne auf jeder der Spitzen. Diese Obelisken hatte Pharao Hatschepsut aufstellen lassen, von dem man sich erzählte, dass er eigentlich eine Frau gewesen sei. Aber gerne sprach man nicht darüber, denn allzu groß war die Verehrung und Hochachtung, die man diesem großen Herrscher entgegenbrachte, als dass man sie mit derart ungehörigen Dingen beflecken wollte.
Anis Vater ließ das Boot ans Ufer treiben, noch lange bevor sie die Anlagestelle des Amun-Tempels erreicht hatten. „Da sind mir zu viele Menschen unterwegs“, sagte er nur. „Nachher ist unser Boot noch verschwunden. Hier in der Stadt klauen sie alle wie die Paviane!“ Und in der Tat: Es herrschte quirliges Treiben am Bootssteg flussabwärts. Ein prächtiges Schiff, bewacht von mehreren Bewaffneten, lag dort vertäut. Es musste einem Fürsten gehören, so verschwenderisch war es bemalt und mit bunten Stoffen geschmückt. Es standen Dutzende von Leuten herum, die gafften und schwatzten. Unter ihnen priesen Wasserverkäufer ihr kühles Gut an, eine Frau mit schriller Stimme versuchte auf sich aufmerksam zu machen, um ihre Amulette zu verkaufen und eine Menge neugieriger Kinder wuselte herum.
So nah der dichte Schilfgürtel es zuließ, steuerte der Vater das Boot ans Ufer und befestigte es an einem aus dem Schlick heraus ragenden Ast. Ani erschrak, als er ins Wasser sprang und spürte, dass seine Füße sogleich im Schlamm versanken. „Ja, hier kannst du nicht stehen bleiben“, sagte der Vater, „hier musst du laufen!“ und reichte ihm den Korb mit den Opfergaben. Ani musste aufpassen, dass er sie auch sicher an Land brachte, denn nur so würde der zornige Gott zu besänftigen sein. Er merkte das Gewicht der Verantwortung, das auf seinen Schultern lag. Doch schließlich spürte er wieder festen Boden unter den Füßen. Zufrieden drehte der Vater sich um. „Unser Boot wird hier so schnell niemand entdecken“, meinte er halblaut. „Ich hoffe nur, dass wir selbst es nachher auch wieder finden.“
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wollte der Vater sich schon auf den Weg in Richtung Anlegestelle machen, als er mitten in der Außenmauer des Tempels eine kleine Pforte entdeckte. Sie war kaum auszumachen gewesen, war sie doch mit Mauerwerk bemalt, das sich aufs Genaueste dem echten Gemäuer anpasste. So war es nur aus allernächster Nähe möglich, sie tatsächlich auch als Täuschung zu erkennen. Prüfend klopfte der Vater dagegen - und in der Tat: Es klang, als ob es hohl dahinter wäre. Er drückte dagegen – und tatsächlich: Sie war nicht verschlossen. Vorsichtig drückte er sie auf, wobei sie seltsamerweise keinen Ton von sich gab. Also, dachte Ani, dürfte es nicht allzu selten geschehen, dass sie benutzt wurde. Hinter der Pforte war es stockdunkel und Ani konnte fühlen, wie kühle Luft aus dem Inneren des Tempels zu ihnen in die Mittagsglut strömte, angefüllt mit dem Duft von Weihrauch und Myrrhe. Ani erschauderte, denn er spürte, dass er dem Gott nahe war.
„Ja, hier haust Amun“, nickte der Vater wie zur Bestätigung, der ebenfalls den Duft des Gottes gerochen hatte. „Der Herrscher der Orakel, der Zürnende. Und keiner weiß so recht, warum er überhaupt zürnt.“ Vater nahm Ani den Korb aus den Händen. „Ich erledige das hier jetzt gleich. Und du bleibst auf der Stelle stehen und wartest, bis ich wiederkomme.“
„Nimm mich mit!“, flehte Ani, doch der Vater schüttelte den Kopf und sah ihn streng an. Schon war er im Dunkel des Tempels verschwunden, während Ani ihn noch rufen hörte: „Ihr heiligen Männer, wo seid ihr, um meine Gaben zu empfangen? Wo seid ihr, ich höre doch eure Stimmen?“ Nach einer Weile Grabesstille konnte Ani den Vater wie aus weiter Ferne abermals rufen hören: „Ihr heiligen Männer, für Gott Amun bringe ich meine Opfergaben. So zeigt euch und nehmt sie entgegen!“ Auf einen Wimpernschlag absoluter Ruhe folgte ein Schrei - dann noch einer und dann noch einer, gurgelnd und erstickend. Ani schreckte derart zusammen, so dass er unwillkürlich einen Schritt nach hinten tat. Er stolperte, er fiel, er hörte Schritte und Stimmen, er sprang auf, lief fort. Wohin nur? Wohin?
Plötzlich stand er vor ihm: Ein Junge – etwa in seinem Alter, vielleicht ein oder zwei Jahre älter. Nur so ganz anders sah er aus. „Verpetz mich nicht!“, sagte der andere außer Atem, was Ani zunächst verwirrte, klang es doch eher wie ein Befehl und weniger wie eine Bitte. Doch Ani spürte eine seltsame Komplizenschaft in sich aufkeimen, denn auch er wollte nichts anderes, als schleunigst wegzukommen von diesem grauenhaften Ort. „Komm!“, winkte er dem Jungen zu. „Im Schilf, da liegt unser Papyrusboot.“
Als Ani dem Jungen ins Boot half, sah er die schlammverschmierten goldene Sandalen an dessen Füßen. So etwas hatte er noch nie gesehen! Also nahm er die Füße des Jungen, einen nach dem anderen, und schwenkte sie im Flusswasser ab. „Du kannst mich doch nicht einfach anfassen“, staunte der fremde Junge, schaute dann aber doch ganz zufrieden drein, als seine Füße wieder sauber waren.
“Wieso denn das nicht?“, fragte Ani verwundert. Erst jetzt bemerkte er, was den Jungen so vollkommen anders aussehen ließ. Es war weniger die erlesene Kleidung, wie die goldenen Sandalen, der Schurz aus allerfeinstem Leinen, der breite Sonnenschutzkragen aus bunten Perlen oder das aufs Peinlichste in Falten gelegte Tuch, das von einem Goldreif auf dem Kopf des Jungen gehalten wurde. Diese Aufmachung erschien Ani schon eigentümlich genug, allein, weil sie von einer derartigen Gediegenheit war, wie er sie noch nie gesehen hatte. Was Ani sein Gegenüber so fremdartig erscheinen ließ, war vielmehr der gepflegte und wohlgenährte Körper des Jungen. Zudem war seine Haltung eigenartig gekünstelt. Er hockte nicht einfach auf den zu einem Boot gebundenen Papyrusstängeln, sondern er thronte geradezu auf ihnen. Es war offensichtlich, dass seine Haut nie lange der Sonnenglut ausgesetzt war. Sie war zwar nicht wirklich hell, allerdings auch keineswegs verbrannt, wie bei den Menschen zu Hause, die auf den Feldern arbeiteten. Außerdem war sie sauber und ohne jegliche Schrammen, Narben oder Pusteln. Und als Ani die gepflegten Hände sah, zischte er unwillkürlich mit den Zähnen.
„Was glotzt du denn so blöde?“ Der andere fühlte sich begutachtet, was ihm offenbar wenig behagte. „Ist das überhaupt dein Boot? Oder bist du so was wie ein Dieb?“
„Ich bin kein Dieb“, entgegnete Ani entrüstet, „genauso wenig wie ich ein Verräter bin.“
Erst jetzt nahmen sie die Priester wahr, die aus der Pforte hervorgequollen kamen und spähend sowie Verwünschungen ausstoßend an der Tempelmauer standen oder das Ufer absuchten. Der komische Junge schien Freude an der Szene zu haben, denn er duckte sich hinter das Schilf wie eine Katze, die sich auf einen Leckerbissen freut.
„Sollten wir nicht lieber abhauen?“, fragte Ani besorgt. „Der Fluss ist so reißend, dass wir längst weit weg sein werden, bis sie uns überhaupt gesehen haben.“
„Und dann?“, kam die Antwort. „Bis nach Malqata werden wir’s mit deinen armseligen Schilfbündeln wohl kaum schaffen.“ Dabei deutete der Junge auf ein in weiter Ferne liegendes flaches, aber weiträumiges Gebäude auf der anderen Seite des Nils.
„Was?!“, rief Ani fast ein wenig zu laut, um nicht die Priester auf sich aufmerksam zu machen. „Auf die andere Seite des Nils, in die Duat sollen wir fahren? Ins Reich der Toten und der Götter? Du bist doch nicht recht bei Trost?“
„Was für einen Blödsinn redet er daher?“ Der Junge funkelte ihn herrisch an. „Wer ist er überhaupt? Und was hat solch ein Bauernlümmel hier am Allerheiligsten des Tempels zu schaffen?“
„Dich in mein Boot retten.“ Ani blickte ihm fest in die Augen. „Wenn du willst, kannst du gerne aussteigen und zu deinen Priestern rübergehen.“
„Das sind nicht meine Priester. Das sind Amuns Priester.“
Ani meinte, etwas Feindseliges in der Stimme des Jungen zu hören. Und um der Maat Genüge zu tun, die Ausgewogenheit in allen Lebenslagen forderte, raunte er dem Jungen versöhnlich zu: „Ich bin übrigens Ani, der Sohn des Imenhotep.“
„Das passt ja gut!“ Der andere lachte. „Ich bin Amenhotep, der Sohn des Amenhotep.“ Stolz richtete er sich auf.
„Ja, komisch. Klingt ähnlich. Imenhotep – Amenhotep.“ Ani zuckte mit den Schultern.
„Du bist ja ein richtiger Bauerntrampel!“ Der Junge war begeistert und strahlte ihn an. „Imenhotep – Amenhotep. Das ist doch ein und dasselbe. Nur, dass ihr Bauern eben eine nachlässige Aussprache habt und euch schließlich auch noch an euer Genuschel gewöhnt habt und die Sprache verhunzt.“
„Warum beleidigst du mich?“ Ani wurde ärgerlich.
„Mein lieber Ani, das ist keine Beleidigung, sondern lediglich eine Feststellung.“
„Na, dann wirst du ja froh sein, wenn der Bauerntrampel dich von seinem verdreckten Papyrusboot runterschmeißt.“
„Ganz und gar nicht“, sagte Amenhotep versöhnlich. „Ich hab nämlich noch nie mit einem echten Bauerntrampel gesprochen. Meine Schwester Sit-amun und meine Base machen gerne eure Sprache nach und wir haben immer viel Spaß daran.“
„Wozu? Wenn ihr euch was zu sagen habt, dann sagt es in der Sprache, die ihr versteht. Und wenn ihr euch nichts zu sagen habt, dann haltet lieber das Maul.“ Ani war nun wirklich verärgert.
„Wie redest du mit mir?!“ Der fremde Junge wollte gerade vor Empörung aufspringen, als Ani ihn glücklicherweise noch rechtzeitig am Schurz packen und nach unten ziehen konnte, bevor er vom Ufer aus gesehen wurde.
„Pst! Sei still!“, wurde er von Ani angeherrscht. „Du willst doch unerkannt hier fortkommen. Was hast du überhaupt angestellt da drinnen? Vielleicht bist du der Dieb von uns beiden und hast dem Gott etwas von seinen Opfergaben stibitzt?“
„Ich darf doch bitten!“ Amenhotep sagte dies mit einer derartigen Entrüstung in der Stimme, dass Ani ihm augenblicklich glaubte, dass solch ein Gedanke ihm nie und nimmer in den Sinn gekommen wäre. „Ich habe der Wahrheit ins Gesicht geblickt“, sagte Amenhotep fast ehrfürchtig.
„Das ist meistens keine angenehme Begegnung.“
„Nein, meistens nicht. Aber man hat danach wenigstens Klarheit. Man weiß, von wem man belogen wird.“
„Ach komm, Amenhotep! Jeder von uns hat seine eigene Wahrheit. Ich hab meine, du hast deine, mein Vater hat seine und dein Vater ebenso.“
„Bauerntölpel-Blödsinn! Wir müssen uns nur trauen, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Wenn die Sonne aufgeht, ist die Nacht vorbei. Das ist die Wahrheit. Die Nacht ist voller Schrecken, Angst und Tod. Die Sonne ist Wahrheit und bringt sie ans Licht.“
„Oh je!“, Ani kicherte verhalten. „Da haben wir’s. Du bist der Sohn eines Priesters und redest deswegen solch ein Zeug daher. Womöglich bist du noch der Sohn eines Oberpriesters einer dieser verrückten Sekten.“
„Fast richtig!“, erwiderte Amenhotep und kicherte ebenfalls.
Plötzlich zogen sich die Priester zurück. Einer nach dem anderen verschwand wieder hinter der Pforte. Kaum war sie geschlossen, als sie abermals geöffnet wurde und zwei Priesterschüler etwas Schweres herausschleppten, ein Dritter hinterher.
Jetzt war es Amenhotep, der seinen neuen Freund im Boot zurückhalten musste. Und da er fürchtete, Ani könne jeden Augenblick anfangen, wie von Sinnen zu schreien, überlegte Amenhotep einen kurzen Atemzug lang, ob es denn nicht eine allzu widerwärtige Entweihung seiner selbst wäre, wenn er Ani den Mund zuhielte. Schließlich entschied er sich jedoch dafür, dass dies eine mit einem Kriegsfall vergleichbare Situation sei, die somit derartige Mittel erlaubte. Gerade noch rechtzeitig, denn Ani krümmte sich vor Schmerz, als hätte man ihm in den Magen getreten. Anis Tränen liefen über seine Hand, die er mit aller Kraft vor den Mund seines neuen Freundes hielt, während Amenhotep etwas Eigentümliches verspürte. Es war ein Gefühl, dass er bislang nur gegenüber seinen Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden gekannt hatte. Außenstehende oder gar Fremde waren davon ausgeschlossen. Denn mit Menschen, die man nicht berührte, hatte man dort, wo er herkam, nur äußerst selten Mitgefühl.
Die Priester schleppten einen übel zugerichteten Toten heraus und schmissen ihn etwas flussabwärts wie ein Stück Abfall in den Nil. Ani krümmte sich vor Schmerz und versuchte, sich aus Amenhoteps Armen zu befreien, die bereits drohten, ihre Kraft zu verlieren. Also nahm Amenhotep Ani einfach fest in die Arme und strich ihm tröstend über den Kopf.
Schon längst waren die Priester wieder hinter der geheimnisvollen Pforte verschwunden, als Ani sich soweit beruhigt hatte, dass er versuchen konnte, sich zu erklären. „Das war mein Vater. Sie haben meinen Vater erschlagen! Warum nur? Warum? Er wollte Opfergaben bringen für Gott Amun, der in seinem Zorn mir erst heute im Morgengrauen die Mutter und die neugeborene Schwester genommen hat.“
Amenhotep hielt das schluchzende Bündel Mensch fest in seinen Armen, das binnen eines Tages alle seine Lieben verloren hatte. Fast meinte er, dieselben Schmerzen fühlen zu können wie Ani. Nur dessen langsam aufziehende Angst vor dem Morgen kannte er nicht. „Er hat das Allerheiligste betreten“, versuchte Amenhotep zu erklären. „Keiner darf das, nur der Pharao und der Oberpriester. Darauf steht der Tod.“
„Woher weißt du denn das?“
„Oh, so etwas bringt man mir im Unterricht bei. Und noch etliches anderes mehr…“
„Nein!“, unterbrach ihn Ani. „Ich meine, woher weißt du, dass mein Vater das Allerheiligste betreten hat? Er wollte nur Gott Amun opfern, um ihn gnädig zu stimmen.“
„Na, ich war doch dabei!“ sagte Amenhotep verwundert. „Plötzlich stand er da, wie aus dem Erdboden gewachsen und hatte einen Korb mit sich.“
„Ja, die Opfergaben. Hat Amun sie bekommen?“
Amenhotep stutzte. „Ja, sicher. Natürlich hat er sie bekommen. Dein Vater hat sie ihm direkt vor die Füße gelegt. Verstehst du denn nicht? Dein Vater ist mir nichts dir nichts in das Allerheiligste des Gottes Amun gelaufen, des Dunklen, den niemand erblicken darf. Er hat dem Gott ins Angesicht geschaut. Also musste er sterben.“
Ani wurde bleich vor Schrecken. „Aber er wollte doch nur die Opfergaben bringen. Und was hast du getan? Du hast einfach zugesehen, wie man einen unbescholtenen Mann umbringt?“
„Ich wusste ja nicht, dass es dein Vater war. Und dich kannte ich ja auch noch gar nicht. Er war einfach nur ein Mann, der am falschen Ort war.“
„Er ist tot! Für dich ist es lediglich ein Missverständnis, eine Bagatelle! Aber für mich war er der letzte Mensch, den ich noch hatte.“ Ani wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. „Jetzt sag mir, warum hast du dich dann überhaupt verborgen?“
„Der Gang führt direkt ins Allerheiligste.“
„Na und?“ Ani verstand nicht. „Du warst doch längst schon draußen.“
„Sicher. Aber wer durch diesen Gang kommt, war vorher zwangsläufig im Allerheiligsten.“
„Aha…“ Ani begann zu verstehen. „Warst du es etwa, der meinen Vater getötet hat?“
„Blödsinn! Ich hatte gerade eine Unterweisung durch den Oberpriester. Die letzte Tempelkammer vor dem Allerheiligsten ist von diesem nur durch einen halbdurchsichtigen Vorhang getrennt. Und hinter dem thront Gott Amun. Plötzlich stand dein Vater direkt neben dem Gott und legte ihm seine Gaben zu Füßen. Es gab einen unglaublichen Tumult. Ich habe ihn genutzt. Ich bin durch den Vorhang geschlüpft und habe Amun endlich ins Gesicht geschaut. Und soll ich dir sagen, was ich erblickt habe? Eine lächerliche Statue aus schwarzem Stein, leblos und starr. Ohne jedes Leben. Sie war noch nicht einmal von besonders erlesener Qualität. Irgendeine Statue wie sie in jedem Provinz-Tempel herumsteht. Ein Popanz, ein Mummenschanz, ein Spuk, um kleinen Kindern Angst zu machen.“
„Lass mich gehen, ich muss Vater suchen, damit ich ihn wenigstens richtig bestatten kann.“ Schon war Ani aus dem Boot gesprungen und hatte den Morast mit schnellen Schritten durchquert, um am Ufer entlang zu laufen bis zu der Stelle, wo die Priester den Leichnam ins Wasser geworfen hatten. Obwohl der Nil schnell dahinströmte war der Körper des Vaters nicht allzu weit abgetrieben worden. In einem Gestrüpp, das kaum noch aus der Flut herausragte, war er hängen geblieben. Schnell war Ani dorthin gewatet. Doch so sehr er auch zog und zerrte, das Wasser drückte den Leichnam immer stärker ins Gebüsch. „So hilf mir doch!“, rief er Amenhotep zu, der inzwischen ebenfalls das Boot verlassen hatte und am Ufer stand.
„Lass das!“, kam Amenhoteps Antwort. „Ich hole Hilfe. Und dann bekommt dein Vater die ihm gebührende Bestattung.“ Schon war er, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, in Richtung der Anlagestelle gelaufen. Ani sah ein, dass all seine Versuche nichts weiter bewirken würden, als dass der Leichnam vom Druck des Stroms nur noch tiefer ins Gebüsch gedrückt werden würde. So setzte er sich ans Ufer, aufmerksam darauf achtend, dass der Fluss den Körper nicht doch noch mit sich riss oder gar Krokodile sich daran zu schaffen machten.
Da saß er nun. Heute Morgen erst hatte er Mutter und Schwester in der kargen Erde begraben und nun starrte er auf den toten Vater, der der letzte Mensch war, den er auf dieser Welt noch hatte. Mit seinen ausgebreiteten Armen, die sich mit der Strömung bewegten, erinnerte ihn der tote Vater an einen Falken, der nahezu bewegungslos hoch über der Wüste schwebte. Ani fühlte sich einsam und verlassen. War er doch wie das Stück Treibholz, das er gerade vorbei strudeln sah. Es gehörte niemandem mehr und es trieb sinn- und zwecklos ins Nirgendwo. Wozu sollte er noch zurück in die elterliche Hütte? Das Land bebauen? Das konnte er niemals allein. Hatte es doch schon sein Vater kaum geschafft. Man würde ihn einfach von dem Stück Land fortjagen, das man seinem Vater zur Bewirtschaftung zugeteilt hatte. Er war jetzt wie einer der Köter, die ziellos umherstreiften und darauf hofften, von einer gnädigen Seele etwas Essbares zugeworfen zu bekommen.
Plötzlich schob sich ein mächtiger Schatten stromaufwärts. „Ani!“, hörte er rufen. „Ani, komm an Bord!“ Das prächtige Boot, das vorhin an der Anlegestelle dümpelte, hatte Segel gesetzt und war direkt auf ihn zugekommen. Eine Strickleiter hing an seiner Bordwand herunter, auf deren Höhe Amenhotep über die Reling lugte. Zwei Soldaten kletterten die Leiter hinunter und machten sich daran, Anis Vater aus dem Gestrüpp zu befreien. Sie legten ihn auf eine ebenfalls herabgelassene Bahre, die sogleich wieder an Bord gehievt wurde. Alles war so schnell vor sich gegangen, dass Ani seinem toten Vater kaum hatte ins Gesicht blicken können.
„Ani, komm mit an Bord!“ Amenhoteps Stimme war voller Mitgefühl. „Wir bringen ihn ins Einbalsamierungshaus, wo er siebzig Tage bleiben wird. Danach kannst Du ihn bestatten. Der Gute Gott hat sicherlich noch irgendwo ein freies Grab für einen verdienten Mann. Und du, komm mit und bleib bei mir. Hörst du, Ani? Wo sonst willst du denn hin? Du bist doch nun ganz allein. Und berührt hast du mich sowieso schon. Also kannst Du auch mein Diener sein.“
„Dein Diener?! Ich bin ein freier Mensch und diene nur dem Guten Gott!“
„Dann diene halt eben ihm!“, lachte Amenhotep vergnügt.
„Außerdem kann ich die Priester und Einbalsamierer überhaupt nicht entlohnen. Und was wird schließlich dein Vater sagen, wenn du noch einen weiteren Fresser anschleppst, der nichts Rechtes kann?“
„Du solltest dir eher Gedanken wegen meiner Mutter machen. Aber lass das alles mal meine Sorge sein. Und nun komm!“ Amenhotep machte Anstalten als ob er die Strickleiter hinunterklettern wollte. „Ich kann dich einfach auch abführen lassen. Ein Wort von mir und die Bewaffneten kommen dich holen.“
„Das traust du dich nur, weil ich ohne Vater und Namen wehrlos bin und niemand mehr für mich einsteht!“
„Du irrst dich, Ani. Ich bin es, der jetzt für dich einsteht.“
Ani stockte. Denn wieder hatte Amenhoteps Stimme denselben Klang lauterer Wahrheit, wie vorhin, als Ani ihn des Opferdiebstahls bezichtigt hatte. „Warum solltest du das tun? Ich bin doch nur ein Bauerntrampel?“
„Eben drum, Ani, eben drum. Komm! Und jetzt gib mir deine Hand.“ Amenhotep beugte sich weit nach unten, so dass man ihm sogleich zur Hilfe eilen wollte und ein gewaltiger Aufruhr an Bord entstand. Der wurde von Amenhotep jedoch schnell mit einem herrischen „Fort mit Euch!“ weggezischt.
Und da Ani keinerlei Ahnung hatte, was er überhaupt hätte tun sollen - sich den Nil hinab treiben lassen, in der Stadt um milde Gaben betteln oder nach Hause zurücklaufen, wo sowieso niemand mehr auf ihn wartete -, ergriff er Amenhoteps Hand. „Ich freue mich, dass du sie mir reichst“, sagte der, als er seinen neuen Freund an Bord zog.
Kaum hatte Ani die Planken des Schiffes betreten, meinte er, sich in einem Traum wieder zu finden. Eine Reihe Bewaffneter stand bereit, die ihn, einer wie der andere, misstrauisch, ja, feindlich beäugten. Und dennoch war die Schönheit, die ihn plötzlich umgab, dasjenige, was Anis Sinne am meisten beschäftigte. Unter einem weiten Baldachin lagen auf einem Podest, zu dem drei Stufen hinaufführten, Berge von Kissen. Saubere Kissen wohlgemerkt - die aussahen wie neu. Davor stand auf einem hohen Piedestal ein Räuchergefäß, das schwere, süße Düfte verbreitete. Auf einem mit bunten Einlagen geschmückten Tischchen leuchtete ein gefüllter Krug aus blauem Glas im Sonnenlicht, an dessen Außenwänden Wassertropfen perlten - so kühl war das Getränk in seinem Inneren! Gleich daneben stand in einem riesigen Topf ein seltsamer Baum, an dem bunte Schleifen zitternd im Flusswind flatterten. Ein aufgeregter Mensch, Ani konnte sich nicht recht entscheiden, ob er ihn für einen Mann oder eine Frau halten sollte, kam mit einer riesigen goldenen Wasserschale in Händen und einem blendendweißen Tuch über dem Arm auf ihn zu. Er trug ein golden gegürtetes dunkelviolettes, bodenlanges Gewand, in das man die Umrisse von Mandragora-Früchten eingewebt hatte sowie eine übertrieben gelockte Perücke, die ein prächtiger goldener Stirnreif krönte. Sein stark geschminktes Gesicht zeigte nichts als Unwillen. „Du hast ihn berührt, junger Herr“, sagte er vorwurfsvoll zu Amenhotep und hielt ihm die Wasserschale entgegen. Und als der nicht reagierte, versuchte er es abermals. „Du reichtest deine Hand, junger Herr. Dieser Mensch ist unrein, denn er ist nicht von deiner Art…“
„Lass das Wasser und gieß den Weihrauchbaum damit. Er sieht aus als ob er’s nötig hätte“, sagte Amenhotep bestimmt. Und da der Andere zögerte und den Eindruck machte, als habe er nicht recht verstanden, setzte Amenhotep nach. „Na los!“, lachte er und klatschte in die Hände, woraufhin der Violette unterwürfig davonlief. Die Soldaten grinsten. Und nachdem Amenhotep ihnen zugenickt hatte, verteilten sie sich zwanglos auf Deck.
„Ich will meinen Vater sehen!“, sprach Ani seinen Freund plötzlich an.
„Geduld! Komm jetzt, sei vernünftig und setz dich zu mir“, sagte Amenhotep freundlich. „Heute Abend kannst du deinen Vater noch einmal sehen. Wir bringen ihn jetzt sofort ins Einbalsamierungshaus. Lass sie ihn dort ein wenig vorbereiten, damit du dann heute Abend geziemend Abschied nehmen kannst.“
Gemächlich drehte das Schiff im Wind und trieb dem gegenüberliegenden Ufer des Nils entgegen, während die beiden neuen Freunde miteinander plauderten, Amenhotep auf den blitzsauberen Kissen sitzend und Ani auf einer der drei Stufen, die zum Podest emporführten. Amenhotep ließ den Violetten sogar noch ein zusätzliches Glas holen, was dieser eher widerstrebend tat. Ani hatte noch nie etwas derart Köstliches geschmeckt. Es war, als ob sich in seinem Mund eine Lotusblüte öffnete und schwere, süße Aromen freisetzte.
„Das ist Wein“, erkläre Amenhotep. „Er kommt aus den Gärten meiner Mutter im Fayum. Es ist der beste Wein im ganzen Land. Sogar die Achijawa wollten in eintauschen, die ja frech von sich behaupten, einer ihrer Götter habe ihnen das Wissen um den Weinbau geschenkt. Immer wieder haben sie nachfragen lassen. Aber meine Mutter hat verboten, dass je ein Tropfen ihres Weins Ägypten verlässt.“
Ani verstand nichts von alledem, was Amenhotep ihm sagte. Es war ihm auch einerlei. Denn er fühlte sich außerstande, noch über irgendetwas nachzudenken. Der kalte Wein machte ihn überdies müde und entspannt. Doch trotz allem, was ihm heute widerfahren war, fühlte er sich auf einmal seltsamerweise wohlig erschöpft und ruhig. Das Einzige, was zu wünschen er noch in der Lage war, wäre lediglich gewesen, dass diese Fahrt nie enden möge, so wohl fühlte er sich im Augenblick. Sie fuhren direkt auf das linke Ufer des Flusses zu, dort, wo irgendwann später die Sonne untergehen würde. Und obwohl er wusste, dass der Nil mit einem solchen Schiff schnell überquert war, hoffte Ani, dass diese Fahrt noch möglichst lange dauern würde.
Ani war nicht verwöhnt. So war er zwar enttäuscht, als das Schiff schnell einen breiten Kanal am anderen Ufer erreicht hatte, andererseits aber auch dankbar, dass ihm wenigstens diese kurze Dauer der Überfahrt geschenkt worden war.
Das Schiff ankerte vor einem großen Haus, direkt an der Mündung des Kanals, das leuchtend blau angestrichen war.
„Das hält die Fliegen fern“, erklärte Amenhotep. „Blau macht ihnen Angst. Weil sie dann glauben, sie flögen geradewegs in die Unendlichkeit des Himmels.“
Erst als man den Leichnam seines Vaters von Bord brachte, verstand Ani: Es war das Einbalsamierungshaus. Der Violette druckste vor Amenhotep herum. „Junger Herr, der Oberste der Einbalsamierer lässt nachfragen, ob es denn wirklich eine königliche Vorbereitung des Dahingeschiedenen für die Ewigkeit sein soll.“
„Selbstverständlich! Sag es ihm.“
Der Violette räusperte sich. „Derartige Vorbereitungen sind aber üblicherweise nur den Familienmitgliedern des jungen Herrn vorbehalten…“
„Ach, sei still und tu wie dir befohlen. Sag es ihm einfach!“ Mit einer beiläufigen Handbewegung schickte Amenhotep den vor Schreck kreidebleich Gewordenen fort. „Es ist der Vater meines Freundes. Und der gehört so gut wie zur Familie!“
Kaum hatten die Soldaten den Leichnam ausgeladen, setzte sich das Schiff wieder in Bewegung. Auf Anis entsetzten Blick meinte Amenhotep nur, dass er schließlich versprochen habe, dass Ani am Abend gebührend Abschied von seinem Vater würde nehmen können. Und auf ein Versprechen seinerseits ‑ Ani möge sich dies von nun an für alle Zeiten merken ‑ könne man sich jederzeit verlassen. Schnell jagte das Schiff den Kanal entlang, von dem plötzlich ein kurzer Stichkanal zu einem See führte, der von Dattelpalmen umstanden war. Es war wie das Traumbild einer Oase: Inmitten all des grau-gelben öden Sandes leuchtete ein tiefblauer See, umringt von hohen Palmen und regelrechten Blumenpolstern, die in allen Farben blühten.
„Den hat mein Vater meiner Mutter als Liebesgabe geschenkt. Als sie noch jung waren.“ Amenhotep deutete auf den See.
„Den ganzen See?“, fragte Ani ungläubig. „Dann muss dein Vater aber reich sein!“
„Tja“, nickte Amenhotep. „Das war in der Tat ein kostspieliges Unterfangen. Hier war ja gar nichts. Es dauerte ewig, bis das Becken ausgehoben worden war. Und die besten Architekten scheiterten daran, es schließlich auch dicht zu bekommen.“
„Und was macht deine Mutter nun mit ihrem See?“ Ani kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
„Sie fährt darauf spazieren.“
„Was? Sie fährt einfach nur darauf spazieren?“ Ani meinte seinen Ohren nicht trauen zu können. „Das kann sie doch genauso gut auf dem Nil machen.“
„Wo denkst du hin?“, kam entrüstet Amenhoteps Antwort. „Nur auf einem solchen Schiff wie dem unseren kann man den Nil sicher befahren. Bei all den Krokodilen und vor allem den zahllosen bösartigen Nilpferden ist Vorsicht geboten. Auf ihrem See aber kann sie, nur von ihren Zofen begleitet, nach Herzenslust spazieren fahren und ihre Ruhe genießen. Bei uns zu Hause sind ja immer und überall irgendwelche Menschen. Diener und Beamte, Wesire und Priester. Sogar der Zeugung der Kinder wünscht man beizuwohnen. Also hat mein Vater ihr diesen ganz persönlichen See geschenkt, den er selbstverständlich mit ihr bei einer gemeinsamen Bootsfahrt eingeweiht hat.“ Amenhotep zwinkerte.
„Ha“, schlussfolgerte Ani. „Und dabei bist du gezeugt worden!“
„Ich habe so sagen hören“, pflichtete Amenhotep schmunzelnd bei, wobei Ani sofort an seine eigenen Eltern denken musste, die ihn gewiss unter ganz anderen Umständen gezeugt hatten. Noch immer konnte er nicht fassen, was alles geschehen war und zwickte sich unauffällig ins Bein, um sicher zu gehen, dass er nicht träumte.
Am Ende des tief ins Land hinein führenden Kanals befand sich ein beeindruckend großes Hafenbecken, in dem mehrere Schiffe lagen. Eines von ihnen wurde gerade mit großem Geschrei ausgeladen. Fremdartige Tiere wurden von Bord geführt, die Ani noch nie zuvor gesehen hatte. Schwarz-weiß gestreifte, pummelige Pferde, fast mannshohe zottelige Affen, die artig an der Hand ihrer Pfleger von Bord gingen, riesige, in Käfige eingesperrte Löwen, die furchterregend brüllten und nervöse Leoparden, die unablässig fauchten und rastlos in ihren Gefängnissen auf und ab liefen. Am eindrucksvollsten fand Ani jedoch ein Tier mit turmhohem Hals, das aussah wie eine Kreuzung von Leopard und Dromedar. Es stank erbärmlich, was selbst aus der Ferne noch deutlich zu vernehmen war. Es wurde gerade die Rampe hinuntergeführt und stakste mit seinen langen, dürren Beinen unbeholfen über die Planken.
„Komm“, winkte ihm Amenhotep zu. „Der Trubel kommt uns sehr gelegen. Alle begaffen jetzt die Viecher, also werden sie uns kaum beachten.“ Und schon war er von Bord und nickte Ani aufmunternd zu. Der kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Es wurde geschrieen und gelacht, hierhin gerannt und dorthin, zwischendrin die allgegenwärtigen Wasserverkäufer aber auch Händler, die irgendwelche anderen Dinge anpriesen. Bald wäre Ani angst und bange geworden vor dieser ungewohnt riesigen und lauthals krakeelenden Menschenmenge, hätten sich ihnen nicht die Bewaffneten angeschlossen, die ihnen sogleich einen Weg durch die Massen bahnten. Eigentlich taten sie nichts weiter, als vor, neben und hinter Amenhotep und Ani zu gehen. Ihre schiere Gegenwart genügte jedoch, die Menschen wie selbstverständlich ausweichen zu lassen, so dass sich schnell eine Gasse bildete. Die meisten Menschen senkten sogar den Kopf, als ob sie einer ehrwürdigen Person Achtung darbieten wollten.
„Und du sagst noch, dass sie uns kaum beachten würden“, zischte Ani.
„Das tun sie doch auch gar nicht“, entgegnete Amenhotep belustigt. „Die glotzen alle nach den Tieren hin. Und wer im Weg steht, weicht aus und senkt den Blick. Was meinst du, was sonst hier los wäre, wenn nicht gerade stinkende und geifernde Bestien ausgeladen werden würden.“
Fröhlich marschierte Amenhotep weiter, während Ani die Augen überzugehen drohten. Was von weitem wie ein einziger lang gezogener Gebäudekomplex ausgesehen hatte, stellte sich von nahem als regelrechte Stadt heraus, die sich vom Hafen bis zu einem teilweise grotesk verschachtelten, riesigen Bauwerk erstreckte. Jetzt, während der Nilflut, stand die dem Fluss zugewandte Seite mitten im Wasser. Trutzig ragten dort die Mauern empor. Aber dennoch wirkte der Bau nicht einschüchternd, abweisend oder gar feindlich. Die vielen Anbauten, die in den unterschiedlichsten Stilen ausgeführt und ebenso bunt bemalt waren, ließen ihn sogar freundlich, ja, heiter, wenn auch wehrhaft erscheinen.
Amenhotep bemerkte Anis Interesse. „Das ist der Harem. Jede der Frauen bekommt ihr eigenen Gemächer, die sie selbstverständlich ganz nach ihrem Geschmack ausstatten darf. Sie sollen sich ja auch zu Hause fühlen. Ich wohne gleich daneben.“
„Aha“, dachte Ani, „dann ist er wohl der Sohn von irgendeiner der Haremsdamen.“ Weitere Überlegungen konnte er nicht mehr anstellen, da sie gerade an einer Töpferwerkstatt vorüberkamen. Noch nie hatte Ani derart bemalte Gefäße gesehen. Und er kannte sich ein wenig darin aus, denn seine Freundin Sahirah … Nun, er nannte sie seine Freundin, während sie ihn hingegen hartnäckig als einen guten Bekannten zu bezeichnen pflegte. Jedenfalls war seine Freundin Sahirah die Tochter eines Töpfers und Ani hatte fast all seine freie Zeit in dessen Werkstatt verbracht. „Dieses Hellblau ist wunderbar“, entfuhr es ihm. „Wie bekommen sie das nur hin? Und dann die Ornamente! So beschwingt und heiter!“
„Ach was!“, staunte Amenhotep. „Ich dachte dein Vater war Landmann.“
„War er auch.“ Und knapp erzählte Ani die Geschichte von Sahirah.
„Und warum zeigt sie sich dir gegenüber so spröde, deine Sahirah?“ Amenhotep war auf einmal sehr viel mehr an einer womöglich tragischen Liebesgeschichte interessiert, als an Anis Wissen über das Töpferhandwerk.
„Nun ihr Vater ist Töpfer und führt eine eigene Werkstatt. Mein Vater ist…“ Ani stockte. „Mein Vater war nur Pachtbauer.“
„Ich verstehe.“ Amenhotep nickte. „Wir sollten dafür sorgen, dass solche Dinge zukünftig aufhören. Und jetzt spute dich ein wenig. Wir sind schon spät dran. Und weder meine Mutter noch mein Vater schätzen Unpünktlichkeit.“
Ani nahm sich fest vor, bei allernächster Gelegenheit einen ausgedehnten Streifzug durch die seltsame Stadt zu unternehmen. Denn alles, was hier gefertigt wurde, schien gediegener und von weitaus besserer Qualität zu sein als alles, was er bislang gesehen hatte. Sogar die Straße war sauber. Zwar gab es auch hier Schweine, die sich um den Unrat kümmerten und grunzend umherstanden. Aber der Dreck sammelte sich hier in Gossen, um die sich die Schweine versammelten, und war nicht wie sonst überall wild verstreut.
Erst als sie es durchschritten, nahm Ani wahr, welch großes und prächtig ausgeschmücktes Tor die Stadt mit ihrem Lärm und Gestank vom Inneren des Gebäudekomplexes abschirmte. Die Torflügel waren aus wertvollstem Zedernholz, das noch immer duftete, so alt es auch sein mochte. Zwei Bewaffnete winkelten zum Gruß ihre Speere an als Amenhotep an ihnen vorbeilief und ein runder Mann mit einem enormen Perlenkragen und einem mindestens ebenso eindrucksvollen, dicken Bauch stellte sich ihnen in den Weg.
„Junger Herr, hat dein Begleiter schon die notwendige Reinigung erhalten, um das Innere betreten zu dürfen?“
Amenhotep packte Ani stumm am Arm und schob ihn dem dicken Mann entgegen. Der nahm Amenhoteps Berührung mit einem erstaunten Gesichtsausdruck zur Kenntnis. „Bring ihn nachher zu mir“, sagte Amenhotep. „Und sei gut zu ihm, hörst du?!“ Und schon war er verschwunden.
„Na komm!“, meinte der Dicke und gab Ani einen sanften Klaps auf die Schulter, wischte sich aber sogleich verstohlen die Hand an seinem Schurz ab. „Ich heiße Rechmire. Und ich bin dafür verantwortlich, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, dass du jetzt erst einmal tüchtig gewaschen wirst. Dann kommt die Wolle von deinem Kopf.“ Rechmire warf einen heimlichen Blick auf Anis Haare und nickte stumm, als ob er seine Ahnungen bestätigt sah. „Und etwas Frisches zum Anziehen für dich werden wir auch noch finden. Hast du bestimmte Wünsche?“
Ani muss ihn angesehen haben wie ein Schaf beim Blöken. Denn Rechmire lachte nur laut und knuffte sein überfordertes Mündel in die Seite. „Na komm, mein Kleiner, jetzt wird’s erstmal schön nass und frisch. Wie heißt du überhaupt?“
Ach, war das herrlich in diesem kleinen, dunklen, kühlen Raum! Nur durch ein sternförmiges Fenster drang ein Strahl des Sonnenlichts herein, das sich in unzähligen schwebenden Wassertröpfchen spiegelte, sie tanzen ließ und Abermillionen von Farben hervorzauberte. Kurze Augenblicke nur leuchteten sie auf, die mit keiner Macht der Welt zu bannen waren. Noch nie hatte Ani eine solch liebevolle Zuwendung erfahren wie in diesem Bad. Sicher, seine Mutter hatte ihn auch manchmal fürsorglich gewaschen. Aber meistens war ja kaum einmal richtig Zeit dazu. So lange die Sonne schien, war man auf dem Feld. Und war man endlich zu Hause, dann war man meist müde und wollte nur noch essen, trinken und schlafen. „Ach …“ Ani seufzte leise. „Essen, trinken und schlafen …“
„Geduld … Hab nur Geduld …“, sagte eine der drei Dienerinnen, die aus ständig neu gefüllten Schalen lauwarmes Wasser über ihn gossen. „Hier, wo du jetzt bist, kommt alles zu seiner Zeit.“ Doch wie zum Protest meldete sich Anis leerer Magen und knurrte erbärmlich wie ein Straßenköter. Das Gelächter der drei jungen Mädchen muss bis weit in die Stadt hinein zu hören gewesen sein.
Nachdem man ihn gewaschen, rasiert und danach abermals gewaschen hatte, fühlte Ani sich frisch und fast wie neu geboren. Rechmire legte ihm die Hand auf die Schulter. „Da du noch nie heiligen Boden betreten hast, müssen wir dich nun rituell reinigen.“
„Und was bedeutet das?“ Ani fürchtete das Schlimmste.
„Keine Angst, dies geschieht nur einmal. Und es tut auch nicht weh. Es ist nur ein wenig warm – und dann auch wieder kalt zugleich.“
Drei Mal musste Ani von einer Wanne mit kochend heißem Wasser in eine andere umsteigen, die mit Wasser aus der tiefsten und kühlsten Zisterne gefüllt war, die Ani sich vorstellen konnte. Jedes Mal war er froh, in das andere Becken gestiegen zu sein, bereute diese Freude aber auch jedes Mal keine drei Wimpernschläge später. Schließlich landete er in einem weiteren Gemach auf einem angenehm kühlen marmornen Tisch. Niedrige Bogengänge trennten den Raum von einem wunderschönen Garten. Eigentlich war es gar kein Garten, überlegte Ani, sondern nur eine saftige Wiese auf der bunte Blumen wuchsen. Doch ihm fiel schnell auf, dass es nur drei Arten von Blumen waren, die hier standen: Margeriten, Kornblumen und Mohn.
„Es ist eine wunderschöne Farbzusammenstellung, nicht wahr?“ Amenhotep war in seiner Ungeduld zurückgekommen, um nach seinem Schützling zu sehen. „Das Weiß der Wahrheit, das Blau der Ewigkeit und das Rot der Liebe. Und unter allem: das Grün der Zuversicht. Mein Vater hat sich das ausgedacht. Hübsch, nicht wahr?“
„Oh, es ist bezaubernd“, pflichtete Ani ihm eifrig bei. „Es ist so einfach, so grundsätzlich - einfach nur schön. Dein Vater ist ein wahrer Künstler. Er dichtet und malt und musiziert nicht mit Worten, Farben oder Tönen, sondern mit der Natur. Er muss ein großer Gärtner sein!“
Jetzt stand Amenhotep mit offenem Mund da. „Na, das musst du ihm aber nachher gleich sagen. Und zwar genauso wie du es eben zu mir gesagt hast. Er wird dich lieben dafür. Er wird dich bestimmt zu seinem Hofdichter machen oder so was. Hast du doch mit deinen Worten sein Herz genau getroffen. Und dies nur, weil du seine Wiese gesehen hast.“
Ani kam gar nicht mehr dazu, etwas zu erwidern, da ihn plötzlich eine Schar von freundlich dreinblickenden Dienerinnen umringte. Eine fummelte an der linken Hand, eine andere an der rechten, eine schabte am linken Fuß, die nächste am rechten, eine zupfte an irgendwelchen übersehenen Härchen, eine weitere massierte den kahlen Kopf und von beiden Seiten wurde Anis Gesicht überdies mit irgendwelchen Dingen beschmiert. Doch während all der Zeit sah er nur in die Gesichter von bildhübschen, freundlich lächelnden Mädchen, die ihm Gutes tun wollten. Sie waren in wunderschöne weiße Gewänder gekleidet, die eigentlich gar nicht da waren, so durchsichtig waren sie. Es ist ein eigentümlicher Reiz, dachte Ani. Sie sind bekleidet, doch ihre Gewänder schenken die Möglichkeit, dass man ihre makellosen Körper mit den Augen genießen darf. Wie viel Schönheit hatte er heute schon sehen dürfen! Und wie gerne hätte er jetzt auch mit seinen Fingern genießen wollen, was seine Augen voller Freude betrachten durften.
„Daran darfst du hier, in diesem Haus, noch nicht einmal denken!“, unterbrach Amenhotep die Sinnesfreude seines Freundes, die sich in unwillkürlichen Regungen zeigte. „Sie sind Dienerinnen fürwahr. Aber das heißt nur, dass sie dazu da sind, dir die Fingernägel zu feilen und dich hübsch zu schminken. Sie sind die Besten ihrer Zunft und eine Zierde für das Große Haus. Dabei sind sie nebenher so freundlich und gestatten dir, dich währenddessen an ihren schönen Körpern zu erfreuen. Für alles andere aber, wie kochen, Sandalen reparieren oder was auch immer, sind sie nicht zuständig. Dafür gibt es andere Diener und Dienerinnen. Und sie werden ihr Bestes geben, dessen sei versichert, dich in ihrem jeweiligen Bereich zufrieden zu stellen.“
Ani wurde rot, denn er fühlte sich ertappt. Wortlos hielt ihm Amenhotep eine runde Bronzescheibe an einem Stiel vors Gesicht, die blank poliert war. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr Ani, so dass die soeben noch freundlich lächelnden Dienerinnen mit etlichen Ahs und Ohs erschrocken beiseite sprangen. Nach einem Augenblick der Stille brachen alle in albernes Gekicher aus, das Ani jedoch noch mehr reizte. Erst als er sah, das Amenhotep und Rechmire am lautesten von allen lachten, warf er abermals einen Blick in den Spiegel. „Aber das ist doch einfach lächerlich. Ich sehe aus wie eine schlecht bemalte Statue in irgendeinem Tempel. Und diese Perücke! Wie grässlich! Das bin nicht ich!“
„Doch, Ani“, erwiderte Amenhotep mit aufrichtiger Freundlichkeit. „Das bist du. Und du wirst es auch immer bleiben, egal womit man dich behängt. Sieh nur hin: Das ist Ani. Und der Rest von dem, was du siehst, ist ein bisschen Farbe, ein bisschen Schmuck, Tralala eben, um deine Schönheit zu unterstreichen. Und niemand im Land weiß verborgene Schönheit besser zu entdecken, als unsere liebreizenden Dienerinnen.“ Amenhotep machte eine knappe Geste, woraufhin die Gepriesenen geziert wie sich im Wind wiegende Lilien wieder verschwanden. „Hier im Großen Haus lieben wir es, ein wenig extravaganter zu sein. Wir gehen nicht mit der Mode, wir machen die Mode. Und so ist es unabdingbar, zumindest auf der Höhe der Zeit zu sein. Darum deine Aufmachung. Es ist ein blödes Spiel, ich weiß, aber wir alle haben auch schon sehr viel Spaß daran gehabt.“
„Ich hab keinerlei Ahnung wovon du überhaupt redest. Aber lass mich wenigstens diese blöde Perücke abnehmen.“ Und schon schwebte sie an Anis Hand durch die Luft.
„Ach - gar nicht mal so schlecht“, Amenhotep schien von dem Anblick sogar ganz angetan zu sein. „Was meinst du denn, Rechmire?“
„Oh, bei Fragen der Mode fühle ich mich nicht wirklich zuständig …“, versuchte der Oberhofmeister einer Blamage zu entgehen.
„Ach was?!“, meinte Amenhotep erstaunt. „Einerlei! Ich finde Ani ohne Perücke tatsächlich auch besser. Und da die Mädchen ihn nicht übertrieben geschminkt haben, kreieren wir heute eben einfach die allerneueste Mode des Hohen Hauses, die Landmann–Mode. Und statt erlesener Duft-Essenzen nehmen wir schlichtes Rosenwasser.“ Wie aus dem Nirgendwo erschien eine der tänzelnden weißen Lilien und besprengte Ani mit besagter Essenz.
„Na, dann können wir ja jetzt gehen“, sagte Ani missmutig und Rechmire kicherte.
Als sie über den weitläufigen Hof gingen, fiel Ani auf, dass ihn kaum noch jemand anstarrte oder sich nach ihm umdrehte. Amenhotep meinte, er kenne eine Abkürzung, die jedoch durch derart viele dunkle Flure und Räume führte, dass Ani schon argwöhnte, sie hätten sich verlaufen. Plötzlich blieb Amenhotep jedoch stehen und begann, Anis verrutschten Schmuckkragen gerade zu ziehen. „Wenn wir uns verschnauft haben, gehen wir rein. Und denk einfach nur daran, dass du bist, wer du bist.“
„Mach ich“, nickte Ani und schon öffnete Amenhotep die Tür. Sie entließ sie in einen langen Flur, dessen Wände über und über mit Schilf und Gras bemalt waren. Lotus reckte seine Blüten, eine Ente zog mit ihrer Kükenschar durchs Schilf, dort kletterte eine winzige Maus gewagt auf einem Blatt herum und über alldem schwirrten Libellen, Schmetterlinge und Vögel. Ani konnte kaum an sich halten, so begeistert war er von seinen Entdeckungen an den Wänden. „Hat sich das auch dein Vater ausgedacht?“, fragte er ehrfürchtig.
Amenhotep nickte stolz. „Mein Vater.“ Und schon öffnete er die prachtvoll bemalte Tür am Ende des Flures.
„Da bist du ja, mein Junge!“ Eine schwarze Frau saß in einem goldenen Sessel und streckte Amenhotep ihre Arme entgegen. „Fast mussten wir auf dich warten. Und sag, wen hast du denn da mitgebracht?“
Amenhotep wollte gerade ausholen, um seine und Anis Geschichte zu erzählen, als eine weitere Tür aufgestoßen wurde und ein imposanter Mann eintrat. Seine Gegenwart erfüllte sogleich den ganzen Raum, ja, er beherrschte ihn vollkommen. Er war zwar nicht übermäßig groß, doch durchaus gut genährt, was jedoch bei seinem kräftigen Körper überhaupt nicht nachlässig aussah. Er war ganz gewiss niemand, der sich gehen ließ, sondern ein Mann in den besten Jahren, der offensichtlich zu genießen wusste. Auf seinem rundlichen Leib saß ein enormer Schädel, der dieselbe längliche Form hatte wie Amenhoteps Kopf. Sein spitzes Kinn ließ einen starken Durchsetzungswillen erkennen und die zahlreichen Fältchen um die Augen verrieten, dass er offensichtlich gerne lachte. Ani war beeindruckt. Der Mann beugte sich zur schwarzen Frau hinunter und küsste sie zärtlich auf die Stirn. Erst jetzt hatte Ani ihr Gesicht richtig sehen können. Sie war von einer eigenartigen Schönheit. Ein wenig streng und herb vielleicht, aber mit unglaublich wachen Augen, die unter schweren Lidern in die Welt guckten. Sie war das Gegenteil ihres stattlichen Mannes. Zart und elegant, aber keineswegs zerbrechlich. Die ausgeprägten Falten, die sich von ihrer Nasenwurzel aus über die Wangen zogen, hatte Amenhotep offenbar von ihr geerbt.
„Und wen hast du uns denn da mitgebracht, Ameni?“, fragte der Vater schließlich interessiert.
Schau an, dachte Ani, wie die Menschen sich einander angleichen, wenn sie nur lange genug miteinander leben. Sie stellen sogar dieselben Fragen im gleichen Wortlaut.
„Ich dachte mir“, erwiderte Amenhotep selbstsicher, „dass es wohl an der Zeit wäre, dass ich mir einen eigenen Leibdiener zulege. Das ist Ani, der Sohn des Amenhotep.“ Freundlich legte er die Hand auf die Schulter seines Freundes und drückte ihn fest nach unten, damit dieser eine Verbeugung machte.
„Und woher kommst du, Ani, Sohn des Amenhotep?“ Die schwarze Frau sah ihn forschend an.
Natürlich wusste Ani, dass der Weiler, aus dem er kam, zu einem Verwaltungsbezirk gehörte. Doch der Name wollte ihm vor lauter Aufregung nicht einfallen. Für ihn und seine Leute war es einfach nur ihr Zuhause. „Von flussaufwärts“, stammelte er also nur.
„Oh, Ani der Sohn des Amenhotep von flussaufwärts“, wiederholte die schwarze Frau ohne jeden Anklang von Spott in der Stimme. „Tritt näher, Ani!“ Kaum dass er vor ihr stand, griff sie ihm ins Gesicht und zog seinen Unterkiefer nach unten. Wie einem Gaul auf dem Pferdemarkt schaute sie ihm in den Mund. „Oh je! Schlechtes Brot aus schlechtem Mehl. Die Zähne sind schon tüchtig abgeschliffen von dem vielen Sand im Mehl. Na, das wird sich ja jetzt ändern.“ Mitten in ihrer Begutachtung stockte sie plötzlich, trafen sich doch ihre und Anis Blicke. Sie sah die Demütigung darin, die sie ihm mit ihrer Untersuchung zugefügt hatte. Schnell ließ sie von ihm ab. „Schau doch nicht so traurig, Junge!“ Ihre Stimme klang nun weich und warm. „Es wird dir hier gut gehen. Also freu dich!“
Mit knappen Worten berichtete Amenhotep, was Ani widerfahren war. „So so, ein Bauernbub“, meinte der Vater nachdenklich. „Ein richtiger Bauernbub. Aber jetzt sag du mir“, meinte er zu Amenhotep gewandt, „was du hinter dem Allerheiligsten des Amuntempels zu schaffen hattest? Solltest Du nicht von Anen in die Heiligen Handlungen eingewiesen werden?“
Stolz blickte Amenhotep seinem Vater ins Gesicht. „Das wurde ich auch. Aber nachdem Anis Vater für einen solchen Aufruhr gesorgt hatte, habe ich es gewagt, ins Allerheiligste zu schlüpfen.“
„Oh“, riefen Vater und Mutter einstimmig und sahen sich an.
„Sie belügen uns“, sagte Amenhotep mit halblauter Stimme, als ob er verhindern wollte, dass andere Ohren seine Worte hörten. „Es gibt keinen Gott im Allerheiligsten. Nur eine noch nicht einmal übermäßig kunstvoll ausgeführte Statue aus schwarzem Stein. Ein Götzenbild, wie in jedem beliebigen Schrein im Land. Und bei ihrer albernen Prozession während des Opet-Festes schleppen sie diese Statue in einer mit Schleiern verhängten Sänfte herum und tun so, als säße der leibhaftige Gott darin.“
Amenhoteps Eltern sahen sich vielsagend an.
„Wir werden noch Zeit finden, ausführlicher darüber zu reden“, beendete der Vater das Thema. „Ein frischer Abend unter dem Sternenhimmel, wird sich bald schon finden. Dann können wir Näheres bereden.“
Amenhotep wusste, dass er bald Gelegenheit haben würde, diese ihn beschäftigenden Dinge mit der ganzen Familie zu besprechen. Also wechselte er eifrig den Gesprächsstoff. „Ani hat übrigens dein Garten vor der Halle der rituellen Reinigung überaus gut gefallen.“ Dabei gab er seinem Freund einen Schubs, damit er etwas sage.
„Ja“, nickte Ani. „Und die Malerei hier im Flur … Einfach nur schön.“
„Ani meinte, dass du ein großer Gärtner wärst. Ein wahrer Künstler, der statt Worten, Farben und Tönen die Natur nutzt, um ein Kunstwerk zu erschaffen.“
„Ach, da schau an!“ Der Vater schaute überrascht drein, freute sich aber offensichtlich über das unerwartete Verständnis für seine Absichten. „Das erstaunt mich aber jetzt …“ Und zu seinem Sohn gewandt, fuhr er fort: „Jetzt erzähle du mir aber erst einmal, warum es gerade Ani sein soll, der dein Leibdiener wird.“
Amenhotep druckste zunächst ein wenig herum, fasste sich aber schließlich ein Herz und nannte seine Beweggründe. „Er ist der Sohn eines Pachtbauern. Er steht ganz allein in der Welt und muss niemand anderem gegenüber loyal sein. Und er kennt all die Intrigen und das Gerede des Palastes nicht. Er ist auf niemandes Seite - außer auf meiner. Und er ist überdies vollkommen unschuldig und unverdorben. Einen klugen Kopf hat er obendrein. Es war sicherlich kein Zufall, dass wir uns heute unter diesen Umständen begegnet sind. Mir scheint, es steckt ein höherer Wille dahinter. Ich möchte, dass er mein Freund wird und hoffentlich auch immer bleibt.“
„Nun, dann wollen wir mal sehen, wie er sich so anstellt als dein neuer Freund.“ Liebenswürdig blickte der Vater in Anis Gesicht. Und an seinen Sohn gewandt fuhr er fort: „Dein Bruder findet ein verwaistes Kätzchen und schleppt es mit sich herum, du aber gleich einen Bauernbuben … Nun denn! Die Einbalsamierung dauert siebzig Tage. Über diese Zeit mag er also bei dir bleiben, Ameni. Wir werden dann sehen, ob er sich bewährt. Am Tag, wenn er seinen Vater beerdigt, werden wir wissen, ob wir ihn bei uns behalten wollen oder nicht.“
„Oh, danke Vater!“, die Erleichterung war deutlich in Amenhoteps Stimme zu hören. „Ich würde ihn gern ständig um mich haben. Darf er auch mit mir in die Palastschule gehen?“
„Nun, ein wenig mehr Bildung wird ihm sicherlich nicht schaden. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch jede Menge verborgener Talente in ihm zu entdecken. Du weißt ja, dass ich seit jeher der Meinung war, dass edle Abkunft nicht unbedingt auch eine edle Gesinnung und außerordentliche Begabungen gewährleistet.“ Mit diesen Worten sah er seiner Frau ins Gesicht und küsste zärtlich ihre Hand. „Sei so lieb und kümmere dich darum“, meinte er zu ihr gewandt. „Er braucht auch eine eigene Wohnung …“
„Oh, kann er vorerst nicht auch bei mir wohnen?“ Amenhotep war ganz aufgeregt.
„Nun, für die siebzig Tage der Einbalsamierung mag das wohl angehen. Für später sehen wir dann. So wie es zurzeit aussieht, werden wir sowieso bald wieder größere Umbauten im Palast in Auftrag geben müssen.“ Der Vater blickte seine Frau bedeutungsvoll an.
„Hat Tuschratta geschrieben?“, fragte sie.
„Ja, das hat er. Eben kam der Bote aus Mitanni. Er würde mir seine Tochter Taduchepa gerne zur Frau geben.“
„Das ist ja wunderbar!“, rief Amenhoteps Mutter, was Ani ein wenig befremdete. „Endlich wärt ihr dann Brüder. Und der Frieden wäre gesichert. Ein für alle Mal. Haben sich all die endlosen Verhandlungen dann doch noch gelohnt. Welch schöne Nachricht!“ Voller Begeisterung sprang sie auf und küsste ihren Mann auf die Wange. „So und nun lasst uns schnell in den Speisesaal gehen. Die Kinder warten schon und ihre Mägen sind gewiss längst am Knurren.“
„Meiner knurrt auch“, pflichtete Amenhoteps Vater bei. „Und auf unser anschließendes Mittagsschläfchen freue ich mich auch schon.“ Als ob Amenhotep und Ani plötzlich Luft wären, gingen sie, einander an Händen haltend, an ihnen vorbei auf eine weitere Tür zu, hinter der Diener warteten, die sie eilfertig öffneten. Noch bevor sie die Tür durchschritten hatten, konnte Ani sehen, wie Amenhoteps Vater den Po seiner Frau zärtlich streichelte. Es schien ihr zu gefallen. Denn sie lachte ein so herzliches Lachen voller Glück, dass Anis Seele vor Freude jubelte, während Amenhotep nur ein Kichern unterdrückte.
Kaum war die Tür geöffnet worden, verstummte das laute Geschnatter im Speisesaal. Ani kam mit dem Zählen gar nicht mehr nach, denn überall lagen sie auf dicken Polstern herum: Mädchen – und zwar jeden Alters. Jede von ihnen hatte zwei oder drei Zofen, die zumeist im Alter ihrer Herrin waren und sie befächelten, an ihrer sowieso kaum vorhandenen Kleidung herumzupften oder auch Senet mit ihnen spielten. Inmitten der heiteren Schar saß ein missmutig dreinblickender junger Mann. Ani sah sofort, dass er keine Jugendlocke mehr trug. Er hielt sich den Bauch und hatte die Augen verdreht, als die Tür aufgegangen war.
„Ah, welch Anblick!“, rief Amenhoteps Vater mit gespieltem Erstaunen. „So viele schöne Wesen auf einen Streich. Meine Goldstücke! Meine Rosenknospen! Meine kleinen Göttinnen!“ Unverhohlen genoss er die Zuneigung, die ihm aus leuchtenden Mädchenaugen entgegenstrahlte. Dann ging er schnurstracks auf den Mürrischen zu. „Und dir knurrt sicher schon der Magen, Thutmosis. Ist es nicht so?“
„Ja“, kam beleidigt die Antwort. „In diesem Weiberhaufen wird auf die Wünsche und Bedürfnisse eines Kriegers ja kaum Rücksicht genommen.“
„Kaum“, bestätigte der Vater und grinste breit. „Da kann ich dir nur beipflichten.“
„Papperlapapp!“ Amenhoteps Mutter ging auf die Jüngste unter den Mädchen zu. Die Kleine konnte gerade erst gehen und fing ausgerechnet jetzt, wo das Geschnatter ihrer Geschwister aufgehört hatte, lauthals an zu schreien. „So ist sie nun mal, unsere Nebet-tah“, sagte Amenhoteps Mutter und alle lachten.
„Nebet-tah bedeutet Herrin des Palastes“, klärte Amenhotep Ani auf. „Sie hält uns alle wahrlich auf Trab.“
„Amenhotep!“ Ani nahm die Gelegenheit wahr, um seinen Freund endlich fragen zu können. „Dein Vater“, flüsterte er, „der ist doch nicht wirklich Gärtner, nicht wahr?“
„Was redest du da?“ Dieses Mal war es Amenhotep, der nicht wusste, wovon überhaupt die Rede war. „Wieso Gärtner? Er denkt sich so einen Garten oder solche Malereien doch nur aus. Machen dürfen es dann andere, die auch was davon verstehen. Es sind wahre Künstler, Meister ihres Fachs, die…“
„Aber was ist dein Vater dann eigentlich?“
Amenhotep staunte. „Du hast es noch immer nicht kapiert? Na, da scheint mir also doch was dran zu sein, dass die Bauern allesamt ein wenig schwer von Begriff sind.“
Ani meinte, den Boden unter sich zu verlieren. Nur Amenhoteps Geistesgegenwart war es zu verdanken, dass er kein Aufsehen verursachte. Denn schnell hatte der ihn auf eines der Polster gesetzt und ihm einen Becher mit Wasser gereicht. Ani konnte den Becher kaum an den Mund setzen, so sehr zitterte seine Hand.
„Was ist denn mit dem los?“, fragte das Älteste der Mädchen, die schon fast zur Frau geworden war. „Und wer ist das überhaupt?“
Als habe er sie überhaupt nicht wahrgenommen, sagte Amenhotep zu Ani: „Das ist Sit-amun, meine älteste Schwester. Sie ist ständig schlecht gelaunt und dabei auch noch wahnsinnig neugierig.“
„Blödmann!“, konterte die so unvorteilhaft Vorgestellte beleidigt und schon war sie aufgestanden und gegangen.
„Sag mal Ani, hast du wirklich nichts geahnt?“ Amenhotep begriff jetzt erst, dass sein Freund tatsächlich völlig unvorbereitet in diese Gegenüberstellung mit einer ihm vollkommen fremden Welt geraten war.
„Man wird mich pfählen“, stammelte Ani verzweifelt, „man wird mich vierteilen, mich den Krokodilen zum Fraß vorwerfen…“
„Na, wenn schon, dann den Hyänen. Das ist passender“, versuchte Amenhotep die Situation mit einem wenig gelungenen Witz aufzulockern.
„Ach, Amenhotep“, raunte Ani, „ich hab dem Guten Gott in die Augen geschaut! Man wird mich töten dafür. Bring mich wieder fort von hier. Ich gehöre nicht hierher. Ich bin der Sohn eines Bauern. Ich habe noch nicht einmal jemals mit unserem Ortsvorsteher gesprochen. Wie kann ich dann… hier… mit…“ Ani sah sich hilflos um. „Ich meine… Ich traue mich noch nicht einmal, es auszusprechen …“
„Ach was!“, wiegelte Amenhotep ab. „Da wirst du dich ganz schnell dran gewöhnen, glaub mir.“
„Und was ist, wenn dein Vater, der Gute Gott, er möge leben eine Million Mal eine Million Jahre, mich anspricht?“
„Wozu sollte er? Du bist doch nur mein Leibdiener.“
„Oder die Gute Göttin“, Ani wurde wieder schwindelig, „sie möge leben eine Million Mal…“
„Hör auf mit dem Geschwafel!“, unterbrach ihn Amenhotep. „Wenn wir unter uns sind, unterlassen wir diese Floskeln. Draußen ist es natürlich etwas anderes. Da liegen alle vor meinem Vater im Staub.“ Und mit gedämpfter Stimme fuhr er fort. „Meine Mutter ist übrigens nicht die Gute Göttin. Diesen Titel gibt es nicht. Was sie allerdings außerordentlich ärgert.“ Amenhotep kicherte. „Sie ist die Große Königliche Gemahlin und Mutter des Thronfolgers Thutmosis. Ich weiß gar nicht, was sie will: Mehr geht doch nun wirklich nicht.“
Als hätte sie gespürt, dass über sie geredet wurde, stand Amenhoteps Mutter plötzlich vor ihnen, die zufrieden an ihrer Brust nuckelnde Nebet-tah auf dem Arm. „Das arme Jungchen ist fahl wie Natronsalz“, sagte sie zu ihrem Sohn. „Achte mal ein bisschen besser auf ihn. Er hatte heute einen schlimmen Tag, der Arme. Schau, dass er was zu essen bekommt.“
Wie Traumgesichte schossen die Bilder durch Anis Kopf. Die eingewickelte tote Mutter, auf deren Körper er die Erde gehäuft hatte. Seine Schwester, die ihr neues Leben kaum gekostet hatte und von der er noch nicht einmal wusste, wie sie überhaupt aussah. Der totgeschlagene Vater, dessen Körper man den Krokodilen vorgeworfen hatte und der jetzt im Einbalsamierungshaus lag …