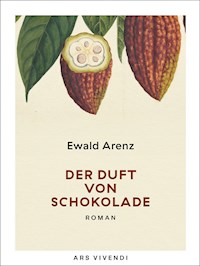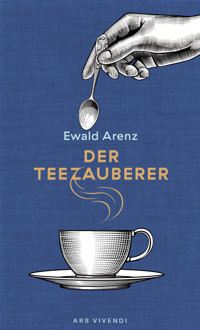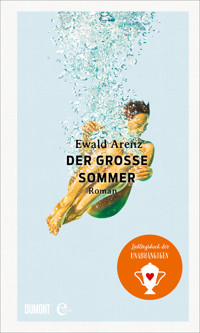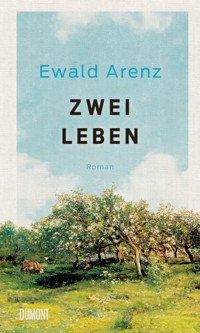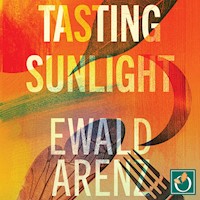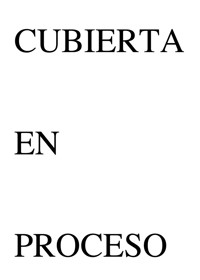Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestattungsunternehmer Friedrich Ehrlich hat einen ungewöhnlichen Beruf, aber auch vier ungewöhnliche Kinder. Diese bunt gemischte Familie lässt sich auch vor Krisen wie dem Wiederauftauchen einer 25 Jahre alten Wachsleiche und der Erpressung durch einen Ex-Terroristen nicht erschüttern. Wie der Bestatter seine mittlerweile erwachsenen Söhne und Töchter nach Hause holt, um mit einer sehr unorthodoxen Bestattung auch seine RAF-Vergangenheit zu begraben und wie sich das komplizierte Liebesleben des Ich-Erzählers, Samuel Ehrlich, entwickelt, davon berichtet dieser Familienroman mit viel Geist, Herz und gnadenlosem schwarzen Humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
EWALD ARENZ
EHRLICH & SÖHNE
Bestattungen aller Art
Roman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage 2009)
© 2009 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Hanna Stegbauer
Umschlaggestaltung: Armin Stingl unter Verwendung einer Fotografie von Susanne Casper-Zielonka
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-327-0
1
Es war der ideale Tag für eine Beerdigung. Der Himmel wirkte herbstlich und tief. Nieselregen kam in Schwaden, die Bäume trieften. Trostloser konnte die Stimmung kaum sein. Johannes stand auf der anderen Seite des Sarges, der auf den Brettern über dem offenen Grab ruhte, und vermied es, mich anzusehen, aber es entging mir nicht, dass er sich in den Zeigefinger biss. Um seine Mundwinkel zuckte es trotzdem. Ich konnte nicht anders – ich suchte seinen Blick, aber er sah konsequent weg. Ich spürte, wie das Lachen wieder in mir hochstieg. Die Trauergemeinde war jetzt auch bis zum Grab herangekommen, der Pfarrer suchte sich einen schwankenden Platz auf den Brettern, die über die Grube gelegt waren, und begann zu sprechen. Eine Bö ließ die Ewigen Lichter auf den Nachbargräbern flackern und klebte ihm den Talar an die Beine. Das half auch nicht. Ich blickte schnell zu den Wolken hoch, aber sogar die sahen komisch aus. Ich versuchte, nicht darüber nachzudenken, damit ich nicht lachen musste.
Johannes hatte damit angefangen. In der Aussegnungskapelle. Bevor wir den Sarg zuschrauben konnten, war der Pfarrer in die Halle gekommen und hatte überall und sehr nervös nach etwas gesucht. Johannes und ich sahen uns an. Wir kannten ihn nicht, aber das hatte nicht viel zu bedeuten – wir waren ja auch Jahre nicht mehr hier gewesen. Er sah jung aus, vielleicht war er sogar noch Vikar. »Können wir helfen?«, fragte ich höflich. »Nein, nein«, winkte er leicht abwesend ab, »nur die Predigt. Ich weiß, ich hab’ sie irgendwo hier gelassen.« Er ging in der Sakristei suchen, er kam wieder in die Halle, er sah auf und unter den Stühlen nach, und schließlich, als Johannes und ich eben den Deckel anhoben, machte er eine fahrige Handbewegung, ging mit ein paar schnellen Schritten zum Sarg und hob zerstreut das Kissen an einer Ecke etwas an, als ob sich seine Predigt dort versteckt haben könnte. Im Sarg. Unter dem Kissen. Unter dem Kopf des Toten. »Nee«, murmelte er dann halb zu sich, halb zu uns, »da auch nicht.« Schließlich eilte er aus der Kapelle, und ich sah ihm verblüfft nach. In all den Jahren hatte ich so etwas noch nie erlebt. Ich sah zu Johannes hinüber; er hob auch nur die Schultern. Aber dann grinste er, zischte »Pst!« und machte eine kleine Kopfbewegung zum Sarg hin. Zuerst dachte ich, Johannes hätte die Predigt vielleicht versteckt, aber dann sah ich, was er meinte. Während ich nämlich dem Pfarrer nachgesehen hatte, hatte Johannes dem Toten eine Augenbraue nach oben gezogen. Der verstorbene Richter Bader machte auf einmal ein Gesicht, als sähe er dem zerstreuten Pfarrer leicht tadelnd hinterher.
»Nicht lustig!«, sagte ich halb betroffen und musste dann doch grinsen.
»Doch!«, sagte Johannes vergnügt, aber weil in diesem Augenblick die Tür aufging und der Organist hereinkam, konnten wir das nicht vertiefen.
Dann begann der Gottesdienst, und als sich unsere Blicke wieder trafen, als der Pfarrer das zweite Mal von »der lieben Verstorbenen« sprach, zog ich sehr langsam die Augenbraue hoch, und Johannes musste sofort wegsehen, aber sein Rücken hörte lange nicht auf zu vibrieren.
Und nun standen wir am Grab und bemühten uns, einander nicht anzusehen, aber es hatte keinen Sinn. Der Sarg war sehr schön und sehr schlicht. Er stand schwarz und nass glänzend zwischen uns. Die Blumen leuchteten in der Regenluft, und die Bänder hatte der Regen glatt auf den Lack geklebt. »Aus der Ferne in Liebe. Herbert und Eva.« – »Schlaf wohl. Deine Kollegen.« Und dann gab es ein Band, auf dem wohl »In unvergesslicher Liebe« stehen sollte, aber zwei unglückliche Falten machten den letzten Gruß zu »unerlicher Liebe.« Ich konnte aus den Augenwinkeln sehen, wie Johannes die Augenbraue wieder hob, und ich deutete unauffällig auf das Trauerband, biss mir auf die Lippen, so fest ich konnte, spürte jedoch, wie das Lachen glucksend hochstieg, und kämpfte dagegen an. Als ich aber hörte, wie Johannes leise prustende Geräusche machte, hielt ich es auch nicht mehr aus. Mit einem Hustenanfall, der niemanden täuschte, rannte ich zu einer Birke ein paar Meter weiter. Johannes tat, als müsse er mir helfen, und kam mir nach. Wir lehnten uns an den Stamm und lachten, wie es nur unter Brüdern möglich ist, versuchten, das Lachen zu unterdrücken, um nicht aufzufallen, und lachten doch hilflos immer weiter.
»Du gefühlloses Monster«, flüsterte Johannes atemlos, »du gottloses Schwein!«
Ich holte auch tief Luft. »Wir müssen den Sarg runterlassen«, keuchte ich, noch immer lachend, »hör auf jetzt! Hör auf!«
Der Pfarrer war fast am Ende seiner Ansprache und sah besorgt in unsere Richtung. »Denn von der Erde bist du genommen«, sagte er unsicher, »und zu Erde sollst du wieder werden.«
Johannes und ich kamen hinter dem Baum hervor. Wir gaben uns wirklich Mühe, aber ich glaube, jeder konnte sehen, dass hinter diesem Baum nicht getrauert worden war. Ich hustete noch ein- oder zweimal, aber wahrscheinlich konnte ich niemanden überzeugen. Es gab jetzt mehr als eine hochgezogene Augenbraue, als wir uns zu beiden Seiten des Sarges aufstellten und die Gurte ergriffen.
»Jetzt!«, murmelte Johannes, ohne mich anzusehen, und wir hoben an. Der Friedhofsgärtner zog die Bretter weg. Wir ließen den Sarg hinunter. Ich hatte die Schleife mit der unerlichen Liebe noch glatt ziehen wollen, um meine Pietätlosigkeit wiedergutzumachen, aber jetzt sank sie mit ins Grab, wie sie eben lag. Ich konnte Johannes noch immer nicht ansehen. Er ließ die Tragschlaufen von den Schultern gleiten, und ich zog die Seile auf meiner Seite nach oben. Dann, endlich, konnten wir zurücktreten. Ein Trauergast nach dem anderen kam nach vorne, schob sein Schäufelchen in den Erdhaufen neben dem Grab und warf etwas davon auf den Sarg.
»Lass uns gehen«, flüsterte ich Johannes zu, »die laden uns sowieso nicht zum Leichenschmaus ein. Niemals.«
»Undank ist der Welten Lohn«, sagte Johannes nicht eben leise, und wir wandten uns zum Gehen.
Der Regen hatte aufgehört, aber der Wind wehte stetig durch den Friedhof, und überall tropfte es von den Bäumen. Die Kuppel des Krematoriums schimmerte kupfergrün zwischen den Kastanien durch, unter denen überall die braun glänzenden Früchte lagen. Der Herbst hatte eben erst begonnen, und es war ein wunderbarer Tag, als ich mit meinem Bruder den langen Weg vom Südende des Friedhofs bis zur Aussegnungshalle ging, wo unser Leichenwagen stand. Für mich ist es immer dieser Tag gewesen, an dem die Geschichte angefangen hat.
Ich fuhr. Schon als Kind hatte ich mir immer gewünscht, den Wagen fahren zu dürfen. Obwohl es natürlich hin und wieder neue Wagen gegeben hatte, hatten sie doch alle gleich ausgesehen: Lang und hoch, damit auch große Särge bequem hineinpassten, schwarz glänzender Lack und dunkle Scheiben – ich hatte nie gefunden, dass sie traurig aussahen. Ernst und vornehm, aber nicht traurig. Ich mochte den silbernen Olivenzweig, der unaufdringlich aus den verchromten Handgriffen der hinteren Türen hervorging. Sonst gab es keinen Schmuck und auch keinen Namen – mein Vater war immer der Ansicht gewesen, dass sein Name auf den Leichenwagen nichts zu suchen hatte. Der Wagen gehört den Toten, hatte er irgendwann einmal gesagt, wer ihn fährt, will keiner wissen.
»Wie lange hast du Urlaub?«, fragte ich Johannes.
»Bis Mittwoch«, sagte er, »aber ich muss am Dienstag schon zurück sein. Wäre gut, wenn wir morgen schon fahren könnten.«
»Ich habe die ganze Woche«, sagte ich, »wir fahren ja sowieso mit zwei Autos, dann kann ich noch zwei Tage in Berlin bleiben und mich um Großmutters Wohnung kümmern und so.«
»Um Großmutters Wohnung kümmern«, wiederholte Johannes ernst, »klar. Und mit osteuropäischen Straßenbahnschaffnerinnen in den Friedrichshain ziehen. Womöglich mit zweien gleichzeitig. Ich kenne deine dunklen Neigungen. Alle.«
»Mein lieber Bruder«, sagte ich ebenso ernst, »nicht jeder hat ein so unverkrampftes Verhältnis zu mehrdimensionalen Beziehungen wie du. Euch Ärzten ist ja nichts Menschliches heilig.«
»Ich bin kein Arzt«, sagte Johannes heiter, »ich bin Pathologe. Das ist was völlig anderes. Es ist der beste Beruf von allen. Ich stehe unter keinerlei Erfolgsdruck. Ich muss nichts reparieren. Ich bin so was wie ein Mechaniker, der auseinandernehmen darf, ohne wieder zusammensetzen zu müssen.«
»Ja, klar«, sagte ich, »das macht dann Papa. Mit sehr viel Schminke. Ihr Pathologen seid Metzger! Wenn die Angehörigen die Leichen so zu sehen bekämen, wie ihr sie liefert …«
»Ich muss bloß herausfinden, warum jemand gestorben ist. Und da ich so lange an den Toten herumfummeln kann, wie ich will, klappt das auch meistens. Würdest du bitte anhalten«, sagte Johannes in unverändertem Ton, »die Ampel ist rot.«
Ich trat auf die Bremse.
»Spießer«, murmelte ich. »Wenn du dich anschnallen würdest, hättest du keine Angst vor roten Ampeln.«
»Samuel«, sagte Johannes streng, »nenn mich nicht Spießer. Ich bin der Einzige, der die Familientradition weiterführt. Das ist nicht spießig. Das ist wertekonservativ.«
Die Ampel sprang wieder auf grün. Ich gab Gas. Johannes wurde in den Sitz gedrückt. Ich sagte lächelnd: »Es hat in dieser Familie noch nie einen Teilzeitpathologen gegeben, der den größten Teil seines Geldes mit Saxophonspielen in einer Bigband verdient. Das ist nicht wertekonservativ. Jazz ist wirklich bloß spießig.«
»Neid«, sagte Johannes lässig, »aus dir spricht der blanke Neid, weil du nur mit Toten spielen darfst, wenn du übers Wochenende bei den Eltern bist. Du hättest was Ordentliches lernen sollen.«
»Zu spät«, seufzte ich, »zu spät, zu spät.«
Wir bogen in den Hof unseres Elternhauses ein. »Friedrich Ehrlich« stand in strengen, kühlen Buchstaben über dem Tor, »Bestattungen aller Art«.
Wir waren zu Hause.
2
Im Jahr 1965 fuhr Friedrich Ehrlich mit einem hellblauen Volkswagen, 34 PS, auf der neu gebauten Autobahn von Würzburg nach Kassel. Seine Frau saß neben ihm, als sie auf der Höhe der hessischen Mittelgebirge die Ausfahrt zum Gramschatzer Wald nahmen. Auf dem Rücksitz saß ein Irischer Setter. Der Setter gehörte Gesine Ehrlich, und dieser Setter stellte die einzige Mitgift dar, die sie in die Ehe hatte einbringen können. Friedrich Ehrlich dagegen hatte den Volkswagen mitgebracht, der aus der Autowerkstatt eines seiner Brüder stammte. Er war das Hochzeitsgeschenk seiner acht Geschwister gewesen. Genauer gesagt: Die Reparatur dieses total zerknüllten Volkswagens, den man in der Nähe von Würzburg aus einem Landstraßengraben gezogen hatte, war das Hochzeitsgeschenk gewesen. Der hellblaue Volkswagen war das einzige farbige Auto, das Friedrich Ehrlich je fahren würde, aber das wusste er noch nicht, als er an jenem Tag durch hessische Dörfer immer höher in den Gramschatzer Wald kurvte, bis seine Frau plötzlich »Halt!« rief und »Links!«, woraufhin Friedrich versuchte, nach links abzubiegen, aber dann kurz vor dem Abzugsgraben ruckartig auf die Bremse stieg. Der Irische Setter saß jetzt plötzlich auch vorne und wirkte verblüfft.
»Gesine«, sagte Friedrich ruhig, »wohin links? Hier ist ein Acker.«
»Ach, du weißt genau, dass ich ›rechts‹ meine, wenn ich ›links‹ sage«, sagte Gesine fröhlich und tätschelte den Setter. »Rechts. Da – der Feldweg! Jetzt kennst du mich schon so lange – und wieso fährst du nach links, wenn da nur Acker ist?«
»Sechzehn Monate«, sagte Friedrich düster und legte den Rückwärtsgang ein, wobei ihm der Setter im Weg war, »und davon sind wir anderthalb verheiratet. Sag in Zukunft bitte ›rechts‹, wenn du ›rechts‹ meinst. Bei der Trauung hast du übrigens ›ja‹ gesagt. Hast du da auch ›nein‹ gemeint?«
Gesine lachte und schob den Setter wieder nach hinten. »Fahr schon.«
Der Feldweg war von Holunderbüschen und Birken überwachsen. Die herbstlich schräge Nachmittagssonne drang kaum durch die Hecken. Als das Gebüsch lichter wurde, konnte man sehen, dass rechts vom Weg ein Steinbruch steil ins Tal abfiel. Der Weg war voller Schlaglöcher, und Friedrich fuhr vorsichtig, während Gesine aufgeregt auf dem Sitz hin und her rutschte. »Gleich muss es kommen«, sagte sie, »er hat gesagt, direkt nach den Ulmen. Die sind hier.«
Friedrich fuhr unter einer sehr kurzen Ulmenallee entlang und kam auf dem grasüberwachsenen Pflaster eines Aussiedlerhofes zum Stehen. Friedrich sah sich um, stellte den Motor ab, stieg aus, sah sich den Hof noch einmal an und sagte dann zu Gesine: »Man kann nicht genau sagen, ob dein Bruder im Haus oder in der Scheune wohnt. Ist dir aufgefallen, dass beide kein Dach haben?«
Der Hof sah aus wie ein Bild von Caspar David Friedrich. Sehr romantisch. Sehr kaputt. Das Bauernhaus war ein wunderbares Fachwerkhaus und hätte noch sehr viel eindrucksvoller gewirkt, wenn nicht die Fenster und das Dach gefehlt hätten. Es gab einen Brunnen, an dessen Kette ein Melkeimer baumelte. Es gab ein Gebäude, das wahrscheinlich früher mal eine Scheune gewesen war, vielleicht aber auch eine römische Grenzanlage. Der Zustand der Grundmauern ließ keine genauere Deutung zu. Und dann gab es noch einen heruntergekommenen Volvo, der mitten im Hof stand und auf dessen Dach ein Geigenkasten sowie eine Mörtelwanne voller Ziegel geschnallt waren. Gesine hatte sich auch umgesehen.
»Es war ganz billig«, sagte sie, als ob sie sich für ihren Bruder entschuldigen müsste, »Klaus hat gesagt, er hat nur zehntausend Mark bezahlt.«
Friedrich sah dem Setter zu, der fröhlich durch Hof und Garten tobte.
»Hoffentlich waren es Reichsmark«, sagte er trocken.
»Grüß Gott!«, kam es fröhlich vom Haus. Das »r« wurde bairisch gerollt, was sich ein wenig affektiert anhörte. Klaus stand vor der Tür auf der kleinen, vollständig mit Efeu überwachsenen Freitreppe. Sein Bart war seit der Hochzeit noch länger geworden, und Friedrich fand, dass sein Schwager genau so aussah, wie man sich einen Revolutionär vorstellte: Schlank und groß, im Rollkragenpullover, mit langen Haaren und langem Bart. Den jungen Dozenten für Psychologie jedenfalls hätte man nicht vermutet. Aber es war ja alles im Aufbau und im Umbruch. Wenn die Kasseler Hochschule nicht so dringend junge Professoren gebraucht hätte, dachte Friedrich, dann wäre Klaus wohl noch immer außerordentlicher Professor. Friedrich war sich noch nicht schlüssig, was er von ihm halten sollte. Ihm war nicht klar, dass er auf seine Weise ebenso revolutionär war wie Klaus. Friedrich fand sich selbst völlig normal und durchschnittlich und war sich niemals richtig bewusst geworden, wie ungewöhnlich er in Wirklichkeit war.
»Wo werden wir schlafen?«, fragte Friedrich, als sie in der Küche saßen, in der es immerhin einen Herd gab. Strom dagegen gab es nicht. Von der Decke hing eine Petroleumlampe, aber das machte nichts, weil das Küchenfenster sowieso ausgebaut war.
»Ach, das wird sich finden«, sagte Klaus fröhlich und streichelte Gesines Hund.
Es fand sich in der Tat. Sie schliefen im Kaminzimmer. Es war ruhiges Herbstwetter, deshalb regnete es in den zwei Nächten nicht, und sie konnten durch die Ritzen in der Decke in den offenen Dachboden und weiter in den Himmel sehen. Es war in mancher Hinsicht sehr romantisch.
»Dein Bruder«, sagte Friedrich nachdenklich, als sie nach einem langen Abend voller hitziger Diskussionen in ihren Schlafsäcken auf alten Matratzen lagen, »ist vielleicht ein kluger Mann. Aber er glaubt, er sei das Zentrum der Welt. Und er will die Welt so umbauen, dass sie ihm passt. Wen hat er bestochen, um mit achtundzwanzig auf einen Lehrstuhl berufen zu werden?«
Gesine drehte sich nicht zu ihrem Mann um, sondern betrachtete die schmalen, hellen Streifen, die der Mond durch die Ritzen in der Decke auf die lehmverputzten Wände warf.
»Wir sind Flüchtlingskinder«, sagte sie, »wir hatten nichts anderes als uns. Wir mussten fleißig sein. Ehrgeizig. Besser als die anderen. Und irgendwie war die Welt oft ungerecht gegen ihn. Vielleicht kommt das davon. Er war immer krank und viel schwächer als die anderen. Ich musste ihn dauernd beschützen, als er klein war. In Flensburg habe ich mich für ihn schlagen müssen. Und Mutti hat in München gearbeitet. Wir haben sie zweimal im Jahr gesehen.«
»Er kann sich jetzt selber ganz gut schlagen«, sagte Friedrich. »Deinem Bruder ist nichts heilig. Er ist ein gefährlicher Mann.«
Gesine lachte leise.
»Was?«, fragte Friedrich.
»Das hat Klaus von dir auch gesagt«, sagte sie.
»Dass mir nichts heilig ist?«, fragte Friedrich mit gespielter Entrüstung. »Ich komme aus einer Familie der Herrnhuter Bruderschaft – mein Vater hat manchmal sogar gepredigt. Wir sind eine durch und durch christliche Familie.«
»Ja«, sagte Gesine, »aber er hat das Gewehr im Auto gesehen.«
Friedrich holte tief Luft.
»Ich habe dir das schon erklärt. Ich weiß noch nicht, ob ich es kaufen will. Und in der Stadt kann ich es nicht ausprobieren. Du hast gesagt, dein Bruder lebt jetzt mitten in der Wildnis, und da habe ich mir gedacht, dass man es da ja mal … na ja, da hört einen keiner.«
Gesine schwieg eine kleine Weile. Von draußen hörte man die Grillen, die Nächte waren noch warm genug. Vom fernen Waldrand rief ein Käuzchen, aber sonst war es still – ganz anders als in der Stadt.
»Waffen gefallen dir, hm?«, fragte sie schließlich.
»Ich komme aus einer Familie der Herrnhuter Bruderschaft«, wiederholte Friedrich, aber diesmal hörte es sich ein klein wenig spöttisch an, »ich bin sehr christlich erzogen worden. Tu dies nicht. Tu das nicht. Ich habe mich fast nie geprügelt, ich habe nicht mit Holzschwertern und nicht Räuber und Gendarm gespielt, jedenfalls nicht zu Hause. Und dann … der Müller ist schließlich auch Jäger und im Schützenverein. Er hat mich einfach mitgenommen. Mir gefällt das Schießen. Wusstest du, dass für die japanischen Mönche Bogenschießen ein Weg zum Ich ist? Eine Philosophie?«
»Im Auto liegt aber kein Bogen«, sagte Gesine.
»Ach was«, sagte Friedrich vergnügt. »Schießen ist eine Philosophie. Ob Gewehr oder Bogen, das ist alles eins.«
Sie schwiegen, und Gesine wurde allmählich schläfrig. Aber noch bevor sie einschlief, in dem Augenblick, in dem die Gedanken von der Leine gelassen werden und im Kopf herumstreunen, bevor sie sich alle leise davonstehlen und man über die weiche Kante des Wachseins in den Schlaf gleitet, in diesem Augenblick hatte sie ein warmes Gefühl von Liebe zu diesem eigenartigen Mann neben ihr, der Gewalt ablehnte und ein Gewehr im Auto spazieren fuhr, der Philosophie studierte und wie Buddha tagelang hungerte, der um Erkenntnis rang und im nächsten Augenblick mit ernster Miene ungeheuer komisch sein konnte. Und der leider manchmal schnarchte, wie sie eben merkte. Sie stieß ihn an, er rollte sich zur Seite und sie kuschelte sich an ihn. Dann schlief sie auch ein. Durch das Haus ohne Dach strich der Nachtwind, und in der Ruine der Scheune saß Klaus, der Revolutionär, und spielte Geige.
3
Johannes und ich saßen beim Frühstück. Es war ein seltsames Gefühl gewesen, in meinem alten Zimmer zu übernachten. Das Bett war dasselbe geblieben, und auch wenn das Zimmer jetzt mit allen möglichen Kisten vollgestellt war, der Blick auf die großen Bäume in unserem weitläufigen Garten hatte sich nicht verändert. Als Junge war ich in diesen lauen Nächten, wenn der Spätsommer allmählich in den Herbst überging, oft lange wach gelegen, hatte heimlich geraucht und sehr leise Radio gehört; all die Musik, die tagsüber nicht gespielt wurde. Ich hatte mir aus dem Rauschen der nächtlichen Stadt und der Musik und den Düften aus dem Garten meine Träume von Mädchen in fremden Städten gewebt. Damals war alles noch offen gewesen, alle Sehnsüchte noch unerfüllt, aber alles noch möglich. Das, dachte ich jetzt über dem Tisch, an dem ich so oft gesessen hatte, war kein schöner Gedanke mehr, wenn man auf die vierzig zuging.
Dorothee kam ins Esszimmer und sah uns. Sie hatte wohl Nachtdienst gehabt, denn sie war noch in Weiß und roch nach Desinfektionsalkohol.
»Ach nee«, sagte sie, »schon auf?«
»Wir müssen ja bald los«, sagte Johannes. »Willst du Kaffee?« Er schenkte ihr ein.
»Hoffentlich hast du heute Nacht keine Sterbehilfe geleistet, Do«, sagte ich.
Dorothee war unsere Spötteleien gewöhnt und zuckte nicht mit der Wimper, als sie erwiderte: »Wieso? Hat Papa keine Särge mehr?«
»Nee«, sagte ich, »aber Johannes und ich brauchen beide Autos in Berlin. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem zwanzig Mal fahren.«
»Ach was«, sagte Johannes, »Großmutters Wohnung ist doch nicht groß.«
»Aber voll«, sagte Dorothee, »und wahrscheinlich will sie sich von nichts trennen. Alle alten Leute sind so.«
Dorothee arbeitete auf der urologischen Station des städtischen Krankenhauses. Von meinen beiden Schwestern war sie die warmherzigere – und die pragmatischere. Sie machte sich überhaupt keine Illusionen über das Alter. Sie hatte auf der Station fast nur mit alten Menschen zu tun, mit dementen, bösartigen, altersschizophrenen, apathischen Alten. Und während ich meine Großeltern immer in einem milden Glorienschein sah – vielleicht, weil ich von uns vier Geschwistern der Älteste war und sie noch mitten im Beruf, mitten im Leben erlebt hatte –, hatte Dorothee einen scharfen und unerbittlichen Blick für die vielen kleinen Anzeichen des Verfalls. Aber trotzdem wohnte sie immer noch zu Hause bei unseren Eltern.
»Ich wundere mich sowieso, wie Papa sie dazu gekriegt hat, ins Heim zu gehen«, sagte sie und nahm sich ein Brötchen. »Sie ist genauso stur wie ihr Schwiegersohn.«
»Wird hier von mir gesprochen?«
Papa war ins Esszimmer gekommen. Eigentlich war es ungewöhnlich, dass er um diese Zeit schon auf war. Er liebte es, nächtelang zu lesen und erst am frühen Morgen ins Bett zu gehen, was bedeutete, dass er normalerweise auch erst am späteren Vormittag aufstand. Er war zwar schon angezogen, trug aber über Hemd und Hose seinen geliebten, völlig abgeschabten Morgenmantel. Niemand, der ihn je in einem seiner tadellos sitzenden schwarzen Anzüge gesehen hatte, hätte glauben wollen, dass es sich um denselben Menschen handelte, wenn er dieses Ding anhatte. Meine Mutter hasste es. Der Morgenrock war mindestens fünfunddreißig Jahre alt, und das wusste ich, weil ich ihn seit meiner Kindheit kannte. Im Gegensatz zu den zeitlos eleganten schwarzen Anzügen, die er in seinem Beruf trug, war dieser Morgenrock ein verblasster Musterkatalog aller Farbverfehlungen aus den späten sechziger Jahren. Aber wahrscheinlich hatte das mein Vater nie bemerkt. Er mochte es einfach nur, den Vormittag, wann immer er konnte, im Morgenmantel zu verbringen.
»Wieso bist du schon wach?«, fragte Johannes und fügte boshaft hinzu: »Senile Bettflucht?«
Dorothee lächelte. Unser Vater setzte sich an den Tisch, sah misstrauisch auf seinen Teller und deklamierte dann: »Es frieret selbst im wärmsten Rock der Säufer und der Hurenbock. In meinem Zimmer ist es kalt.«
»Papa!«, sagte Dorothee tadelnd. Ich musste lachen.
»Hättest du etwas Ordentliches gelernt«, sagte ich zu ihm, »dann hättest du jetzt genügend Geld, um dein Zimmer zu heizen.«
Papa goss sich Kaffee ein. Randvoll, wie immer. Dann gab er Milch dazu, bis die Tasse überlief, was er völlig ungerührt betrachtete. Danach schaufelte er drei Löffel Zucker hinein.
»Papa«, sagte Dorothee warnend, »irgendwann kriegst du Altersdiabetes.«
Papa rührte heftig, bis die Tasse nur noch zu drei Vierteln voll war. Bei ihm hatten Untertassen wirklich einen Sinn. Dann hob er die Hand und sah mich an. »Aufgemerkt!«, sagte er. Ganz offensichtlich war er gut gelaunt. Vielleicht genoss er es auch nur, dass er uns um sich hatte. Das kam nicht mehr so oft vor.
»Undankbare Brut!«, fuhr er dann freundlich fort. »Ich habe etwas Ordentliches gelernt. Ich bin Doktor der Philosophie. Ein unfreundliches Geschick sowie die unziemliche Hast, mit der eure Mutter die Erzeugung von Nachkommen aufgenommen hat, führten dazu, dass ich den mir bestimmten Beruf aufgeben musste.«
»Was hätte das sein sollen?«, fragte Johannes amüsiert. »Ethikberater bei Smith & Wesson?«
»Schweig stille!«, sagte Papa und schlürfte einen Schluck Kaffee. »Anders als meine pflichtvergessenen Söhne war ich zur Stelle, als mein Vater starb, und habe das Familienunternehmen weitergeführt.«
Ich sah Johannes an. Dann sagte ich höflich: »Wir sind zur Stelle, Papa. Noch bis neun Uhr. Wenn du willst, kannst du jetzt sofort sterben. Wir übernehmen dann das Geschäft.«
Johannes und Dorothee lachten. Unser Vater blieb ernst. Er beherrschte das bis zur Vollendung.
»Ich kann aber keinem von euch«, sagte er bedächtig, »das Bestattungsunternehmen Ehrlich vermachen, weil ihr nicht einmal in der Lage seid, eine Bestattung ordentlich zu begleiten, ohne dem Pfarrer seine Predigt zu stehlen.«
»Hat er das gesagt?«, fragte Johannes in gespielter Entrüstung. »Hat er wirklich angerufen, diese miese Petze? Er hat sie einfach verlegt. Und wir haben dir überhaupt nur aus der Patsche geholfen. Wir kommen hier an, und das Erste, was wir tun müssen, ist bei einer Beerdigung aushelfen. Ich habe das seit zwanzig Jahren nicht mehr gemacht!«
»Und du wirst es auch nie wieder tun«, sagte Papa, »man hat sich über euch beschwert.«
»Mal wieder«, sagte Dorothee grinsend. Ich stieß sie an. Dorothee hatte kein Recht zu grinsen. Sie war früher mindestens so schlimm gewesen wie wir. Im Alter von zehn hatten andere Leute sie oft für einen Jungen gehalten, weil sie so wild war.
»Dass das auch nie aufhört«, murmelte Papa, »nie! Meine Söhne sind vierzig Jahre alt und immer noch pflichtvergessene Verbrecher. Wann kommt ihr zurück?«, fragte er dann übergangslos. »Ich brauche die Autos bald wieder. Meine Tochter Dorothee ist die Einzige, die mir hier zur Hand geht und dafür sorgt, dass das Geschäft nicht pleitegeht, indem sie ab und zu jemanden umbringt.«
»Morgen Abend oder übermorgen früh«, sagte Johannes, »es darf halt jetzt keiner sterben. Oder wir mieten doch einen Laster.«
»Laster mieten«, empörte sich Papa, »einen Laster mieten! Denkst du, ich bin Krösus, oder was? Da habe ich Gott sei Dank von Berufs wegen zwei riesige Autos, in die man sogar Doppelsärge stellen kann und die jeden Laster ersetzen. Auf der Sollseite dagegen habe ich viel zu viele Kinder. Und dann soll ich einen Laster mieten? Und«, sagte er nach einer kleinen bedeutungsschwangeren Pause, »was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass eure Mutter kaufsüchtig ist.« Er wies auf einen ziemlich großen Flachbildfernseher im Wohnzimmer, der mir auch schon aufgefallen war. »Jeden Monat entdecke ich ein neues elektronisches Gerät, von dem sie dann entweder behauptet, es sei schon immer da gewesen, oder aber, es sei ganz billig gewesen. Leider vergisst sie manchmal, die Preisetiketten abzuziehen. Auf jeden Fall kann ich mir keinen Laster leisten, solange sie sich Laster leistet. Faules Pack! Es ist bloß ein Umzug. Geht mir aus den Augen!«
Er machte eine dramatische Handbewegung, und dann nahm er die Zeitung vom Tisch und fing an zu lesen. Johannes und ich standen auf.
»Bis morgen«, sagte ich, »und schlaf schön, Do.«
»Bis morgen«, sagte Papa und streckte die Hand mit den beiden Autoschlüsseln aus, ohne hinzusehen. Brav nahm sich jeder von uns einen, dann gingen wir zur Garage.
Ein Bestattungsunternehmen ist ein eigenartiges Geschäft. Es stellt außer Illusionen nichts her. Und es ist ein wenig wie ein letztes Hotel. Es gibt einen Fahrdienst, es gibt eine ganze Menge kühler Betten, es gibt einen Beautysalon und sogar Garderoben. Ein Restaurant hingegen gibt es nicht. Tote brauchen viel Aufmerksamkeit, aber sie beschweren sich selten übers Essen. Vielleicht lag es daran, dass meine Mutter mit einem Bestattungsunternehmer verheiratet war – Kochen war jedenfalls keine ihrer Leidenschaften. Deshalb hatten wir Kinder alle schon früh kochen gelernt. Johannes und ich gingen an den Schränken vorbei, in denen die Leichenhemden aufbewahrt wurden. Totenhemden in allen Größen und Formen, aber alle nur in einer Farbe.
Johannes ging durch den Waschraum vor und öffnete die Doppeltür zur Garage. Die beiden Leichenwagen standen nebeneinander. Sie waren frisch gewaschen und sahen beeindruckend düster aus.
»Ich mag diese Autos«, sagte Johannes voll boshaften Vergnügens, »wirklich. Es geht nichts über einen Leichenwagen, wenn man Frauen kennenlernen will.«
»Oder wenn man sie nicht mehr braucht«, merkte ich sarkastisch an.
Johannes sah zu mir herüber. »Ach … Ärger mit Vera?«, fragte er. »Schon wieder?«
»Ich nehme den Benz«, sagte ich statt einer Antwort.
»Vergiss es«, sagte Johannes, schubste mich zur Seite und rannte um den Benz herum. Als er aus der Garage rollte, ließ er das Fenster herunter und lehnte sich weit aus dem Wagen.
»Wer zuerst in Berlin ist, ja?«
»Nein«, rief ich aus dem Volvo, in den ich eben eingestiegen war, »kein Rennen! Wir fahren kein Rennen!«
Aber Johannes war schon auf die Straße gerollt und wartete auf mich. Als ich mit dem Volvo herausgefahren war, ließ er den Motor aufheulen, und der Mercedes schoss vorwärts.
»Also gut«, grinste ich, »wie du willst, mein Herz!«
Ich drehte das Radio auf volle Lautstärke und trat auch aufs Gas. Es war fast wie früher.
4
Die Tage auf dem Herrenhof waren für Friedrich eine neue Erfahrung. Sein Schwager war eine höchst eigenartige Mischung aus Gelehrtem und Don Juan, aus Revolutionär und rückwärts gewandtem Romantiker, aus Weltferne und praktischer Begabung.
Klaus stand im offenen Dachstuhl seines Hauses und nagelte neue Dachlatten auf die Balken. Es war ein schöner Herbstmorgen, und ein leichter Wind wehte durch das ganze Haus. Gesine half ihrem Bruder und reichte eine Latte nach der anderen hoch, während Friedrich eben erst aufgestanden war und nun in der Küche saß. Die Küche war der einzige Raum, in dem man schon einigermaßen wohnen konnte. In Klaus’ Zimmer dagegen bestand die Decke nur aus den Tragbalken, man konnte direkt in den Dachstuhl sehen. Trotzdem stand dort schon ein riesiges, selbst gezimmertes Regal mit hunderten von Büchern. Friedrich hatte am Tag zuvor darin gestöbert. Neben kommunistischen Kampfschriften, regenbogenfarbigen pädagogischen Werken und einer Ausgabe des Kamasutra gab es unzählige wissenschaftliche Bücher, die Klaus offenbar auch gelesen hatte, wie Friedrich widerstrebend hatte zugeben müssen, als er ein paar Bände zur Hand genommen und überall Anstreichungen und Bleistiftnotizen gefunden hatte. Ein eigenartiger Mann. Friedrich wunderte sich, wie verschieden er und Gesine waren.
Im Herd war noch ein Rest Glut, und die halbvolle Kaffeekanne simmerte leise. Friedrich saß auf der Holzbank vor dem schweren Eichentisch, hatte das Fenster in den völlig verwilderten Garten geöffnet und hörte Klaus’ und Gesines Stimmen vom Dach. Es war sehr friedlich. Er trank seinen Kaffee, dachte nach, und dann blieb sein Blick an einem der Bilder hängen, die ihm schon am Abend aufgefallen waren. Erst hatte er gedacht, die Bilder seien ein Überbleibsel der ehemaligen Besitzer, die Klaus noch nicht entfernt hatte oder die er vielleicht mit ironischer Absicht hatte hängen lassen. Aber Klaus, so viel wusste Friedrich jetzt schon, war eher selten ironisch. Er verstand auch Witze nur schwer und meistens erst, nachdem man sie ihm erklärt hatte. Ironie war ihm weitgehend fremd. Das Bild zeigte Jesus und ein paar seiner Jünger in einer Landschaft, die der Maler wohl als das Heilige Land verstanden haben wollte. Eine pompöse Sonne ging eben über einigen Tempelruinen unter. In Ölzweigen nisteten übergewichtige Tauben. Jesus hatte einen sanften Schein um sein blondes Haupt. Die Jünger waren neben ihm zu Boden gesunken und hatten die Hände zu ihm erhoben. Die Unterschrift war auch nicht hilfreich. In Fraktur stand da: »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden.« Friedrich war in einer durch und durch protestantischen Familie aufgewachsen. Christliche Werte waren ihm nicht fremd. Aber Bilder wie diese hatte er bisher nur aus altbayerischem Bauerntheater gekannt. Bilder wie diese waren in seiner Welt bisher nicht vorgekommen, und Friedrich hatte sich nicht vorstellen können, dass Klaus sie so meinte, wie sie da hingen. Als er dann aber beim Mittagessen am Tag zuvor ein lateinisches Tischgebet gemurmelt hatte, war Friedrich allmählich klar geworden, dass Klaus’ Innenleben nicht ganz widerspruchsfrei war. Im Verlauf des Mittagessens war es nämlich zu einer Diskussion über Politik gekommen. Klaus hatte von einer Welt ohne Geld geschwärmt, hatte dem Kommunismus das Wort geredet und vom bewaffneten Kampf gegen die Kapitalistenschweine gesprochen.
»Deswegen baue ich das hier auf«, hatte er gesagt, »das wird eine herrschaftsfreie Kommune. Ich werde Ziegen haben, Hühner, Enten, und wir werden von dem leben, was wir hier anbauen.«
»Und von deinem Dozentengehalt an der Uni Kassel«, warf Gesine ein. »Oder hast du etwa gekündigt?«, fragte sie entsetzt nach. Klaus schüttelte den Kopf.
»Man muss diesen Staat von innen heraus zerstören«, sagte er voller Pathos, »man muss die Jugend von Anfang an herrschaftsfrei erziehen. Meine Seminare sind gewaltfrei.«
»Es gibt keine Erziehung ohne Herrschaft«, sagte Friedrich gelassen, »und wahrscheinlich ist auch kein Kommunismus möglich. Weil nämlich die eine Hälfte des Volkes dumm ist und die andere schlecht erzogen, aber beide wollen immer ein größeres Stück vom Kuchen, als ihnen bekommt.«
»Das«, sagte Klaus voller Energie, »ist der Fehler des Bürgertums. Immer und immer wieder fehlt das Vertrauen ins Volk! Immer und immer wieder reißen die Intellektuellen die Herrschaft an sich, weil sie glauben, sie wissen, was für das Volk gut ist. Diktatur. Unter dem Mantel der Demokratie.«
Die Diskussion nahm an Fahrt auf. Friedrich war ein präziser Denker. »Und was genau tust du hier?«, fragte er. »Eben das, oder? Das hier wird eine Kommune unter deiner Herrschaft, oder sehe ich das falsch?«
»Aber geistige Führung ist doch etwas total anderes als Unterdrückung!«, rief Klaus. »Das ist doch ein Vorangehen! Ich baue hier die erste Zelle des Widerstandes auf.«
»Widerstand wogegen?«, fragte Friedrich nach. »Gegen mich? Gegen den Kapitalismus? Gegen die Dummheit? – Da wäre ich dann dabei«, sagte er spöttisch.
Klaus blieb immer freundlich, auch wenn er sich erhitzte, aber völlig unbeirrbar. Argumente prallten von ihm ab.
»So«, sagte Gesine zu Friedrich, »war er schon immer.«
»Scheint eine Familientugend zu sein«, murmelte Friedrich.
»Was hast du gesagt?«, fragte Gesine nach, die genau verstanden hatte.
»Nichts«, sagte Friedrich und musste lachen.
Die Diskussionen wurden weitergeführt. Abends, nachdem Klaus den Dachstuhl auf der Hofseite tatsächlich fertig eingelattet hatte, hatte er im Hof aus den alten Dachlatten ein großes Feuer gemacht. Zwei weitere Autos waren im Laufe des Nachmittags auf das Grundstück gefahren. Eines hatte ein ausländisches Kennzeichen, das Friedrich nicht zuordnen konnte. Eine junge Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm stiegt aus. Sie trug ein langes Kleid und trotz des lauen Abends eine Pelzmütze auf dem Kopf.
»Lovisa«, stellte sie sich vor.
»Luisa?«, fragte Friedrich nach.
Lovisa lachte. »Nein«, sagte sie, »versuch es noch mal. Ein kurzes u und ein ganz weiches v.«
Friedrich versuchte es und wurde immer besser. »Wo kommen Sie her?«, fragte er.
Lovisa kam aus Schweden. Erst nach einer ganzen Weile merkte er, dass sie nur ihren einen Arm benutzen konnte. Der andere war verkürzt und schien gelähmt zu sein. Lovisa bemerkte seinen Blick: »Kinderlähmung«, sagte sie achselzuckend. Die eine Schulter hob sich nur wenig, und so sah die Geste ein wenig grotesk aus. »Zum Glück ist es der linke Arm.«
Aus dem anderen Auto war ein junger blonder Mann gestiegen, ein Lehrer aus dem Nachbarstädtchen, der Klaus offensichtlich ohne Einschränkung verehrte. Sein Haar war lang und lockig, eigentlich hieß er Otto, aber Klaus nannte ihn Otando. Friedrich war längst aufgefallen, dass Klaus dazu neigte, seinen Freunden andere Namen zu geben. Es klang einerseits wie eine Auszeichnung, andererseits war es eine Kennzeichnung, eine Besitznahme: Er gab den anderen neue Namen, also gehörten sie ihm. Otando hing an Klaus’ Lippen, egal was er sagte. Lovisa unterhielt sich zwar vor allem mit Friedrich und Gesine, saß aber den ganzen Abend eng an Klaus gedrückt auf den großen Steinen, die er um das Feuer angeordnet hatte. Ihr kleines Mädchen hatte lange auf dem Hof mit Gesines Hund herumgetollt, war aber schließlich auf Lovisas Schoß eingeschlafen.
Klaus holte seine Geige und fing an zu spielen. Eine Etüde.
»Weißt du, dass Friedrich auch Geige spielt?«, fragte Gesine ihren Bruder. Der setzte die Geige ab.
»Wollen wir zusammen spielen?«, fragte er.
»Oh ja«, sagte Lovisa, »das wäre schön.«
»Ich habe keine Geige dabei«, sagte Friedrich zurückhaltend.
Klaus war ins Haus gelaufen und kam mit einer zweiten Geige zurück. Friedrich nahm sie bedächtig unters Kinn und stimmte sie. Klaus begann eine Sonate. Friedrich setzte zögernd ein. Gesine saß zwischen Lovisa und Otando und hörte zu. Klaus spielte besser als Friedrich, aber was sie an Friedrich mochte, das war auch in seinem Geigenspiel – ein behutsam zärtliches Vibrato, das der Musik Wärme gab.
Lovisa, Gesine und Otando applaudierten. Funken stoben aus dem Feuer in die Luft, als ein feuchtes Scheit knackte. Von unten, aus dem Dorf, hörte man einen Hund bellen und Gesines Setter spitzte die Ohren.
»So kannte ich dich noch gar nicht«, sagte Klaus zu Friedrich.
»Kennenlernen dauert ein ganzes Leben«, sagte Friedrich.
»Bei Frauen nicht«, sagte Klaus leichthin, »Frauen kennt man, wenn man mit ihnen geschlafen hat.«
Gesine schwieg, aber ihr Mund wurde schmal. Das war etwas, das sie an ihrem Bruder nicht leiden konnte. Otando lächelte. Lovisa sagte auch nichts, sondern strich nur ihrer Tochter die Haare aus dem Gesicht. Man wusste nicht, was sie dachte.
»Das ist Quatsch«, sagte Friedrich schroff. Er wunderte sich, dass er so stark reagierte.
»Nein«, sagte Klaus, als ob er eine Lehrmeinung verkündete, »das ist so. Frauen kennt man erst, wenn man mit ihnen geschlafen hat, aber dann kennt man sie. Das ist immer so.«
Lovisa nahm ihr Kind hoch und sagte: »Ich bin müde.«
Sie ging ins Haus. Man sah, wie in Klaus’ Zimmer die Fenster hell wurden.
Otando, Gesine, Klaus und Friedrich saßen noch eine Zeitlang ums Feuer, aber es wurde nicht mehr viel geredet. Schließlich brach Otando auf. Klaus verabschiedete ihn und ging dann auch hinein, zu Lovisa.
Friedrich und Gesine waren am Feuer sitzen geblieben.
»Schön hast du gespielt«, sagte Gesine.
»Dein Bruder spielt viel besser«, antwortete Friedrich zurückhaltend, »er ist sehr gut.«
»Er war bei den Symphonikern«, sagte Gesine, »und bei der Bundeswehr im Musikkorps.«
»Hat er da den Bart auch schon gehabt?«, fragte Friedrich.
Gesine lachte. »Nein«, sagte sie, »der Bart, die langen Haare, das ist alles erst in den letzten Jahren gekommen. Er sieht aus wie Rasputin, oder?«
Friedrich musste auch lachen. Das traf es sehr genau. Dann schwiegen sie lange. Schließlich sagte Gesine: »Wir kriegen ein Kind. Wenn es ein Junge wird, möchte ich ihn gerne Samuel nennen.«
»Samuel ist kein schlechter Name«, sagte Friedrich nach einer ganzen Weile gelassen.
»Klaus heißt mit zweitem Namen Samuel«, erklärte Gesine, »und er ist mein einziger Bruder.«
»Na ja«, sagte Friedrich, »da wir ihm nicht die acht Namen meiner Geschwister geben können, soll er eben Samuel heißen. Wenn es ein Junge wird.«
»Es wird ein Junge!«, versprach Gesine voller Überzeugung.
»Samuel Ehrlich.« Friedrich lauschte dem Namen nach und sah ins Feuer. »Wie klingt das?«
5
Der Polizist starrte auf meinen Führerschein. Dann trat er etwas zurück und betrachtete den Wagen. Der Autobahnparkplatz war voller Autos und Polizisten. Es hatte wieder angefangen zu nieseln, und die Stimmung war entsprechend schlecht. Bei den Polizisten wegen des Wetters, bei den Autofahrern, weil sie die Radarfalle übersehen hatten. Ich war noch keine fünf Minuten auf der Autobahn, als ich schon wieder herausgewunken wurde. In der regnerisch diesigen Ferne konnte ich sogar noch die Türme des Doms sehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!