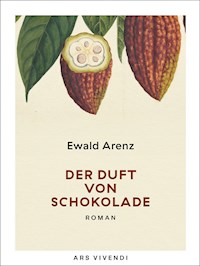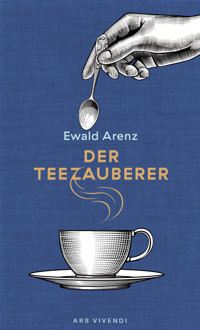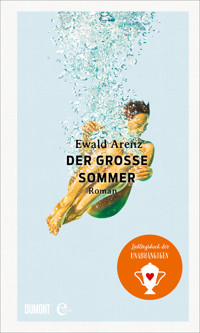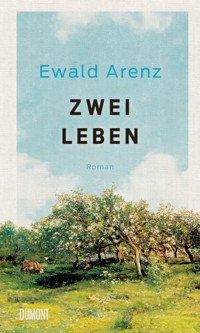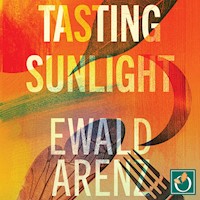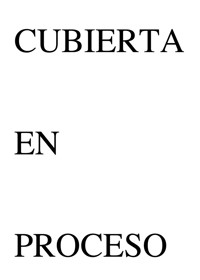Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Nach dem großen Erfolg von »Meine kleine Welt«: Die gesammelten Weihnachtsgeschichten von SPIEGEL-Bestsellerautor Ewald Arenz in einem Band Jedes Jahr aufs Neue: Wochen-, ja monatelang wird man auf Schritt und Tritt an die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit erinnert, und dann kommt man kurz vor Heiligabend doch noch in die Bredouille, alle Geschenke rechtzeitig besorgen zu müssen. Ewald Arenz deutet in seinen leichtfüßigen, humorvollen Storys nicht nur die Weihnachtsgeschichte neu, sondern erzählt auch von der »Weihnachtsfrau« und dem ganz normalen Wahnsinn einer Familienweihnacht. Das perfekte Begleitbuch für die schönste und verrückteste Zeit des Jahres – und zugleich selbst das ideale Geschenk!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: © Birkefeld
Ewald Arenz’ umfangreiches Werk wurde vielfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Bei ars vivendi erschienen u. a. sein Bestseller Der Duft von Schokolade, der Kriminalroman Das Diamantenmädchen über das Berlin der Goldenen Zwanzigerjahre, der Familienroman Ehrlich & Söhne, der luftig-leichte Sommerroman Ein Lied über der Stadt, sein heiter-apokalyptischer Roman Herr Müller, die verrückte Katze und Gott, sein Erzählband Eine Urlaubsliebe und die Familiengeschichten Meine kleine Welt.
Ewald Arenz
PLÖTZLICHBESCHERUNG
UND ANDERE(UN)WEIHNACHTLICHEGESCHICHTEN
Tannenbaum und Hundeglück (2017), Der Weihnachtsring (2015) und Leise! Was liegt da im Schnee? (2013) waren bereits als eigenständige Adventskalendergeschichten in Dosen erschienen. Ein Teil der Weihnachtsgeschichten stammt aus dem Band Knecht Ruprecht packt aus (2009).
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage September 2022)
© 2022 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
www.arsvivendi.com
Umschlaggestaltung: finken&bumiller, StuttgartEinbandfoto: © aoei24oct/Shutterstock (Cover)Datenkonvertierung eBook: CPI buchbücher.de GmbH, Birkach
eISBN 978-3-7472-0436-8
Plötzlich Bescherung
Inhalt
Vorwort
Adventskalendergeschichten
Tannenbaum und Hundeglück
Der Weihnachtsring
Leise! Was liegt da im Schnee?
Weihnachtsgeschichten
Mittsommerweihnacht
Die Weihnachtsfrau
Unfriede auf Erden
Weihnachten im Tiergarten
Weihnachten im Grüner Automat
Nach dem Stern
Das Leibgericht
Distanzbescherung
Christkindlesmarkt 2.0
Kinder, Kaffee, Kokain
Wir warten aufs Christkind
O Tannenbaum
Orientalische Weihnacht
Trott & Schrödel
Fürther Weihnachten
Warum die Engländer ihre Weihnachtsgeschenke in Strümpfen bekommen
Josefs Geschenk
Vorwort
Wenn man als das älteste von sieben Kindern in einer protestantischen Pfarrersfamilie aufwächst, dann ist Weihnachten noch einmal anders als in allen anderen Familien. Drei Gottesdienste an Heiligabend bedeuten, dass in der eigenen Familie alles im Schnelldurchlauf passieren muss: Vorbereitung, Festessen und Bescherung. Alles findet zwischen Familiengottesdienst um fünf, Festgottesdienst um neun Uhr und der Mitternachtsmesse um halb zwölf statt. Man könnte meinen, dass alle Besinnlichkeit und aller Zauber des Weihnachtsfestes in so einer Familie keine Chance hat. Aber – und das ist vielleicht selbst schon die Magie dieses Festes – das ist nie passiert. Weihnachten hat seinen Charme für mich nie verloren, und deshalb kehre ich in meinen Geschichten auch immer wieder dorthin zurück.
Ich glaube, man merkt diesen gesammelten Weihnachtsgeschichten an, dass mein Verhältnis zum Fest der Feste immer ein heiter ambivalentes geblieben ist – wie es eben in meiner Kindheit auch war. Wahnwitziger Trubel und lächelnde Besinnlichkeit gehen in meinen Geschichten Hand in Hand. Es ist alles ein großes Spiel, und am Ende steht natürlich immer eine Bescherung. Manchmal ist sie unerwartet und manchmal plötzlich, und manchmal besteht sie auch einfach nur in einem Lächeln.
In diesem Buch sind meine Weihnachtsgeschichten aus zwanzig Jahren versammelt. Viele von ihnen habe ich für meine Familie geschrieben: für meine Brüder und Schwestern, für meine Kinder und manche auch für die vielen Onkel und Tanten oder für ein Familienfest mit den mehr als dreißig Cousins und Cousinen. Es sind aber auch viele Erzählungen dabei, die für Zeitung und Radio entstanden sind. So ist es ein ziemlich bunter Geschenkehaufen geworden, der da unter dem Baum liegt. Aber ich finde ja sowieso, dass eine gute Geschichte immer wie ein Geschenk sein sollte.
Viel Vergnügen beim literarischen Auspacken. Und natürlich … Frohe Weihnachten!
Ewald Arenz
Adventskalendergeschichten
Tannenbaum und Hundeglück
1
Ich starrte meinen Vater entgeistert an. Der hingegen schnitt mit einer uralten Messingschere den blakenden Docht der ersten Adventskerze zurück.
Draußen regnete es stetig. Meine Mutter war im Flur auf der Suche nach irgendetwas. Der Hund füllte den gesamten Raum unter dem Tisch aus. Alles war eigentlich wie immer. Eigentlich.
»Das ist nicht dein Ernst«, sagte ich nach einer ganzen Weile.
»Papa, ich bin kein Zoo. Ich habe ein Haus von normaler, westeuropäischer Größe. Und es wohnen noch Kinder darin. Ich kann den Hund nicht nehmen.«
Mein Vater sah mich eine Weile traurig an, dann stand er schweigend auf und ging aus dem Zimmer.
»Was?«, rief ich ihm nach, »was ist jetzt?« Es kam keine Antwort.
Ich rückte meinen Stuhl zurück und sah unter den Tisch. Achilles. So hatte meine Mutter den Hund genannt, als sie ihn bekam. Ein Hovawart, in dessen Vorfahren irgendein gewissenloser Züchter mal ein Shetlandpony eingekreuzt haben musste. Er hob den mächtigen Kopf, um gestreichelt zu werden. Widerwillig tat ich es, aber ich warnte ihn: »Nein! Und wenn es tausendmal Adventszeit ist – nein!«
2
Die Tür öffnete sich, und Mama kam herein.
»Oh! Hallo! Wie heißt du?«
Früher war das ein Spiel gewesen. So viele Kinder und so viele Namen. Jetzt erinnerte sie sich manchmal wirklich nicht mehr, wie ihr ältester Sohn hieß.
»Hallo, Mama«, sagte ich zum vierten oder fünften Mal an diesem Nachmittag, »ich bin’s. Dein Ältester.«
Sie strahlte und umarmte mich. »Fährst du mich heim?«
Ich lächelte sie leise an und zeigte auf die Kerze. »Mama, du bist daheim.«
»Ach so«, sagte sie unbeschwert und setzte sich. »Willst du Tee?«
Ich verzichtete dankend. Meine Mutter neigte zunehmend dazu, den Tee in Blumenvasen, Suppenterrinen oder Milchflaschen aufzugießen; meist ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass in den Vasen noch Wasser, in den Terrinen noch Suppe oder in den Flaschen noch Milch war. Außerdem hatte sie mich vorhin schon gefragt.
»Mama«, fragte ich vorsichtig, »sag mal, mit dem Hund gehst du aber schon noch, oder?«
Sie richtete sich auf. »Na, selbstverständlich!«, sagte sie mit dem Stolz auf ihre körperliche Fitness, die sie noch immer hatte, »jeden Tag.«
3
»Jeden Tag?«, fragte ich zweifelnd.
»Ja«, sagte Papa, als er nun auch wieder ins Wohnzimmer kam, »das denkt sie jedenfalls. Hast du dich mal gefragt, warum du uns in den letzten Tagen telefonisch nicht erreichen konntest?«
Mein Vater ist fast achtzig. Er geht gebeugt, und manchmal leidet er unter Schwindel, aber seinen Humor und seinen wachen Geist hat er nicht verloren. »Sie versteckt alle Hundeleinen, und dann findet sie sie nicht mehr. Letztes Mal hat sie stattdessen ein Telefonkabel genommen. Natürlich nicht, ohne es vorher mit einer Schere säuberlich durchtrennt zu haben. Immerhin hat sie so den Kontakt zum Hund wieder aufgenommen, aber schön ist das für niemand von uns! Er hat sich fast stranguliert, und ich konnte nicht telefonieren.«
Mama lachte. »Du kennst den Vater! Immer erzählt er Witze.«
Ich lachte auch, aber eigentlich mehr, weil Papa sein uraltes Kleinkalibergewehr mit in den Raum gebracht hatte, das mit großer Sicherheit nicht mehr funktionstüchtig war.
»Ich finde, du solltest der Mama noch eine Chance geben«, sagte ich boshaft mit Blick auf die Waffe.
Mein Vater legte das Gewehr auf den Tisch, setzte sich und sagte hoheitsvoll: »Entweder nimmst du den Hund mit, oder ich muss ihn erschießen. Ins Tierheim geht er so wenig wie wir beide ins Altersheim. So wahr mir Gott helfe!«
4
»Erpressung! Schändliche Erpressung!«, schrie ich ohne echte Überzeugung. Achilles legte mir eine seiner mächtigen Pfoten vertrauensvoll aufs Knie und sah mich treuherzig an. Ich hasse es, wenn Hunde mich so ansehen. Das wirkt bei mir besser als ein altes Gewehr.
»Neulich hat sie Bindedraht als Leine genommen. Und außerdem hat er sie schon zweimal umgeworfen. Es geht nicht mehr«, sagte mein Vater jetzt ernster. Es wurde mir ein bisschen komisch in der Brust. In solchen Augenblicken schimmerte sein wahres Alter durch. »Aber er kann in kein Heim. Sie muss ihn ab und zu sehen können. Er ist ihr Ein und Alles.«
Ich nickte. Leider hatte er recht. In den Familienfilmen, die Mama vor vierzig Jahren gedreht hatte, wimmelte es von Hunden. Irische Setter, groß und klein, Welpen, Dalmatiner, Terrier. Nur ab und zu stolperte eins ihrer Kinder durchs Bild. Meistens unscharf. Und heute? Es gab nicht mehr so viele Freuden im allmählich dunkler werdenden Leben meiner Mutter.
»Ach, verdammt«, sagte ich. »Verdammt. In Ordnung. Ist gut. Ich mach’s.«
Papa stand auf und legte mir die Hände auf die Schultern.
»Willst du das Gewehr auch mitnehmen?«
5
Ich war – trotz fast fünfzigjähriger Erfahrung mit meinen Eltern – nicht darauf vorbereitet, dass ich den Hund sofort mitzunehmen hatte.
»Ich hab’s mir anders überlegt«, schnaufte ich atemlos in Richtung meines Vaters, der mit auf den Hof gekommen war und gelassen meine Versuche beobachtete, den überproportionalen Hund in den Kofferraum zu schieben. »Ich nehme doch lieber das Gewehr.«
Mein Vater sah mich blicklos an. »Wer sind Sie, junger Mann?«, wimmerte er dann mit übertrieben brüchiger Stimme. »Verlassen Sie meinen Grund und Boden!« Ich schwankte zwischen Wut und Lachen.
»Papa! Wieso musstet ihr als letzten Hund ausgerechnet ein kleines Pferd auswählen?«
Mein Vater kehrte zu seiner normalen Stimmlage zurück. »Vielleicht dachte deine Mutter, dass sie auf ihm reiten kann, wenn sie mal alt ist?«, meditierte er laut über meine Frage.
Achilles hingegen hatte es sich überlegt und stieg in den Kofferraum. Stieg, wohlgemerkt. Er brauchte nicht zu springen. Ich sah ihn verzweifelt an. Er füllte das Auto bis zum Dach.
»Muss ich den Hänger nehmen, um das Futter zu transportieren?«, fragte ich Papa sarkastisch. »Und ich brauche eine Leine.«
»Leinen sind schon lange aus«, lachte mein Vater trocken. »Ich kann dir ein Telefonkabel mitgeben.«
6
Ich hatte nie eine Chance, als ich die Tür aufschloss und gleichzeitig versuchte, den Hund davon abzuhalten, so durch die Öffnung zu stürmen, dass die Tür mit Wucht an die Wand knallte. Eine Leine wäre hilfreich gewesen.
»Was ist das denn?«, schrie Otto im Esszimmer entsetzt auf, als Achilles ihn freudig bellend begrüßte. Der Hund war eine Frohnatur, das konnte nicht abgestritten werden. Er neigte dazu, Familienmitglieder mit Umarmungen zu begrüßen, ungeachtet der Tatsache, dass es nur wenige Menschen gibt, die von einem fünfzig Kilogramm schweren Hund umarmt werden möchten.
Dem dumpfen Geräusch aus dem Esszimmer sowie dem Stöhnen meines jüngsten Sohnes entnahm ich, dass eines der grundlegenden Gesetze der Physik wieder einmal bestätigt worden war: Zwei Körper können nicht zur selben Zeit am selben Ort sein. Ich schloss resigniert die Haustür und trat ein.
»Frohen Nikolaus«, wünschte ich Otto, der sich angewidert dagegen wehrte, von Achilles’ langer Zunge ebenfalls beglückwünscht zu werden. Schwer atmend kämpfte er sich unter dem Hund hervor, der sich sofort auf dem Teppich zu drehen begann und dann niederlegte.
»Ich«, sagte Otto und wischte sich wütend die Backe ab, »hatte mir ein Buch über Wölfe gewünscht. Den Wolf sehe ich. Wo ist das Buch?«
7
»Mein Zimmer betritt der Hund nicht!«, bestimmte Otto mit all der Überzeugung, zu der ein Vierzehnjähriger fähig ist. Ich sah zwischen ihm und Achilles hin und her.
»Ich fürchte, das liegt nicht allein in deiner Entscheidungsgewalt, mein Sohn.« Es tat gut, die Hilflosigkeit gegenüber dem eigenen Vater eine Generation weiterzureichen. »Und außerdem schafft die Oma das nicht mehr mit dem Hund.«
Otto sah mich lange an. »Papa!«, sagte er dann in dem gleichen Tonfall, den ich normalerweise meinem Vater gegenüber hatte, »nicht einmal Chuck Norris käme mit diesem Hund klar. Wie lange bleibt er hier?«
Ich antwortete nicht. Otto sah mich an und wiederholte seine Frage. Ich antwortete wieder nicht. Ottos Augen wurden weit. »Nee«, sagte er schwach, »nee, oder?«
»Ich glaube, er ist schon acht«, warf ich hastig ein, »vielleicht stirbt er bald.«
»Bevor der stirbt, bin ich längst ausgezogen«, meinte Otto düster, »Hunde werden fünfzehn oder sechzehn Jahre alt.«
Ich versuchte ihn zu ködern: »Ich erhöhe dein Taschengeld, wenn du mit ihm gehst.«
Mein Sohn lachte auf. Es klang nicht sehr fröhlich.
»Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich mit einem Hund gehe, den du dir zugelegt hast, oder? Biete doch dem Hund Geld an, dass er alleine spazieren geht!«
Er verschwand in seinem Zimmer. Ich hörte, wie er den Schlüssel umdrehte, und murmelte müde in Richtung des Hundes:
»Ich fürchte, alleine verstößt du gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.«
8
Ich schlief nicht so sehr viel in dieser Nacht. Obwohl ich umgeben von Meerschweinchen, Hamstern, Katzen und vor allem Hunden aufgewachsen war, schien diese Erfahrung einfach schon zu lange zurückzuliegen. Zwar war ich zunächst sehr schnell eingeschlafen, nachdem ich dem Hund in einer großen, zweckentfremdeten Teigschüssel eine beträchtliche Menge Nahrung hingestellt hatte, aber in meine unruhigen Träume drang schon bald eine Truppe klein gewachsener Stepptänzer, die aus irgendeinem Grund auf Waldboden im Haus meiner Eltern tanzten, das plötzlich in einem dunklen Dschungel stand. Ich wunderte mich im Traum so sehr über das Klick-Klack, das die Tänzer dennoch erzeugten, dass ich aufwachte. Es brauchte ein wenig, bis ich den anhaltenden Stepptanz der Zwerge richtig zugeordnet hatte. Es war der Hund, der noch schlafloser als ich war und dessen Krallen meinen Parkettboden malträtierten. Fest entschlossen, mich morgen um dieses Problem zu kümmern, schlief ich wieder ein. Diesmal traumlos, bis mich ein tigerartiges Fauchen, ein wildes Geschrei und dann ein entsetztes Bellen aus dem Bett riss und ich vor Panik beinahe die Treppe hinunterfiel.
Die Katze! Ich hatte die Katze vergessen, die in ihrem Besitzdenken kapitalistischer war als Donald Trump. Die Schlichtung dieses Kampfes dauerte fast den Rest der Nacht, und Otto sah mich am nächsten Morgen müde und böse an. Man hätte meinen können, dass es nach dieser Nacht nicht schlimmer kommen konnte …
9
Achilles gewöhnte sich sehr rasch ein, was sich auch daran zeigte, dass er innerhalb weniger Tage herausgefunden hatte, wie man die Kühlschranktür öffnete.
Ich hatte Ottos pubertären und nächtlichen Heißhunger im Verdacht gehabt, als ich eines Morgens die Kühlschranktür halb offen stehen und auf dem Boden leeres Einwickelpapier gefunden hatte.
»Nein!«, hatte Otto jedoch mit brechender Stimme gekrächzt, »ich war das nicht!«
Achilles, von meinem Unglauben und dem darauffolgenden Streit komplett unbeeindruckt, fraß währenddessen die Teigschüssel leer.
»Ich mag doch gar keinen rohen Schinken!«, schrie Otto schließlich völlig wutentbrannt. »Ich habe nichts aus dem Scheißkühlschrank genommen! Aber bitte! Wenn du mir nicht glaubst, dann halt nicht!«
Es war nicht der Ton, der mich überzeugte. Es war der Schinken. Und es stimmte. Wenn Otto eines seit frühester Kindheit nicht ausstehen konnte, war es roher Schinken.
»Okay«, sagte ich langsam, »okay.«
Und dann wandten unser beider Blicke sich dem Hund zu.
»Nee«, sagte Otto nach einer Weile, »das kann der nicht, oder?«
10
Es war der zehnte Dezember, und Otto und ich lagen auf der Lauer. Wir lagen wirklich. Auf der Treppe. Von dort konnte man durch die Stufen in die Küche sehen, wurde aber vom durchschnittlichen Räuberhund, der auf der Suche nach rohem Schinken war, nicht bemerkt.
Otto und ich hatten ein halbes Pfund gekauft, das Einwickelpapier verführerisch gelockert und den Schinken durch die Küche gewedelt, bevor wir ihn in den Kühlschrank legten. Dann hatten wir das Licht bis auf die beiden Adventskerzen gelöscht und lautstark getan, als gingen wir ins Bett.
Es wäre aber gar nicht nötig gewesen. Selbst wenn wir im selben Raum gewesen wären, hätte Achilles sich wahrscheinlich nicht abhalten lassen. Er hatte zunächst den Kopf gehoben und geschnuppert. Dann war er von seinem Lager aufgestanden, hatte sich gestreckt – ich fragte mich, ob er wohl die Decke erreichte, wenn er sich auf die Hinterpfoten hob – und war zielstrebig in die Küche geschlendert. Auf dem Parkett steppten die Zwerge. Und dann stieß Otto mich an.
»Schau!«, zischte er in tiefer Genugtuung, »schau!«
Ich schaute. Der Hund hatte sich erhoben, eine Pfote auf die Spüle gestützt und kratzte mit der anderen an der Kühlschranktür, die sich bereits nach wenigen Versuchen öffnete. Sanftes Licht beleuchtete Achilles, der seinen Riesenschädel erstaunlich sanft in den Kühlschrank steckte und dann mit dem Schinken im Maul wieder zum Vorschein kam.
»Vergebung«, murmelte ich meinem Sohn erschüttert zu, »Vergebung.«
11
»Warum habt ihr ein Schloss am Kühlschrank, Peter?«, fragte meine Mutter Otto.
Es war Donnerstag, und wie immer hatte ich sie für den Nachmittag zu mir geholt, damit Papa auch mal einen freien Tag genießen konnte. Es war in der Ehe meiner Eltern wahrhaftig nicht jederzeit heiter zugegangen, aber mich erstaunte immer wieder, wie rührend mein Vater sich jetzt im Alter um sie kümmerte, denn man konnte sie kaum noch alleine lassen.
»Ich heiße Otto, Oma«, korrigierte Otto sie halb nachsichtig, halb genervt. »Dein Hund ist ein Dieb.«
Mama lachte fröhlich.
»Ja, nicht wahr? Er ist so schlau!« Sie tätschelte dem Hund in liebevoller Grobheit den Kopf. Das zumindest war besser als früher – sie konnte es nicht mehr mit meinem Kopf tun. Meine Mutter war stets – wenn man es positiv ausdrücken wollte, konnte man sagen: – stürmisch gewesen.
Achilles wich nicht von ihrer Seite, als sie zielstrebig auf den Keller zuging.
Otto sah ihr nach. »Wohin willst du, Oma?«
»Ach«, sagte sie, »ich muss mal eben …«
Otto seufzte und stand vom Mittagstisch auf.
»Ich zeig’s dir.«
Meine Mutter hakte sich vertraulich bei ihm ein, als er sie die Treppe zur Toilette hochführte. Ich hörte sie von oben sagen:
»Das ist aber ein hübsches Bad, Simon. Wohnst du hier?«
Ich konnte aus Ottos Antwort hören, wie er die Augen nach oben drehte, als er antwortete: »Nein.«
Und dann die Verblüffung, als er laut nachsetzte:
»Oma! Nimmst du echt den Hund mit aufs Klo?«
12
Es war ein ungewöhnlich milder Tag, und deshalb ging ich mit meiner Mutter am Nachmittag in den Garten. Eine etwas blasse Dezembersonne schien schräg auf die braunen Beete und Hecken. Achilles grub nach Maulwürfen oder Mäusen, aber das war in Ordnung. Die Gartenmauer war in dem langen Sommer vom Efeu komplett überwuchert worden.
»Willst du mir ein bisschen helfen, Mama?«, fragte ich.
»Gerne!«, sagte sie fröhlich und rieb sich die Hände. Das funktionierte fast immer. Sie liebte es, wenn sie körperlich arbeiten konnte. Vielleicht, weil Holz schlichten oder Rasen mähen oder Efeu schneiden einfache Aufgaben waren, bei denen es kein Vergessen von Arbeitsschritten gab. Ich reichte ihr eine Gartenschere.
»Alles, was über die Mauer wächst, Mama, siehst du? Den ganzen Efeu.«
Meine Mutter fing an, den Efeu zu vernichten. Energisch rupfte sie die Blätter, schnitt die Ausläufer ab, rang mit langen Wurzeln und war glücklich.
Ich ging zufrieden in den unteren Garten, um den Rechen zu holen. Als ich wieder nach oben kam, war meine Mutter nicht mehr am Efeu. Ich sah mich um. Achilles’ Fell leuchtete aus dem Dickicht auf der anderen Gartenseite, und dort sah ich auch meine Mutter, wie sie selbstvergessen und kraftvoll meinen dritten Johannisbeerstrauch auf den Stumpf setzte.
»Mama!«, schrie ich, »Nein! Das sind Johannisbeeren.«
Meine Mutter hielt ein, sah mich schuldbewusst an, ohne wirklich zu wissen, warum, und ließ die Schere fallen.
13
»Es ist nicht schlimm«, beruhigte ich meine bedrückte Mutter zum zwanzigsten Mal, als wir beim Abendessen saßen. Mittlerweile hatte sie die Johannisbeeren vergessen, war aber nun der Ansicht, sie hätte eine Delle in mein Auto gefahren. »Das wächst wieder nach.«
Meine Mutter sah mich verwundert an. »Das Blech wächst nach?«, fragte sie in einem sehr seltenen Anflug von Logik, »Junge, du redest Unsinn!«
Otto grinste.
Ich gab mich geschlagen und füllte ihren Teller auf. Achilles wich ihr nicht von der Seite. Er saß aufmerksam neben ihr und sah ihr beim Essen zu.
Die Katze wiederum saß als dauergesträubte Fellkugel hoch auf dem Geschirrschrank und sah giftgrün auf uns alle herunter.
»Schmeckt’s dir nicht, Oma?«, fragte Otto etwas zu süffisant. Er selber aß sorgfältig um die gebratenen Auberginenstücke auf seinem Teller herum und sah, dass meine Mutter sie ebenfalls äußerst misstrauisch auf dem Teller hin- und herschob.
»Normal«, antwortete sie missmutig. Das Telefon klingelte, und ich stand auf.
Eine Sekunde später lachte Otto überrascht auf, und dann stimmte seine Oma ein. Ich drehte mich zu ihnen um.
»Was?«, aber dann sah ich es schon. Achilles fraß schnell, aber ein paar Auberginenstücke auf dem Boden hatte er übersehen.
Otto kicherte heiser, aber hochvergnügt: »Der Hund hat doch ein paar Vorteile!«
Ich hingegen fragte mich, ob es ein Lob oder eine Kritik meiner Kochkünste war, wenn der Hund mein Essen mehr schätzte als meine Familie.
14
Ich fuhr meine Mutter heim. Als ich zurückkam, begrüßte mich Achilles laut bellend. Das hatte er schon immer bei meinen Eltern getan, aber jetzt fand ich doch, er konnte seine Freude etwas zügeln, wenn ich gerade mal eine halbe Stunde weg war. Außerdem hasste meine Katze mich zunehmend. Sie war schon heiser von dem ewigen Gefauche, auch wenn ich mein Möglichstes tat, die beiden voneinander fernzuhalten.
Im Wohnzimmer saß Otto und sah eine Serie. Er blickte kaum auf, als er sagte: »Sie hat es wieder getan.«
»Was?«, fragte ich müde.
»Die Oma«, antwortete er, »zähl das Besteck.«
»Och nein«, stöhnte ich gequält.
Meine Mutter hatte als kleines Kind im Krieg aus dem Osten fliehen müssen. Das Einzige, was die Familie am Schluss der Flucht noch hatte, war ein Köfferchen mit Silberbesteck. Anscheinend kam das jetzt immer stärker hoch, denn Mama stahl Löffel, Gabeln oder Messer, wo immer sie war. Im Restaurant, bei Bekannten und sogar zu Hause. Mein Vater aß seit Monaten mit Campingbesteck, das er in seinem Zimmer aufbewahrte. Denn was Mama gestohlen hatte, fand man nie wieder. Es war weg. Sie versteckte es so gut, dass in grauer Zukunft Archäologen denken würden, unsere Kultur hätte eine religiöse Beziehung zu Essbesteck mit Fadenmuster gehabt.
15
Ich ließ mich müde neben meinem Sohn aufs Sofa fallen.
»Otto«, sagte ich, »so ganz leicht ist das nicht immer.«
Otto gab sich unbeeindruckt und sah weiter irgendwelchen Superhelden zu, die blitzschnell durch Zeit und Raum rasten. Aber nach einer Weile sagte er dann doch etwas.
»Sie nennt mich jedes Mal anders. Heute hat sie sogar mal Fabricius oder so zu mir gesagt. Wahrscheinlich hat sie’s irgendwo gelesen. Meinen richtigen Namen kennt sie seit Jahren nicht mehr.«
Der Superheld ging gerade in Flammen auf, weil er allzu schnell gerannt war und die Reibung sein Cape entzündet hatte.
»Zum Glück ist der Weihnachtsmann aus Asbest«, meinte ich nachdenklich, »sonst würde er an Heiligabend in einem Feuerball explodieren, noch bevor er den Nordpol verlassen hat.«
Otto lachte mit stimmbrüchiger Stimme. »Papa«, sagte er dann.
»Was?«, fragte ich. Otto schwieg eine Weile.
»Ich … ich möchte nicht, dass du mal so wirst«, nuschelte er dann, ohne vom Bildschirm aufzusehen.
Ich konnte nicht anders: Obwohl Otto schon vierzehn war, musste ich ihm den Arm um die Schultern legen.
»Werd ich nicht. Versprochen.«
Und dann setzte ich nach: »Fabricius.«
Otto boxte mich lachend in die Rippen.
16
Es war kalt geworden, auch wenn kein Schnee fiel. Dicker Raureif lag auf den Wiesen, wenn ich morgens mit dem Hund über die benachbarten Felder ging, bevor ich in die Arbeit musste. Das war eine der wenigen schönen Seiten an meiner neuen Rolle als Hundebesitzer. An solchen Tagen hing eine rote Sonne lang über dem Nebelstreifen in der Ferne, bevor sie sich in flachem Bogen vom Horizont löste.
Ich war immer noch nicht dazugekommen, eine Leine zu kaufen, und führte Achilles mit schlechtem Gewissen an einem Strick, den ich ihm immer abstreifte, wenn wir aus dem Dorf heraus waren. Man hatte den Eindruck, dass die Erde erzitterte, wenn er nach einer langen Runde wie wild auf einen zugaloppierte und es dabei manchmal noch schaffte, tief und durchdringend zu bellen. In diesen Augenblicken konnte ich meine Mutter verstehen: Es war schön, so ein Tier um sich zu haben, seine reine Lebensfreude, seine Kraft, seine Lust am Rennen zu spüren.
Aber trotzdem, dachte ich, als ich ihm den Strick wieder überstreifte und seinen hechelnden Atem dampfen sah, trotzdem wird das auf Dauer nichts mit uns. Es ging einfach nicht – weder Otto noch ich waren oft genug da, und außerdem hasste die Katze ihn.
Ich musste eine Lösung finden.
17
Wir trafen uns in einem Café in der Stadt, damit meine Mutter den Hund sehen konnte. Außerdem war es Freitag – an dem Tag holte ich Otto immer von der Schule ab, und wir gingen eine Kleinigkeit essen.
Mama hatte mich schon durch die große Scheibe entdeckt, als mein Vater noch umständlich aus dem Auto stieg, das viel zu niedrig für ihn war. Fröhlich klopfte sie von außen wild an das Glas, Achilles erkannte sie, sprang auf und rannte zur Tür.
Leider hatte ich den Strick am Stuhl festgemacht, der Stuhl flog hinter ihm her und fegte die Bedienung von den Beinen, die gerade meinen Kaffee brachte.
»Ja, mein Schöner, mein Guter, mein Bester!«, jubelte meine Mutter, die den Hund im Eingang stürmisch begrüßte und der seinerseits so etwas Ähnliches in Hundisch bellte. Ich hingegen versuchte der Bedienung aufzuhelfen, die wütend meine Hand wegschob und aufsprang.
»Ein Strick! Super, wirklich super! Sie wissen schon, dass Sie den Hund damit erwürgen können, oder?«
Ich war so perplex, dass sie sich nicht über die zerbrochene Tasse, sondern über meine Tierquälerei aufregte, dass ich für einen Augenblick sprachlos war.