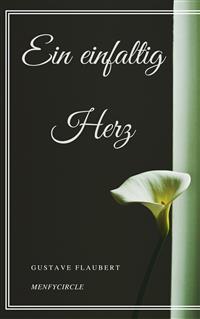
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gérald Gallas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fiction, Short Stories
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ein einfältig Herz
Gustave Flaubert
Gustave Flaubert (December 12, 1821 – May 8, 1880) was a French novelist who is counted among the greatest Western novelists. He is known especially for his first published novel, Madame Bovary (1857), and for his scrupulous devotion to his art and style, best exemplified by his endless search for "le mot juste" ("the precise word").
Kapitel1
Ein halbes Jahrhundert lang beneideten die Bürgerinnen von Pont -l'Évêque Frau Aubain um ihre Magd Felicitas. Für hundert Franken im Jahre versah sie Küche und Haus, nähte, wusch, plättete, verstand ein Pferd zu schirren, Geflügel zu mästen, zu buttern – allezeit ihrer Herrin treu, die nichts weniger war als eine angenehme Person.
Frau Aubain hatte einen hübschen Jungen ohne Vermögen geheiratet, der ihr bei seinem Tode, zu Beginn des Jahres 1809, zwei ganz kleine Kinder sowie eine Menge Schulden hinterließ. Da verkaufte sie ihre Liegenschaften bis auf die Meierhöfe Toucques und Geffosses, die ihr, wenn es hoch kam, fünftausend Franken Pachtzins eintrugen, und zog aus ihrem Haus in Saint-Melaine in ein weniger kostspieliges, das ihren Vorfahren gehört hatte und hinter der Markthalle stand.
Dieses Haus, ein mit Schiefer verkleidetes Gebäude, stand zwischen einem Durchgang und einer zum Fluß führenden schmalen Gasse. Der Boden drinnen hatte eine andere Höhe als der draußen, so daß man stolperte. Ein enger Flur trennte die Küche von der »Großen Stube«, in der Frau Aubain den ganzen Tag in einem Großvaterstuhle am Fenster zu sitzen pflegte. An der weißgestrichenen Wandtäfelung standen nebeneinander acht Mahagonistühle. Auf einem alten Klavier, über dem ein Wetterglas hing, türmte sich eine Pyramide von Kästen und Schachteln. Zwei bestickte Lehnsessel spreizten sich links und rechts vom Rokokokamin aus gelbem Marmor. Die Standuhr mitten darauf stellte einen Vestatempel vor, und das ganze Zimmer roch ein wenig nach Moder, denn die Diele war tiefer als der Garten.
Im ersten Stock lag zunächst das Zimmer der »gnädigen Frau«, ein sehr großer Raum mit blasser Blumentapete und dem Bilde des »gnädigen Herrn« als Dandy. Von da ging es in ein kleineres Zimmer, wo man zwei Kinderbettstellen ohne Matratzen sah. Dahinter kam die »Gute Stube«, die immer verschlossen blieb und reich an Möbeln mit Leinwandüberzügen war. Sodann führte ein Gang zu einem Studierzimmer. Drinnen stand ein breiter Schreibtisch aus schwarzem Holz und darum ein dreiteiliges Gestell mit Büchern und Schriften in den Fächern. Die Rückwände der beiden Flügel verschwanden unter Federzeichnungen, Gouache-Landschaften und Stichen von Audran, Überbleibseln besserer Zeiten und längst entschwundenen Prunks. Im zweiten Stock lag die Kammer von Felicitas, belichtet von einem Dachfensterchen mit Ausblick über die Wiesen.
Felicitas stand bei Tagesgrauen auf, um die Messe nicht zu versäumen, und arbeitete ohne Unterlaß bis zum Abend. War das Mahl zu Ende, das Geschirr wieder in Ordnung und die Haustür gut verschlossen, dann überdeckte sie noch die glimmenden Kohlen mit Asche und nickte, den Rosenkranz in den Händen, am Herd ein. Beim Einkaufen konnte niemand hartnäckiger feilschen. In Punkto Sauberkeit brachten ihre blitzblanken Pfannen alle anderen Mägde zur Verzweiflung. Sparsam, wie sie war, aß sie langsam und tippte mit dem Finger vom Tische die Krumen ihres Brotes auf, eines eigens für sie gebackenen zwölf Pfund schweren Brotes, das drei Wochen vorhielt.
Zu jeglicher Jahreszeit trug sie ein buntes Kattuntuch, das hinten mit einer Nadel zusammengesteckt war, eine Haube auf dem Haar, graue Strümpfe, einen roten Unterrock und über ihrer Jacke eine Latzschürze, wie die Krankenschwestern.
Ihr Gesicht war hager, ihre Stimme scharf. Mit fünfundzwanzig Jahren sah sie aus wie eine Vierzigjährige. Von den Fünfzigern an nahm man keine Alters Veränderungen mehr an ihr wahr; und in ihrer Schweigsamkeit, mit ihrer steifen geraden Haltung und ihren abgemessenen Bewegungen machte sie den Eindruck einer automatisch funktionierenden Holzfigur.
Kapitel2
Wie jede andere hatte sie ihre Liebesgeschichte gehabt. Ihr Vater, ein Maurer, war vom Gerüst zu Tode gestürzt. Dann starb die Mutter. Ihre Schwestern kamen dahin und dorthin. Sie selbst wurde von einem Pächter aufgenommen, bei dem sie, noch ein Kind, die Kühe zu hüten hatte. Sie fror unter ihren Lumpen, trank, platt auf dem Boden, aus den Pfützen, wurde um nichts geprügelt und schließlich wegen eines Diebstahls von zwölf Groschen, den sie nicht begangen hatte, fortgejagt. Sie verdingte sich auf einen andern Pachthof, als Viehmagd, und weil sie dem Gutsherrn gefiel, waren ihre Mitmägde eifersüchtig auf sie.
Eines Abends im August – sie war nunmehr achtzehn Jahre alt – nahm man sie mit nach Colleville auf die Kirmes. Ihr wurde sofort schwindelig. Der Lärm der Musikanten, die Lichter in den Bäumen, das bunte Durcheinander der Kleider, der Putz, die Goldkreuze, die herum wirbelnde Menschenmenge, alles das betäubte sie. Bescheiden hielt sie sich abseits. Da trat ein stattlicher, junger Mann – er hatte zuvor, die Ellenbogen auf eine Karrendeichsel gestürzt, seine Pfeife geraucht – auf sie zu und forderte sie zum Tanz auf. Er bezahlte Apfelwein, Kaffee, Kuchen, kaufte ihr ein seidenes Tüchel und trug ihr, im Glauben, sie verstände ihn, an, sie heimzugeleiten. Am Rain eines Haferfeldes zwang er sie roh zu Boden. Sie bekam Angst, begann zu schreien, und er machte sich davon.
An einem andern Abend wollte sie, auf dem Wege nach Beaumont, an einem großen Heuwagen, der langsam dahinfuhr, vorüber, und wie sie sich an den Rädern hindrückte, erkannte sie Theodor wieder.
Ohne irgendwelche Verlegenheit redete er sie an und sagte, sie dürfe ihm nicht böse sein. Der Wein sei schuld daran gewesen.
Sie wußte nicht, was sie antworten sollte, und am liebsten wäre sie weggelaufen.
Gleich darauf sprach er von der Ernte und von den Großen in der Gemeinde. Sein Vater wäre von Colleville weg und habe den Ecots-Hof übernommen, so daß sie jetzt Nachbarn seien.
»So!« sagte sie.
Er fügte hinzu, daß man ihn verheiraten wolle, Indessen, er habe keine Eile und warte auf eine Frau nach seinem Geschmack.
Sie senkte den Kopf. Da fragte er sie, ob sie nicht auch ans Heiraten dächte. Sie lächelte und sagte, es sei nicht recht, daß er sich über sie lustig mache.
»Bei Gott, das tue ich nicht!« beteuerte er und umfaßte sie mit dem linken Arm. So ging sie von ihm gehalten. Sie verlangsamten den Schritt. Der Wind war weich. Die Sterne funkelten. Die mächtige Heufuhre vor ihnen schwankte dahin, und die vier Gäule schleppten ihre Hufe durch den aufwirbelnden Staub. Dann bogen sie von allein nach rechts ab. Er drückte sie noch einmal an sich. Sie verschwand im Dunkel.
In der Woche darauf erlangte Theodor von ihr ein Stelldichein nach dem andern.
Sie trafen sich hinter dem letzten Gehöft an einer Mauer unter einem einzelnen Baume. Sie war nicht unschuldig wie wohlgehütete junge Damen (die Tiere hatten sie aufgeklärt), aber gesunder Menschenverstand und natürliche Ehrbarkeit bewahrten sie vor dem Fall. Dieser Widerstand steigerte Theodors Verliebtheit, so daß er ihr, um sein Gelüst zu befriedigen (oder vielleicht wirklich treuherzig), einen Heiratsantrag machte. Sie wollte nicht daran glauben. Er schwor bei Tod und Teufel.
Bald darnach gestand er ihr etwas Unangenehmes. Seine Eltern hatten ihm das Jahr vorher einen Ersatzmann gekauft; aber jeden Tag konnte man ihn doch ausheben. Dienen zu müssen war ihm greulich. Diese Schlappheit nahm Felicitas als ein Zeichen seiner Liebe; die ihre verdoppelte sich dadurch. Sie stahl sich nachts hinaus, und beim Stelldichein quälte Theodor sie mit seiner Angst und Not.
Am Ende kündigte er ihr an, er wolle selber auf die Präfektur gehen, um sich zu erkundigen. Am nächsten Sonntag zwischen elf Uhr und Mitternacht werde er ihr berichten.
Als die Stunde kam, eilte sie zum Stelldichein. Statt seiner fand sie einen seiner Freunde.
Der teilte ihr mit, daß sie ihn nicht wiedersehen dürfe. Um sich vor der Aushebung zu sichern, habe Theodor eine ältere schwerreiche Frau geheiratet, die Frau Lehoussais aus Toucques.
Ihr Schmerz war maßlos. Sie warf sich zu Boden, schrie, rief den lieben Gott an und jammerte einsam und allein auf dem Felde bis die Sonne aufging. Wieder im Hof, kündigte sie ihren Dienst; und am Ende des Monats, nach Empfang ihres Lohnes, packte sie ihre paar Habseligkeiten in ein Taschentuch und begab sich nach Pont-l'Évêque.
Vor dem Gasthof ging sie eine Bürgersfrau an, die die Witwenhaube trug, und es traf sich, daß sie just eine Köchin suchte. Das junge Mädchen konnte zwar nicht viel, hatte aber offenbar guten Willen bei geringen Ansprüchen, so daß Frau Aubain schließlich sagte:
»Gut, ich nehme Sie.«
Eine Viertelstunde später hatte sich Felicitas bei ihr häuslich niedergelassen.
Anfangs lebte sie in einer Art Bangigkeit, verursacht vom »Geist des Hauses« und vom Andenken an den »gnädigen Herrn«, das über allem schwebte. Paul und Virginia, die beiden Kinder, das eine sieben Jahre alt, das andere nicht ganz vier, kamen ihr vor wie aus kostbarem Stoffe gebildet. Sie ging geradezu für sie auf, und Frau Aubain mußte ihr verbieten, sie aller Augenblicke zu küssen, was sie höchlichst kränkte. Gleichwohl fühlte sie sich glücklich. Die freundliche Umgebung hatte ihren Kummer verscheucht.
An jedem Donnerstage kamen die Stammgäste des Hauses zum Boston. Felicitas legte die Karten und die Fußwärmer vorher zurecht. Pünktlich um acht Uhr erschienen sie, und kurz vor Schlag elf gingen sie wieder.
Jeden Montag breitete der Trödler, der im Durchgange hauste, seinen Kram an der Erde aus. Dann war die Stadt voller Stimmengesumm, in das sich Pferdegewieher, Lämmergeblök, Schweinegegrunz und das harte Rattern der Karren auf dem Steinpflaster mischten. Gegen Mittag, wenn der Markt in vollem Gange war, erschien auf der Schwelle ein alter hochgewachsener Bauer mit einer Hakennase, die Mütze im Genick. Das war Robelin, der Pächter von Geffosses. Bald darauf stellte sich Liébard ein, der Pächter von Toucques, ein rotes, feistes Männchen in grauer Jacke und sporenklingenden Gamaschenstiefeln.
Beide brachten ihrer Gutsherrin Hühner und Käse dar. Felicitas verstand ihre Hinterabsichten immer irgendwie zu vereiteln, und voll Respekt vor ihr gingen sie von dannen.
Hin und wieder empfing Frau Aubain den Besuch des Barons von Gremanville. Das war ein Onkel von ihr, der sein Vermögen durchgebracht hatte und nun in Falaise auf dem letzten bißchen Anwesen lebte. Er stellte sich stets zur Frühstücksstunde ein, begleitet von einem scheußlichen Pudel, der mit seinen Pfoten alle Möbel beschmutzte. Wie angelegen er sich's auch sein ließ, alleweg als Edelmann zu erscheinen – was so weit ging, daß er jedesmal, wenn er »mein Vater selig« sagte, den Hut lüftete –, schenkte er sich doch, wie es seine Gewohnheit war, Glas um Glas ein und gab schlimme Geschichten zum besten. Felicitas nötigte ihn höflich hinaus: »Sie haben genug, Herr Baron! Aufs nächste Mal!« Und zu war die Tür.
Mit Vergnügen öffnete sie Herrn Bourais, einem ehemaligen Advokaten. Seine weiße Halsbinde und seine Glatze, das Jabot seines Hemds, sein weiter brauner Rock, seine Armhaltung, wenn er eine Prise nahm, kurz seine ganze Persönlichkeit versetzten sie in jene Erregung, die uns erfaßt, wenn wir einem ungewöhnlichen Menschen ins Auge schauen.
Da er die Güter der »gnädigen Frau« verwaltete, verbrachte er mit ihr ganze Stunden hinter verschlossener Tür im Arbeitszimmer des »gnädigen Herrn«. Er fürchtete immer, etwas Dummes zu sagen, hatte grenzenlosen Respekt vor den Behörden und tat, als ob er Latein verstünde.
Zur unterhaltsamen Belehrung schenkte er den Kindern eine Erdkunde mit Kupferstichen. Selbige stellten verschiedene Schauplätze derErde dar, federngeschmückte Menschenfresser, einen Affen, der eine junge Dame raubt, Beduinen in der Wüste, einen Wal, der mit Harpunen erlegt wird, und dergleichen mehr.
Paul erklärte Felicitas diese Stiche. Das war ihre ganze wissenschaftliche Bildung. Die der Kinder lag einem gewissen Guyot ob, einem armen Teufel, der im Rathause angestellt und wegen seiner schönen Hände berühmt war; er pflegte sein Messer am Stiefel zu wetzen.
Bei schönem Wetter ward am frühen Vormittag nach dem Gute Geffosses gewandert.
Der Hof lag lehnan, das Haus stand in der Mitte; in der Ferne schimmerte das Meer wie ein grauer Streifen.
Felicitas holte aus ihrem Handkorbe kalten Aufschnitt hervor, und in einem Zimmer neben der Molkerei wurde gefrühstückt. Das Gelaß war das einzige, was von einem verschwundenen Landhause übrig war. Die Tapete war zerfetzt und flatterte im Zugwind. Von Erinnerungen übermannt, ließ Frau Aubain den Kopf hängen. Die Kinder wagten nicht mehr zu reden. »Aber so spielt doch!« sagte sie. Da liefen sie hinaus.
Paul kletterte auf den Boden der Scheune, fing Vögel, flitschte Steine über den Teich oder schlug mit einem Stock auf die großen Fässer, die wie Trommeln dröhnten.
Virginia fütterte die Kaninchen, lief ins Feld nach Kornblumen, und ihre Beine flogen, daß man ihre gestickten Höschen sah.
An einem Herbstabende nahm man den Rückweg über die Weiden.
Der Mond, der im ersten Viertel stand, erhellte einen Teil des Himmels, und Nebel schwebte wie ein Band über den Windungen der Toucques. Rinder lagen im Gras und ließen die vier Menschen ruhig vorübergehn. Auf der dritten Hut erhoben sich ein paar und stellten sich in der Runde vor ihnen hin.
»Keine Furcht!« rief Felicitas und summte ein Liedchen vor sich her, während sie dem nächststehenden Tier mit der Hand übers Rückgrat strich. Es machte rechts um, und die anderen taten desgleichen. Aber als sie die folgende Hut hinter sich hatten, erscholl furchtbares Gebrüll. Es war ein Stier, den der Nebel verbarg. Er kam auf die beiden Frauen zu. Frau Aubain begann zu laufen.
»Nein, nein! nicht so schnell!«
Sie gingen aber doch rascher, hinter sich dumpfes Schnauben, das näher und näher kam. Hufe schlugen wie Hämmer auf den Grasboden. Jetzt galoppierte das Tier!
Felicitas wandte sich um, riß mit beiden Händen Erdklumpen aus und schleuderte sie ihm ins Gesicht. Der Stier senkte das Maul, schüttelte die Hörner und zitterte vor Wut, wobei er schrecklich brüllte.
Frau Aubain war mit ihren beiden Kindern an den Rand der Hut gelangt und trachtete in ihrer Angst irgendwie über den hohen Grenzwall zu kommen. Felicitas wich vor dem Stier schrittweise zurück, währenddem sie unaufhörlich Rasenstücke warf, die ihn blind machten.
Dabei rief sie: »Macht schnell! Macht schnell!«
Frau Aubain sprang in den Graben hinab, hob erst Virginia, dann Paul hinüber, strauchelte bei dem Versuche, die Böschung zu erklimmen, mehrmals, bot allen Mut auf und brachte es endlich zuwege.
Der Stier hatte Felicitas gegen ein Gatter gedrängt. Sein Geifer flog ihr ins Gesicht. Noch eine Sekunde, und er hätte sie aufgespießt. Sie hatte gerade noch Zeit, sich zwischen zwei Latten durchzuzwängen. Verblüfft blieb der mächtige Stier stehen.
Von diesem Ereignis redete man in Pont-l'Évêque noch nach Jahren. Felicitas bildete sich nichts darauf ein; ahnte sie ja nicht einmal, daß sie etwas Heldenhaftes getan hatte.
All ihr Augenmerk galt Virginia. Das Kind war infolge des Schreckens nervös geworden, und Herr Poupart, der Arzt, empfahl die Seebäder von Trouville.
Sie waren damals noch wenig besucht. Frau Aubain zog Erkundigungen ein, hielt mit Bourais Rat und traf Vorbereitungen wie für eine Weltreise.
Ihre Koffer gingen am Abend vorher auf Liébards Wägelchen voraus. Am andern Morgen kam er selber mit zwei Pferden, wovon eins einen Damensattel mit einer Samtlehne trug. Auf dem Rücken des zweiten bildete ein zusammengelegter Mantel eine Art Sitz. Frau Aubain stieg auf. Hinter ihr nahm Felicitas Platz, Virginia auf dem Schoß; und Paul setzte sich auf den Esel, den Herr Lechaptois unter der Bedingung bester Fürsorge gestellt hatte.
Der Weg war so schlecht, daß man zu den acht Kilometern zwei Stunden brauchte. Die Gäule versanken bis an die Fesseln im Kot; um wieder herauszukommen, mußten sie gehörig treten. Öfters stolperten sie über die Radgleise, und ab und zu mußten sie springen. An gewissen Orten blieb Liébards Stute plötzlich stehen. Er wartete geduldig, bis sie wieder anging, erzählte von den Leuten, denen die Felder an der Straße gehörten, und knüpfte moralische Betrachtungen an ihre Geschichte. So sagte er mitten in Toucques, als man unter Fenstern vorüberritt, die mit Kapuzinerkresse umrankt waren, achselzuckend:
»Hier wohnt eine Frau Lehoussais, die, statt einen jungen Mann zu heiraten … «
Das Weitere hörte Felicitas nicht. Die Pferde trabten, der Esel galoppierte. Man bog in einen Seitenweg ein. Ein Gattertor ging auf. Zwei Burschen erschienen, und am Misthaufen, dicht vor der Haustür, wurde abgesessen.
Mutter Liébard verlor sich beim Gewahrwerden der Grundbesitzerin in endlose Freudenbezeigungen. Sie tischte ein Frühstück auf, das aus einem Lendenbraten, Kaldaunen, Blutwurst, Hühnerfrikassee, Apfelschaumwein, Obstkuchen und Pflaumen in Rum bestand, und begleitete all das mit Komplimenten für die gnädige Frau, die »prächtig« aussehe, für das gnädige Fräulein, das »wunderhübsch« geworden sei und für Herrn Paul, der sich »riesig herausgemacht« habe. Auch vergaß sie »die seligen Großeltern« nicht, die die Liébards noch gekannt hatten, da sie schon seit mehreren Geschlechtern im Dienst der Familie standen.
Das Gehöft hatte gleich ihnen ein altertümliches Aussehen. Die Deckenbalken waren wurmstichig, die Wände rauchgeschwärzt, die Fliesen grau vom Staub. Auf einer eichenen Anrichte prangten allerlei Gerät, Krüge, Teller, Zinnäpfe, Wolfangeln, Schafscheren. Eine mächtige Klistierspritze erweckte die Heiterkeit der Kinder. Auf den drei Höfen stand kein Baum, unter dem nicht Edelpilze wuchsen und in dessen Geäst kein Mistelbusch saß. Mehrere hatte der Wind hinuntergeworfen; sie waren am Stamm wieder emporgewachsen. Und alle die Bäume bogen sich unter der Last der Äpfel. Die Strohdächer, die wie brauner Sammet aussahen und ungleich dick waren, hielten den stärksten Stürmen stand. Der Wagenschuppen jedoch war halb verfallen. Frau Aubain meinte, sie werde ihn im Auge behalten, und befahl, die Tiere wieder aufzuzäumen.
Man ritt noch eine halbe Stunde, bis man Trouville erreichte. Die kleine Kavalkade saß ab und nahm den Weg über die »Schoren« zu Fuß; das war ein überhängender Fels, unter dem Boote lagen. Und drei Minuten später war man am Ende des Hafendammes im Hofe des »Goldnen Lammes« bei der Mutter David.
Virginia fühlte sich schon nach ein paar Tagen infolge des Luftwechsels und der Wirkung der Bäder nicht mehr so schwach. In Ermangelung eines Badeanzuges badete sie im Hemd; wiederangezogen wurde sie von ihrer Wärterin in einer Zollwächterhütte, die den Badegästen zur Verfügung stand.
Nachmittags machte man mit dem Esel Ausflüge über die »Schwarzen Felsen« hinaus nach Hennequeville zu. Der Weg führte zunächst durch hügeliges Gelände mit Rasen wie in einem Park; dann stieg er auf eine Hochfläche, wo Weidenplätze mit bestellten Äckern abwechselten. Aus dem Dorngestrüpp am Wegrande leuchtete Ginster, und da und dort starrte das Gezack der Äste eines abgestorbenen hohen Baumes in die blaue Luft.
Fast immer machte man auf einer Wiese Rast, Deauville zur Linken, Le Havre zur Rechten und vor sich das freie Meer. Es glänzte in der Sonne, glatt wie ein Spiegel und so still, daß man kaum die Brandung hörte. Sperlinge, die man nicht sah, piepten; und Über alledem wölbte sich der unendliche Himmel. Frau Aubain saß mit ihrer Näharbeit im Gras. Virginia neben ihr flocht Binsen; Felicitas zupfte Lavendel; Paul langweilte sich und wollte wieder fort.
Manchmal auch fuhr man im Boot über die Toucques hinaus und suchte Muscheln. Die verebbende Flut ließ Seeigel, Seepferdchen und Seesterne zurück; und die Kinder liefen umher, die Schaumflocken zu fangen, die der Wind herblies. Schläfrig fielen die Wellen über den Sand und verrieselten hier. Der Strand dehnte sich, so weit man sah. Auf der Landseite aber begrenzten ihn die Dünen und trennten ihn vom »Marais«, einem großen rennbahnförmigen Wiesenplan. Nahm man darüber den Rückweg, so wuchs Trouville drüben auf dem Hange der Höhe mit jedem Schritte und lag mit all seinen ungleichen Häusern in lustigem Durcheinander da.
An Tagen, da es zu heiß war, kam man nicht aus dem Zimmer. Die blendende Helle draußen drängte sich in lichten Streifen durch die Stäbe der Jalousien herein. Im Dorf alles still. Unten auf dem Gehsteig kein Mensch. Dies Schweigen allüberall steigerte die Ruhe der Dinge. In der Ferne hämmerten die Stemmeisen der Kalfaterer gegen Schiffsplanken, und schwerer Wind trug Teergeruch heran.
Das Hauptvergnügen war die Rückkehr der Fischerbarken. Sowie sie die Bojen hinter sich hatten, begannen sie zu lavieren. Ihre Segel sanken auf Zweidrittelmast; das Focksegel blähte sich auf wie ein Ballon, und so kamen sie näher, glitten durch die schaukelnden Wellen bis mitten in den Hafen, wo dann mit einem Schlage der Anker fiel. Darauf legte das Boot am Damm an. Die Matrosen warfen zappelnde Fische über Bord. Eine Reihe von Karren wartete auf sie, und Frauen in Wollhauben eilten herzu, um die Körbe zu nehmen und ihre Männer zu umarmen.
Eine von ihnen sprach eines Tages Felicitas an. Kurz darauf kam sie außer sich vor Freude ins Zimmer. Sie hatte eine Schwester wiedergefunden. Und Nastasia Barette, verehelichte Leroux, erschien, einen Säugling an der Brust, an der rechten Hand ein ander Kind und links neben sich einen kleinen Schiffsjungen, der die Fäuste in die Seiten stemmte und die Mütze schief aufhatte.
Nach einer Viertelstunde ward sie von Frau Aubain verabschiedet.
Man traf sie immer wieder in der Nähe der Küche oder auf den Spaziergängen, die man unternahm. Der Mann zeigte sich nicht.
Felicitas faßte Zuneigung zu ihnen. Sie kaufte ihnen eine Decke, Hemden, einen Kochherd. Offenbar beutete man sie aus. Diese Schwäche ärgerte Frau Aubain, der außerdem die Vertraulichkeit des Neffen nicht recht paßte, denn er duzte ihren Sohn; und da Virginia hustete und das schöne Wetter aufgehört hatte, kehrte sie nach Pont-l'Évêque zurück.
Herr Bourais beriet sie in der Wahl einer Schule. Die in Caën galt für die beste. Paul wurde dorthin geschickt und überstand brav den Abschied, froh, in ein Haus zu kommen, wo er Kameraden haben sollte.
Frau Aubain fand sich in die Trennung von ihrem Sohne, weil sie unumgänglich notwendig war. Virginia dachte weniger und weniger an ihn. Felicitas vermißte sein Lärmen. Aber eine neue Obliegenheit lenkte sie ab; von Weihnachten an brachte sie das kleine Mädchen täglich in die Katechismusstunde.
Kapitel3
Wenn sie an der Kirchentüre das Knie gebeugt hatte, schritt sie durch das hohe Schiff im Gang zwischen den Sitzreihen, öffnete Frau Aubains Bank, setzte sich hin und ließ den Blick umherschweifen.
Die Chorstühle rechts waren voller Knaben, die links voller Mädchen. Der Pfarrer stand am Pult. Auf einem Fenster der Apsis schwebte der Heilige Geist über der Jungfrau; auf einem andern kniete sie vor dem Jesuskind, und hinter dem Sakramentshäuschen stand der Erzengel Michael im Kampfe mit dem Drachen, in Holz geschnitzt.
Der Geistliche erzählte erst aus der Biblischen Geschichte. Sie glaubte das Paradies zu schauen, die Sündflut, den Turm zu Babel, brennende Städte, sterbende Völker, umgestürzte Götterbilder, und von diesem Gesicht verblieb ihr Ehrfurcht vor dem Allerhöchsten und Furcht vor seinem Zorn. Dann hörte sie unter Tränen die Leidensgeschichte an. Warum hatte man ihn gekreuzigt, ihn, der die Kinder liebkoste, das Volk speiste, die Blinden heilte und in seiner Demut mitten unter den Armen, auf der Streu eines Stalles, hatte geboren werden wollen? Die Aussaat, die Ernte, das Keltern, alle diese vertrauten Verrichtungen, von denen das Evangelium spricht, fanden sich auch in ihrem Dasein. Das Auge Gottes hatte darauf geruht und sie seitdem geheiligt. Und zärtlicher denn je liebte sie fortan die Lämmer aus Liebe zum Lamme Gottes und die Tauben um des Heiligen Geistes willen.
Es fiel ihr schwer, sich ihn leibhaft vorzustellen; denn er war nicht nur ein Vogel, sondern auch ein Feuer und zu andern Malen ein Windeshauch. Vielleicht war es sein Licht, das nachts am Rande des Moors flackert; sein Atem, der die Wolken treibt; seine Stimme, die in der Glocken Klang erschallt. Und sie verharrte in Andacht und genoß die Kühle der Mauern und die Stille der Kirche.
Von den Dogmen begriff sie nichts, gab sich auch gar keine Mühe, etwas zu verstehn. Der Pfarrer predigte. Die Kinder sagten her. Schließlich schlief sie ein und fuhr erst jäh auf, wenn die Holzschuhe der weggehenden Kinder auf den Fliesen klapperten.
Auf diese Weise, vom Anhören, lernte sie den Katechismus, denn sie selber hatte als Kind keinen religiösen Unterricht erhalten. Nun aber machte sie alle die frommen Dinge nach, die Virginia tat, fastete wie sie, ging zur Beichte mit ihr. Zu Fronleichnam richteten sie zusammen eine Station her.
Virginias erste Kommunion brachte sie schon lange zuvor um alle Ruhe. Die Schuhe, der Rosenkranz, das Gebetbuch, die Handschuhe bereiteten ihr Sorgen. Und sie zitterte, als sie der Mutter das junge Mädchen ankleiden half.
Während der ganzen Messe war sie beklommen. Herr Bourais verdeckte ihr eine Seite des Chors; aber geradeaus vor ihr stand die Schar der Jungfrauen mit ihren weißen Kränzen über den lang herabhängenden Schleiern. Das sah wie ein Schneefeld aus; und sie erkannte von weitem die liebe Kleine an dem zierlicheren Hals und an der andächtigen Haltung. Das Glöckchen bimmelte. Die Köpfe neigten sich. Es ward ganz still. Dann rauschte die Orgel, und die Sänger und die Gemeinde stimmten das »Agnus Dei« an. Dann traten die Knaben der Reihe nach vor, und nach ihnen standen die Mädchen auf. Schritt vor Schritt, mit gefalteten Händen, zogen sie vor den über und über erleuchteten Altar, knieten auf der ersten Stufe nieder, empfingen eins nach dem andern die Hostie und kamen in derselben Reihenfolge zu ihren Betstühlen zurück. Als Virginia daran kam, beugte sich Felicitas vor, um sie zu sehen; und kraft der Phantasie, die wahre Liebe dem Menschen verleiht, kam es ihr vor, als sei sie selber das Kind dort. Sein Leib wurde der ihre; sie trug sein Kleid; sein Herz schlug in ihrer Brust. Und als es die Lippen öffnete, mußte sie die Augen schließen und wäre beinahe ohnmächtig geworden.
Am nächsten Morgen erschien sie zu früher Stunde in der Sakristei, damit der Herr Pfarrer auch ihr das Abendmahl reiche. Sie empfing es andächtig, empfand aber nicht jene Wonnen wie am Tage zuvor.
Frau Aubain wollte ihre Tochter nach jeder Richtung hin ausbilden lassen, und da ihr Guyot weder das Englische beibringen noch ihr Musikstunden geben konnte, so beschloß sie, sie zu den Ursulinerinnen nach Honfleur zu geben.
Das Mädchen wandte nichts dagegen ein. Felicitas seufzte; sie fand die gnädige Frau gefühllos. Später meinte sie, ihre Herrin habe vielleicht doch recht. Dergleichen ging über ihre Begriffe.
Eines Tages endlich hielt ein alter Kremser vor der Tür; und heraus stieg eine Nonne, die das gnädige Fräulein abzuholen kam. Felicitas hob das Gepäck auf das Wagenverdeck, trug dem Kutscher verschiedenes auf und packte sechs Töpfe mit eingemachten Früchten, ein Dutzend Birnen und einen Veilchenstrauß in den Sitzkasten.
Im letzten Augenblick begann Virginia heftig zu schluchzen. Sie umarmte die Mutter; und die küßte sie auf die Stirn und sagte mehrmals:
»Geh nun! Mut! Mut!«
Der Tritt wurde aufgeklappt; der Wagen fuhr ab.
Hinterher hatte Frau Aubain einen Ohnmachtsanfall, und am Abend kamen alle ihre Freunde, die Familie Lormeau, Frau Lechaptois, die Fräuleins Rochefeuille, Herr von Houppeville und Bourais, um sie zu trösten.
Die Trennung von ihrer Tochter war ihr anfangs sehr schmerzlich. Aber dreimal in der Woche kam ein Brief; und an den andern Tagen schrieb sie ihr, wandelte im Garten auf und ab, las ein wenig und füllte so die Leere der Stunden.
Aus Gewohnheit ging Felicitas am Morgen in Virginias Stube und starrte die Wände an. Es war ihr gräßlich, daß sie ihr nicht mehr das Haar zu kämmen, die Schuhe zu schnüren, sie zu Bett zu bringen hatte, und daß sie nicht mehr beständig ihr reizendes Gesicht sah, sie nicht mehr an der Hand hielt wie ehedem, wenn sie zusammen ausgingen. Um nicht müßig zu sein, versuchte sie zu klöppeln. Ihre Finger waren zu schwer und zerrissen das Garn. Sie taugte zu nichts mehr, hatte den Schlaf verloren; sie hatte, wie sie sich ausdrückte, einen »Knacks« bekommen.
Um sich zu »zerstreuen«, bat sie um die Erlaubnis, daß ihr Neffe Viktor sie besuchen dürfe.
Am Sonntag nach der Messe kam er, mit roten Backen, die Brust bloß, umweht vom Duft der Felder, durch die er gewandert war. Sofort deckte sie für ihn. Sie frühstückten, einander gegenübersitzend, und während sie selber möglichst wenig aß, um die Mehrausgabe wieder einzubringen, stopfte sie ihn dermaßen voll, daß er zuletzt einschlief. Beim ersten Schlag des Vesperläutens weckte sie ihn, bürstete ihm die Hosen, knüpfte ihm die Halsbinde und ging mit ihm, in einer Art Mutterstolz auf seinen Arm gestützt, zur Kirche.
Seine Eltern gaben ihm stets den Auftrag mit, ihr etwas abzuknöpfen, etwa ein Päckchen Zucker, oder Seife, Schnaps, manchmal sogar Geld. Er brachte seine Leibwäsche zum Ausbessern, und Felicitas besorgte diese Arbeit, froh darüber, daß ihn dies zum Wiederkommen veranlagte.
Im August nahm ihn sein Vater auf die Küstenfahrt mit.
Es waren gerade Ferien. Die Ankunft der Kinder tröstete sie. Aber Paul war launisch, und Virginia durfte nicht mehr geduzt werden, was ihrem Verkehr Zwang antat, eine Schranke zwischen sie setzte.
Viktor fuhr nacheinander nach Morlaix, nach Dünkirchen und nach Brighton. Jedesmal, wenn er zurückkam, brachte er ihr ein Geschenk mit: das erstemal ein Muschelkästchen, das zweitemal eine Kaffeetasse, das drittemal einen großen Pfefferkuchenmann. Er wurde hübsch, war gut gewachsen, bekam einen Anflug von Schnurrbart, hatte treuherzige offene Augen und trug ein Lederhütchen, das er wie ein Lotse im Nacken sitzen hatte. Er erzählte ihr ergötzliche Geschichten, die von seemännischen Ausdrücken wimmelten.
An einem Montag, am 12. Juli 1819 (sie vergaß das Datum ihr Lebelang nicht), teilte ihr Viktor mit, daß er für eine lange Fahrt geheuert sei und in der übernächsten Nacht mit dem Paketboot von Honfleur nach Le Havre zu seinem Schoner abgehen werde, der demnächst seine Reise antrete. Er werde etwa zwei Jahre ausbleiben.
Daß sie ihn so lange nicht sehen sollte, versetzte Felicitas in großen Kummer. Um ihm ein letztes Lebewohl zu sagen, zog sie am Mittwoch abend, nachdem die gnädige Frau gegessen hatte, ihre Überschuhe an und lief die drei Meilen von Pont-l'Évêque nach Honfleur.
Am Kalvarienberg wandte sie sich statt nach links nach rechts, verirrte sich in den Lagerplätzen und mußte umkehren. Leute, die sie fragte, sagten, sie solle sich beeilen. Sie ging rund um den Hafen mit seinen vielen Schiffen; stolperte über Taue. Dann senkte sich der Boden. Lichter schimmerten kunterbunt durcheinander; und als sie Pferde am Himmel hängen sah, glaubte sie verrückt geworden zu sein.
Am Rande des Hafendammes wieherten auch welche, erschreckt durch die See. Ein Kran hob sie in die Höhe und ließ sie in ein Schiff hinab, wo sich zwischen Obstweinfässern, Käsekörben, Getreidesäcken Fahrgäste drängten. Man hörte Hühner gackern. Der Kapitän fluchte; und ein Schiffsjunge lehnte am Ankerbalken, die Ellbogen aufgestützt, unbekümmert um all das. Felicitas, die ihn nicht gleich erkannt hatte, rief: »Viktor!« Er hob den Kopf; sie stürzte nach ihm hin – und im selben Augenblick ward die Brücke weggezogen.
Das Paketboot wurde von Frauen, die dabei sangen, aus dem Hafen getreidelt. Seine Rippen krachten; die schweren Wogen peitschten seinen Bug. Das Segel hatte sich gedreht. Man sah niemanden mehr… . Auf dem mondsilbrigen Meere schwamm ein schwarzer Fleck, der immer blasser ward, immer tiefer tauchte und schließlich verschwand.
Als Felicitas wieder am Kreuzberg vorüberkam, kam es ihr in den Sinn, ihn, den sie am meisten auf der Welt liebte, den lieben Gott anzuflehen. Lange stand sie da und betete, das Gesicht in Tränen gebadet, den Blick in den Wolken. Die Stadt schlief. Zollwächter wandelten auf und ab; und ohne Unterlaß, brausend wie ein Wildbach, stürzte das Wasser aus den Löchern der Schleusen. Es schlug zwei Uhr.
Das Sprechzimmer bei den Nonnen wurde vor Tagesanbruch nicht geöffnet. Ein längeres Ausbleiben wäre der gnädigen Frau sicherlich nicht recht, und so machte sie sich auf den Heimweg, trotz aller Sehnsucht, ihren Liebling zu umarmen. Die Mägde im Gasthofe standen eben auf, als sie in Pont-l'Évêque ankam.
Der arme Junge sollte also monatelang auf den Wellen treiben! Seine früheren Fahrten hatten sie nicht in Besorgnis versetzt. Aus England und der Bretagne kam man wieder; aber Amerika, die Kolonien, die Antillen, das lag in verlorenen Regionen am anderen Ende der Welt.
Fortan dachte Felicitas immer nur an ihren Neffen. Brannte die Sonne, so meinte sie, der Durst müsse ihn quälen; witterte es, so fürchtete sie, der Blitz könne ihn erschlagen. Wenn sie hörte, wie der Wind im Schornstein heulte und die Schiefer vom Dache losriß, sah sie ihn im selben Unwetter, hoch auf einem zerbrochenen Maste, ganz hintenübergestreckt, vom Gischt überflutet; oder er wurde – eine Erinnerung an das Geographiebuch mit den Kupferstichen! – von den Wilden gefressen, im Walde von Affen verschleppt, oder er verschmachtete an ödem Gestade. Aber niemals sprach sie von ihren Kümmernissen.
Frau Aubain hatte andre Sorgen: um ihre Tochter.
Die guten Schwestern fanden, sie sei lieb und gut, aber zart. Die geringste Erregung schadete ihr. Das Klavierspiel mußte sie aufgeben.
Die Mutter bekam vom Kloster regelmäßig Bericht. Als eines Morgens der Briefträger nicht gekommen war, geriet sie in Unruhe. Sie ging in der Großen Stube hin und her, immer von ihrem Großvaterstuhle bis zum Fenster. Es war unbegreiflich. Seit vier Tagen keine Nachricht!
Um sie durch Beispiel zu trösten, sagte Felicitas:
»Ich, gnädige Frau, ich habe nun sechs Monate keine!«
»Von wem denn? … «
Leise erwiderte die Magd:
»Nu … von meinem Neffen!«
»Ach, dein Neffe!«
Frau Aubain zuckte mit den Achseln und begann von neuem auf und ab zu gehen; was soviel heißen sollte wie: »Was schert mich der? An den denke ich gar nicht! Ein Schiffsjunge! Ein Strolch! Große Sache! Meine Tochter dagegen … Bedenke doch!«
Felicitas war an Roheit gewöhnt, aber das empörte sie. Und doch vergaß sie es wieder.
Es schien ihr ganz natürlich, daß man wegen der Kleinen den Kopf verlor.
Die beiden Kinder waren ihr gleich wert; mit beiden fühlte sie sich durch Herzensbande verbunden; beider Schicksal war auch das ihre.
Der Apotheker teilte ihr mit, daß Viktors Schiff in der Havanna angekommen sei. Er hatte die Nachricht in einer Zeitung gelesen.
Wegen der Zigarren stellte sie sich die Havanna als ein Land vor, wo man nichts tat als rauchen; und so dachte sie sich ihren Viktor in einer Tabakwolke unter Negern lustwandeln. Konnte man von dort im »Notfalle« auf dem Landwege zurück? Und wie weit war das von Pont l'Évêque? Um dies zu erfahren, wandte sie sich an Herrn Bourais.
Der holte seinen Atlas hervor, begann ihr zunächst den Begriff der Längengrade beizubringen, und wie er Felicitas höchlichst verdutzt sah, lächelte er fein schulmeisterlich. Schließlich zeigte er mit seinem Bleistift innerhalb der Umrisse eines länglichen Flecks auf einen schwarzen, kaum erkennbaren Punkt und sagte: »Da ist's!« Sie beugte sich über die Karte. Der angetuschte Wirrwarr von Strichen ermüdete ihre Augen, ohne ihr etwas zu sagen, und als Bourais sie fragte, was sie eigentlich möchte, bat sie ihn, er solle ihr das Haus zeigen, wo Viktor wohne. Bourais erhob die Arme, nieste und brach in ein Riesengelächter aus. Derartige Einfalt erregte seine Heiterkeit, während Felicitas nicht verstand, warum er lachte. Sie hatte vielleicht gar erwartet, das Bild ihres Neffen gezeigt zu bekommen. So beschränkt war ihr Verstand!
Vierzehn Tage später ereignete es sich, daß Liébard wie gewöhnlich zur Marktzeit zu ihr in die Küche kam und ihr einen Brief von ihrem Schwager übergab. Da keines von beiden lesen konnte, nahm sie ihre Zuflucht zu ihrer Herrin.
Frau Aubain zählte eben die Maschen eines Strickstrumpfes, legte ihn beiseite, machte den Brief auf, fuhr zusammen und sagte mit leiser Stimme und geheimnisvollem Blick:
»Es wird dir da ein Unglück mitgeteilt. Dein Neffe … «
Er war tot. Mehr ward ihr nicht berichtet.
Felicitas sank auf einen Stuhl, drückte den Kopf an die Wand und schloß die Lider, die mit einemmal rot wurden. Dann senkte sie die Stirn, ließ die Hände hängen und wiederholte, starr vor sich hinblickend, von Zeit zu Zeit:
»Armes Kerlchen! Armes Kerlchen!«
Liébard sah sie an und seufzte. Frau Aubain zitterte leicht.
Sie schlug ihr vor, ihre Schwester in Trouville aufzusuchen.
Felicitas antwortete durch eine Gebärde, das sei nicht nötig.
Eine Weile redete niemand. Der treffliche Liébard hielt es für angemessen, sich zu entfernen.
Da sagte sie:
»Denen ist das gleich!«
Der Kopf fiel ihr zurück; und mechanisch hob sie ab und zu die langen Nadeln in die Hand, die auf dem Nähtische lagen.
Im Hof gingen Frauen mit einer Trage vorbei, auf der Wäsche triefte.
Sie sah das durch die Scheibe und erinnerte sich ihrer Wäsche. Sie hatte sie gestern eingeweicht und mußte sie heute spülen. Da verließ sie das Zimmer.
Ihr Brett und ihr Waschfaß standen am Ufer der Toucques. Sie warf einen Haufen Hemden auf die Böschung, krämpelte sich die Ärmel auf, ergriff den Bleuel, und ihre starken Schläge hallten in den umliegenden Gärten wieder. Die Wiesen waren verlassen. Der Wind kräuselte die Flut; in ihrem Grunde trieben lange Grasbüschel wie Haar von Leichen. Sie unterdrückte ihren Schmerz und hielt sich tapfer bis zum Abend. Aber dann in ihrer Kammer ergab sie sich ihm, warf sich lang hin auf die Matratze, preßte das Gesicht ins Kissen und preßte beide Fäuste an die Schläfen.
Erst lange darnach erfuhr sie, durch Viktors Kapitän, die näheren Umstände seines Todes. Er war am Gelben Fieber erkrankt, und man hatte ihn im Krankenhaus zu stark zur Ader gelassen. Vier Ärzte hatten ihn gehalten. Er war sogleich gestorben, und der Chefarzt hatte gesagt:
»Schön! Wieder einer!«
Seine Eltern hatten ihn immer schlecht behandelt. Sie wollte sie lieber nicht sehen; und sie wiederum kamen ihr nicht entgegen, sei es aus Vergeßlichkeit, sei es aus der Verhärtung, die das Unglück mit sich bringt.
Virginia wurde schwächer und schwächer.
Beklemmungen, Husten, beständiges Fieber und rote Flecken auf den Wangen verrieten eine tiefere Erkrankung. Herr Poupart riet zu einem Aufenthalt in der Provence. Frau Aubain entschloß sich dazu und hätte Virginia sofort nach Hause genommen, wenn das Klima von Pont-l'Évêque nicht zu rauh gewesen wäre.
Sie traf ein Abkommen mit einem Wagenvermieter, der sie nun an jedem Dienstag nach dem Kloster fuhr. Von einer Terrasse im Garten war die Seine zu sehen. Dort ging Virginia am Arme der Mutter über gefallenes Weinlaub auf und nieder. Man sah die Segel in der Ferne und den ganzen Himmelsrand vom Schloß Tancarville bis zu den Leuchttürmen von Le Havre. Manchmal, wenn die Sonne durch die Wolken brach, mußte sie die Lider halb schließen. Später wurde in der »Laube« gerastet. Die Mutter hatte ein Fäßchen vorzüglichen Malaga angeschafft. Mit dem Scherz, sie werde sich berauschen, trank die Kranke einen Schluck, aber nicht mehr.
Sie kam etwas zu Kräften. Der Herbst ging gemächlich hin. Felicitas sprach Frau Aubain Mut ein. Aber eines Abends, als sie in der Nachbarschaft eine Besorgung gemacht hatte, fand sie Herrn Pouparts Dogcart vor der Tür; er selber stand im Flur. Frau Aubain band ihren Hut.
»Bring Sie mir meine Wärmflasche, meine Börse, meine Handschuhe! Rasch, rasch!«
Virginia hatte Lungenentzündung. Ob es hoffnungslos wäre?
»Noch nicht!« sagte der Arzt; und die beiden stiegen in wirbelndem Schneegestöber in den Wagen. Die Nacht brach an. Es war bitterkalt.
Felicitas lief in die Kirche, um eine Kerze anzuzünden. Dann rannte sie dem Wagen nach, erreichte ihn in einer Stunde, sprang flink hintenauf und hielt sich an den Federn fest. Plötzlich kam ihr der Gedanke: »Der Hof ist nicht abgesperrt! Wenn Diebe kämen!« Und sie sprang wieder ab.
Am andern Morgen, bei Tagesanbruch, begab sie sich zum Doktor. Er war bereits zu Haus gewesen und wieder aufs Land gefahren. Dann hielt sie sich im Gasthof auf, weil sie sich einbildete, Fremde würden ihr einen Brief bringen. Schließlich, schon gegen Abend, stieg sie in die Post nach Lisieux.
Das Kloster lag am Ende einer abschüssigen Gasse. Als sie in der Mitte war, hörte sie seltsame Klänge, Totengeläut.
»Das ist für jemand anders!« dachte sie und ließ heftig den Klopfer schlagen.
Nach ein paar Minuten schlürften Schlappschuhe heran. Die Tür ging halb auf, und eine Nonne erschien.
Die gute Schwester sagte in trübseligem Tone: »Sie ist eben verschieden!«
Zugleich setzte das Glöcklein von Sankt Leonhard doppelt laut ein.
Felicitas ging die Treppe hinauf.
Schon an der Schwelle des Zimmers sah sie Virginia liegen, auf dem Rücken, die Hände gefaltet, den Mund offen und den Kopf hintenüber, unter einem schwarzen Kreuz, das sich über sie neigte, und zwischen starren Gardinen, die weniger weiß waren als ihr Gesicht. Frau Aubain kniete zu Füßen des Bettes, hielt es mit den Armen umklammert und schluchzte krampfhaft. Die Oberin stand zur Rechten. Drei brennende Kerzen auf der Kommode schimmerten wie rote Flecke, und vor den Fenstern wallte weißer Nebel. Nonnen führten Frau Aubain hinaus.
Zwei Nächte lang wich Felicitas nicht von der Toten. Sie betete immer wieder von neuem dieselben Gebete, sprengte Weihwasser auf das Bett, setzte sich wieder und schaute sie an. Am Ende der ersten Nachtwache bemerkte sie, daß das Gesicht gelb geworden war, die Lippen blau, daß sich die Nase zuspitzte und die Augen einsanken. Sie küßte sie mehrere Male, und sie wäre gar nicht weiter verwundert gewesen, wenn Virginia sie wieder aufgeschlagen hätte. Für ein solch Gemüt ist das Übernatürliche ureinfach. Sie kleidete sie an, hüllte sie in ihr Totenhemd, legte sie in den Sarg, setzte ihr einen Kranz auf und löste ihr das Haar. Es war blond und ungemein lang. Felicitas schnitt sich eine dicke Strähne ab und steckte die Hälfte davon in ihren Busen, entschlossen, sich nie davon zu trennen.
Der Sarg Wurde nach Pont-l'Évêque überführt. So hatte es Frau Aubain angeordnet. Sie folgte dem Leichenwagen in einer geschlossenen Kutsche.
Nach der Messe ging es auf den Friedhof. Man brauchte dreiviertel Stunden dahin. Paul eröffnete den Zug. Er schluchzte. Herr Bourais folgte ihm; dann kamen die angesehensten Einwohner, die Frauen in schwarzen Schleiern. Zuletzt Felicitas. Sie dachte an ihren Neffen, und da sie ihm die letzte Ehre nicht hatte erweisen können, war ihre Trübsal doppelt groß, als begrübe man beide zugleich.
Frau Aubains Verzweiflung war grenzenlos.
Zuerst klagte sie Gott an, nannte es Ungerechtigkeit, daß er ihr die Tochter genommen, ihr, die nie etwas Böses getan habe, deren Gewissen so rein sei! Aber nein! Sie hätte sie nach dem Süden bringen sollen. Andere Ärzte hätten sie gerettet! Sie machte sich Vorwürfe, wollte ihr folgen, schrie in ihren Träumen vor Angst auf. Einer vor allem quälte sie. Ihr Mann, in Matrosentracht, kehrte von einer langen Seefahrt zurück und sagte ihr unter Tränen, daß er den Auftrag habe, Virginia mitzunehmen. Dann beratschlagten sie miteinander, um ein Versteck für sie ausfindig zu machen.
Einmal kam sie ganz verstört aus dem Garten ins Haus zurück. Eben waren ihr – und sie zeigte die Stelle – Vater und Tochter erschienen, eins neben dem anderen. Sie hatten nichts getan, sie nur angeblickt.
Während mehrerer Monate blieb sie teilnahmlos in ihrem Zimmer. Felicitas redete ihr sanft zu. Sie müsse sich erhalten, ihrem Sohne zuliebe und auch zu »ihrem« Gedächtnis.
»Ihrem?« wiederholte Frau Aubain, als erwache sie aus einem Traum. »Ach! Das besorgst du ja! Du vergißt sie nicht!«
Damit meinte sie den Friedhof, den zu besuchen ihr aufs strengste untersagt war.
Felicitas pilgerte Tag für Tag hin.
Schlag vier Uhr ging sie die Häuser entlang, erstieg die Anhöhe, öffnete das Gittertor und trat vor Virginias Grab. Das war eine kleine Säule aus hellrotem Marmor, eine Platte darunter, davor ein von Ketten umfriedetes Gärtchen. Die Steine der Gruft verschwanden unter Blumen. Sie begoß die Pflanzen, streute frischen Sand auf, kniete nieder, um die Erde besser lockern zu können. Für Frau Aubain war es eine Erleichterung, eine Art Trost, als sie selber hingehen durfte.
Dann verstrichen die Jahre, eins wie das andere, ohne andere Ereignisse als die Wiederkehr der großen Feste: Ostern, Himmelfahrt, Allerheiligen. Häusliche Geschehnisse gaben Daten ab, auf die man sich später bezog. So verkitteten 1825 zwei Glaser die Fenster im Flur; 1827 stürzte ein Stück vom Dach in den Hof und hätte beinahe einen Mann erschlagen. Im Sommer 1828 hatte die gnädige Frau das »Heilige Brot« zu spenden. Seit dieser Zeit unternahm Bourais geheimnisvolle Reisen, und die alten Bekannten traten eines nach dem anderen vom Schauplatz ab: Guyot, Liébard, Frau Lechaptois, Robelin, der Onkel Gremanville, der seit langem vom Schlage gelähmt war.
Eines Nachts brachte der Postschaffner nach Pont-l'Évêque die Nachricht von der Juli-Revolution (1830). Wenige Tage darnach wurde ein neuer Unterpräfekt ernannt: der Baron von Larsonnière, der Konsul in Amerika gewesen war und außer seiner Frau seine Schwägerin mit drei schon ziemlich großen Töchtern mitbrachte. Man sah sie in flatternden Blusen auf ihrem Rasenplatz. Sie hatten einen Neger und einen Papagei. Frau Aubain empfing ihren Besuch und verfehlte nicht, ihn zu erwidern. Wenn sie sich von ferne zeigten, meldete Felicitas es schleunigst ihrer Herrin. Aber nur eines vermochte sie zu erregen: die Briefe ihres Sohnes.
Er kam nicht dazu, sich einem Berufe zu widmen, weil ihn die Wirtshäuser in Beschlag nahmen. Sie bezahlte seine Schulden; er machte neue. Und wenn Frau Aubain am Fenster bei ihrem Strickzeug seufzte, konnte es Felicitas, die in der Küche ihr Spinnrad drehte, hören.
Sie gingen zusammen am Spalier auf und ab und sprachen immer von Virginia. Sie fragten einander, ob dies oder jenes ihr gefallen hätte; was sie bei der oder jener Gelegenheit wohl gesagt haben würde.
Ihre kleine Hinterlassenschaft war im Stübchen mit den zwei Betten in einem Wandschrank untergebracht. Frau Aubain sah so selten wie möglich nach. Eines Sommertags bequemte sie sich dazu – und Schmetterlinge flogen aus dem Spind.
Virginiens Kleider hingen aneinandergereiht unter einem Brett, worauf drei Puppen, Spielreifen, ein Besteck und der Napf, den sie in Gebrauch gehabt, ihren Platz hatten. Sie nahmen auch die Unterröcke, die Strümpfe, die Taschentücher vor und breiteten sie auf den beiden Betten aus, ehe sie sie wieder zusammenlegten. Die Sonne schien auf diese armseligen Sachen und zeigte die Flecken und Falten, die sich durch die Körperbewegungen gebildet hatten. Die Luft war warm und blau. Eine Amsel zwitscherte. Ringsum war wonniger Frieden. Sie fanden einen kleinen Hut aus langhaarigem kastanienbraunem Plüsch; aber er war ganz von Motten zerfressen. Felicitas bat ihn sich aus. Beider Augen blickten starr ineinander und füllten sich mit Tränen. Da öffnete die Herrin die Arme, und die Magd warf sich hinein; sie umschlangen sich und stillten ihren Schmerz in einem Kuß, der sie einander gleich machte.
Das war das erstemal in ihrem Leben, denn Frau Aubain war keine mitteilsame Natur. Felicitas war ihr dafür dankbar wie für eine Wohltat und liebte sie von da an mit der Treue eines Hundes und in frommer Verehrung.
Ihre Herzensgüte entfaltete sich.
Wenn sie auf der Straße die Trommeln eines durchmarschierenden Regiments vernahm, trat sie vor die Türe mit einem Krug Apfelwein und gab den Soldaten zu trinken. Sie pflegte Cholerakranke. Sie nahm sich polnischer Flüchtlinge an, und einer von ihnen erklärte sogar, er wolle sie heiraten. Aber sie entzweiten sich; denn eines Morgens, als sie von Angelus heimkam, fand sie ihn in ihrer Küche, wo er sich eingeschlichen hatte, bei einer Schüssel kalter Essigtunke, die er in Gemütsruhe auslöffelte.
Nach dem Polen kam Vater Colmiche, ein alter Mann, von dem es hieß, er habe Anno 93 Schandtaten verübt. Er lebte am Ufer des Flusses in einem verfallenen Schweinekoben. Die Gassenjungen belauerten ihn durch die Risse im Mauerwerk und warfen Steine hinein, die auf sein erbärmliches Bett fielen. Dort lag er, von beständigem Katarrh geschüttelt, mit überlangem Haar, entzündeten Lidern und einer Geschwulst am Arm, die größer war als sein Kopf. Sie versah ihn mit Wäsche, reinigte seinen Stall, so gut es ging, und träumte davon, ihn in der Backstube unterzubringen, ohne daß er die gnädige Frau belästige. Als das Geschwür aufgegangen war, verband sie ihn Tag für Tag, brachte ihm manchmal Kuchen, setzte ihn auf ein Bund Stroh in die Sonne, und der arme Alte dankte ihr sabbernd und zitternd mit seiner erloschenen Stimme. Vor Angst, sie zu verlieren, streckte er die Hände aus, sowie er sie fortgehen sah. Er starb. Sie ließ eine Messe für die Ruhe seiner Seele lesen.
Am nämlichen Tage widerfuhr ihr ein großes Glück. Zur Essenszeit erschien der Neger der Frau von Larsonnière und brachte den Papagei im Käfig, dazu die Stange, die Kette und das Schloß. Ein Briefchen der Baronin vermeldete Frau Aubain, daß ihr Mann eine Präfektur bekommen habe und sie am Abend den Ort zu verlassen gedächten. Sie bat, den Vogel als Andenken und Zeichen ihrer Hochschätzung annehmen zu wollen.
Felicitas hatte sich in Gedanken schon seit langem mit dem Vogel beschäftigt. Er war aus Amerika, und dieses Wort erinnerte sie so sehr an Viktor, daß sie sich von dem Neger davon erzählen ließ. Einmal hatte sie sogar gesagt: »Die gnädige Frau wäre glücklich, wenn der Papagei ihr gehörte!«
Der Schwarze hatte dieses Gespräch seiner Herrin berichtet, und da sie das Tier sowieso nicht mitnehmen konnte, entledigte sie sich seiner auf diese Weise.
Kapitel4
Er hieß Lulu. Am Leibe war er grün, an den Flügelspitzen rosa, an der Stirn blau und an der Kehle goldig. Leider hatte er lästige Unarten. Er zerbiß seine Stange, rupfte sich Federn aus, warf seinen Unrat umher und verschüttete das Wasser seines Badekästchens. Als Frau Aubain seiner überdrüssig ward, schenkte sie ihn Felicitas für immer.
Sie begann ihn in die Schule zu nehmen. Bald sprach er ihr nach: »Lieber Junge! Ihr Diener, mein Herr! Gruß dir, Maria!« Er hatte seinen Platz an der Tür. Allgemein wunderte man sich, daß er nicht auf den Namen »Jakob« hörte, da doch alle Papageien »Jakob« heißen. Man sagte, er sei eine »dumme Pute!« – ein »stumpfsinniger August!« Das versetzte Felicitas jedesmal einen Dolchstoß! Was für ein sonderbarer Eigensinn auch von Lulu, mit sprechen aufzuhören, sobald man ihn ansah!
Trotzdem sehnte er sich nach Gesellschaft. Denn am Sonntag, wenn die Fräuleins Rochefeuille, Herr von Houppeville und neue Freunde, der Apotheker Onfroy, Herr Varin und der Landwehrhauptmann Malhieu ihr Spielchen machten, schlug er mit den Flügeln an die Scheiben und gebärdete sich so unbändig, daß man sein eigenes Wort nicht verstand.
Bourais kam ihm offenbar sehr spaßig vor. Sobald er seiner ansichtig ward, begann er zu lachen, zu lachen, so laut er nur konnte. Sein Gelärm scholl über den ganzen Hof, und das Echo wiederholte es. Die Nachbarn kamen an die Fenster und lachten ebenfalls. Damit der Vogel ihn nicht bemerke, duckte sich Herr Bourais an der Mauer hin und verdeckte sein Gesicht mit dem Hut. So schlich er bis zum Fluß und trat dann durch die Gartenpforte ein, wobei die Blicke, die er dem Vogel zuwarf, nicht gerade zärtlich waren.
Lulu hatte einmal von dem Fleischergesellen einen Nasenstüber erhalten, weil er sich erlaubt hatte, den Kopf in seinen Korb zu stecken. Seitdem suchte er stets, ihn durch sein Hemd zu zwicken. Fabu drohte, er werde ihm den Hals umdrehen, obwohl er kein grausamer Mensch war, trotz der Tätowierung auf seinem Arm und seinem großen Backenbart. Im Gegenteil, er hatte geradezu eine Vorliebe für den Papagei, und die ging so weit, daß er ihm zum Spaß Flüche beizubringen versuchte. Felicitas, die derlei garstig fand, stellte den Vogelkäfig in die Küche. Dem Vogel ward die Kette abgenommen, und er spazierte frei im Haus umher.
Wenn er die Treppe hinunterwollte, stemmte er seinen krummen Schnabel auf die Stufen, hob erst den rechten Fang, dann den linken. Felicitas war in tausend Ängsten, er könne bei dieser Turnerei Schwindel bekommen. In der Tat wurde er krank, konnte weder fressen noch sprechen. Es hatte sich unter seiner Zunge eine Verdickung gebildet, wie sie die Hühner bisweilen haben. Sie heilte ihn, indem sie die kleine Geschwulst mit den Nägeln herausriß. Eines Tages war Herr Paul so unverständig und blies ihm Zigarrenrauch in die Nasenlöcher. Ein andermal reizte ihn Frau Lormeau mit der Spitze ihres Sonnenschirms; da riß er ihm die Zwinge ab. Schließlich war er verschwunden.
Sie hatte ihn aufs Gras gesetzt, damit er sich erfrische, und sich einen Augenblick entfernt; und wie sie wiederkam, war kein Papagei mehr da! Sie suchte ihn zunächst in den Büschen, am Flußufer und auf den Dächern, ohne auf ihre Herrin zu hören, die ihr nachrief:
»Sei nur vorsichtig! Du bist verrückt!«
Dann suchte sie alle Gärten von Pont-l'Évêque ab, wobei sie die Vorübergehenden anhielt:
»Haben Sie zufällig vielleicht meinen Papagei gesehen?«
Wenn jemand den Papagei nicht kannte, beschrieb sie ihn. Auf einmal glaubte sie unten am Hügel hinter den Mühlen etwas Grünes flattern zu sehen. Aber auf dem ganzen Hügel war nichts! Ein Hausierer versicherte ihr, er habe ihn »gleich vorhin« in Saint-Melaine im Laden der Mutter Simon gesehen. Felicitas lief hin. Man verstand nicht, was sie wollte. Schließlich kehrte sie zurück, ganz erschöpft, die Hausschuhe zerrissen, totunglücklich; und wie sie so auf der Bank neben ihrer Herrin saß und erzählte, wo sie überall hingelaufen war, da fiel ihr eine leichte Last auf die Schultern: Lulu! – Weiß der Teufel, was er gemacht hattet Vielleicht einen Spaziergang in die Umgegend.
Von diesem schrecklichen Erlebnis erholte sie sich nur schwer, oder vielmehr, sie erholte sich niemals wieder.
Sie erkältete sich und bekam eine Halsentzündung; kurze Zeit danach ein Ohrenleiden. Nach drei Jahren war sie taub; sie sprach sehr laut, sogar in der Kirche. Obwohl ihre Sünden, ohne Schande für sie und ohne Anstoß in der Welt, bis in alle Winkel der Gemeinde hätten vernommen werden können, hielt es der Herr Pfarrer doch für angebracht, ihr die Beichte nur noch in der Sakristei abzunehmen.
Eingebildete Geräusche verwirrten sie vollends. Oft sagte ihre Herrin zu ihr:
»Gott, bist du dumm!«
Sie gab zur Antwort:
»Jawohl, gnädige Frau!« und begann um sich herum zu suchen.
Ihr kleiner Gedankenkreis verengte sich noch mehr. Glockengeläut und Rindergebrüll waren für sie nicht mehr vorhanden. Alle Wesen bewegten sich mit der Lautlosigkeit von Gespenstern. Nur ein einziges Geräusch kam ihr noch zu Gehör: die Stimme des Papageis.
Als wolle er sie unterhalten, ahmte er das Krick-Krack des Bratenwenders nach, den gellenden Ruf eines Fischhändlers, die Säge des Tischlers, der gegenüber wohnte; und wenn es an der Haustüre läutete, rief er wie Frau Aubain:
»Felicitas! Es klingelt! Es klingelt!«
Sie führten Zwiegespräche miteinander. Dabei wiederholte er bis zum Überdruß die drei Sätze seines Sprachschatzes, und sie antwortete mit Worten, die auch nicht mehr Zusammenhang hatten, in denen aber ihr Herz überströmte. In ihrer Vereinsamung war ihr Lulu schier ein Sohn, ein Geliebter. Er kletterte auf ihre Finger, knapperte an ihren Lippen, krallte sich an ihr Busentuch, und wenn sie die Stirn senkte und den Kopf wiegte, wie es die Ammen tun, flatterten die großen Flügel der Haube und die Fittiche des Vogels um die Wette.
Wenn die Wolken sich türmten und der Donner grollte, stieß er, vielleicht in Erinnerung an die Regengüsse im heimatlichen Walde, laute Schreie aus. Das Rieseln des Wassers steigerte seine Raserei. Er flatterte außer sich hin und her; schoß zur Decke hinauf; warf alles um und entwich durch das Fenster, um im Garten einherzuwaten, kam aber schnell wieder auf einen der Schemel zurück und zeigte, hüpfend, um seine Federn zu trocknen, bald seinen Schwanz, bald seinen Schnabel.
Eines Morgens in dem furchtbaren Winter von 1837, als sie ihn der Kälte wegen vor den Herd gestellt hatte, fand sie ihn mitten in seinem Käfige tot, den Kopf nach unten, die Krallen in den Stangen. Zweifellos hatte ihn ein Blutschlag getötet. Sie glaubte, er sei durch Petersilie vergiftet worden, und ohne daß sie irgendeinen Beweis dafür hatte, fiel ihr Verdacht auf Fabu.
Sie weinte dermaßen, daß ihre Herrin zu ihr sagte:
»Weißt du? Laß ihn doch ausstopfen?«
Sie fragte den Apotheker, der immer gut zu ihrem Papagei gewesen war, um Rat. Der schrieb nach Le Havre.
Ein gewisser Fellacher übernahm derlei Arbeiten. Da aber auf der Post manchmal Pakete verlorengehen, entschloß sie sich, den toten Vogel persönlich nach Honfleur zu bringen.
Längs der Straße waren die Apfelbäume kahl, einer wie der andere. Die Gräben waren von Eis bedeckt. An den Gehöften bellten Hunde. Die Hände unter ihrem Umhänge, schritt sie in ihren schwarzen Halbschuhen dahin, Ihren Korb am Arm, auf der Mitte der gepflasterten Heeresstraße.
Sie durchquerte den Wald; bald hatte sie Haute-Chêne hinter sich und erreichte Saint-Gatien.
In eine Staubwolke gehüllt, dahinstürmend wie eine Windhose, im scharfen Tempo der Talfahrt, kam rückwärts ein Postwagen angerast. Als der Schaffner die Frau bemerkte, die sich in ihrem Gange nicht stören ließ, reckte er sich hoch, über das Verdeck weg, und auch der Kutscher schrie; aber die vier Pferde, die er nicht zurückzuhalten vermochte, liefen nur noch stärker. Die Vorderpferde streiften sie. Der Kutscher riß sie an den Zügeln zur Seite bis an den Fußsteig. Aber in seiner Wut holte er, in voller Fahrt, mit seiner langen Peitsche aus und versetzte ihr einen solchen Hieb vom Leib bis zum Nacken, daß sie rücklings hinfiel.
Als sie wieder zu sich kam, war es ihr erstes, daß sie ihren Handkorb aufmachte. Lulu war unversehrt. Ein Glück! Die rechte Wange brannte ihr. Sie griff mit den Händen daran. Sie waren rot. Das Blut rann herab.
Sie setzte sich auf einen Meilenstein, tupfte sich das Gesicht mit ihrem Sacktuche ab. Dann aß sie ein Stück Brot, das sie vorsorglich in den Korb getan hatte, und, indem sie den Vogel anschaute, tröstete sie sich ob ihrer Wunde.
Dann, auf der Höhe von Ecquemauville erblickte sie die Lichter von Honfleur, die wie eine Menge Sterne durch die Nacht flimmerten. Weiter weg dehnte sich das umrißlose Meer. Von Schwäche übermannt, mußte sie stehenbleiben. Und das Elend ihrer Kinderzeit, ihre fehlgegangene erste Liebschaft, die Abfahrt ihres Neffen, der Tod Virginias, alles das überflutete sie wie wildes Wasser, stieg ihr bis an die Kehle und nahm ihr den Atem.
Fellacher behielt den Papagei lange. Er versprach ihn von Woche zu Woche. Nach einem halben Jahre meldete er, eine Kiste sei abgegangen. Seitdem war nichts mehr zu hören. Man mußte annehmen, Lulu werde nimmer wiederkommen. »Er ist mir wohl gestohlen worden,« dachte sie.
Endlich kam er doch – und wie schön! Er saß aufrecht auf einem Baumast, der in einem Mahagonigestell stak, hielt einen Fang in die Höhe, den Kopf schräg, und im Schnabel hatte er eine Nuß, die der Ausstopfer aus Hang zum Großartigen vergoldet hatte.
Sie schloß ihn in ihre Kammer ein.
Dies Gemach, in das sie selten jemanden einließ, sah wie eine Kapelle und zugleich wie eine Trödelbude aus; so viele fromme Sachen und wunderliche Dinge waren darin.
Ein großer Schrank versperrte die halbe Tür. Gegenüber dem Fensterchen, von dem man den Garten überblickte, ging eine runde Luke nach dem Hof. Auf einem Tisch, neben dem Gurtenbett, sah man einen Wasserkrug, zwei Haarkämme, ein viereckiges Stück blaue Seife in einem bestoßenen Napf. An den Wänden hingen Rosenkränze, Denkmünzen, mehrere heilige Jungfrauen, ein Weihwasserbecken aus Kokosnuß. Auf der Kommode, die mit einem Tuch wie ein Altar bedeckt war, stand das Muschelkästchen, das ihr Viktor geschenkt hatte, ferner eine Gießkanne, eine bauchige Flasche, Schreibhefte, das Geographiebuch mit den Kupferstichen, ein Paar Kinderschuhe; und am Spiegelhaken, mit den Bändern angebunden, hing der kleine Plüschhut. Felicitas trieb diese sonderbare Pietät so weit, daß sie einen der Röcke des gnädigen Herrn aufbewahrte. Allen alten Plunder, den Frau Aubain bei Seite warf, nahm sie in ihre Stube. So hatte sie Papierblumen an der Kommode stecken und das Bild des Grafen von Artois in der Lukennische.
Vermittelst eines Brettchens wurde Lulu auf das Kaminrohr gesetzt, das ein Stück aus der Wand trat. Jeden Morgen, wenn sie aufwachte, erblickte sie ihn im dämmerigen Frühlicht und erinnerte sich der vergangenen Tage sowie geringfügiger Geschehnisse bis in die kleinsten Einzelheiten, ohne Schmerz, in voller Ruhe.
Da sie mit niemandem Umgang pflog, lebte sie im Stumpfsinn eines Schlafwandlers hin. Nur die Umzüge am Fronleichnam rüttelten sie auf. Da bettelte sie in der Nachbarschaft Wachskerzen und Strohmatten zusammen, um die Altarstation, die auf der Straße errichtet ward, auszuschmücken.
In der Kirche betrachtete sie immerfort das Symbol des Heiligen Geistes, wobei sie fand, es habe etwas von ihrem Papagei. Diese Ähnlichkeit war ihr noch auffälliger auf einem Epinaler Bilderbogen, der die Taufe des Herrn Jesu Christi darstellte. Mit seinen purpurroten Flügeln und seinem smaragdgrünen Leib war er wirklich das Abbild Lulus.
Sie kaufte das Blatt und hing es an den Platz des Grafen von Artois, so daß sie mit ein und demselben Blick den Vogel und auch das Bild sehen konnte. Beide vereinigten sich in ihren Gedanken. Der Papagei wurde durch diesen Zusammenhang mit dem Heiligen Geist geheiligt, und dieser ward ihr nun anschaulicher und begreiflicher. Der liebe Gott, meinte sie, hätte zu seinem Verkünder gar keine Taube wählen sollen, sondern besser einen Vorfahren Lulus. Felicitas betete im Anschauen des Bildes, aber hin und wieder wandte sie sich etwas nach dem Vogel.
Sie hatte Lust, in den Orden der heiligen Jungfrau zu treten. Frau Aubain brachte sie davon ab.
Ein wichtiges Ereignis geschah: Paul heiratete.
Zuerst war er Kanzlist bei einem Notar gewesen, dann Handlungsgehilfe, dann Zollbeamter, dann bei der Steuer, und sogar bei der Forst- und Wasserverwaltung hatte er sich zu betätigen versucht; da entdeckte er mit einem Male durch eine Eingebung des Himmels seinen Beruf: die Registratur. Hierzu offenbarte er so hohe Fähigkeiten, daß ein Registratur ihm seine Gönnerschaft zugleich mit seiner Tochter anbot.
Paul, der ein gesetzter Mann geworden war, führte sie seiner Mutter zu. Die Braut machte sich über das Tun und Treiben zu Pont-l'Évêque lustig, spielte die Prinzessin und kränkte Felicitas. Bei ihrer Wiederabreise atmete Frau Aubain auf.
In der Woche darauf ward der Tod des Herrn Bourais bekannt, der in der Nieder-Bretagne in einem Gasthofe erfolgt war. Das Gerücht, er habe Selbstmord verübt, bestätigte sich, und es erhoben sich Zweifel an seiner Rechtschaffenheit. Frau Aubain prüfte ihre Abrechnungen nach und kam alsbald hinter eine Reihe von Schändlichkeiten: Zinsenunterschlagungen, heimliche Holzverkäufe, gefälschte Quittungen usw. Überdies hatte er ein uneheliches Kind und »ein Verhältnis mit einem Frauenzimmer« in Dozulé.
Diese Gemeinheiten betrübten sie tief. Im März 1853 wurde sie von Brustschmerzen befallen. Ihre Zunge war wie mit Rauch belegt. Blutegel hoben die Beschwerden nicht, und am neunten Abend verschied sie, genau zweiundsiebzig Jahre alt.
Für so betagt hatte man sie nicht gehalten wegen ihres braunen Haares, das gescheitelt ihr blasses pockennarbiges Gesicht umrahmte. Nur wenige Freunde trauerten ihr nach, weil ihr Benehmen so hochmütig gewesen, daß man ihr ferngeblieben war.
Felicitas beweinte sie, wie keine Herrschaft beweint wird. Daß die gnädige Frau das Zeitliche vor ihr gesegnet hatte, wollte ihr gar nicht in den Kopf. Das dünkte sie wider die Ordnung der Dinge, unzulässig, ungeheuerlich.
Zehn Tage darauf – so lange braucht man von Besançon nach Pont-l'Évêque – trafen die Erben ein. Die Schwiegertochter durchstöberte alle Schubkästen, wählte Möbelstücke aus, verkaufte die andern. Dann fuhren sie nach dem Orte der Registratur zurück.
Der Großvaterstuhl der gnädigen Frau, ihr Nähtisch, ihr Fußwärmer, die acht Stühle waren weg! Die Stellen, wo die Stiche gehangen, hoben sich als gelbe Vierecke an den Wänden ab. Die beiden Bettstellen samt den Matratzen waren mitgenommen worden, und im Wandschränke war von allen den Sachen Virginias nichts mehr zu erblicken! Felicitas lief, trunken vor Trübsal, von einem Stock in den andern.
Anderntags klebte an der Haustür ein Anschlag. Der Apotheker schrie ihr ins Ohr, das Haus sei zu verkaufen.
Sie taumelte und mußte sich setzen.
Was sie hauptsächlich trostlos machte, war der Gedanke, daß sie nun wohl ihre Kammer verlassen mußte, in der sich der liebe Lulu so wohl fühlte. Den Blick voller Herzensnot auf ihn geheftet, flehte sie den Heiligen Geist an und gewöhnte sich fortan wie eine Götzendienerin, ihre Gebete kniend vor dem Papagei herzusagen. Manchmal traf die Sonne, die durch die Luke eindrang, sein Glasauge und entlockten ihm einen sprühenden Strahl, der sie in Verzückung versetzte.
Ihre Herrin hatte ihr ein Jahresgeld von einhundertfünfundzwanzig Talern vermacht. Der Garten lieferte ihr Gemüse. An Kleidern hatte sie so viel, daß es wohl bis an ihr Lebensende langte, und Beleuchtung brauchte sie nicht, da sie zu Bett ging, sobald es dunkel ward.
Sie ging ganz selten aus, um nicht am Laden des Trödlere vorbei zu müssen, wo etliche der alten Möbel feilstanden. Seit ihrem Schwindelanfall hinkte sie auf einem Beine. Und als ihre Kräfte abnahmen, kam die alte Simon, die ihr Vermögen bei ihrem Kolonialwarenhandel eingebüßt hatte, jeden Morgen, um ihr Holz zu spalten und Wasser zu plumpen.
Ihre Augen wurden schwach. Die Holzläden blieben geschlossen. Und so ging Jahr auf Jahr dahin. Das Haus fand weder einen Mieter noch einen Käufer.
Aus Furcht; man könne sie hinaussetzen, verlangte Felicitas keine Ausbesserung. Die Latten des Dachstuhles faulten. Einen ganzen Winter hindurch tropfte es alle Tage auf ihr Lager. Nach Ostern bekam sie Blutspucken.
Da holte die alte Simon den Doktor. Felicitas wollte wissen, was ihr fehle. Aber, schwerhörig wie sie war, verstand sie bloß das eine einzige Wort: »Lungenentzündung.« Das war ihr bekannt, und so erwiderte sie leise:
»Aha! Wie die gnädige Frau!«
Sie fand es in der Ordnung, daß sie hierin ihrer Herrschaft Folge leistete.
Die Zeit der Ruhe-Altäre kam heran.
Der erste Altar stand immer am Fuße des Hügels; der zweite vor der Post; der dritte ungefähr in der Mitte der Hauptstraße. Wegen dieses letzteren kam es zu Streiterei, und die Frauen der Gemeinde wählten schließlich den Aubainschen Hof.
Atemnot und Fieber nahmen zu. Felicitas grämte sich, daß sie nicht auch etwas für den Altar tun konnte. Wenn sie nur wenigstens etwas daraufzustellen hätte! Da dachte sie an den Papagei. Das sei nicht angängig, wandten die Nachbarinnen ein. Aber der Herr Pfarrer gab die Erlaubnis. Darüber war sie so glücklich, daß sie ihn bat, wenn sie tot wäre, Lulu, ihren einzigen Schatz, anzunehmen.
Vom Dienstag bis zum Sonnabend, den Tag vor Fronleichnam, hustete sie immer mehr. Am Abend war ihr Gesicht zusammengeschrumpft; die Lippen klebten ihr am Zahnfleisch. Sie erbrach mehrere Male, und am anderen Morgen, ganz in der Frühe, ließ sie einen Geistlichen holen.
Während der letzten Ölung weilten drei Frauen bei ihr. Darauf erklärte sie, sie müsse mit Fabu sprechen.
Er kam im Sonntagsstaate, und in der dumpfen Luft war ihm unbehaglich.
»Vergebt mir!« flüsterte sie und bemühte sich, den Arm auszustrecken. »Ich habe geglaubt, Ihr hättet ihn umgebracht.«
Was sollte dies Geschwätz bedeuten? Daß man ihn im Verdacht eines Mordes gehabt, einen Mann wie ihn! Er war entrüstet und wollte Lärm schlagen.
»Sie ist nicht mehr bei Sinnen! Das seht Ihr doch!«
Von Zeit zu Zeit redete Felicitas mit Erscheinungen. Die alten Weiber entfernten sich. Die Simon frühstückte.
Eine Weile später nahm sie Lulu und hielt ihn Felicitas hin.
»Da! Nehmt Abschied von ihm!«
Obwohl er einbalsamiert war, zerfraßen ihn doch die Würmer. Ein Flügel war gebrochen. Das Werg quoll ihm aus dem Leibe. Blind, wie sie nun war, küßte sie ihn doch auf die Stirn und drückte ihn an ihre Wange. Die alte Simon nahm ihn dann wieder und trug ihn auf den Altar.
Kapitel5





























