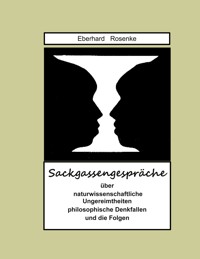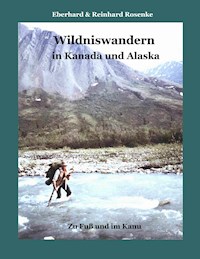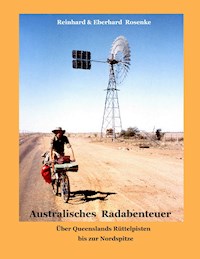Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Warum zu Fuß von München nach Berlin? Weil es der Lebensweg rückwärts ist. Aber auch: damit der Weg lang genug ist, dass der Wanderer Zeit zur inneren Entleerung hat. Gefragt ist Zähigkeit, um all die kleinen Hindernisse unterwegs zu überwinden. Aber jeder, der schon gewandert ist, weiß: Anstrengungen werden belohnt, es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Rosenke schläft meist draußen, schaut in den Sternenhimmel, wird von Blitz, Donner und Regengüssen heimgesucht. Die Vorräte gehen ihm aus, er kommt vom Weg ab, wird von Blutsaugern gequält, vom Hund gebissen. Dieses Buch kann als Anleitung, Erlebnisbericht, Wanderphilosophie, Reiseführer, Autobiographie oder Zeitspiegel gelesen werden. Es zeigt eine Möglichkeit, Freiheit zu realisieren: In der Balance von Wandern und Alltag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Tag:
Von München nach Freising
Der Rucksackdeutsche läuft sich ein und blickt zurück. Es regnet.
Tag:
Weiter nach Landshut
Wanderers Leid. Ein Klagelied auf die Isar. Ein bedrohliches Kruzifix. Hitze.
Tag:
Kloster Mallersdorf
Selbstvorwürfe. Trost der Philosophie. Marterln, schwere Beine, eine Wasserspende. Die Sonne brennt.
Tag:
Walhalla
Eine Achillessehne klopft, ein See lächelt, ein Ahnenschrein lockt.Heimatschwere. Der wiedergefundene Becher. Gluthitze.
Tag:
Regensburg
Ein Perfektionist rackert. Stadtführung. Marc Aurel, Johannes Kepler und das Tausendjährige Reich leben auf.
Tag:
Im Laaber-Land
Der Rucksackdeutsche trifft einen Artgenossen. Ein Gespräch über Erich Honecker. Verschiedene Sichten auf den Sternenhimmel.
Tag:
Main-Donau-Kanal
Der Rucksackdeutsche singt Jugendlieder, verirrt sich und schaut in die Wolken. Verregnete Nacht.
Tag:
Nürnberg
Der Rucksackdeutsche trocknet seine Sachen, tauscht verdorbenes Geld um und besucht die Warenwelt. Exkurs über Höflichkeit. Großer Abendhimmel.
Tag:
Nochmal Nürnberg
Etwas Gewaltiges. Silberbuck und Silbersee. Stadtrundgang.
Tag:
Dampferfahrt
Ein Lebenslauf. Bordleben. Noch ein Lebenslauf.
Tag:
Fränkische Schweiz
Ein göttlicher Morgen und der Schatten der Vergangenheit. Widerstreit zwischen Planung und Abenteuer. Ein verrückter Hund.
Tag:
Coburg
Der Staffelberg. Vierzehnheiligen und sechzehn Nothelfer. Fluch der Reinheit.Lutherzimmergedanken. Der Coburger Convent.
Tag:
Über die Grenze
Sozialistisches Weltniveau, deutsche Sauerkocher, Unterhosenkultur.Regen und andere Sachzwänge. Laufheroismus. Ein Etwas ohne Kontur.
Tag:
Durch den Thüringer Wald
Das Rennsteiglied. Vom Wert des Wanderns. Ein Sturz und seine Folgen.Der Rucksackdeutsche steigt auf den Kickelhahn und galloppiert nach Ilmenau.Arnstädter Gasthausabenteuer.
Tag:
Erfurt
Christus oder Spartakus, Meister Eckhart und Bruder Martin. Arbeitslosengespräche. Stadtgang durch Geschichte und Gegenwart. Nässe.
Tag:
Weimar und Buchenwald
Glanz und Elend der deutschen Sprache. Eine Muse. Goethes
Faust
und die Götter. Täuschungen. Antifaschismus und Steinzeit. Regen.
Tag:
Saaleabwärts
Das Harte und das Weiche. Über gute Menschen und Übermenschen.Schrankenabenteuer. Kösen, Naumburg, Weißenfels.
Tag:
Leipzig
Der Rucksackdeutsche besucht Seume. Ärger mit der Post. Ulbricht und der dritte Teil des
Faust
. Völkerschlachten und Donnerwetter.
Tag:
Halle
Rostige Brücke, verrottete Kombinate. Naturwissenschaft und Merseburger Zauber-sprüche. Mit der Straßenbahn über Land.Händelfestspiele. Die Nacht am Giebichenstein.
Tag:
Endlose Felder
Vergangenheitstourismus. Honeckers Lieblingslied. Rübenduft, Sonnenblumen und Sonnendank. Der Rucksackdeutsche steigt in den Erinnerungskeller.
Tag:
Bitterfeld
Schwarzes Gold. Im Cafehaus. Vom Sozialistischen Realismus zu Paul Gerhardt.Maschinenmonster. Mondlandschaften und der Wert der Arbeit.
Tag:
Dessauer Gartenreich
Russenlager. Das Betonschwellensymbol. Vater Franz und Väterchen Stalin.Ein Verkehrsunfall. Hotelzimmer in Wittenberg.
Tag:
Im Fläming
Lutherische Kaderschmiede. Der Protestant und das Auge Gottes. Kiefern und Sand. Der Rucksackdeutsche bekommt seinen Namen. Lob des Tagebuchs.
Tag:
Am Schwielow-See
Bauerngeschichten. Alte Heimat, alter Gewaltmarsch. Ein preußischer Don Quichote. Zum letzenmal Sternenhimmel.
Tag:
Über Potsdam nach Berlin
Sanssouci, Friedrich der Schurke und der Geist von Potsdam.Dampferfahrt nach Berlin. Die Macht des Wassers. Vom Hundemenschen.Politologie des Drecks. Atomtod.
Rückfahrt
1. Tag:
Von München nach Freising
Der Rucksackdeutsche läuft sich ein und blickt zurück. Es regnet.
Gestern noch lag München unter der ausgezehrten Luft südlicher Breiten. Für eine dritte Maiwoche anno 1993 war das Wetter ungewöhnlich heiß, so daß ich einen Moment zögerte, den Pullover einzupacken. Heute schaut der Tag naßgrau durchs Stiegenhausfenster, die Welt ist wieder in Ordnung. Karin schließt die Wohnungstür ab, wir gehen die Treppe hinunter. Die Wohnungstür ist jetzt mindestens tausend Kilometer entfernt, doch mit jeder Stufe, die ich hinabsteige, komme ich ihr näher. Wozu der riesige Umweg? Diese Frage kommt zu spät, es gibt kein Zurück. Unser Abschiedsritual vor der Haustür überspielt dieselbe Paradoxie: daß man sich nah und doch schon fern ist. Ich blicke Karin nach, die zur Arbeit in die nahe Firma eilt, und steige dann weiter hinab: in den U-Bahn-Schacht.
Alle Augenblicke rollt ein Zug in den Bahnhof. Hinter seinen Fenstern, im fahlen Licht, dösen die Arbeitssklaven. Ich, gestern noch einer von ihnen, fahre in die entgegengesetzte Richtung. An der Isar kehre ich zur Erdoberfläche zurück, erhasche vom Hochufer einen Blick auf Münchens Schokoladenseite und beginne meinen Spaziergang nach Berlin. Vor mir liegen gute fünfhundert Kilometer Luftlinie, in der Vertikalen sind es knappe fünfhundert Meter. Die abstrakten Raummaße stehen also fest, ebenso das Zeitmaß des Urlaubs, doch in der Wahl der Richtung bleibt mir etwas Freiheit. Noch freier bin ich in der fünften Dimension, die ich dem Geist, der Phantasie, der Erinnerung widme.
Münchens Schokoladenseite
Die Isar plätschert matt von Wehr zu Wehr, matt sind die Farben des Au-Waldes unter der Hochnebelwatte, und allmählich ermattet der Körper, der sich erst an den Rucksack gewöhnen muß. Da der umherschweifende, auf neue Reize lauernde Wahrnehmungssinn keine Nahrung findet, wendet sich die Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. Da wäre der Rucksack. Wenn ich sein Gewicht als Maß der Vorsorge betrachte, dann ist meine Besorgnis 25 Pfund schwer. Sie erstreckt sich auf schlechtes Wetter: Schlafsack, Zeltbahn und Regenumhang; auf die Füße: ein zweites Paar Schuhe; auf die Orientierung: ein Paket Landkarten; auf Essen und Trinken: Brotbeutel und Wasserflasche.
Johann Gottfried Seumes Gepäck auf seinem berühmten Spaziergang nach Syrakus des Jahres 1800 war auch nicht schwerer, aber anders sortiert. Außer Frack, Westen, Hosen, Strümpfen, Hals- und Schnupftüchern, Schuhen und Pantoffeln, Flickbeutel und Bürste hatte er noch eine Bibliothek antiker Schriftsteller bei sich: Homer, Theokrit, Anakreon, Plautus, Horaz, Vergil, Tacitus, Sueton, Terenz, Catull, Tibull und Properz. Seine Sorge richtete sich also in erster Linie auf zivilisiertes Auftreten und geistige Nahrung. Mit der Kleiderordnung hat es unsereiner leichter. Die Welt ist nicht mehr nach Ständen geordnet, die alten Eliten wurden gründlich abgemetzelt, heute sind auch Vogelscheuchen manierlich gekleidet. Seume, der wegen seiner Italien-Reise die Stellung eines Korrektors beim Göschen-Verlag aufgab, schrieb an einen Bekannten:
Mein Vaterland verliert, wie ich merke, nichts, wenn mich auch ein Banditendolchstich dahinfördern sollte; und ich will doch einmal in den Ätna gucken und auf der Syrakuser Landspitze eine griechische Idylle lesen.
Griechische Idyllen können mich nicht reizen, schon gar nicht auf einer Deutschland-Reise, doch habe ich - für den Fall poetischer Anwandlungen - eine deutsche Gedichtsammlung eingesteckt. Aber auch ich kann von meiner Wanderung sagen, daß ich sie unternehme, weil mich mein Vaterland - will sagen: meine Firma - nicht braucht. Wurde ich doch vor einem halben Jahr zum Abteilungsleiter bestellt, der mir mit der Miene eines Beerdigungsunternehmers meine Entlassung ankündigte. Da er jedoch zugleich von Abfindung, Betriebsrente und Vorruhestandsregelung sprach, erwies sich der vermeintliche Blitz des Unheils als Glücksglanz. Nach 25 Jahren Dienst am Computer warf Fortuna mir, der in keiner Lotterie gewann, einen Haupttreffer zu. Nach diesem Urlaub, meinem letzten, gehöre ich zu den Freigelassenen der Industriegesellschaft.
Das schrille Gezeter einer Amsel zerreißt mein Gedankengespinst. Ich merke, daß ich Hunger habe, und siehe, schon bietet sich der gefällte Stamm einer Eiche als Sitzbank an. Die Füße werden zum Ausdampfen von den Wanderstiefeln befreit, eine Klappstulle nimmt ihren Weg vom Brotbeutel in den Magen, lauwarmer Tee folgt nach. Meine Ruhepause endet mit dem Geräusch aufschäumender Limonade: es hat angefangen zu regnen. Also weiter, es ist sowieso zu kalt zum Sitzen, die Temperatur will heute die 10-Grad-Marke nicht überschreiten. Ich habe meinen Regenponcho übergezogen und die Hosen bis zu den Knien hochgekrempelt. Meinen Schädel bedeckt der braune, zerknitterte Filzhut, den ich mal in Alaska kaufte und dessen Gegenstück bei meinem Bruder über dem Türsturz hängt. Der Regen wird stärker, er schwillt zu Güssen an, die das Isarwasser in Gischt verwandeln. Ach, könnte ich doch bis in alle Ewigkeit so wohlbehütet dahinschreiten, im menschenleeren Wald, in sanfter, gedankenverlorener Melancholie.
Menschenleer? Nicht ganz: Zwei Radler überholen mich eilig. Sie fahren ihre Bergradln - neudeutsch: mauntn beiks - natürlich ohne Schutzbleche, so daß Schmutzbahnen bis zum Genick hinauf ihre papageienbunten Rückseiten verunzieren - oder naturburschenhaft verzieren. Wind kommt auf, doch der Regen läßt sich nicht vertreiben, er ist heute unwiderstehlich. Schon rinnt er mir kalt den Nacken herunter, und die Füße sind seit einiger Zeit in naßkalte Umschläge gehüllt, was gar nicht unangenehm ist. Wie in Trance setze ich Fuß vor Fuß, es gibt keine Zeit mehr, man könnte meinen, ich bewegte mich im Reich der Schatten. Und tatsächlich habe ich mir vorgenommen, mein Berufsleben mit einer Wanderung in die Vergangenheit abzuschließen, mit einem umgedrehten Lebens-Lauf: ich gehe dorthin, wo ich hergekommen bin. Das hat nichts mit Sentimentalität zu tun. Ich lasse den Beruf des Programmierers gern los, so wie ich ihn gern ergriffen habe, gern im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Selbsterhaltung. Obwohl ich schon in den Pionierzeiten der Datenverarbeitung mit dem Computer in Berührung kam, ist kein Computer-Freak aus mir geworden.
Ja, schon als Ozeanographie-Student in Kiel versorgte ich, meist nachts, den universitätseigenen ZUSE-22-Rechner mit großen Lochstreifenrollen. Während die Maschine stundenlang Meßdaten verarbeitete, schlief ich. Sobald das Ende einer Rolle erreicht war, ertönte ein schnarrendes Geräusch, das mich weckte. Dann legte ich die nächste Rolle ein. Ein Schnarren anderer Art, man könnte es Desillusionierung nennen, ließ mich aus dem Studentenleben erwachen. In diesem Alptraum war die Lust an der wissenschaftlichen Seefahrt und der Drang, dem Geheimnis der Naturwissenschaft auf die Spur zu kommen, zu einem geschäftigen Leerlauf ausgeartet. Ich hängte das Studium an den Nagel, doch den Computer behielt ich im Auge. Während ich tagsüber auf dem Bau arbeitete, lernte ich nach Feierabend an der Bundesfachschule für Datenverarbeitung in Berlin das Programmieren an einer IBM-1401. Zwar raffte ich mich noch einmal zusammen, um eine Eintrittskarte in die Leistungsgesellschaft zu ergattern, der Computerei entging ich trotzdem nicht. Mit einem Mathematik-Diplom in der Tasche landete ich in Konstanz am Rechner TR4, um nie wieder Mathematik zu treiben. Heute stehen alle diese Rechner, die mit ihren Zusatzgeräten Säle füllten und auf gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit angewiesen waren, im Museum.
Der Computer - mein Leben? Nein, wenn damit eine Leidenschaft gemeint ist, ja, insofern mein Leben in ihm einen Kristallisationskern bekam. Ich erlebte den Beruf als Befreiung vom ach so schönen Studentenleben, so wie ich jetzt meine Entlassung als Befreiung empfinde. Die Entwicklung des Programmierberufs vom Kunst-Kopfwerker zum Industriefacharbeiter, von einer überschaubaren Ordnung zu einem angeblich schöpferischen Chaos treibt mir keine Abschiedstränen in die Augen, auch wenn mir gerade große Tropfen übers Gesicht rinnen. Das Sausen des Windes und das Gluckern, Tropfen, Platschen und Prasseln der himmlischen Nässe tritt wieder in den Vordergrund. Vielleicht, weil mich jaulende Geräusche wie von gequälten Kreaturen die Ohren spitzen lassen. Ach so, nur Autos. Ich unterquere eine von grauen Betonpfeilern gestützte Straße und weiß mein Tagesziel, die alte Bischofsstadt Freising, in greifbarer Nähe.
Zwei Stunden später habe ich eine Unterkunft gefunden und sitze im Trockenen. Dafür, daß ich nicht auf dem Trockenen sitze, sorgt ein Kellner aus jener mörderischen Gegend, die früher Jugoslawien hieß. Die Gaststube ist gut besucht. Am Tisch schräg gegenüber sitzen drei amerikanische Ehepaare, vom Tisch zur Linken tönen italienische Vokale. Nur rechts von mir wird bairisch gesprochen: vier alte Damen spielen Karten. Es ist direkt unheimlich, wie friedlich die Nationen nebeneinander sitzen. Fast erwarte ich, daß eine Schlägerbande oder ein schießwütiger Terrorist hereinstürmt. Mir wird doch nicht die tägliche Schreckensration aus der Fernsehmaschine fehlen?
2. Tag:
Weiter nach Landshut
Wanderers Leid. Ein Klagelied auf die Isar. Ein bedrohliches Kruzifix. Hitze.
Die Nacht ist wenig erholsam. Die Schultern schmerzen, die Füße brennen, und im Magen klebt etwas, das ich mit viel Wasser aufzulösen versuche. Gegen Morgen weckt mich Flattern, Flügelschaben und dumpfes Ruckediguh. Die Tauben, die dicht an dicht unter dem Dachgiebel hocken, lassen mich nicht mehr schlafen. Auch vor ihnen hat die allgemeine Proletisierung nicht haltgemacht: einst mit der Aura des Heiligen umkleidet, sind sie heute nur noch die Ratten der Lüfte. Ich stehe auf und schreibe Tagebuch. Pünktlich um sieben wird die Gaststube aufgeschlossen und das hauseigene Radio eingeschaltet. Um die drei Brötchen mit Butter, Käse, Leberwurst und Marmelade beschmieren zu können, muß ich Plastikhülsen aufpolken, die dann wie abgenagte Knochen nach der Mahlzeit übrigbleiben. Plastikmüll anderer Art ist das Gedudel und Gebrabbel aus dem Lautsprecher. Ja, hier ist der Wegwerf-Gast König.
Gereizt frage ich mich, was die Dauerberieselung mit den Greueltaten des bosnischen Bürgerkriegs bezwecken soll. Tagtäglich wird sie aus all den unendlich vielen Neuigkeiten ausgewählt, wir hören sie stündlich mindestens einmal, und zwar ausführlich, und das seit einem Jahr. Vielleicht sollen mir die Brötchen im Halse steckenbleiben, denn die deutsche Medienzunft liebt es ja, sich als Pastorenersatz und Weltenrichter aufzuspielen. Dabei bedient sie zugleich jenen lüsternen Zeitgenossen, der im Faust spricht:
Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,
als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
wenn hinten, weit in der Türkei,
die Völker aufeinanderschlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus...
Ich trinke mein Täßchen aus und erhebe mich. Von der Straße kommt ein Mann herein und bestellt ein Frühstück besonderer Art: einen Schnaps, ein Bier und die hauseigene Zeitung.
Der Regen hat aufgehört, überall glänzen Pfützen, wie nach einem Großreinemachen, und der Hochnebel hängt wie ein nasser Aufwischlappen über den alten Bürgerhäusern. Rund um die Mariensäule werden Markttische aufgebaut. Ein Schwarm Japaner mit vielen Fotoapparaten versucht dem graukalten Morgen ein paar Farbtupfer abzugewinnen. Ich biege nach rechts ab und folge einer Straße, die von einem Bach durchflossen wird. Mein Blick folgt den Nebelschwaden, die am Domberg emporwallen und die Umrisse der weißen, doppeltürmigen Bischofskirche verwischen. Es werden wohl die Nebel der Vergangenheit sein, denn aus ihnen formen sich plötzlich zwei Bilder. Das eine ist der Reliquienschrein mit den Gebeinen des heiligen Corbinian aus dem 8. Jahrhundert. Das andere ist die Geburtstagsparade für Napoleon, die ein französischer General gut tausend Jahre später in der von Stuck, Gold und Bildern strotzenden Barockkirche veranstaltete. Indem er sie requirierte, bewahrte er sie - unabsichtlich - vor dem Abriß, denn der Dom stand im Namen der Säkularisation für 500 Gulden zum Verkauf an.
Säkularisation nennt man den Immobilienschacher auf Kosten des kirchlichen Landbesitzes, durch den die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches für linksrheinische Gebiete entschädigt wurden, die sich Frankreich angeeignet hatte. Ich erinnere mich gelesen zu haben, daß sie für die Aussicht auf eine kleine Bischofstadt vor den Lakaien des französischen Kaisers auf dem Bauche krochen und ehemaligen Müllkutschern und Landsknechten ihre Töchter als Frauen anboten. Sie nannten das Antichambrieren. Damals ging das Heilige Römische Reich Deutscher Nation endgültig zugrunde.
Ein weiteres Zitat aus dem Erinnerungsnebel behauptet, die Deutschen seien aus der Begegnung der Germanen mit dem Römischen Reich entstanden. Die Kirche als dessen einzige intakt gebliebene Institution, die das Wissen und Können der Antike bewahrte, soweit sie es für bewahrenswert hielt, bemühte sich, die Barbaren in römische Kulturmenschen umzuschmelzen. Dabei entstanden die Deutschen, Zwitter, die weder Germanen bleiben noch Römer werden, vielleicht auch weder Christen werden noch Heiden bleiben konnten. Thomas Mann hat gemeint, daß im Deutschen immer wieder der Drang durchbreche nach der
Abschüttelung zivilisatorischer Bindungen, ohne die Deutschtum nicht Deutschtum wäre, sondern eine weltunbrauchbare Bärenhäuterei.
Ob das eine Erklärung für meinen lebenslänglichen Wanderdrang ist? Allerdings schätze ich das Wandern gerade insoweit, als es eine weltunbrauchbare Bärenhäuterei ist. Wenn die Abschüttelung die Massen ergreift, heißt sie Bewegung: Reformationsbewegung, Sturm und Drang, Romantik, Jugendbewegung, kommunistische und nationalsozialistische, ökologische und studentische Bewegung. Die Bewegung ist die deutsche Form der Revolution.
Inzwischen habe ich die Isarbrücke überquert und Freising hinter mir gelassen, ohne die Superlative dieser Stadt zu würdigen: älteste Stadt an der Isar, mit dem ältesten deutschen Güterverzeichnis, dem ältesten Buch deutscher Sprache, dem ältesten deutschen Kirchenlied. Die älteste noch arbeitende Brauerei der Welt befindet sich auf dem Weihenstephaner Berg und nur dort gibt es den echten Obazdn, einen Käse, der aus Käseresten hergestellt wird. Wahrscheinlich kann jede deutsche Stadt mit Erstaunlichem aufwarten, oder wenigstens mit dem Zweiterstaunlichsten, etwa dem Zweitältesten, Zweigrößten usw. Nur der Superlativ aller Superlative, absolut mittelmäßig zu sein, fände, wenn es ihn gäbe, keinen Anklang.
Ich marschiere auf kleinen Asphaltstraßen durchs Erdinger Moos, immer in Richtung Osten. Nach einigen Kilometern überquere ich die Autobahn und lese auf einem blauen Schild: Landshut 34 km. Mein heutiges Ziel. Lockere Busch- und Baumgruppen wechseln ab mit blumenübersäten Moorwiesen. Ständig verschieben sich die Kulissen und bieten dem Auge Sehfutter. Ein Baggersee erglänzt: wo nimmt er das Licht her? An seinem Ufer rostet eine urtümliche Maschine. Wie still es ist, merke ich, wenn Geräusche explodieren: ein Fasan schwirrt mit metallischem Kreischen davon. Autos röhren plötzlich neben mir auf, ihr Brummen verliert sich schnell in der Landschaft, schneller als die Giftwolke, die ihnen folgt.
Ja, Autos - wo sie nur herkommen! Ich zähle in einer Stunde 80 Stück, mehr als ein Auto pro Minute, und das in dieser einsamen Gegend. Zum Glück richten sie sich nicht nach dem arithmetischen Mittel, sondern kommen in Rudeln. Den Maßstäben gemäß, nach denen Radwanderkarten beurteilt werden, befinde ich mich auf einer wenig befahrenen Straße, die für Radtouren gut geeignet ist. Erst eine Straße mit der zehnfachen Autodichte gilt als schlecht geeignet. Dennoch weiche ich, sobald ich kann, auf einen schmierigen Feldweg aus und bin die Störer los. Zwei Pferde stehen Kopf an Schwanz und wedeln sich gegenseitig die Fliegen weg: intelligentes Verhalten. Tief eingeschnittene Gräben zwischen schwarzen Äckern zeigen an, daß ich durch ein trockengelegtes Moor wandere. Zwischen den Erdschollen laufen schwarzweiße Vögel umher, wahrscheinlich Kiebitze. Einige von ihnen erheben sich in die Lüfte und umkreisen mich mit ärgerlichem Geschrei. Was die Autos für mich sind, bin ich wohl für sie.
Alle eineinhalb Stunden setze ich den Rucksack ab, um die Schultern zu entlasten. Dann kneife ich auch die Blasen an meinen Füßen auf, die sich im Sauna-Klima der Wanderstiefel immer neu bilden. Wenn ich wieder starte, erdulde ich die Qualen eines Märtyrers auf glühendem Rost, und wer mich sieht, denkt eher an einen arthritischen Greis als an einen rüstigen Wanderer. Aber mich sieht ja keiner, und nach hundert Metern ist der Schmerz vergessen. Was ist nur mit den Füßen los? Schuhe und Strümpfe sind seit vielen Jahren eingelaufen und butterweich. Habe ich meine robuste Fußhaut durch zu langes Nichtwandern eingebüßt? Fragen ohne Antwort, aber auch eine Antwort würde mir nicht helfen.
Eine ganze Weile schon bemerke ich im Dunst über mir den gleißenden Brennpunkt der kosmischen Sammellinse. Dann ist der Dunst auf einmal verschwunden und mit ihm die trauliche Stimmung. Nur nackte Tatsachen bleiben übrig: Hitze, plattes Land, Maisfelder, Schattenlosigkeit, wieder Straße, dazu Anzeichen von Müdigkeit und Hunger. Ein kleiner Bach erscheint wie gerufen, um die Füße ins kühle Wasser zu stecken. Während ich Brot und einen Apfel esse, ziehen einige Reiter und zwei einachsige Pferdewagen vorbei. Um zwölf Uhr mittags passiere ich einen Parkplatz bei Moosburg, auf dem zwei beleibte Motorradfahrer mit Spucke und weichem Tuch behutsam ihre riesigen lilafarbenen Maschinen wienern. Als sie mich erblicken, lachen sie überrascht.
Weiter geht‘s
Hinter Moosburg, das ich links liegenlasse, erreiche ich wieder die Isar, die hier mit Hilfe starker Betonplatten in Kanäle und Ausgleichsweiher gesperrt wird. Ein paar Kilometer weiter beginnt eine schöne Auenlandschaft, eingezwängt zwischen mittlerem Isarkanal, der rechts oben wasserreich strömt, und dem Fluß, der links unten hinter den Bäumen schwächlich plätschert. Ach, rapidus isara, reißende Isar, was haben sie mit Dir gemacht! Dein Name, der aus dem Keltischen stammen und die Schnelle bedeuten soll, hat nichts mehr zu bedeuten, seit in den 50er Jahren der Sylvenstein-Speichersee entstanden ist. Damit nicht genug, mußt Du auch Wasser an die Loisach abgeben, auf dem Wege über das Walchensee-Kraftwerk. Deinem Kiesbett, das auf weite Strecken trocken lag, wurden erst nach Protesten vier Kubikmeter Wasser pro Sekunde bewilligt.
Welche Gewalt Du einst zu entfesseln vermochtest, lehrt der Einsturz der Münchner Ludwigsbrücke im Jahre 1813. Dabei kamen über hundert Schaulustige ums Leben, die Dein Wüten aus nächster Nähe genießen wollten. Noch vor hundert Jahren hätte ich vielleicht mit einem Ordinari-Floß fahrplanmäßig nach Landshut fahren können. Und ich hätte - schon mit Rücksicht auf meine wunden Füße - nicht nein gesagt.
Langsam wie ein Uhrzeiger streicht der Echinger Kirchturm vorbei. Ein paar Schritte weiter schwingt sich, leise knisternd, eine Hochspannungsleitung über das Tal, ein Aderlaß an der Natur. Bei Hofham verlasse ich die parkähnliche Landschaft und schlage einen kleinen Bogen durch das Hügelland südlich von Landshut. Zuerst umfängt mich kühler Wald, doch dann, hinter Obergolding, führt der Weg durch eine Landschaft, die im Zuge der Flurbereinigung von allen Bäumen, Sträuchern und Wegen gründlich gereinigt wurde, in eine schüsselförmige Senke, an deren tiefstem Punkt ein goldenes Aufblitzen meine Neugier erregt. Unten angekommen, erkenne ich einen goldfarbenen, verkrümmten Jesus, der an einem großen eisernen Kreuz hängt. Daneben lädt eine Bank zum gemütlichen Ausruhen ein. Ich schnalle meinen Rucksack ab und lasse Luft und Sonne meine Füße umfächeln, fühle mich aber unbehaglich neben der Jammergestalt. Ich kann nicht glauben, daß sie die innige Verbundenheit Gottes mit dem Menschen bezeugen soll, dazu ist die Todesnot zu genußvoll ausgestaltet und ihre Darstellung zu weit verbreitet. Nein, eher scheinen mir solche Standbilder Siegeszeichen der Menschen über die Götter zu sein: Seht her, ihr Götter und Dämonen, was wir machen, wenn wir einen von euch zu fassen kriegen! Seht euch vor! Verschwindet!
Ich verschwinde auch, strebe dem gegenüberliegenden Rand der Geländeschüssel zu und überlege, was wohl geschehen wäre, wenn die mittelalterlichen Bemühungen um Gotteserkenntnis zu vergleichbaren Erfolgen geführt hätten wie die neuzeitlichen Bemühungen um Naturerkenntnis. Dann wüßten wir, wie das, was wir Gott nennen, beschaffen ist und könnten dieses Wissen nutzen. Doch da sich das, was wir Gott nennen, trotz größter Anstrengungen nicht zu einem Gegenstand oder einer Struktur machen ließ, existiert Gott nicht. Das hat er nun davon!
Gedanken lenken ab, verkürzen die Zeit, lassen die Blasen vergessen. Erst als Lichtblitze das Ziel ankündigen, wenden sich die Augen wieder von innen nach außen. Die Fenster der Burg Trausnitz gleißen im schrägen Spätnachmittagslicht wie flüssiges Metall. Und der spitze Zeigefinger daneben ist wohl die Landshuter Sankt-Martin-Kirche.
Eine halbe Stunde später humple ich müde durch die Altstadt, die platzartig erweiterte Hauptstraße der Altstadt. Sehr malerisch, wie sich 500jährige Giebelhäuser da dezent gefärbt aneinanderreihen, aber was ich jetzt brauche... - da ist es ja schon: Café Cappuccino. Eine gewölbte Toreinfahrt führt in einen schmalen Innenhof mit Tischen und Stühlen, gedämpftem Stimmengewirr und weinüberzogenem Gemäuer, und zwischen Liebespärchen und einer erhitzten Radlergruppe findet sich noch ein freier Tisch. Auch mein Kopf glüht. Ich ziehe die Schuhe aus und bestelle Cappuccino und Käsekuchen. Es ist halb sechs. Da das Fremdenverkehrsamt schon längst geschlossen hat, muß ich noch eine Stunde von Hotel zu Hotel laufen, bis ich ein Zimmer gefunden habe. Anschließend marschiere ich trotz großer Müdigkeit abermals ins Stadtzentrum, esse aus einer bizarren Laune heraus ein scheußliches Käseomelett und trinke ein Glas Wein. Das laute Stimmengewirr der Stammtischrunde liegt wie ein Filter über allen Geräuschen, besonders über dem Musikgesabber, so daß meine Aufmerksamkeit kein Ziel hat und ich behaglich dösen kann.
Die meisten Leute meinen, ein Wanderer, der kein festes Quartier hat und allein von Ort zu Ort zieht, müsse sich von allen guten Geistern verlassen fühlen. Dabei ist es umgekehrt: der Wanderer ist nicht der Verlassene, sondern er hat die menschliche Gesellschaft verlassen, und ohne festes Quartier schlägt er auch keine neuen Wurzeln. Ein Bild wirklicher Verlassenheit zeigt sich mir auf dem Rückweg zu meiner Herberge: eine alte Frau, die auf einer Sitzbank schläft. Sie liegt weich auf etwa zwanzig ausgestopften Plastiktüten. Weitere zehn Plastiktüten baumeln an ihrem Fahrrad.
3. Tag:
Kloster Mallersdorf
Selbstvorwürfe. Trost der Philosophie. Marterln, schwere Beine, eine Wasserspende.
Die Sonne brennt.
Froh, der Nacht mit ihren wirren und zähen Alpträumen entronnen zu sein, trete ich auf die Straße, die in dichtem Nebel verschwimmt, und marschiere zum Bahnhof. Ich habe beschlossen, eine Station mit der Eisenbahn zu fahren, um mir die ausgedehnten Vororte und Industriegebiete zu ersparen. Der Zug ist pünktlich, sein Ziel Coburg. Während ich bequem im Abteil sitze, meldet sich das schlechte Gewissen des Wanderers. Warum fährst du nicht gleich bis Coburg? nörgelt es. Der andere in mir verteidigt sich mit guten Gründen und der Psychologie: wunde Füße, begrenzte Zeit, Nebel, und schließlich: Wandern soll keine Selbstversklavung sein. Doch als der Nebel strahlendem Sonnenschein gewichen ist, fällt das Licht auch auf die guten Gründe, und ich muß zugeben, daß sie das sind, was gute Gründe und Psychologie meistens sind: Entschuldigungen.
Diese Nachgiebigkeit in den ersten Tagen, wenn Seele und Körper noch schmerzen, ist ein schlechtes Zeichen. Zwar hörte ich es auch schon früher flüstern: „Warum tust du dir das an? Niemand zwingt dich, niemand bewundert dich, gib auf.“ Aber ich bin trotzdem weitergegangen. Was ist los mit mir? Bin ich weich geworden? Oder vernünftig? Vernünftig leben heißt nach alter Überlieferung: in Harmonie mit der kosmischen Ordnung leben. Da der von der Wissenschaft entworfene Kosmos gekennzeichnet ist durch die Vokabeln Urknall, Evolution, Zufall, Überleben, Atom, Information, Mechanik, Energie, Funktion, Struktur, Vernetzung, hieße demnach vernünftig leben: ein Rädchen im Getriebe sein, rackern und strampeln. Doch diesem Kosmos will der Wanderer ja gerade den Rücken kehren, um in jenen anderen Kosmos einzutauchen, wo die Sonne nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang tönt. Dort herrscht eine andere Vernunft.
Der Wanderer ist ein Utopist, nur liegt seine heile Welt nicht im Jenseits der Vergangenheit, der Zukunft oder des Lebens, sondern im Jetzt, meinetwegen auch im Jenseits des Jetzt. Er ist Realutopist: Schmerzen, Hunger, Durst, Kälte, Hitze, Erschöpfung, Mücken löschen das Glück der reinen Gegenwart nicht aus, sondern gehören dazu. Glück winkt bekanntlich auch, wenn der Schmerz nachläßt. Der Wanderer verläßt den Alltagskosmos, um im einfachen Leben wieder Ursprünglichkeit zu gewinnen. Jedoch kehrt er nicht ungern ins Laufrad der Zivilisation zurück, denn zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust. Aus dieser Spannung bezieht das Wandern seinen Reiz, sie auflösen hieße entweder zum Vagabunden werden, oder einer von den Trägen, die zu Hause liegen, von denen Eichendorff dichtet:
sie erquicket nicht das Morgenrot,
sie wissen nur von Kinderwiegen,
von Sorgen, Last und Not um Brot.
Daß ich in der Eisenbahn sitze, ist daher ein Werk der Alltagsvernunft, also habe ich jenen anderen Kosmos noch nicht erreicht.
In Ergoldsbach steige ich aus. Kurz hinter dem Bahnhof stürmt ein kleiner Köter mit heiserem Kläffen auf mich los. Er hat mich als etwas Seltsames erkannt, das nicht in seinen Alltag gehört, als etwas Fremdes, das vielleicht vogelfrei ist und dem man in die Haxen beißen darf. Sein Besitzer hingegen, der in Pantoffeln daher spaziert, wünscht mir freundlich einen „schönen, guten Morgen“. Und tatsächlich: die Sonne scheint mild vom blauen Himmel, keine menschliche Tätigkeitswut stört den Frieden, ein kühles Lüftchen weht Glockenschläge vorbei. Ich mache die Beine lang, und bald ist Ergoldsbach hinter einer Bodenwelle verschwunden. Kleine Wälder und große Felder - mit Mais, Gerste und Kartoffeln - bestimmen das Landschaftsbild. Hinter Oberellenbach verlasse ich die Straße und steige zu einem schütteren Waldstreifen empor, der das Tal der Kleinen Laaber säumt. Die jenseitige Hügelkette ist von einem auseinandergelaufenen Siedlungsbrei überzogen, in dem ich die schloßartige Anlage des Klosters Mallersdorf erkenne.
Wegweiser gen Himmel
Eine halbe Stunde später liegt der sumpfige Wiesengrund des Flüßchens hinter mir und der Klosterberg vor mir. Aus dem Gebüsch am Wege ragt ein steinernes Mal, das wie ein Pfeil in den Himmel zeigt. Seine Inschrift beflügelt die Phantasie des Wanderers. Nomen est omen, spinne ich: der Name „Unverdorben“ lastete auf seinem Träger wie ein Fluch, seine Unverdorbenheit brachte Josef ins Kloster. Dort müssen Dämonen Macht über ihn gewonnen haben, so daß sie ihn verderben konnten, was sie nicht geschafft hätten, wenn er unverdorben geblieben wäre. Oder es war umgekehrt: Josef führte, um sich von der Last seines Namens zu befreien, ein lasterhaftes Leben. Als ihn der Ekel packte, ging er ins Kloster, machte seinem Namen Ehre und starb als heimlicher Märtyrer, um ewig unverderblich zu bleiben.
Durch die Zauberkraft der Phantasie nach oben getragen, berühren meine schmerzenden Füße erst wieder den Boden, als ich von einer Busladung von Pilgern, die zu den Biertischen eilen, an das Gemäuer der Klosterbrauerei gedrängt werde. Die Klosterkirche, aus der die Pilger kommen, gehörte bis zur Säkularisation den Benediktinern und ist jetzt Pfarrkirche von Mallersdorf. Wie der Dom zu Freising sollte sie abgebrochen werden, doch niemand wollte ein Verlustgeschäft riskieren. Es geht eine Treppe hinauf, ich trete ins kühle, von schwachem Weihrauchduft erfüllte Kirchenschiff und setze mich - welche Labsal! - in eine Bank. Am Altar räumt jemand auf.
Ein schöner Raum. Schon erfaßt mich die Heiterkeit des Rokoko, da läßt oben in der Apsis die Sonne das Gold ihres eigenen Abbilds aufblitzen. Ich schaue genauer hin: eine Frau im Strahlenkranz flieht vor dem siebenköpfigen Drachen. Einer der Drachenköpfe ist mir zugewandt, seine geifernde Zunge verwandelt sich in schäumendes Bier. Die Heiterkeit weicht dem Durst, ich stehe auf. Im Vorraum lese ich, daß das Motiv aus der Offenbarung des Johannes stammt und von Ignaz Günther ins Bild gesetzt wurde, um den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkel, Geist und Materie darzustellen. Aha. Ich lese weiter, daß das Kloster 1869 von den Armen Franziskanerinnen von der Heiligen Familie gekauft wurde und seitdem ihr Mutterhaus ist. Das alte Kloster sei damit aufs neue eine Stätte des Segens geworden, eine Gralsburg Gottes, von der das Leuchtfeuer des Glaubens und der Liebe ausstrahlt weit über das Land.
Euer Wort in Gottes Ohr. Oder lieber nicht? Auf den Treppenstufen überhole ich zwei mißgestimmte Männer, deren Frauen schon beim Auto warten. Der eine möchte „den ganzen heidnischen Klimbim aus der Kirche herausreißen“, der andere pocht auf die Tradition. Seltsam - seit wir lesen und schreiben können, ist uns die Bildersprache unverständlich geworden. So gesehen könnte die katholische Kirche tatsächlich den „Klimbim“ verkaufen und kahl werden wie die protestantische, ohne Schaden zu nehmen. Als das Fürstenhaus von Thurn und Taxis seinen Trödel versteigern ließ, war das Erstaunen groß, wie viele Leute sich dafür interessierten. Der Bedarf an geistlichen Trophäen dürfte nicht kleiner sein. Heiligenfiguren, Säulen und Symbole könnten Gartenzwergen den Rang ablaufen und Vorgärten oder Hausfassaden aufwerten. Das Heilige käme unters Volk.
Im Klosterbräu halten die Omnibuspilger Gaststube und Speiesaal besetzt, um Schweinsbraten mit Knödeln zu essen. Ich verzichte auf das Bier, das mich nur schwächen würde, begnüge mich mit Radler-Halbe und Brez‘n.
Wieder im Freien, steche ich die Fußblasen auf und stapfe mit schweren Beinen gen Norden. Der morgendliche Aufschwung ist verpufft, das kühle Lüftchen eingeschlafen. Überhaupt macht die Natur einen schläfrigen, in sich gekehrten Eindruck, abgesehen von der Luft, die unter dem ausgeblichenen Himmel vor Hitze flimmert. Auch die Nerven meiner Füße schlafen nicht. Daß die gedünstete und gewalkte Haut höllisch brennt, ist kaum noch der Rede wert, seit der linke Fuß in sich schmerzt, als sei er durchgetreten. Obwohl ich dicksohlige Wanderstiefel trage, spüre ich jedes Steinchen.
Irgendwo im Schatten eines Waldrandes ziehe ich die verschwitzten Sachen aus, strecke alle Viere von mir und esse Obst. Dafür, daß ich mich nicht allzu wohl fühle, sorgen nicht nur die pochenden Füße, sondern auch Mücken und rote Ameisen. Trotzdem möchte ich nicht mit meinen Kollegen tauschen, die jetzt, nach dem Mittagessen, wieder an ihren Schreibtischen oder in Testräumen hocken und, wie die Hühner im Silo, gackernd Eier legen. Zwar habe ich nur eine Art, mich nicht allzu wohl zu fühlen, gegen eine andere eingetauscht, aber aus Erfahrung weiß ich, daß sich beide gegenseitig neutralisieren und meine Seele im Gleichgewicht halten. Ich bin neugierig, ob mit dem Ende des Berufslebens auch der Wanderdrang verschwindet, der mich jetzt weitertreibt. Das Hemd ist getrocknet, weiße Salzgirlanden zieren Achseln und Rücken.
Das Tal der Großen Laaber mit seinen schattenlosen Feldwegen bleibt zurück, das Dorf Rogging ebenfalls. Ein paar Kilometer weiter entdecke ich ein Kreuz mit einer Inschrift von verdächtiger Naivität, die ich mir notiere. Marterln gibt es viele in Bayern. Sie erinnern an den Sohn, der sich zu Tode fuhr, an den Bergsteiger, den der Blitz erschlug, an den Bauern, der unter den Traktor geriet. Da die Erinnerung das Organ ist, das die Toten wiederauferstehen läßt, sind sie noch nicht ganz tot, solange die Erinnerung wach bleibt. Aus diesem Blickwinkel ist das Streben nach Ruhm - trotz Christentum und Aufklärung - eine Vorsorge für das Leben nach dem Tode. Der große Mann bekommt seinen Platz im Buch der Geschichte, im Literaturarchiv oder im Museum, der kleine Mann scheut keine Mühe, um ins Guinessbuch der Rekorde zu kommen. Er brät eine 500 Meter lange Wurst und fürchtet sein Leben lang die 501 Meter.
Inschrift von verdächtiger Naivität
Bin auch ich auf dem Verewigungstrip? Keine Sorge, niemand rechnet Wandern zu den „Werken“, den guten, den bösen oder den aufsehenerregenden. Wandern ist zwar nicht Un-Tat, aber Nicht-Werk. Der Wanderer ist ein flüchtiger Gast, der Wert darauf legt, keine Spuren zu hinterlassen, keinen Müll, keine geritzten oder gesprühten Autogramme. Was hätte ich davon, ein Nachleben in der Erinnerung x-beliebiger Leute zu führen? Und was hätten x-beliebige Leute davon, die Erinnerung an mich zu pflegen? In archaischen Zeiten hatte Totenverehrung einen Sinn, denn die Toten waren mächtig, im wissenschaftlichen Universum ist sie Sentimentalität.
Ich habe Durst, aber meine Feldflasche enthält nur noch die eiserne Ration für die Nacht. Es ist wie verhext: die wenigen Höfe oder Wirtschaftsgebäude, an denen ich vorbeikomme, sind menschenleer und verschlossen. Da wird doch nicht Xaver Huber seine Hand im Spiel haben? Vielleicht habe ich es beim Lesen seines Gedenkkreuzes an Ehrerbietung fehlen lassen. Das muß ich bedenken, denn als Wanderer habe ich die Grenzen des wissenschaftlichen Universums überschritten und befinde mich im Einflußbereich undurchschaubarer Mächte.
Schon sehe ich in der Ferne den Wald, in dem ich übernachten möchte, da eröffnet sich im Tal eine letzte Chance, Wasser zu bekommen. Inmitten ausgedehnter Getreidefelder liegt wie eine Insel der Mooshof. Auch hier keine Menschenseele, aber aus einem Fenster des Wohnhauses wehen Gardinen. Darunter, im Gemüsegarten, tropft ein Wasserhahn. Ich lasse das Wasser strömen: in die Feldflasche, in den Mund, über Kopf und Arme. Nach dieser Lebensspende kann es mich nicht erschüttern, daß der Wald entlang der Landstraße nach Hagelstadt abgezäunt ist, wohl des Wildes wegen. Um so hemmungsloser können sich die Raser dem Rausch der Geschwindigkeit hingeben. Während ich der Straße folge, rasen mehrere Autos haarscharf an mir vorbei, anscheinend aus Jux, und Motorräder mit weithin schallendem Auspuff liefern sich Feierabendrennen, die vermutlich anschließend auf dem Hagelstädter Marktplatz glorifiziert werden.
Nach einer Viertelstunde erreiche ich das Ende des Zaunes, klettere eine Böschung hoch und finde, ein paar hundert Meter von der Straße entfernt, an einer Waldecke mein Nachtlager. Auf federnden Fichtennadeln rolle ich den Schlafsack aus und ziehe den Schlafanzug an. Der Himmel ist fast wolkenlos, deshalb breite ich die Zeltbahn nur locker über den Schlafsack. Meine Wanderkleidung dient mir als Kopfkissen, die Schuhe werden umgedreht, alles übrige kommt in den Rucksack. Liegend starre ich nach oben ins Buschwerk, aus dem sich jetzt vielleicht eine Zecke fallen läßt. Ihre Chancen stehen nicht besser als die eines Räubers, der im Wald auf reiche Bürger lauert. Mir sind in den vergangenen drei Tagen keine Spaziergänger oder Wanderer begegnet. Außerhalb der als schön definierten Landschaften kommen sie nicht vor, und das ist schön. Die Uhr zeigt auf acht.
Eine Stunde später stelle ich fest, daß ich geschlafen habe. Der Himmel ist voller rosiger Wölkchen, aber mit meinen Gehwerkzeugen sieht es gar nicht rosig aus. Heftige Stiche in den kleinen Zehen haben mich geweckt, die linke Achillessehne pocht besorgniserregend und die Füße sind so unerträglich heiß, daß ich sie ins Freie halten muß. Notgedrungen gerät auch der übrige Körper ins Kühle und beginnt zu frösteln, so daß ich zurückschlüpfe in die wärmende Hülle und die Füße wieder zu brennen anfangen. Dann kommt der Schlaf, und da der Wanderer auch im Reich der Träume nicht auf Bewegung verzichten kann, wälze ich mich hin und her, her und hin, bis mich das Geschrei der Vögel weckt, die sich freuen, daß die Sonne wieder einmal der Unterwelt entkommen ist.
4. Tag:
Walhalla
Eine Achillessehne klopft, ein See lächelt, ein Ahnenschrein lockt. Heimatschwere. Der wiedergefundene Becher. Gluthitze.
Die Nachtruhe - besser: Nachtunruhe - hat mich nicht erquickt, und unbeschuht sind meine Füße nicht imstande, den Körper aufrecht zu halten. Sie sind anscheinend nicht mehr die bewunderungswürdigen Konstruktionen, die sie einmal waren, sondern nur ein Sack voller Knochen. Daher sind meine Bewegungen zeitlupenhaft langsam, und es dauert ziemlich lange, bis ich marschfertig bin. Die Schuhe geben den Füßen zwar äußeren Halt, verursachen aber solche Schmerzen, daß ich mich nur mit Trippelschrittchen fortbewegen kann. Nach einiger Zeit wird der Schmerz stumpf und kann aus der Aufmerksamkeit verdrängt werden.
Der Wald endet vor auswuchernden Siedlungen, die das Dorf Alteglofsheim umgeben. Überall rollen große, gepflegte Autos aus den Garagen, um sich in den Berufsverkehr einzureihen, Menschen sind nicht zu sehen. Mitten im Dorf steht ein Schloß, das dem Verfall entrissen wird, um der Musikpflege zu dienen. Es ist kurz vor sieben Uhr, die Geschäfte sind noch geschlossen. Lastautos und Traktoren lärmen ohrenbetäubend durch die Dorfstraße und treiben mich an einem riesigen Autoschlachthof vorbei zum Bahnhof. Dort ist es still, dort steht eine Bank im Sonnenlicht, dort esse ich meine letzten Vorräte: Fruchtschnitten und einen Riegel Schokolade.
Zwei Stunden später sitze ich auf einer anderen Bank in der Sonne, die nackten Beine weit ausgestreckt. Nasse Wiesen mit hohem, brennesseldurchseuchtem Gras gaben viele Wassertropfen, Samenkörner und Giftinjektionen an mich weiter, als ich eine Brücke über den sumpfigen Bach suchte, der mir in die Quere kam. Was tut man nicht alles, um den Autos zu entgehen! Jetzt, nach erfolgreicher Überquerung des Gewässers, lausche ich dem Pochen der Achillessehne, denn so weit kann ich die Füße gar nicht ausstrecken, daß ich es nicht spüre. Dieser Bestandteil meines Körpers macht mir Sorgen, denn er ist angeschwollen und kann den Fortgang der Reise in Frage stellen. Ich kann nichts anderes tun, als ihn der strahlenden Sonne, dem kühlenden Wind und allen guten Geistern anheimzugeben.
Die fruchtbare Donau-Niederung, die sich mit ihren Rübenfeldern rings um mich herum erstreckt, wird im Norden von blauen Bergen begrenzt. Ein eigenartiger heller Fleck enthüllt sich im Fernglas als Säulentempel: es ist Walhalla, mein Etappenziel. Sein Anblick pulvert mich auf, ich schnüre die Schuhe. Mächtige Pappeln begleiten mich, ihre Blätter klappern leise, ihre Schatten kommen mir nicht zugute. Den Gutshof am Ende der Baumstafette lasse ich links liegen und erreiche den Guggenberger Baggersee. Die Parkanlage um ihn herum spendet ebenfalls wenig Schatten, die Bäume sind noch dünn und klein. Doch die Anwesenheit der weiten Wasserfläche genügt, um Leib und Seele zu erfrischen, ja zu bezaubern. Kleine Wellen klimpern am Ufersaum, Lichtblitze tanzen über das leicht bewegte Element - ein Lächeln liegt auf dem Ort.
Wie ist es nur möglich, daß mich dieses unscheinbare Gewässer geradezu überwältigt? Ist meine Ich-Membran von Schmerz und Anstrengung so zermürbt, daß das Schöne, das Göttliche, hindurchdringen kann? Oder hat mein Oberstübchen zuviel Sonne abbekommen, so daß die Verstandespolizei nicht mehr Ordnung halten kann unter den Begriffen? Ich humple an eingeölten Gestalten vorbei, die reglos im Grase liegen. Da, jenes steile Uferstück bietet sich an zum Füßekühlen, oder umgekehrt: mein Verstand erkennt es als geeignet für diesen Zweck. Na, vielleicht ist beides richtig. Zwei Läufer traben vorbei, hinter dem See lärmen Bagger, große Laster fahren Kies weg. Ich entkleide mich neben einer Bank und zwinge den ganzen Körper ins flüssige Element, tauche unter, wasche Schweiß und Staub zweier Tage ab. Die Kälte durchdringt Leib und Glieder, die keinen Widerstand leisten. Bei dieser Vermählung entsteht ein seltsam zwiespältiges Lustgefühl des Einsseins.
Wie neugeboren setze ich den Weg fort, altere aber schnell in der Erstorbenheit der Landschaft. Sie liegt begraben unter Erdaushub und Häusergrind, unter dem eng geknoteten Netz der Asphaltstraßen, unter Benzolgestank, Dieselqualm und Lärm. Plötzlich stockt mein Schritt: Habe ich den Trinkbecher wieder eingepackt? Nach dem Herauskramen der Badehose, das weiß ich, lag er auf der Bank. Rucksack absetzen, nachschauen. Ergebnis: der Becher ist nicht da. Gehe ich zurück? Es fällt mir verdammt schwer umzukehren, aber ich will den altgedienten Aluminiumbecher, der 1/3 Liter Flüssigkeit faßt, wiederhaben. Nach einer Viertelstunde bin ich abermals am See. Kein Lächeln mehr. Auf der Bank sitzt ein Mann und sonnt sich mit geschlossenen Augen, der Becher liegt hinter seinen Füßen. Als er hinter sich Schnaufen und Klappern hört, zuckt er zusammen. Kruzitürken, höre ich, aber da bin ich schon fast hinter einer Wegbiegung verschwunden.
Jeder Wanderer hat wohl schon mal einen Ausrüstungsgegenstand verloren. Ein alltäglicher Vorfall, der trotzdem Rätsel aufgibt. Wie konnte der Becher verschwinden, obwohl ich es nicht wollte? Hat er sich meiner Aufmerksamkeit zu entziehen gewußt? Das hieße, daß Dinge Absichten haben und in die Tat umsetzen können. Diese Schlußfolgerung ist keine neue Erkenntnis. Friedrich Theodor Vischer geht in seinem Roman Auch Einer so weit, eine Brille, die immer wieder verschwindet, „für jahrelange unbeschreibliche Bosheit“ zum Tode zu verurteilen und zu zertreten. Das Verschwinden des Bechers könnte noch einen anderen Grund haben: eine Macht, die man früher Kobold nannte, entzog ihn meiner Aufmerksamkeit - und damit meiner Herrschaft.
Vorfälle wie dieser würden mich vielleicht nicht nachdenklich machen, wenn ich nicht ein passionierter Wanderer und obendrein Programmierer wäre. Letzterer macht täglich die schmerzliche Erfahrung, daß sich etwas zwischen Theorie und Praxis drängelt, ihn ablenkt, blind macht, die Richtung seiner Gedanken beeinflußt, so daß seine guten Taten eine andere Richtung nehmen, als er eigentlich will. Ihm wird an seinen eigenen Fehlern demonstriert, daß er weder Herr seiner Absichten noch Herr der Dinge ist. Eine solche Erkenntnis stellt die geistige Unabhängigkeit des Menschen in Frage und wird deshalb vom offiziösen Denken unter den Begriffsteppich gekehrt. So lauern heute die Dinge, Mächte, Götter hinter Begriffen wie Zufall, Fehler, Unbewußtes, Verdrängung, Dummheit, Unaufmerksamkeit. Sie sind unkenntlich wie echte Zauberer, die behaupten, sie zeigten nur Tricks und alles gehe mit rechten Dingen zu.
Diese Gedanken begleiten mich noch bis zur großen Betonbrücke über die Donau. 20 Meter über dem aufgedunsenen, durch Stauwehre und Deiche eingeschnürten Leib des Flusses lebe ich auf. Der frische Hauch über dem Wasser und das Grün der bewaldeten Hügel schenken mir neue Energie. Von der Anlegestelle am Fuße des Treppenbaus, der zur Walhalla hinaufführt, legt gerade ein Dampfer nach Regensburg ab. Genau dort legte ich im Sommer 1974 mit einem Faltboot an, um die 358 Stufen zum Ruhmestempel emporzusteigen, während mein Arbeitskollege, dem das Boot gehörte, am Ufer wartete. Wir hatten uns bereits die Altmühl heruntergearbeitet, unser Ziel war Krems an der Donau. Damals stand noch die alte Donaustaufer Holzbrücke, und die Donau war noch keine Großschiffahrtsstraße, sondern ein schlanker, lebhafter Fluß, der uns kostenlos mitnahm.
Seinerzeit befand ich mich in einer ähnlichen Situation wie heute: der Konstanzer Firma ging es schlecht, die Gerüchteküche brodelte, eine Betriebsversammlung jagte die andere, Entlassungen drohten. Alle Kollegen, die Haus und Familie besaßen, kämpften verbissen um ihren Arbeitsplatz, andere, solche wie ich, ließen Seifenblasen steigen oder malten Bilder an die Tafel, um die Zeit totzuschlagen. Manche schmiedeten sogar lateinische Hexameter, denn es gab gebildete Leute unter uns, Historiker, Lateiner, Philosophen. Übrigens auch Hausfrauen und Bäcker, denn in den Anfangszeiten der Datenverarbeitung war das Programmieren noch keine akademische Domäne. Ein halbes Jahr nach der Bootsfahrt hatte mich der Lauf der Dinge nach München getragen. Die Umwälzung der Lebensumstände gab auch den Anstoß zur Hochzeit. So findet der Optimist immer Gründe, die ihn wie einen Gott sagen lassen: „Und er sah, daß es gut war.“
Das Städtchen Donaufstauf, unterhalb einer großen Burgruine gelegen, betrete ich nicht, auch wenn mein Hunger groß ist. Es zieht mich auf den 100 Meter hohen Breuberg, trotz allem, was gegen einen griechischen Tempel auf deutschem Boden und gegen Nationaldenkmäler eingewendet werden mag. Ein teppichweicher Weg im Schatten des Laubwaldes leitet mich bergan. Abgesehen vom Treppenbau hat das Gebäude nichts Pompöses. Sein Urbild soll das Parthenon auf dem Burgberg von Athen sein, und es mag an seinen Proportionen liegen, daß mein Auge mit Wohlgefallen auf ihm ruht. Oder liegt es an seiner Unversehrtheit? Mal keine Ruine, kein Trümmerhaufen wie in Griechenland oder Italien? Jedenfalls paßt dieser Tempel nicht weniger gut in den Wald als eine Wallfahrtskirche, und so etwas Ähnliches ist er ja, wie der Name Walhalla anzeigt. In seinen Giebelfeldern und Friesen sind Szenen germanischer und deutscher Geschichte dargestellt. Sie und die Namenstafeln und Marmorköpfe von Heroen, die dem deutschen Kulturkreis zugerechnet werden, weisen das Gebäude als Stätte des Ahnenkultes, also der Selbstvergewisserung, aus.
König Ludwig I. von Bayern, der den Bau aus eigener Tasche bezahlte und ihn nach 12jähriger Bauzeit 1842 einweihte, sagte bei der Eröffnung:
Ein Tempel für den Ahnenkult
Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch seien, immer fühlen, daß sie ein gemeinsames Vaterland haben, ein Vaterland, auf das sie stolz sein können; und jeder trage bei, soviel er vermag, zu dessen Verherrlichung.
Wie gesagt - Ahnenkult: die Heroen sollen den Besucher mit Stolz erfüllen und zur Nacheiferung anstacheln. Hinter dem Hain, der den Tempel umgibt, befindet sich ein großer Parkplatz und eine kleine Gastwirtschaft. Sie ist eigentlich zu klein für meinen großen Hunger, weil sie nur kleine Gerichte anbietet. Während ich an der Theke auf meine Currywurst warte, fallen mir zwei biertrinkende junge Männer auf. Der eine ist völlig kahlgeschoren, den anderen ziert eine schmale, schwarze Bürstentolle. Sie sind in Schwarz und Oliv gekleidet und tragen amerikanische Schnürstiefel. Was mag sie hierhergeführt haben?
Der mit der Bürste redet unaufhörlich auf den anderen ein. Als ich mit Radler, Currywurst und Kartoffelsalat an ihnen vorbeigehe, sagt er gerade: „...du kannst heutzutage zu Hause nicht mehr zu Hause sein...“ Dieser Satz kommt mir bekannt vor, wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Immerhin, tröste ich die beiden in Gedanken, zeigt eure Kostümierung an, daß ihr bei denen zu Hause seid, die ebenso frisiert und uniformiert sind wie ihr und ebenfalls glauben, daß man zu Hause nicht mehr zu Hause sein könne.
Während ich die Wurst verspeise, beobachte ich die Neuankömmlinge, die aus ihren Autos krabbeln und steifbeinig den ansteigenden Weg zum Tempel einschlagen. Einige Kniebundhosen und Gamsbarthüte zeigen an: wir sind zu Hause noch zu Hause oder wollen es zumindest sein. Was aber wollen die Spätjünglinge, denen kleine Videokameras am Handgelenk baumeln, der Welt mitteilen? Oben herum sind sie fein in Jacke und weißes Hemd gehüllt und mit Seidentüchlein oder buntem Schlips dekoriert, unten herum dagegen in ausgelaugte oder zerfranste Jeans und fleckige Turnschuhe gewandet. Wollen sie kundtun, daß sie disharmonische, innerlich zerrissene Menschen sind? Oder daß sie überall zu Hause sind: bei Reich und Arm, Groß und Klein, Alt und Jung, Hinz und Kunz? Bei soviel Psychologie - das macht das Bier im Radler - kann die Frage: Und du? nicht ausbleiben. Wo ist der Wanderer zu Hause? Da, wo er gerade ist, oder da, wo er hingeht? Egal.
Leidlich aufgemöbelt ziehe ich Strümpfe und Schuhe an und gehe, am Tempel vorbei, die Treppe zur Anlegestelle hinunter. Die Wirtin sagte, der nächste Dampfer aus Regensburg käme um 14.15 Uhr, allerdings nur, wenn sich zehn Fahrgäste fänden, aber bei dem schönen Wetter wäre das sicher. Ein grauhaariger Fernradler, dessen Drahtesel schwer beladen an einem Baum lehnt, holt mich auf den untersten Stufen ein. Er hat mich als seinesgleichen erkannt und fragt nach Woher und Wohin. Nachdem ich seine Neugier befriedigt habe, erfahre ich im Gegenzug, daß er aus Trier kommt und nach Wien will und daß das Übernachten auf Campingplätzen nicht billig sei. Dann sitze ich neben der Anlegestelle auf einer Bank und halte Ausschau nach dem Schiff. Das Donauwasser umspült träge meine Füße, der Schweiß quillt aus Stirn und Achsel, aber kein Dampfer will mich retten. Schließlich krieche ich in den Schatten des Anlegestegs, wo es eng und steinig ist, und döse vor mich hin. Doch es bleibt dabei: kein Dampfer!
5. Tag:
Regensburg
Ein Perfektionist rackert. Stadtführung. Marc Aurel, Johannes Kepler und das Tausendjährige Reich leben auf.
Während unterhalb der berühmten Steinernen Brücke ein Kajakfahrer trainiert, kreisen in mir gebetsmühlengleich die Verse:
Als wir jüngst in Regensburg waren,
sind wir über den Strudel gefahren.
Damals, als ich mit meinem Kollegen über den Strudel fuhr, genügten ein paar kräftige Paddelschläge, um ihn zu überwinden. Der Wasserkünstler da unten durchfährt eine Slalomstrecke, legt an einer Treppe an, schiebt das Boot auf einem kleinen Wagen bis jenseits der Brücke und wirft sich erneut in die Strömung, immer wieder, wie ein Besessener. Ein Sisyphos, der den Stein freiwillig und wohl nicht ohne Vergnügen wälzt, Prototyp des modernen Menschen: beseelt von dem Willen, sich eine bestimmte Materie vollständig zu unterwerfen. Im Fernsehen sah ich mal einen Spitzenathleten im Fingerhakeln, der sich jeden Tag von einem Kran am Mittelfinger in die Höhe ziehen ließ. Dieser Körperteil - das konnte man sehen - hatte inzwischen eine überdimensionale Größe gewonnen.
Die steinerne Brücke
Unsere Kultur, der es vor allem um die Beherrschung der Materie geht, begünstigt solche Perfektionisten. Ihre Fähigkeit, sich ganz einer Sache - Sport, Kunst, Wissenschaft, Beruf - hinzugeben, geht mir ab. Nicht, daß ich nicht gewollt hätte. Aber das verstandesmäßige Wollen, dem der Nutzen oder Ruhm vor Augen steht, reicht nicht aus. Das eigentliche Wollen, das Wollen dieses Wollens, verweigert sich, indem es den Blick für die Absurdität der Anstrengungen schärft. Nur solange die Sache auch Spaß macht, bin ich vor Absurdität sicher. Es muß ein Verhältnis von Geben und Nehmen bestehen, und das besteht nicht mehr, wo es um Perfektionismus, um absolute Beherrschung geht. Das heißt: ich bin nicht zum Profi geboren. Mir fällt auf, daß das Lied verstummt ist - und schon ist es wieder da: