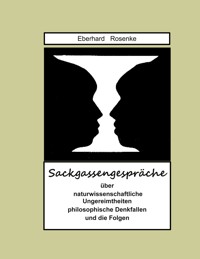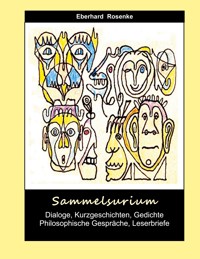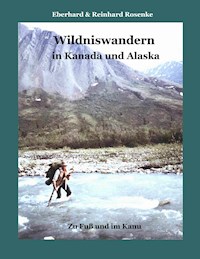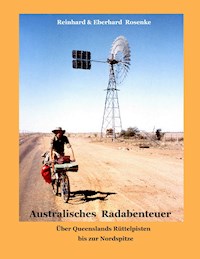Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Autor wandert von Trier nach Görlitz. Anschließend reist er über Kottbua (Branitzpark) nach Berlin und von dort zurück nach Hause. Er übernachtet entweder draußen oder in billigen Privatquartieren und Pensionen. Unterwegs führt er mancherlei Gespräche über alle möglichen Themen: Natur, Philosophie, Theologie u.a. Er blickt manchmal in die Vergangenheit und beobachtet seine Umgebung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Von der Mosel zum Rhein
Anfang
Start
Kues
Der Hunsrück
Burg Waldeck
Am Rhein
An der Lahn
Bad Ems
Auf der Hohen Ley
Der Jakobsweg
Limburg
Wetzlar, Gießen
Von der Lahn zur Schwalm
Gewitter
Zu Besuch
Gespräch über die Natur
Gespräch über den Zufall
Theologisches Gespräch
Durchs Knüllgebirge
Nächtliches Abenteuer
Nach Rotenburg an der Fulda
Noch ein Gespräch über die Natur
Im Märchenwald
Der Hohe Meißner
Geschichtliches
Der Wandervogel
Kulturkrise
Das Jugendfest auf dem Hohen Meißner
Danach
Eschwege
Mythologisches Gespräch
Von der Werra zur Unstrut
Zonengrenze
Kreuzweg
Lengenfeld
Mühlhausen
Gespräch mit Luzifer
Bad Frankenhausen
An der Unstrut entlang
Kyffhäuser
Roßleben
Laucha
Freyburg
Friedrich Ludwig Jahn
Kurze Dampferfahrt
Jena
An der Saale entlang
Das grüne Haus
Vortrag über Fichte
Gespräch über Fichte
Von der Saale zur Elbe
Bad Köstritz
Mit Gottes Segen nach Gera
Von Gera nach Crimmitschau
Ein Abstecher zu Karl May
Von Chemnitz nach Oedenau
Die alte Managerschmiede Freiberg
Gespräch über Fortschritt
Draußen
Von der Elbe zur Neiße
Dresden
Abstecher nach Radebeul
Schloß Wackerbarth
Gespräch übers Verreisen
Königstein
Wandern pur
Gespräch über die Schöpfung
Spreequelle
Herrnhut
Fortsetzung des Schöpfungsgesprächs
Görlitz
Letzte Etappe
Jakob Böhme
Oder-Neiße-Grenze
Rückreise
Branitzer Park
Berlin
Nachwort
Vorwort
Während seine Frau in der Küche werkelt, nutzt der alte Mann die Zeit bis zum Mittagessen dazu, alte Papiere zu sichten und möglichst viel wegzuwerfen: alte Briefe, Zeitungsausschnitte, Notizen, Rechnungen und sogar ein paar Bücher. Gerade wirft er wieder einige Papiere auf den Abfallhaufen, da rutscht zwischen den Blättern ein altes, fleckiges Schreibheft hervor. Er ergreift es, schlägt es auf und liest: „Tagebuch Trier – Görlitz‟. Der Alte ärgert sich: „Das wollte ich bestimmt nicht wegschmeißen!‟
Kurz darauf ertönt aus der Küche der Ruf: „Bitte essen!‟ Als er seiner Frau von dem Fund erzählt, meint sie: „Das war die Wanderung, die mit der Todesnachricht anfing.‟ Die Todesnachricht, ein schwarz umrandeter Brief, kündete vom Tod eines Studenten aus längst vergangenen Zeiten. Der alte Mann: „Diese Wanderung hatte ich total vergessen.‟ - „Dabei war doch die Todesnachricht der zündende Funken, der dich hinaustrieb.‟ - „Ja, jetzt erinnere ich mich: damals war ich noch ein frisch gebackener Frührentner.
+
Der alte Mann versinkt in Erinnerungen. Als Student an der Universität Kiel hatte er mit viel Glück ein Zimmer in einer alten Mietskaserne ergattert, in der sich das Klo eine halbe Treppe tiefer im Treppenhaus befand und ein Wasserhahn in der Küche das Badezimmer ersetzte. Seine Wirtin, die Besitzerin der Mietskaserne, war selbst alt, ja siech. Einmal rutschte er im dämmrigen Flur auf einem Häufchen Kacke aus. Dann starb die alte Frau und er hätte ausziehen müssen. Doch er hatte Glück. Sie hatte das Haus ihrem Neffen Lars vererbt, der gegen den Willen seines Vaters, eines Fleischermeisters, Philosophie studierte und kein Geld bekam. Lars vermietete ihm eine der Dachkammern als Ersatzwohnung. Auch für die übrigen Dachkammern, die alle nicht heizbar waren und statt Fenster Dachluken hatten, fand er dankbare Studenten, denn Studentenbuden waren rar. Und weil einige der Bewohner abends gern im Trockenraum zusammensaßen und diskutierten, kam Lars auf die Idee, eine „Dachkammergesellschaft zur Beförderung philosophischer Gedanken‟ zu gründen. Es gab feste Sitzungszeiten, meist abends bei Wein und Kerzenschein, denn der Trockenraum hatte keinen elektrischen Anschluß.
+
Der alte Mann geht ins Wohnzimmer, setzt sich aufs Sofa und schlägt das Tage buch auf.
Von der Mosel zum Rhein
Anfang
Die Wanderung begann mit der Geburt des Wanderers aus Stille und Dunkelheit, Stille, in der ein Dröhnen nachhallte, Dunkelheit, in der es aufblinkte wie Fischbauch über der Wassertiefe. Eine dunkle Stille, von elastischen Stößen erschüttert. Ebenso plötzlich Lärm, der die brodelnde Stille sprengte, aber nicht von ihr loskam. In der Spannung von Lärm und gewesener Stille nahm das Chaos Form an. Lärm wurde zu heiserem Röhren, zu dumpfem Dröhnen, zu Quietschen und Knarren. Die Geräusche verräumlichten, glitzernde Flecken glitten vorüber.
Dann erhob sich dünner Gesang, schwang sich auf über das Ächzen der Elemente und das Spiel der Formen und kondensierte am Faden einer Melodie zu einem Individuum. Die Verdinglichung schritt immer weiter fort: ein schaukelnder Bus, ein sich wiegender Körper, lautlos pendelnde Köpfe über den Sessellehnen, Regenschlieren. Das Individuum wurde zu einem Ich, das zu der Gewißheit erwachte, sei ne eigene Entstehung erlebt zu haben.
+
Verschattete Häuser rückten heran, wichen zur Seite, verdichteten sich zu fahlen Straßenzügen, schminkten sich mit schrillen Neonfarben. Dann der Bahnhofsplatz: Endstation, alles aussteigen! Die Businsassen zerstreuten sich und verschwanden eilig in der Dämmerung, ein leichter Luftzug hauchte Sprühregen auf alle Oberflächen. Ich schnallte den Rucksack fest und sah mich um. Ein Bahnhofsschild bestätigte: Hier ist Trier.
Die undeutlichen Fassaden ragten auf wie Grabmäler, über den Dächern hing ein schmutzigbrauner Wolkensack. Mehrere Kirchturm-Uhren schlugen wirr durcheinander: elf Uhr, noch eine Stunde bis Mitternacht, drei Stunden Verspätung! Wegen Bauarbeiten an den Bahngleisen waren die Zuginsassen beim Halt in einem kleinen Ort aufgefordert worden, in bereitstehende Busse umzusteigen. Es stand aber nur ein einziger Bus da, und der wurde von einer Meute chinesischer Touristen mit riesigen Rollkoffern rücksichtslos gekapert. Es dauerte eineinhalb Stunden, bis der Bus zurück kam, um die restlichen Passagiere abzuholen.
Was nun? Ein großer, beleuchteter Stadtplan empfahl einige Hotels, aber ich konnte mich nicht entschließen, auf Zimmersuche zu gehen und wählte lieber einen Park als Nachtquartier. Das half auch gegen den Pesthauch der Verlassenheit, wie ich aus Erfahrung wußte. Unbemerkt von einigen Hundebesitzern und Liebespärchen, die ihren Abendspaziergang absolvierten, verzog ich mich in ein Gebüsch unter großen Bäumen, unter denen der Boden trocken war, und rollte meinen Biwaksack aus.
+
Etwas Bohrendes störte. Ich schlug die Augen auf und starrte verständnislos auf einen moosüberzogenen Felsbrocken, in dessen Schatten sich etwas bewegte. Doch der Felsbrocken verwandelte sich in ein Stück des olivgrünen Biwaksacks, das Störende entpuppte sich als mißtönendes Kläffen. Ich hob den Kopf - aus dem Ge büsch glotzten mich die vorquellenden Augen einer Art Luxusratte an. Ich zischte scharf, worauf das Wesen einen Satz nach hinten machte. Eine weibliche Stimme rief ängstlich: „Buppi, komm her! Komm endlich!“
Ein feuchtwarmer Wind strich durch das neblige Geäst der Bäume, in den Netzen der Spinnen glitzerten winzige Wassertröpfchen. Ich suchte mir auf dem wurzligen, harten Untergrund eine bequemere Lage und blieb noch ein wenig liegen. Ich stellte mir vor, ein Parkwächter hätte mich entdeckt und gefragt: Was machen Sie da? - Na, übernachten. - Und was wollen Sie hier? - Nichts. - Nichts? Warum sind Sie dann hergekommen? - Weil Trier so weit im Westen liegt. - Werden Sie nicht patzig! - Das ist nicht patzig, sondern die Wahrheit. - Und was wollen Sie hier? Ich fragte es schon einmal. - Nichts, das sagte ich auch schon einmal. Ich bin hier, um Trier zu verlassen.
Eine Kirchturmuhr unterbrach das Traumgespräch. Schlug sie sechsmal? siebenmal? Ich quälte mich hoch, packte meine Sachen zusammen und machte mich auf die Suche nach einem Frühstück. Daß ich nach Trier gekommen war, weil die Stadt ganz im Westen lag, stimmte. Meine Absicht war, Deutschland von West nach Ost zu durchwandern – von Trier bis Görlitz. Unterwegs hoffte ich zwei Kumpel aus der Dachkammerzeit besuchen zu können, mit denen ich noch in lockerer brieflicher Verbindung stand.
Der Tag hatte noch nicht richtig begonnen. Es sprühte leicht, ein paar Tauben gurrten und klatschten mit den Flügeln. Weiter vorn drehte sich etwas im Kreise: ein Halbmensch, Hund genannt, kackte in den Rinnstein. Er wußte, was sich gehört, besser als mancher Ganzmensch. Nun schlurfte auch das zugehörige Herrchen um die Ecke, dickbäuchig unterm Regenschirm eine Zigarre rauchend, die Zeitung im Arm. Er wünschte mir einen schönen, guten Morgen. Ich nutzte die Gelegenheit und fragte nach einer Bäckerei. Der Mann erwiderte: „Kommen Sie mit.“ Der wollige Hund sah genau so gemütlich aus wie sein Besitzer, der gerade eine dicke Tabakwolke ausatmete. Ich schnupperte: „Nanu, Ihre Zigarre duftet ja.“ Der Mann nickte: „Zigaretten stinken mir zu sehr.‟ - „Aber früher gab es auch duftende Zigaretten.‟ - „Heute raucht man nicht, um zu genießen.“ - „Sondern?‟ - Er zuckte mit den Achseln: „Um sich aufzuputschen.‟
Wir erreichten eine Straßenecke, vor uns lag ein weiter Platz. Der Mann zeigte auf ein großes Gebäude: „Wissen Sie, was das ist?“ - „Sieht aus wie eine Fabrik. Ein Kraftwerk?“ - „Ein Kraftwerk, ja, aber ein geistliches, aus dem 4. Jahrhundert.“ „Die Konstantin-Basilika?“ - „Ja, erst ein politisches Kraftwerk, danach ein religiöses.“ - „Sicher katholisch.‟ - „Nein, seit unserer preußischer Zeit leider evangelisch.‟ - Warum „leider‟? - Weil evangelische Kirchen meistens verschlossen sind.“ - „Es wird eben zu viel geklaut.“
Der Mann ergriff meinen Arm und deutete nach links: „Dort kommen Sie direkt ins Stadtzentrum.“ Ich bedankte mich und fand schnell eine Bäckerei, die nicht nur Gebäck, sondern auch Kaffee und belegte Brötchen verkaufte.
+
Bevor ich die Stadt verließ, streifte ich noch ein wenig durch die sauber herausgeputzten Gassen. Trier rühmt sich, die älteste Stadt Deutschlands zu sein, ge gründet schon im Jahre 17 v. Chr. als Augusta Treverorum. Die Basilika des Kaisers Konstantin, einst eine Markt- und Gerichtshalle, bezeugt jedenfalls, daß Trier in der Spätantike eine Kaiserresidenz des Römischen Imperiums war, ein Verwaltungszentrum, dessen Macht von Schottland bis nach Nordafrika reichte. Damit nicht genug: Eine Gründungssage munkelt sogar, daß Trier älter sei als Rom: ein gewisser Trebeta, Sohn eines Assyrer-Königs, habe die Stadt 1300 Jahre vor Rom gegründet.
Früher, als die Antike und alles Alte großen Respekt genoß, mag ja diese Sage Eindruck gemacht haben. Heute klebt am Alten das Etikett des Morschen, Klapprigen, Unnützen, deshalb glaubt man jetzt lieber an Sagen von der Zukunft.
Der Fuß Kaiser Konstantins
Am Rand eines Parks stand ich plötzlich vor einem riesigen, nackten Fuß aus Stein auf einem Sockel, ausgewiesen als Kopie eines Fußes, dessen römisches Original zu den Überresten einer Konstantin-Statue gehört. Der Kaiser hatte sie nach einer gewonnenen Schlacht zu seinem Ruhm anfertigen lassen. Dieser Fuß war bestens zum Geküßtwerden geeignet, ein Ort der Sehnsucht für Anhänger „starker Männer‟.
In einer Straße fiel mir eine Menschenansammlung auf: es waren die Chinesen aus dem Bus, die vor dem Geburtshaus ihres Propheten Karl Marx auf Einlaß warteten. So wie Christen nach Santiago de Compostela wallfahren, so Chinesen nach Trier zur ehrerbietigen Beschau seiner Reliquien. Wenn die wüßten...! Marx und Engels verachteten nämlich ihre Fans. In einem Brief von 1851 schrieb Engels:
Was soll uns, die wir auf die Popularität spucken, die wir an uns selbst irre werden, wenn wir populär zu werden anfangen, eine „Partei“, das heißt eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält?
Und Marx im gleichen Jahr:
... die Pflicht, vor dem Publikum seinen Teil Lächerlichkeit in der Partei mit all diesen Eseln zu nehmen, das hat jetzt aufgehört.
Start
Porta Nigra
Nach einem Blick in den Dom marschierte ich, an der Porta Nigra vorbei, aus der Stadt hinaus. Es heißt, das gewaltige Stadttor sei dem Schicksal eines Steinbruchs nur entronnen, weil es zu Ehren eines frommen Einsiedlers, der in ihr gehaust hatte, nach dessen Tod in eine Kirche umgewandelt wurde. Dieser Einsiedler namens Simeon war ein griechischer Mönch aus dem Katharinenkloster am Sinai. Er sollte da Geld eintreiben, das ein normannischer Herzog dem Kloster während eines Kreuzzugs im „Heiligen Land“ versprochen hatte. Als er nach einer abenteuerlichen Reise in der Normandie ankam, war der Herzog verstorben und das Geld futsch. Simeon kehrte nicht ins Kloster zurück, sondern ließ sich in der Porta Nigra einmauern und galt als wundertätig. Der Papst sprach ihn heilig.
Mein Weg aus der Stadt hinaus folgte den Bahngeleisen, die ihrerseits den Windungen der Mosel folgten. An den Berghängen der berühmten Mosellandschaft reckten sich unzählige Weinstöcke, streng ausgerichtet wie Soldaten bei der Parade, und beeinträchtigten die Romantik. Moselwein hatte ich von früher her in schlechter Erinnerung: wenn im Familienkreis überhaupt mal Wein getrunken wurde, dann „lieblicher‟ Moselwein, der mir zu süß und labberig war.
Christus- Monogramm
Der trübe Himmel und die feuchte Luft dämpften die äußeren Sinnesreize und bevorzugten die inneren: meine Gedanken schweiften zurück zum Fuß des Konstantin. Heute träumen viele von einem „historischen Fußabdruck“ und wären stolz, wenn sie nach ihrem Tod einen überdimensionalen, steinernen Fuß zurücklassen könnten. Warum eigentlich?
Die Statue Kaiser Konstantins, zu welcher der Fuß gehört, liegt längst in Trümmern, und das kann jedem „historischen Fußabdruck" passieren. Zwar hat Konstantin bei den Christen – zumindest in den Ostkirchen – bis heute einen Heiligenstatus, obwohl er seine Mitkaiser Maximinianus und Licinius, der eine sein Schwiegervater, der andere sein Schwager, hatte ermorden lassen, ebenso seine Frau und einen Sohn, und das werden nicht die einzigen gewesen sein. Historische Fußabdrücke sind umstritten und nicht davor gefeit, sich in „geschichtliche Fußtritte‟ zu verwandeln.
Sonnensymbol
„Heilig“ nennt man etwas, das göttlich infiziert ist. Die Christen glaubten, daß es ihr Gott war, der Konstantin dazu veranlaßte, das Christentums zu einer Staatsreligion zu erheben. Eine merkwürdige Sache, denn Konstantin war Anhänger des Sonnenkults. Eine Legende erzählt, daß er vor der Schlacht gegen seinen Mitkaiser Maxentius an der Milvischen Brücke in einem Traum angewiesen wurde, das im Traum geschaute Zeichen auf den Schilden seiner Soldaten anzubringen. Er tat es und siegte. Und weil er den Sieg auf dieses Zeichen zurückführte, so die Legende, habe er das Christentum zu einer erlaubten Religion erhoben. Das Zeichen war aber schon vorher als Sonnensymbol bekannt. Man kann es auch leibhaftig sehen, wenn die Sonne von einem Baumstamm verdeckt wird und ihre Strahlen rechts und links hervorleuchten.
Vielleicht hatte die Aufwertung des Christentums auch strategische Gründe: für den Ausbau und Erhalt seiner Macht war ein staatstragender ideologischer Überbau wichtig, und das Christentum war in vielen Städten des Reichs verbreitet. So begann die Koalition des Christentums mit der Staatsmacht.
Auch Konstantins Mutter Helena wird als Heilige verehrt, denn sie bekam eine göttliche E-mail, die ihr befahl, nach Jerusalem zu reisen. Sie tat es und ließ die Hinrichtungsstätte Jesu ausgraben. Um herauszubekommen, welches der drei ausgegrabenen Kreuze dasjenige war, an dem Jesus einst gehangen hatte, machte sie eine Art naturwissenschaftliches Experiment: sie ließ die Kreuze nacheinander an einen Leichnam legen, der gerade aus der Stadt herausgetragen wurde. Als der Leichnam plötzlich lebendig wurde, hatte sie das richtige Kreuz gefunden.
Die „Königlich privilegierte Berlinische Zeitung“ vom 20. November 1844 druckte die Kritik Ronges ab.
So kam sie, „schwer mit den Schätzen des Orients beladen“, nach Europa zurück. Einige Schätze sollen sich noch heute in der römischen Kirche Santa Croce in Gerusalemme befinden, nämlich Erde vom Kreuzigungshügel Golgatha, drei Bruchstücke des Kreuzes Christi, zwei Dornen der Dornenkrone, ein Kreuznagel, ein Stück der Inschrift INRI und der Finger des „ungläubigen Thomas“, den er dem auferstanden Christus in dessen Wunde legte. Nach Trier schickte Helena, wie eine alte Chronik berichtet, ein Kleidungstück Jesu: den sogenannten „Heiligen Rock“.
1844 organisierte das Bistum Trier eine Wallfahrt zum Heiligen Rock, die eine halbe Million Menschen auf die Beine brachte. Von 18 Heilungswundern war die Rede. Es gab aber auch heftige Kritik und Spott von Christen beider Konfessionen. Der katholische Priester Johannes Ronge empörte sich öffentlich: die Wallfahrt sei eine bewußte Täuschung ungebildeter Menschen, das Opfergeld ein Geschäft mit ihrem Aberglauben. Christus habe den Gläubigen seinen Geist, nicht seinen Rock hinterlassen. Daraufhin wurde er exkommuniziert.
Bewies nicht der unmittelbare Anblick des Rocks, daß die Berichte über den Wan derprediger Jesus von Nazareth stimmten? So wie das, was wir im Fernsehen mit eigenen Augen sehen, im Radio mit eigenen Ohren hören können, real sein muß? Und ebenso, daß der Zauberkünstler ein Kaninchen aus seinem leeren Hut ziehen kann.
+
Ein Stolpern brachte mich zurück in die Wirklichkeit. Der Himmel, eben noch grau in grau, ließ hinter dünnen Wolkenschleiern die Sonnenscheibe erkennen. Im Örtchen Ruwer bog ich ab auf einen Weg hinauf in die Weinberge, einen schier endlosen Weg, der sich etwa 300 Höhenmeter hinaufwand. Bald keuchte ich und mußte den Schritt verkürzen, der Schweiß rann mir kitzelnd über die Haut. Oben wechselte sich schöner Mischwald mit Weinfeldern ab. Plötzlich alarmierte ein Aufleuchten aller Farben meine Sinne – die Sonne hatte den Wolkenvorhang zur Seite gezogen. Zwischen den dünnen Stangen der Rankenpflanzen wurde es augenblicklich heiß. Oberhalb von Fastrau unterquerte ich die riesigen Stelzen einer Autobahnbrücke und legte in ihrem Schatten eine kurze Pause mit ein paar Dehnübungen ein, denn der Rucksack begann zu drücken und das Kreuz zu schmerzen. Dann stieg ich wieder hinab zur Mosel.
Der Ort im Tal hieß Riol. Der nächste Aufstieg ging durch nassen Wald. Jedes Blatt, jeder Grashalm war tropfnaß und glänzte wie Edelstein. Noch zweimal mußte ich die Autobahn queren, einmal auf einer Brücke, auf der ein Ehepaar, aufs Geländer gestützt, genießerisch das Vorbeirasen aufheulender Autorudel beobachtete. Mittags erreichte ich einen dreieckigen Aussichtsturm, kletterte die zwanzig Meter zur Spitze empor und machte oben Pause. Der Blick schweifte über die Moselschlingen hinweg bis ins Gebiet der Südeifel. Ein erstes Hochgefühl machte sich breit.
Beim Weitergehen vermißte ich die Anschlußwanderkarte, offenbar war sie zu Hause liegengeblieben. Das war aber kein Unglück, weil ich dem M des Mosel- Wanderwegs folgen konnte. Allerdings mußte ich scharf aufpassen, um das Zeichen bei den fast unvermeidlichen Träumereien nicht aus den Augen zu verlieren. Aber genau das passierte. Nun hatte ich nur noch die Sonne als Orientierungshilfe. Die Wege verzweigten sich, ich manövrierte mich von einem zum anderen – und siehe da, in einem Ort namens Papiermühle winkte wieder das M. Wie zur Strafe leitete es mich abermals himmelwärts, das wievielte Mal eigentlich? Till Eulenspiegel hatte sich beim Bergaufgehen mit dem Gedanken getröstet, daß es danach wieder abwärts gehen würde – mich nicht!
Um halb sechs betrat ich schmerzgequält die Dorfstraße von Horath, kaufte in einem Tante-Emma-Laden Joghurt, Dickmilch, Äpfel und Bananen ein und erfragte von der Verkäuferin eine Privatunterkunft. Nach dem achtstündigen Marsch war ich ziemlich kaputt, der Körper begann zu schlottern. Eine heiße Dusche, Essen, Liegen und ein paar Dehnübungen stellten mich wieder her. Das Zimmer lag direkt unter dem Dach. Nachts weckten mich unheimliche Geräusche im Flur – ach so, die Hauskatze.
+
Kurz vor acht am nächsten Morgen stieg ich die Treppe hinunter, den Rucksack nahm ich gleich mit. Der Frühstücksraum überraschte mich mit unzähligen Blumentöpfen und einem großen Vogelkäfig. Ein Frühstücksbuffet gab es nicht, dafür Mehrkornbrot, Käse, Wurst, Marmelade am Platz. Die Pensionswirtin, eine lebhafte, pummlige Frau, erzählte, sie und ihr Mann wären Zugereiste - also Migranten? - aus Düsseldorf. Schon seit 40 Jahren vermietete sie Zimmer. Ihr Sohn hätte mit der „Gorch Fock“ eine Reise nach Dakar gemacht: vorher wäre er begeistert vom Seemannsleben auf dem Segelschulschiff gewesen, hinterher nicht mehr. Jetzt sei er Marineflieger, wolle Hubschrauberpilot werden. Ich fragte: „Und warum hat er gewechselt?“ „Das Seemannsleben war sehr hart.‟ - Ich: „Wandern kann auch hart sein.‟ Sie, erstaunt: „Warum tun Sie es dann?“ - „Weil es Spaß macht. Auf die Härte kommt es nicht an.‟ - „Und worauf kommt es an?“ Mir fielen Verse von Heinrich Heine ein:
Beine hat uns zwei gegeben
Gott der Herr, um fortzustreben,
Wollte nicht, daß an der Scholle
Unsre Menschheit kleben solle.
Um ein Stillstandsknecht zu sein
G'nügte uns ein einz‘ges Bein.
Sie, kopfschüttelnd: „Ist das Ihr Ernst?“ Ich lächelte und stand auf.
Als ich gesättigt aus dem Haus trat, schien die Sonne, auf der Dorfstraße tummel ten sich viele Menschen. Sie bereiteten die Fronleichnamsfeier vor. Überall Fahnen und große Wimpel - blau-weiß, rot-weiß, gelb-weiß - und mit Tannenzweigen geschmückte Altäre. Auf dem Boden kunstreiche Bilder aus Blättern und Blüten. Dieses festlich-bunte Treiben wirkte auf einen, der in protestantischer Nüchternheit aufgewachsen war, fremd und seltsam.
Noch seltsamer erschien mir, was da gefeiert werden sollte: Fronleichnam. Eine Feier, die an die sogenannte Abendmahlsfeier, also an das letzte Abendessen Jesu und seiner Jünger erinnern sollte. Und weil Jesus beim Verteilen von Brot und Wein laut Evangelium gesagt hatte, dies sei sein Leib und sein Blut, nehmen Katholiken an, die Oblaten und der Wein bei der Eucharistiefeier seien zuvor vom Pries ter durch die Zauberformel Hoc est enim corpus meum! - deutsch: „Dies ist mein Leib‟ - in das Fleisch und Blut Jesu verwandelt worden. Diese Zauberformel kannte ich auch – etwas abgewandelt – aus Kindertagen:
Hokuspokus Fidibus,
dreimal schwarzer Kater!
Die Kannibalen, die getötete Feinde verspeisten, glaubten, sie würden sich deren Kraft und Tapferkeit einverleiben. Glauben das auch die Katholiken?
Kues
Während sich mein Körper den Weg hocharbeitete, den er gestern abend heruntergestolpert war, weilte mein Geist noch in religiösen Gefilden, bis mich der Anblick eines M elektrisierte und mich veranlaßte, in eine einstige Römerstraße einzuschwenken. Auf ihr wurden auch Autos geduldet, aber es kamen keine. Gegen Mittag erreichte ich Monzelfeld und machte eine kurze Obst-Pause auf dem Friedhof.
Der M-Weg führte ins Tal, doch in einem Wald verschwand das M in einem Chaos von Wanderzeichen und ich stand plötzlich am Steilhang über dem Moseltal. Der Übergang aus der einhüllenden, dämmrigen Waldatmosphäre ins grelle Sonnenlicht auf dem Felsvorsprung war abrupt. Unter mir lag der bekannte Weinort Bernkastel, am anderen Ufer Kues. Die Mosel umrundete in der Nähe ein Berghindernis und transportierte gerade ein Ausflugsschiff flußabwärts. Ein Ansichtskartenblick!
Nicht weit entfernt von meinem Ausguck entdeckte ich die Burgruine Landshut, kämpfte mich zu ihr durch und folgte dort einem Pfad zwischen Weingärten hin ab in den Ort. Der Himmel hatte sich verdüstert, ein kühler Wind wehte. In einem fast leeren Café stärkte ich mich mit Käsekuchen und Cappuccino. Draußen auf der Straße drängten sich Touristengruppen, meist ältere Semester. Ich blieb nicht lange sitzen. Durch eine enge, von Menschen verstopfte Straße mit Fachwerkhäusern kämpfte ich mich abwärts zum Flußufer durch, überquerte die Mosel auf einer Brücke und gelangte nach Kues.
Nikolaus von Kues
Der kleine Ort lag zwar nicht auf, aber an meinem Wanderweg. Sein Name war für mich mit dem Namen eines berühmten Mannes verknüpft. Und der Weg des Wanderers, der ja angeblich sein Ziel ist, wird durch attraktive Zwischenziele anziehender. Der berühmte Mann hieß eigentlich Nikolaus Cryfftz (=Krebs), nannte sich aber nach seinem Geburtsort Nikolaus Cusanus (1401-1464) und war ein berühmter Philosoph, Theologe, Kardinal und Mathematiker.
Eine Viertelstunde lang marschierte ich am Mosel-Ufer entlang flußaufwärts, nur um einen Blick auf sein Geburtshaus zu werfen. War das reine Neu- bzw.
Altgier? Vielleicht war es auch die Anziehungskraft eines bedeutenden Geistes, der hier materielle Spuren hinterlassen hatte. Was ich vorfand, war keine Hütte eines armen Schluckers, sondern eher ein Schloß, dem man den Wohlstand seines Vaters, eines Schiffers, ansah.
Ich kehrte um. In der Nähe der Brücke, über die ich gekommen war, steht auch noch das alte Cusanus-Stift, das der Kusaner im Jahre 1458 als Armenhospital gegründet hatte, und zwar – entsprechend den 33 Lebensjahren Jesu - für 33 alleinstehende Männer: sechs Adlige, sechs Priester und 21 Leute aus dem Volk. Seit Ende der 1960er Jahre wurden sogar Frauen aufgenommen. Statt Armenhospital nennt es sich jetzt Altenheim.
Das Cusanus-Stift bewahrt auch die Bibliothek des berühmten Mannes auf: wissenschaftliche Instrumente und Hunderte mittelalterlicher Handschriften aus Theologie, Philosophie, Mathematik und Wissenschaft. Sie gilt als die bedeutendste Privatbibliothek, die aus dem Mittelalter erhalten geblieben ist. Ich warf aber nur einen Blick auf das Gebäude und kehrte über die Brücke nach Bernkastel zurück.
+
Der Name des Cusaners war mir vor allem wegen seiner philosophischen Überlegungen geläufig, die der Suche nach dem verborgenen Gott gewidmet waren. In seiner Schrift coincidentia oppositorum (das Zusammenfallen der Gegensätze) unterscheidet der Autor zwei geistige Sichtweisen: die des Verstandes, der die Dinge voneinander trennt, sie vereinzelt, und die der Vernunft, welche das Einzelne, das Unterschiedene, ja Gegensätzliche im jeweiligen Bezugsrahmen zusammendenkt. Dieses Verhältnis zwischen Verstand und Vernunft erweiterte der Kusaner zum Verhältnis Welt-Gott. Giordano Bruno (1548-1600), der durch ihn zur Idee einer unendlichen Natur inspiriert wurde, nannte ihn den „göttlichen Kusanus“.
Eine andere bekannte Schrift handelt von der docta ignorantia, der gelehrten Unwissenheit des Sokrates bzw. vom Begreifen des Unbegreiflichen, genannt „Gott“. Gott, so die Behauptung, können wir nicht durch Wissen über ihn, sondern nur durch Wissen über unser Nichtwissen näherkommen.
Das gilt, denke ich, ganz allgemein für „Geist‟. Warum suchen wir denn Gedenkstätten auf und feiern Gedenktage? Weil sich in ihnen der immaterielle Geist, der auch als Ungeist Geist ist, mit der Raum-Zeit-Welt verbindet und als Gedenk tag, Jubiläum, Denkmal, Bauwerk, Buch, Bild, Partitur fixiert wird. Er wirbt um Teilnahme und Teilhabe, denn ohne Interesse können noch so viele Hinweise und Merkmale nicht verhindern, daß sich der Geist verflüchtigt.
+
Von Bernkastel trabte ich nach Traben-Trarbach, das hinter der nächsten Moselschleife lag. Ich benutzte aber nicht die belebte Uferstraße, sondern wieder den Umweg über die Berge mit den schier endlosen Weinpflanzungen. Auf den Wegen waren viele Ausflügler unterwegs, jeder grüßte, jedem mußte geantwortet werden. In Traben-Trarbach – eineinhalb Stunden später – drängelte sich die Menschheit ebenso wie in Bernkastel. Der Himmel hatte sich inzwischen verdunkelt, es wurde ungemütlich. Ich schlenderte unschlüssig durch die Gassen, konnte mich aber nicht dazu durchringen, in Traben-Trarbach nach einem Hotelzimmer zu fahnden.
Also - ein letztes Mal bergauf, diesmal auf einem schönen Wanderpfad, der durch einen Wald nach Starkenburg führte. Dort begann es zu tröpfeln. Ich erspähte hinter dem Ort in einer Talmulde einen halbfertigen Geräteschuppen, rutschte auf matschigen Wegen steil hinunter und quartierte mich dort ein. Lange Bretter an der Schuppenwand lieferten einen glatten und waagerechten Untergrund für meine Kunststoffmatte und den Schlafsack. Im Brotbeutel fanden sich noch drei Stullen von zu Hause. Inzwischen prasselte wütend ein Regenschauer aufs Schuppendach. Ich holte eine Schrift über den Kusaner aus dem Rucksack, die ich mir in Bernkastel gekauft hatte, und kroch in den Schlafsack.
Bei zunehmender Dämmerung las ich, daß Nikolaus von Kues 1433 erstmals die „Konstantinische Schenkung‟ als Fälschung entlarvte: er fand in ihr Sachverhalte, die zum Zeitpunkt ihrer angeblichen Ausfertigung noch nicht existierten. Auf diese Urkunde, die Kaiser Konstantin angeblich dem Papst Silvester I. ausgestellt hatte, gründete die römische Kurie seit dem 11. Jahrhundert ihre Machtansprüche, auch die auf einen eigenen Staat. Kaiser Konstantin erkannte angeblich den Vorrang Roms über alle Kirchen an, verlieh dem Papst kaiserliche Abzeichen und schenkte ihm den Lateran-Palast. Außerdem gab er ihm die Herrschaft über die Stadt Rom, das Land Italien und die römischen Provinzen im östlichen Mittelmeerraum. Die katholische Geschichtsschreibung konnte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts dazu durchringen, die Fälschung zuzugeben.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Cusanus als Kurienkardinal im Kirchenstaat und arbeitete ein Konzept zur Reform der Kirchenleitung aus, das aber folgenlos blieb. Sein Kommentar:
Nichts gefällt mir, was hier an der Kurie getrieben wird; alles ist verdorben, keiner tut seine Pflicht... Wenn ich im Konsistorium endlich einmal von Reform spreche, werde ich ausgelacht.
Daran hatte sich, scheint‘s, bis heute wenig geändert.
Dann war es zu dunkel zum Lesen. Ich legte das Heft weg und lauschte den kunst vollen Gesängen der Vögel. Irgendwann schlief ich ein. Jedesmal wenn ich wieder aufwachte, regnete es. Einmal näherte sich ein schnaubendes, blubberndes Wesen. Als in der Ferne ein Hund bellte, verstummte es.
Der Hunsrück
Die Nacht auf den Brettern war wenig erholsam, am nächsten Morgen taten mir alle Knochen weh. Ich stand auf, packte meine Sachen zusammen und stärkte mich mit zwei Bananen und zwei Feigen. Dann ging ich los.
Der Himmel hatte eine schwarzgraue Färbung, es regnete leicht. Den Weg hatten Maschinen kaputtgefahren und verschlammt. Eine Fußgängerbrücke über einen Bach befreite mich vom rutschigen Schlamm, aber der grasige Pfad, der dessen Lauf folgte, war naß und ebenfalls rutschig. Es ging zwischen steilen, bewaldeten Hängen bergauf. Auf halber Höhe bog ich in einen Weg ein, der ebenfalls verschlammt war. Endlich, eineinhalb Stunden später, erreichte ich eine Asphaltstraße. Aus den Schuhen quoll Wasser, ich wrang die Strümpfe aus. Auch die Hosen waren durchweicht und schlammbespritzt bis zu den Oberschenkeln. Ich blieb auf der Straße, um nicht noch stärker einzusauen.
Kleine Orte reihten sich aneinander: Raversbeuren, Hahn, Würrich, Belg, Rödelhausen, Kappel, Leideneck, Krastel, Bell. Hinter Hahn lud mich eine kleinen Hütte zu einer Pause ein. Draußen pfiff der Wind und der Regen rieselte vor sich hin. Es war kalt, die Finger wurden klamm.
Auch vor Kappel fand ich einen Unterschlupf. Kurz vor Krastel, es war gegen halb drei, versiegte endlich der Regen. Eine Bank am Straßenrand stand da wie gerufen. Ich setzte den Rucksack ab, um die Schultern zu entspannen, doch da setzte der Regen wieder ein und trieb mich weiter. Erstaunlich, wie lange und über welche Strecken sich die Wassermassen in der Luft halten konnten, um jetzt wie ein Wasserfall auf mich herabzustürzen – ein Liter Wasser bzw. ein Wasserwürfel von 10 cm Kantenlänge wiegt immerhin ein Kilogramm.
Die Gegend, in der ich mich befand, heißt „Hunsrück“, womit aber nicht der Rü cken eines Hundes gemeint ist. Für Geographen und Geologen ist der Hunsrück Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Wer aus dem Moseltal aufgestiegen ist, befindet sich auf einer ausgedehnten Hochfläche mit viel Wald, die von einigen Erhe bungen überragt wird, deren höchste der Erbeskopf (816 m) ist.
Die Geschichte des Hunsrück reicht bis in die Römerzeit zurück. Man hat Überreste von Straßen, Bauernhöfen, Siedlungen und militärischen Bauwerken aus einem Zeitraum von etwa 500 Jahren gefunden (50 v. Chr. - 450 n. Chr). Danach, scheint‘s, folgte der Geschichtsverlauf dem Refrain eines Liedes von Hildegard Knef: „Von nun an geht's bergab.“ Besonders schlimm hausten kurz nach dem 30jährigen Krieg die Truppen des französischen Superkönigs Ludwig IV., der den pfälzischen, anschließend den spanischen Erbfolgekrieg angezettelt hatte. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machten Räuber wie „Schinderhannes‟ oder „Schwarzer Peter‟, meist Viehdiebe, die Gegend unsicher. Unter Napoleon wurden alle Ge biete westlich des Rheins französisch. Nach seiner Niederlage kam der größte Teil des Hunsrück durch Neuaufteilung auf dem Wiener Kongreß 1815 an Preußen.
Als die wirtschaftliche Lage im Hunsrück während der Jahre 1815-1845 besonders schlecht war, das Jahr 1817 ging sogar als Hungerjahr in die Geschichte ein, folgten viele Hunsrücker einer Einladung der brasilianischen Regierung und wanderten 1822 aus. Ihr folgte eine zweite Auswanderungswelle nach Nordamerika und eine dritte, wieder nach Brasilien, in den 1840er Jahren, die europaweit durch Teuerung, Mißernten und soziale Unruhen geprägt waren. Die zunehmende Industrialisierung schuf neue Arbeitsplätze im Ruhrgebiet, so daß viele Hunsrücker mit ihren Familien auch dorthin abwanderten.
Wenn man diese geschichtlichen Ereignisse in den Vordergrund stellt und alle anderen, die guten und schönen, ausblendet, dann kann man nur noch sagen: „Die Hunsrücker waren auf den Hund gekommen“. Natürlich darf in diesem düsteren Panorama ein Konzentrationslager nicht fehlen. Es war 1939 als ein sogenanntes Polizeihaft- und Erziehungslager zur Umerziehung von notorischen Faulenzern, Gewohnheitstrinkern und Rückfälligen in Hinzert bei Trier gegründet worden, erhielt aber ein Jahr später den Status eines KZ‘s, in dem vor allem politische Häftlinge eingepfercht wurden.
Der ganze Körper schmerzte, als ich in dem kleinen, aber autoreichen Ort- Kastellaun regentriefend das Rathaus betrat. Im Verkehrsbüro besorgte mir eine freundliche Dame ein Zimmer in einer privaten Pension und beschrieb mir den Weg dorthin. Wieder empfing mich eine kleine rotbackige Pensionswirtin, wieder befand sich das Gästezimmer unterm Dach. Ich wechselte Hemd und Strümpfe und ging nochmal hinaus, einkaufen, denn ein Wochenende stand bevor! Anschließend genehmigte ich mir „beim Jugoslawen“, einem Bosnier, einen Grillteller und zwei „Halbe Weißbier“.
+
Das große, klobige Kreuz mit der angenagelten Jammergestalt, das über dem Bett hing, sollte dem Gast anscheinend einen Albtraum bescheren, aber das einzige, was mich in der Nacht tatsächlich quälte, war das Federbett. Es lastete auf mir wie zäher Schleim und behinderte jede Bewegung. Dennoch fühlte ich mich am nächsten Morgen ausgeruht. Die Sachen waren fast trocken, nur die dreckigen Schuhe nicht. Ich putzte sie und schmierte sie mit Fett ein.
Das Frühstückszimmer wurde nicht, wie in Horath, von einem Vogelkäfig dominiert, sondern von einem großen Kreuz an der Wand. Einige Heiligenbildchen unterstützen es bei der Abwehr des Bösen. Das Frühstück stand schon bereit: eine Kanne Kaffee, ein Ei, zwei Stullen mit Schinken, Wurst und Käse, zwei große Brötchen mit Marmelade. Und ausreichend Butter!
Die Zimmerwirtin fragte: „Haben Sie gut geschlafen?“ - „Ja, trotz Folterkreuz und der Sorge, es könnte mich erschlagen.“ Ganz erstaunt erwiderte die Frau: „Aber es sollte Sie doch beschützen.“ - „Wovor denn?“ - „Na, vor allem: vor Feuer, schlechten Träumen, bösen Geistern.“ - „Ach so! Die bösen Geister sollen es mit der Angst bekommen.‟ Die Frau, zögernd: „Ja..." Ich: „Das Kruzifix soll ihnen zeigen, was wir Menschen mit Göttern und Geistern machen, wenn wir sie in die Finger kriegen?“ Die Frau, leicht verwirrt: „Darauf bin ich noch gar nicht gekommen.“ - „Nein? Warum stehen oder hängen die Kreuze denn sonst auf den Feldern und in den Ämtern herum? Damit wir uns an einer Folter ergötzen können?“ Nun wußte die Frau Be scheid: „Sie sind ein Zyniker.“ Ich zahlte 30 € für die Übernachtung und ging.
Burg Waldeck
Der Weg, der mit dem H des Hunsrück-Fernwanderwegs gekennzeichnet war, schlängelte sich durch eine abwechslungsreiche Landschaft: mal hügelig, mal flach, mal Wald, mal Feld, und ab und zu menschliche Ansiedlungen, deren Häuser, mit grauen Schieferplatten verkleidet waren und städtisch wirkten. Hinter Uhler nahm der Schlamm überhand, der Weg sank ab ins waldige Deimerbachtal, vorbei an mehreren Forellenteichen. Doch kaum hatte er die Talsohle erreicht, zog es ihn wieder hinauf, wo der Himmel allmählich aufklarte.
An einer Straßenkreuzung hinter Mannebach achtete ich nicht auf das H, sondern tauchte in einen großen Wald ein. Das lautlose Gehen auf dem schmalen Pfad in Verbindung mit dem leisen Rauschen des Windes und dem plötzliche Aufglänzen von Lichtinseln im grünen Halbdunkel versetzte mich in eine zauberische Sphäre. Leider machte ihr eine dicke, glitschige Baumwurzel, die sich quer über den Weg gelegt hatte, ein jähes Ende. Ich stolperte und konnte nur mit Mühe das Gleichge wicht bewahren. Prompt erhob sich ein gellendes, schadenfrohes Kreischen, das mir zu verstehen gab: „Schadt dir gar nix!‟ Der spöttische Nachruf eines Kobolds?
Vielleicht war es auch der Eichelhäher, der über mich hinweg flatterte. Eichelhäher können ja sprechen, das versicherte einst ein alter, amerikanischer Silbergräber dem Mark Twain:
[Der Eichelhäher] besitzt mehr Stimmungen und mehr verschiedenartige Gefühle als andere Tiere, und, merken Sie sich das, was ein Eichelhäher fühlt, kann er auch in Sprache ausdrücken. Und auch nicht bloß in gewöhnlicher Sprache, sondern in fließender Schriftsprache, die von Bildern strotzt! Und was die Beherrschung der Sprache angeht — na, Sie erleben es nicht, daß ein Eichelhäher stecken bleibt und nach einem Wort sucht. Die Worte sprudeln direkt aus ihm heraus! Häher habe ich nur ganz selten schlechte Grammatik sprechen hören, und wenn sie es tun, schämen sie sich. Gleich halten sie den Schnabel und hauen ab. [Mark Twain: Reise durch Deutschland]
Ein Silbergräber, der jahrelang unter den Vögeln des Waldes gelebt hatte, müßte es ja wissen. Und der zivilisierte Mensch, der sich als animal rationale – als sprechendes bzw. intelligentes Tier - allen Tieren haushoch überlegen glaubt und bezweifelt, was ein alter Silbergräber sagt, könnte sich täuschen! Ein animal rationale ist noch lange kein homo sapiens!
Der schmale Pfad mündete in eine breite Schneise, den Baumkronen wie ein Tun neldach überwölbten. In diesem grünen Tunnel kam mir ein Reiher entgegengeflogen. Würde er es wagen, dicht über einen Menschen hinwegzufliegen? Der Vogel mußte sich blitzschnell entscheiden - nein, er wagte es nicht, er traute dem Menschen nicht und rettete sich mit äußerster Kraft durch eine Lücke nach oben ins Freie. Ein glatter, gefährlicher Steig führte hinab in die Baybachschlucht - in Rich tung der Burgruine Waldeck. Wasser rauschte, steile Felsen rechts und links schnürten den Wildbach ein, der einen Nebel feiner Wassertröpfchen versprühte. Manche Stellen des Stolperpfads waren mit Seilen gesichert, die Vegetation glich einem Dschungel. An einer Bacheinmündung verzweigte sich der Steig. Was nun? Links oder rechts?
Da erschien wie bestellt ein weißbärtiger Bundhosenträger. Ich fragte: „Richtung Burg Waldeck?“ Der Mann erkannte mich als seinesgleichen und sprach mich mit Du an: „Komm mit, da will ich auch rauf.“ Das hatte ich zwar nicht vor, aber ich hatte auch nichts dagegen.
Der Weißbärtige fragte: „Bist du ein Neromme?“ - „Nein. Was ist das?“ - „Du kennst nicht die Nerother Wandervögel?‟ - „Nie gehört. Ich bin ein gewöhnlicher Waldläufer.“ -„Von welchem Verein?“ - „Von keinem.“ - „Was willst du dann auf dem Stammsitz der Nerommen?‟ - „Damit meinst du wohl die Burg. Ich will gar nichts, die Burg liegt einfach am Weg. Aber jetzt bin ich neugierig, etwas über die Nerommen zu erfahren.‟
Während wir weiter durch die Wildnis stolperten, erzählte der Weißbart in abgehackten Sätzen, daß die Nerommen zur Deutschen Jugendbewegung gehörten, sich aber nach dem Ersten Weltkrieg vom allgemeinen Wandervogelverein getrennt hatten: aus Unzufriedenheit, denn sie glaubten, die Wandervögel aus der Großstadt hätten die Wanderkultur verdorben. Also das alte Lied von der reinen Lehre...
„Und woher kommt der Name?‟ - "1919 gründeten einige Wandervögel in einer Höhle bei Neroth, einem Ort in der Vulkaneifel, den Ritterbund der Nerommen.‟ „Aha. Und zu einem Ritterbund gehört natürlich eine Ritterburg.‟ - „So ist es. Die Nerommen haben Burg Waldeck, die 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört wurde, teilweise wiederaufgebaut. Sie sind Eigentümer des Burggeländes.‟
Burg Waldeck
Bei einem treppenartigen, glitschigen Felssteig blieb der Weißbärtige stehen: „Übrigens gehörten die Nerommen zu den wenigen Wandervogelgruppen, die sich von den Nationalsozialisten nicht gleichschalten ließen. Sie wurden verboten. Unser Begründer und Bundesführer Robert Oelbermann wurde von den Nazis verhaftet und starb 1941 im KZ Dachau.‟ Dann zeigte er auf den steilen Felssteig: „Hier geht‘s zur Burg‟ und kletterte hoch, ich folgte ihm. Das Gespräch versiegte aus Atemmangel. Oben wich der Wald einer großen Wiese, an deren Rand einige Häuser standen.
Der Weißbart machte Anstalten, sich zu verabschieden, da fiel ihm noch etwas ein: „Hast du schon mal vom deutschen Woodstock gehört?“ - „Nein.“ - „Es gibt hier seit 1964 Musik-Feste. Hier haben Franz Joseph Degenhardt, Reinhard Mey, Hannes Wader, Peter Rohland ihre Karriere begonnen. Mir fällt da ein Degenhardt-Lied ein, vielleicht kennst du es:
Tot sind unsre Lieder,
unsre alten Lieder.
Lehrer haben sie zerbissen,
Kurzbehoste sie verklampft,
braune Horden totgeschrien,
Stiefel in den Dreck gestampft.
Ich: „Das kenne ich nicht. Aber Rohland habe ich gern gehört.“ - „Der ist ja leider schon mit 33 Jahren gestorben.“ Er überlegte kurz:
Lustig, lustig, ihr deutschen Brüder
leget alle eure Arbeit nieder
und trinkt mit mir ein gut Glas Bier
und trinkt mit mir ein gut Glas Bier