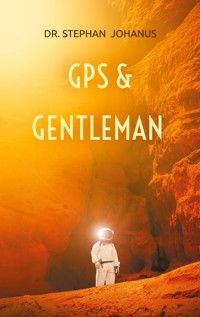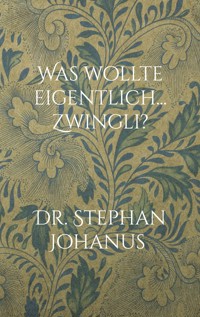Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Predigten zur Apostelgeschichte
- Sprache: Deutsch
Der Band II. enthält fortlaufend Predigten zur Apostelgeschichte (Kap. 15-28). Dabei behandelt er Themen der Mission und der Interkulturalität, sowie existenzielle Fragen, wie das Mensch-sein als Unterwegs-sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Das Apostelkonzil (Kap. 15)
1. Wenn - dann (Apg 15, 1-21)
2. Gemeinsam mit dem Übernatürlichen entscheiden (Apg 15, 22-29)
3. Auf-gerichtet (Apg 15, 30-35)
4. Konflikte aus der Transzendenz (Apg 15, 36-41)
Die Zweite Reise des Paulus (Kap. 16-18)
5. Multi culti – multi religio (Apg 16, 11-15)
6. Und die anderen? (Apg 16, 16-22)
7. Glaube ohne Ketten (Apg 16, 23-40)
8. Weg zum Besseren (Apg 17, 1-9)
9. Unterwegs (Apg 17, 10-15)
10. Wie man über die Religion reden kann (Apg 17, 16-34)
11. Gott zur Sprache bringen (Apg 18, 1-11)
12. Ich stehe unter Gottes Schutz (Apg 18, 12-23).
13. Christus - der Weg (Apg 18, 24-28)
Dritte Reise des Paulus (Kap. 19-21)
14. Natürlich übernatürlich (Apg 19, 1-7)
15. Bewegt (Apg 19, 8-22)
16. Land in Sicht (Apg 19, 23-40)
17. Gelassenheit siegt (Apg 20, 1-12)
18. Geben macht glücklicher (Apg 20, 13-38)
Paulus als Gefangener in Jerusalem (Kap. 21-23)
19. Der Weg verändert (Apg 21, 1-14)
20. Du zuerst! (Apg 21, 15-25)
21. Gottes Wort ist nicht gebunden (Apg 21, 26-40a)
22. Was ist der Heilige Geist? (Apg 22, 1-21)
23. Das Plus des Glaubens (Apg 22, 22-29)
24. Alles auf eine Karte (Apg 22, 30-23, 11)
25. Dem anderen ein Christus sein (Apg 23, 12-22)
26. Jesus rettet! (Apg 23, 23-35)
Paulus als Gefangener in Cäsarea (Kap.24-26)
27. Leben aus der Auferstehung (Apg 24, 1-21)
28. Gottes Gerechtigkeit! - Oder würfeln wir um unser Leben? (Apg 24, 22-27)
29. Sich selbst erfüllende Prophezeiung (Apg 25, 1-12)
30. König Jesus lebt (Apg 25, 13-23)
31. Aus der Erfahrung leben (Apg 26, 1-32)
Paulus auf der Reise nach Rom (Kap. 27-28)
32. Die Intuition des Glaubens (Apg 27, 1-13)
33. Gott trägt durch (Apg 27, 14-26)
34. Essen - Ein Ritual des Glaubens (Apg 27, 27-44)
35. Kein „Clash of Religions“ mit dem Evangelium (Apg 28, 1-10)
36. Gottes neue Welt (Apg 28, 11-31)
37. Literaturverzeichnis
38. Abkürzungen
Vorwort
Nun lege ich den zweiten Band meiner Predigten über die Apostelgeschichte vor (Kap. 15-28). Die meisten dieser Predigten sind in der Corona-Zeit entstanden (ab Predigt 18). Sie gehen eher selten direkt auf die Krisensituation ein und doch sind sie von den Umständen geprägt. Die Titelpredigt „Unterwegs“ (9.) hatte ich noch im Herbst 2019 in Japan in der Kyoto-Kyokai auf Japanisch gehalten. Später arbeitete ich sie ein wenig um und hielt sie auch in Zürich. Ich denke, dass man ihr aber noch anmerkt, dass sie auch auf japanische Hörer eingeht.
Die Corona-Zeit hatte mir tatsächlich etwas geholfen, an den Predigten zu arbeiten. Jetzt waren sie eines der wenigen Mittel, mit denen ich meine Gemeinde noch erreichen konnte. Ich verschickte sie per Post und E-Mail an die Haushalte, Altenheime und Kliniken. Dort wurden sie mitunter auch weitergereicht. Deshalb konzentrierte ich mich noch einmal besonders auf ihre Ausarbeitung.
Das Thema des Unterwegs-Seins ist in der Krisenzeit noch einmal ganz neu laut geworden. Viele Menschen hatten sich gefragt, wo das alles hinführt. Das Thema des Unterwegs-Seins ist aber nicht nur aktuell, sondern auch uralt. Im Alten Testament waren schon die Erzväter als Nomaden ständig auf der Reise und unterwegs und ohne eine geschichtliche Dimension ist das Erste Testament nicht zu denken. Ich greife also eine biblische Perspektive des menschlichen Lebens auf und versuche es systematisch-theologisch zu reflektieren, denn das Unterwegs-Sein gehört wesentlich zum Charakter des christlichen Glaubens.1
Die Apostelgeschichte will aber auch aufzeigen, wie das Evangelium „unterwegs“ zu den Menschen war und wie sich der Glaube in der Erfahrung des Heiligen Geistes änderte.
Hineingezogen in die Texte sind auch meine eigenen Reiseerfahrungen. 17 Mal hatte ich bisher Japan besucht, dreimal die Philippinen, einmal war ich in Hongkong und seit zehn Jahren leben ich als Berliner in der Schweiz. Mein Unterwegs-Sein begann mit einer Reise nach Ostafrika kurz nach dem Abitur, nach Tansania, und einem zweijährigen Aufenthalt in den USA (1985-87).
Die Predigten versuchen die jeweilige Hauptaussage des Textes auf unsere heutige Situation zu beziehen. Historische Informationen gibt es nicht zu allen Predigten. Wer sich hier weiter einlesen möchte, für den kann die angegebene Literatur hilfreich sein.
Die Bibelzitate in den Predigten sind der Lutherübersetzung von 2017 übernommen, falls nicht anders vermerkt.
Jetzt wünsche ich eine spannende Lektüre und eine gute Reise durch die Apostelgeschichte und das Leben.
Dr. Stephan Johanus, Zürich, Mai 2021
1 „Unterwegssein gehört wesentlich zum Christenstand.“ Walter Lüthi, Die Apostelgeschichte, Basel, 1958, 275.
(Das Apostelkonzil, Kap. 15)
1. Wenn - dann
(Apg 15, 1-21)
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
15,1 Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Dort lehrten sie: »Wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es in Moses Gesetz vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden.« 2 Paulus und Barnabas widersprachen, und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. 3 Nachdem die Gemeinde sie verabschiedet hatte, zogen sie durch Phönizien und Samarien. Überall berichteten sie, wie auch die Nichtjuden zu Gott umgekehrt waren, und alle freuten sich darüber. 4 In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich aufgenommen. Dort erzählten sie ebenfalls, was Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. 5 Aber auch hier forderten einige der Pharisäer, die gläubig geworden waren: »Man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz von Mose befolgen.«
6 Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Frage zu klären. 7 Nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte: »Liebe Brüder! Ihr wisst doch, dass Gott mir schon vor langer Zeit aufgetragen hat, die rettende Botschaft auch denen zu verkünden, die keine Juden sind, denn auch sie sollen Gott vertrauen. 8 Und Gott, der jedem Menschen ins Herz sieht, hat sich zu ihnen bekannt, als er den Nichtjuden genauso wie uns den Heiligen Geist gab. 9 Ja, Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen: Er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. 10 Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern und Schwestern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? 11 Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die Nichtjuden.« 12 Alle schwiegen und hörten Barnabas und Paulus gespannt zu, als sie berichteten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte.
13 Dann stand Jakobus auf: »Liebe Brüder, hört mir zu!«, sagte er. 14 »Simon Petrus hat eben erzählt, wie Gott selbst begonnen hat, unter den Nichtjuden ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. 15 Das stimmt mit den Aussagen der Propheten überein, denn es heißt bei ihnen: 16 ›Danach werde ich, der Herr, mich meinem Volk wieder zuwenden und das Reich von König David wieder aufbauen. Jetzt gleicht es zwar einem verfallenen Haus, doch dann richte ich die umgestürzten Wände wieder auf. 17 Dies geschieht, damit auch die übrigen Menschen mich suchen, all die Völker, die seit jeher mein Eigentum sind. Ja, ich, der Herr, sorge dafür, 18 denn so habe ich es schon lange beschlossen!‹ 19 Ich meine deshalb«, erklärte Jakobus, »wir sollten den Nichtjuden, die zu Gott umgekehrt sind, keine unnötigen Lasten aufbürden und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. 20 Wir sollten ihnen allerdings einen Brief schreiben und von ihnen verlangen, dass sie sich nicht durch die Verehrung von Götzen unrein machen, keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen, kein Fleisch von Tieren essen, die nicht völlig ausgeblutet sind, oder gar das Blut selbst verzehren. 21 Denn diese Gebote von Mose sind seit alter Zeit überall bekannt. Aus seinem Gesetz wird ja an jedem Sabbat in allen Synagogen vorgelesen.«
Liebe Gemeinde,
hatten Sie schon einmal eine theologische Diskussion in einem „Kentucky Fried“-Chicken Restaurant? Ja? Ich dachte, so etwas könnte nur mir passieren. Ich ging zu meinem Lieblings-Fastfood-Restaurant am Breitscheidt-Platz in Berlin. Der Laden war knüppeldicke voll, wie der Berliner sagt. Kaum hatte ich mein Hühnchen auf dem Tablett, schon war ganz klar zu sehen, hier gibt es keinen Platz mehr. Du mußt die Knusperhaut mit Knochen wohl im Stehen hinunterschlingen. Doch - da war doch noch ein Platz….Eine Service-Dame hatte auch schon aufgeräumt. Nichts wie hin. Und dann - war ich der Platzhirsch. Also, ich hatte hier endlich einen Tisch gefunden. Aber da kam auch schon ein Ehepaar, dem es genauso ergangen war wie mir. Mutig wagten sie sich in meinen Hohheitsbereich, ob hier noch Platz für zwei wäre? Ja, doch, bitte. Nachdem die ersten Hähnchenteile verschmaust waren, kamen wir irgendwie ins Gespräch. Die beiden waren aus Süddeutschland, also irgendwo im Norden von der Schweiz aus gesehen. Sie waren Christen. Das sagten sie so ganz frei heraus, Mitglieder einer Freikirche. Mmh, klang interessant. Ich wollte mehr wissen. Nein, einer bestimmten Kirche würden sie nicht angehören. Sie waren völlig frei. Wie denn nun? Was? Ja, mit der Institution Kirche hätten sie schlechte Erfahrungen gemacht und wären nun eine völlig freie Gemeinde. Sie würden keinem Kirchenbund angehören, sich zu keiner Dachorganisation rechnen. Interessant, dachte ich. Meine Kritik behielt ich für mich. Schließlich wollte ich noch meine restlichen Hähnchenteile in aller Ruhe genießen. Später sann ich darüber nach. Für mich war es eine etwas fremde Vorstellung: völlig unabhängig? Geht das überhaupt?
In der Apostelgeschichte jedenfalls gibt es diese Unabhängigkeit nicht. Auch die Gemeinden, die im Mittelmeer durch die Mission von Petrus und Paulus entstanden waren, hatten alle eine Verbindung zu einer anderen Gemeinde, und durch die Apostel eigentlich auch nach Jerusalem, zur Urgemeinde. Diese Verbindungen entstanden durch die Mission und lassen sich historisch erklären. Die eine entstand unter Mitwirkung einer anderen. Es gab zwar zu jener Zeit noch kein Konsistorium, keinen Bischofsrat und kein Kabinett, aber als es zum Streit kommt, erkennen alle die Autorität der Apostel und die Gemeinde in Jerusalem als verbindlich an und hören auf ihren Rat. Ihr Beschluss wird nicht infrage gestellt. Eine Kirche ohne eine Organisationsstruktur ist also eigentlich… unbiblisch!
Im Nachhinein wäre ich gerne noch einmal mit meinen Tischnachbarn im Hähnchenrestaurant ins Gespräch gekommen, aber es war einfach zu spät.
Aber worum geht es eigentlich in dem heutigen Text? Ich glaube, es geht um die Freiheit des Evangeliums. Die scheint hier schon in den ersten Jahren der Entstehung der Kirche auf dem Spiel zu stehen. Zum einen ist die Freiheit in Gefahr, wenn das Christentum ohne Bindung und verlässliche Struktur funktionieren soll. Gerade das Verankert-Sein in der Tradition, in der ursprünglichen Lehre, gerade darin, glaube ich, besteht die Freiheit. Freiheit entfaltet sich nicht aufgrund von Beliebigkeit, von Gesetzlosigkeit oder der Diktatur des Einzelnen oder einer Gruppe. Die Freiheit des Glaubens steht auch auf dem Spiel, wenn der Glaube erzwungen werden soll durch ein „wenn-dann“-Prinzip, sei es das Prinzip eines Einzelnen oder einer Gruppe. Dann entstehen meist alle möglichen oder unmöglichen Regeln.
Wenn du nicht das tust, oder jenes, bist du kein Christ…jedenfalls kein richtiger? Ein solches „wenndann“-Prinzip muss für die Freiheit, geopfert werden. Die Botschaft des Evangeliums heißt vielmehr „Gottes Wort schafft der Liebe Raum.“ Die Liebe aber schafft Freiheit nach dem Besten für alle zu suchen. Aber was das ist und sein kann, das müssen wir verantwortlich selbst entscheiden. Dazu kann es zu ganz unterschiedlichen Zeiten ganz verschiedene Antworten geben. Ein Wenn-Dann-Prinzip würde hier auf den Glauben nicht passen. Manchmal erlebe ich in Gemeinden, dass die Frage aufgeworfen wird: Was ist eigentlich ein Christ? Wann ist man Christ? Ich habe dann jedesmal das Gefühl, dass hier ein Kriterien- und Leistungskatalog aufgeschlagen werden soll. Das liegt aber dem Christentum gegenüber ganz fern. Brauchen wir das wirklich? Meiner Ansicht nach entsteht diese Frage oder dieses Bedürfnis nach Versicherung, wenn man sich mit seiner eigenen Spiritualität nicht in einer Tradition und in der Geschichte verwurzelt sieht.
Durch diese Verwurzelung gewinnen wir an Freiheit, eine Freiheit, die wir uns nicht selber geben können, sondern die uns vom Geist Gottes geschenkt wird. Der Geist Gottes aber ist ein uns übersteigendes Prinzip. Er gehorcht uns nicht. Die Jünger sind wieder einmal enttäuscht. Sie brauchen eine Zeit der Reflexion und Stille, um zu verstehen, dass hinter dieser Enttäuschung eigentlich ein wunderbarer Plan Gottes steht. Was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Aber der Geist Gottes nimmt keine Rücksicht darauf, was wir Menschen für möglich halten oder nicht. Er handelt oftmals ganz anders, als wir es uns denken. In der Apostelgeschichte kehrt er sich denen zu, die zu den „Heiden“, zu den Völkern gehören. Aber damit hatten die Apostel eigentlich nicht gerechnet. Es war nicht ihr Plan, sondern es lag in Gottes Vorsehung begründet. Schon wieder wurde eine ihrer Erwartungen enttäuscht. Aber diese Enttäuschung brauchte es, damit sie verstehen würden, wie Gott handelt. Können wir das Unvorhergesehene, das nicht Erwartete als eine durch den Geist gewirkte Gnade verstehen? Hinter so mancher Enttäuschung steckt der Reichtum der Freiheit Gottes, die sich den Weg zu den Menschen bahnt - auch manchmal ganz gegen ihren Willen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2. Gemeinsam mit dem Übernatürlichen entscheiden
(Apg 15, 22-29)
Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da war, der da ist, und der da kommt! Amen.
15, 22 Am Ende der Beratungen beschlossen die Apostel und die Leiter zusammen mit der ganzen Gemeinde, einige Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Man wählte Judas, der auch Barsabbas genannt wurde, und Silas. Beide waren führende Männer in der Gemeinde. 23 Man gab ihnen folgenden Brief mit: »Wir, die Apostel und Gemeindeleiter in Jerusalem, senden brüderliche Grüße an alle Christen in Antiochia, Syrien und Zilizien, die nicht aus dem Judentum stammen. 24 Wir haben gehört, dass euch einige Leute aus unserer Gemeinde – ohne von uns beauftragt zu sein – durch ihre Lehren beunruhigt und verunsichert haben. 25 Deshalb haben wir einstimmig beschlossen, zwei Männer aus unserer Gemeinde auszuwählen und sie zu euch zu senden, zusammen mit unseren lieben Brüdern Barnabas und Paulus, 26 die ihr Leben für unseren Herrn Jesus Christus eingesetzt haben. 27 Unsere Abgesandten Judas und Silas werden euch noch persönlich berichten, was wir in der strittigen Frage entschieden haben. 28 Geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir nämlich zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weitere Last aufzuerlegen: 29 Ihr sollt euch nicht durch die Verehrung von Götzen unrein machen, außerdem kein Fleisch von Tieren essen, die nicht völlig ausgeblutet sind, und ihr sollt auch kein Blut verzehren. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen! Wenn ihr danach handelt, verhaltet ihr euch richtig. Herzliche Grüße an euch alle.«
Liebe Gemeinde,
ich musste etwas stutzen: „Es gefiel dem heiligen Geist und uns“ - eine steile Formulierung und Behauptung. Aber wie sollte man sonst gute Entscheidungen fällen, wenn nicht in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Der Geist Gottes ist die große Entdeckung der Christen in der Apostelgeschichte. Dass Christus lebendig ist im Geist, dass sie nicht allein zurückgelassen worden sind als Witwen und Waisen, wie Christus es vorausgesagt hatte, sondern dass sie einen Fürsprecher an ihrer Seite hatten, einen Anwalt, das erlebten sie jetzt. Paulus nennt den Heiligen Geist auch eine Anzahlung, Angeld (griech. „arrabon“; 2. Kor 1, 22) oder ein Unterpfand, quasi eine Vorauszahlung für die himmlische Herrlichkeit, die sie noch erfahren sollten.
„Es gefiel dem heiligen Geist und uns…,“ das heißt doch, dass dem Heiligen Geist ein ganzer Mensch gegenübersteht. Nicht einer, bei dem alles geregelt wird vom Geist Gottes, oder der nur gehorchen muss oder auch wie eine Marionette an den Fäden Gottes herumgezogen wird, bis es endlich stimmt. Nein, ein freier Mensch steht dort Gott gegenüber, der selbst verantwortlich entscheiden kann und soll.
Doch heißt das nicht, dass es nicht wichtig wäre, auf den Geist zu hören. Von Anbeginn der biblischen Erzählungen gehört das Hören auf Gottes Stimme zu den Chancen des christlichen Lebens, das es mit Gott ernst meint. Darin liegt eine große Chance, sich mit dem Geist Gottes zu beraten, ihn mit hinzuzuziehen, ihm eine Stimme zu geben.
John Wesley hatte eine Vielzahl seiner Predigten über den Geist Gottes gehalten. Es gibt immer noch eine gewisse Reserviertheit unter Christen, auch unter den Theologen, überhaupt etwas über den Geist Gottes zu sagen. Auch gibt es manchmal die Meinung, man könne zwar durch ihn reden, aber nicht über ihn. Die Rede vom Geist Gottes ist die Rede von der persönlichen Erfahrbarkeit des Glaubens. Manchmal ist es nicht einfach zu erkennen, was der Geist sagt. In einem anderen Fall ist es klar und eindeutig. Es braucht Erfahrung und auch Wissen, um zu verstehen, was Gottes Geist in einer bestimmten Situation sagt.
Oftmals spricht er zu uns auch, wenn wir es gar nicht wollen, sozusagen ungefragt, weil er Menschen warnen will, einen guten Gedanken gibt. Manchmal ist die Wahrnehmung des Geistes Gottes gar nicht angenehm, weil er auch ein Geist ist und sein kann, der in Unruhe versetzt, der wach hält, Warnungen ausspricht, Aufmerksamkeit verlangt, auch wenn wir es gar nicht wollen.
Die Geschichte vom jungen Samuel, der, als er noch ein Kind war, im Tempel zu Jerusalem schläft und bei seinem Namen gerufen wird, ist so eine Geschichte der persönlichen Erfahrung, die ungewollt gemacht wird (1. Sam 3).
Der Geist ist der eigentliche Urheber des Glaubens. Martin Luther konnte sagen:
„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glaube oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten; …“2
John Wesleys besonderes Interesse an der Theologie und am christlichen Glauben lag besonders in jenen Erfahrungen, die Menschen durch den Heiligen Geist machen konnten. Er war weniger an Dogmen und Liturgie, sondern vielmehr an der Wirkung des Glaubens interessiert. Seine Konzentration auf die Wirkungsweise des Geistes Gottes begründete seine Toleranz gegenüber verschiedenen Glaubensrichtungen. Er fand in den verschiedenen Kirchen, Traditionen, Gruppen und Glaubensrichtungen den Geist lebendig am Werk. Er war entschlossen, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Erfahrung des Geistes gemacht hatten.
Die frühe Polemik der Methodisten gegen die Anglikanische Staatskirche, dass sie am Geist Gottes vorbei manövrieren würde, begründete sich in verschiedenen sozialen und politischen Konflikten, wie z. B. der Sklaverei, und in der Tatsache, dass Wesley selbst anglikanischer Priester war, aber zu seinen frühen Amtszeiten vom Geist Gottes nichts wusste und erfahren hatte. Entscheidend blieb für Wesley immer, dass der Geist keine Rücksicht nimmt auf die Konfession und er hier und dort weht, wo er gerade will. Er kann in einer Pfingstgemeinde genauso erfahren werden, wie in einer hochliturgischen katholischen Gemeinde. Natürlich kann er auch womöglich in einer Freikirche fehlen. Eines meiner schockierendsten Erlebnisse war einmal der Besuch einer ziemlich leeren Pfingstkirche. Trotzdem ist auch die Zahl der Mitglieder kein Kriterium. Doch dass der eine in einer Gemeinde eine Geisterfahrung macht, muss nicht heißen, dass es anderen Menschen auch so gehen würde.
Der Grund, warum man sich einer Gemeinde und Kirche anschließt, sollte darin liegen, dass Gottes Geist einen zum Glied an diesem Leib, an diesem Ort werden lassen möchte, dass es sein Wille ist. Dann ist es der beste Ort, den man sich denken kann, mag er auch objektiv noch so schrecklich und die Kirche noch so fehlbar sein. Ganz objektiv gesprochen ist keine Kirche besser oder schlechter als jede andere. In allen christlichen Gemeinschaften und Kirchen gibt es menschliche Anteile, die eine Kirche zu einem Mischgewebe aus Menschlichem und Göttlichem werden lassen: Sie sind nicht mehr als eine Gruppe von fehlerhaften und sündigen Menschen, die aber von der Gnade Gottes wissen, gerecht gesprochen wurden und von der Kraft des Heiligen Geistes und seiner Weisung wissen, obwohl sie selbst unvollkommen und auf Vergebung angewiesen sind.
Der Geist Gottes scheut sich vor keinem fehlbaren Menschen. Er dürfte sich sonst nirgendwo zu erkennen geben. Er kommt auch nicht nur zu den Heiligen oder den besonders Guten, sondern er kommt zu denen, die zerbrochenen Herzens sind, die Trost brauchen, nicht mehr ein noch aus wissen und sich selbst nicht helfen können. Es heißt ja: „Wir haben einen Gott, der da hilft, und den HERR, der vom Tode errettet.“ (Psalm 68, 21, Luther 2017) Niemand soll denken, er hätte diesen Geist nicht, wenn er doch glaubt und von Gott Hilfe erwartet. Ihm nachzuspüren aber ist unsere große Chance und Aufgabe. Deshalb braucht es auch heute eine Reflexion, eine Theologie des Heiligen Geistes.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
2 Martin Luther, Kleiner Katechismus, Hamburg, 16. Auflage, 1982, 16.
3. Auf-gerichtet
(Apg 15, 30-35)
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
15, 30 Judas und Silas wurden zusammen mit Paulus und Barnabas von der Gemeinde verabschiedet und gingen nach Antiochia. Dort beriefen sie eine Gemeindeversammlung ein und übergaben das Schreiben. 31 Als man es vorgelesen hatte, freute sich die ganze Gemeinde über diese Ermutigung. 32 Judas und Silas – beide waren Propheten – sprachen lange mit den Christen, ermutigten und stärkten sie im Glauben. 33 Begleitet von den besten Wünschen der Gemeinde kehrten sie erst einige Zeit später zur Gemeinde in Jerusalem zurück, die sie abgesandt hatte. 35 Paulus und Barnabas blieben noch länger in Antiochia. Sie verkündeten die Botschaft des Herrn und lehrten zusammen mit vielen anderen die Gemeinde.
Liebe Gemeinde,
der hier folgende Textabschnitt in der Apostelgeschichte kommt ganz unscheinbar daher. Zuerst dachte ich, dass es sich eigentlich nicht lohnen würde, über diesen Abschnitt zu predigen. Hier geschieht nichts Atemberaubendes, keine Heilung, kein Wunder, nichts Anstößiges, weder im positiven noch im negativen Sinne. Doch als ich mich etwas genauer mit dem Text beschäftigte, wurde er immer spannender.
Lassen sie uns erst einmal die Situation anschauen. Die Apostel und Ältesten hatten sich in Jerusalem der Streitfrage angenommen, die in Antiochien aufgekommen war: Müssen sich die Menschen aus den Völkern, also alle Nicht-Juden, die zum Glauben an Christus kamen, nicht auch noch beschneiden lassen und das Gesetz halten?
Paulus und Barnabas waren nach Jerusalem gezogen, um von den Ältesten dort die Frage klären zu lassen. Schließlich ging es um nichts Geringeres, als um den Inhalt der Verkündigung des Evangeliums und um die Gültigkeit des Gesetzes, des Alten Testaments, auch für die Christen. (Es ist teilweise auch heute noch eine Streitfrage.) Die Praxis des Paulus stand auf dem Spiel. In dem Urteil der Jerusalemer wurde die Ansicht des Paulus aber bestätigt. Die Ältesten in der Gemeinde schickten Paulus und Barnabas nach dem Urteil zurück nach Antiochien, zusammen mit zwei Männern aus Jerusalem, Silas und Judas. Es kam also eine kleine Delegation aus Jerusalem nach Antiochien, was die Christen dort sicherlich ehrte.
Der Brief aus Jerusalem wurde vorgelesen. Die Gemeinde in Antiochien war erleichtert, einige Gemeindemitglieder waren vielleicht auch enttäuscht, weil sie eine andere Lösung erwartet hatten. Davon wird aber nichts mehr berichtet. Die Stimme der sogenannten Judaisten, die die Gültigkeit des Gesetzes auch für Nicht-Juden vertraten, verstummte. Sie scheinen wie verschwunden.
Nun berichtet der Text, dass Silas und Judas die Christen in Antiochien ermahnten und stärkten. Ich frage mich, wie das wohl ausgesehen haben mag. Was war wohl der Inhalt dieser Seelsorge, die dort geübt worden war? Was können wir annehmen? Erst einmal muss man sagen, dass die Christen dort in Antiochien verunsichert waren, wenn man sich den Verlauf der Verkündigung in der Apostelgeschichte anschaut. Man kann nur sagen, dass sich der Glaube der ersten Christen durch das Dekret, durch den Brief aus Jerusalem verändert hatte. Alle, die am alten Glauben noch festhalten wollten, wurden sicherlich enttäuscht. Gestärkt zu werden ist eine Sache, aber seinen Glauben zu verändern? Wer fühlt sich dabei schon wohl? Wer wird dadurch gestärkt?
Silas und Judas ermahnten und stärkten die Gemeinde. Ich denke, dass sie diese Verunsicherung ernst nahmen, die ja durch die Botschaft des Paulus und den Streit mit den Judaisten aufgekommen war. Aber gerade mit dieser Verunsicherung waren sie dem Geheimnis der Erlösung durch Christus ein Stück näher gekommen. Das Heil in Christus beschränkte sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern Gottes Liebe war größer und reichte weiter, als sie ursprünglich dachten. Ihre Verunsicherung war also ein Gewinn, eine neue Erkenntnis, die sie ins Weite führte. Fragen sie sich doch einmal in der Begegnung mit anderen, welche Worte, welche Inhalte in einem Gespräch dem anderen gut tun würden. Was sie ihm oder ihr sagen könnten, um dem Leben eine neue Weite zu geben. Nicht als Belehrung, sondern als Anteilnahme und als Mitteilung einer großen Freude über die Erkenntnis, auch ihr Gesprächspartner, Nachbar, Bekannter oder Freund ist ein Geschöpf Gottes, von ihm geliebt und geachtet.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
4. Konflikte aus der Transzendenz
(Apg 15, 36-41)
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
15, 36 Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf: »Lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht.« 37 Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. 38 Doch Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. 39 Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, 40 wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an, und so begann er seine Reise. 41 Zunächst zog er durch Syrien sowie durch Zilizien und stärkte die Gemeinden dort im Glauben.
Liebe Gemeinde,
es geht wohl nicht ohne Streit, selbst in der Kirche, oder gerade in der Kirche. Über die Hintergründe des Streits zwischen Paulus und Barnabas lässt uns die Bibel im Ungewissen. Wir wissen nur: Sie sind aneinandergeraten und haben sich getrennt. Dass der eine den Johannes Markus auf die nächste Missionsreise mitnehmen wollte und der andere nicht, scheint nur der Auslöser gewesen zu sein. Den eigentlichen Konflikt stellt diese Meinungsverschiedenheit nicht ausreichend dar. Auch dass dieser sie auf der ersten Missionsreise im Stich gelassen haben soll, mag zwar richtig sein, wird aber den heftigen, hier zum Ausbruch kommenden Affekt auch nicht in der Tiefe begründen können.
Man kann einfach nur feststellen, dass es hier einen tiefen Graben an Meinungsverschiedenheiten zwischen Paulus und Barnabas gibt, und das im Umfeld des sogenannten antiochenischen Zwischenfalls und des Apostelkonzils. Paulus wird misstrauisch gewesen sein, ob Barnabas die Beschlüsse des Konzils auch wirklich auf der zukünftigen Reise weiter vertreten wird. In der weiteren Erzählung wird Barnabas schließlich nicht mehr genannt. Hingegen wird Paulus als Hauptfigur in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte dargestellt. Aber er geht aus diesem Streit ohne Rückendeckung der Gemeinde hervor und seinen bisherigen Mitarbeiter musste oder wollte er auch ziehen lassen.
Barnabas segelt also mit Markus nach Zypern, während Paulus mit Silas durch Syrien und Zilizien zieht.
Was fangen wir damit an? Es scheint so, als ob es ohne Streit einfach nicht geht. Der eine will und kann nicht länger aushalten, eine unhaltbare und unerträgliche Situation nicht weiter mittragen. Es geht über seine Kräfte. Der andere will sich dem Diktat nicht beugen und nicht nachgeben. Es scheint eigentlich der Regelfall. Dort, wo es Harmonie und Eintracht geben sollte, jedenfalls in kirchlichen Angelegenheiten, gibt es oftmals eine durch Autorität erzwungene Einträchtigkeit, unter deren Oberfläche eine gelittene Opposition und Meinungsverschiedenheit vor sich hin brodelt und nur nicht die Stärke zum Widerspruch besitzt. Also realistisch gesehen ist das auch ein Streit.
Die Kirchengeschichte ist voll von Streitsituationen, Spaltungen und Trennungen, und konfessionell gesehen ist die Geschichte der Kirchen eine Geschichte des Streits. Aus dem Konflikt um 1054 hat sich die Kirche gespalten in die Römisch-Katholische, also die westliche Papstkirche, und die orthodoxe Kirche im Osten. Aus dem Streit der Reformation gingen die Evangelischen Kirchen hervor. Auch die Evangelischmethodistische Kirche verdankt ihre Existenz einem Streit und einer Unversöhnlichkeit mit der Anglikanischen Staatskirche. Man kann nicht unbedingt sagen, dass all dies ohne Gottes Willen geschah, aber auch nicht behaupten, es sei sein Wille gewesen. Gottes Idee ist sicherlich die Einheit der Kirchen. Doch hat er die Zertrennung der Christenheit zugelassen.
Auf dem Missionsfeld erregen die verschiedenen Konfessionen oft Kopfschütteln, Fragezeichen und Ärger in der nicht-christlichen Bevölkerung. Wer sich in einem Land mit vielen verschiedenen Konfessionen zu Christus bekennen möchte, fragt sich manchmal, welcher Kirche er sich denn nun anschließen soll und welche „richtig“ ist.
Mir scheint, dass Gott Streit in den Kirchen immer wieder zulässt, weil der Konflikt häufig berechtigt ist und Missstände in den Gemeinden dadurch an die Oberfläche geraten. Auch wenn die Spaltungen der Christenheit gegen Gottes Willen sind, so bewahren sie die Kirche davor, eine große machtvolle Institution zu sein oder zu werden. Dies kann man, glaube ich, wiederum vielleicht als gottgewollt annehmen. Von den methodistischen Gemeinden in der Schweiz kenne ich kaum eine, die nicht schon durch einen Streit oder eine Spaltung gegangen ist. Natürlich gibt es auch hier Kirchen, die sich ab und an im Streit befinden und andere, die ständig in der Fehde liegen. Mir fallen nur zwei Kirchen ein, in deren Geschichte ich bisher von keinem Streit etwas gehört habe. Aber worin ihr Geheimnis liegt, vermag ich nicht zu sagen. Was soll man also tun angesichts einer solchen Zerstrittenheit? Wie soll man sich verhalten oder denken?
Es gilt ja nicht nur für die Kirchen, sondern auch für die Familien, für Ehen, für Freundschaften. Eine Trennung hat oft einen Todesgeruch an sich, etwas Endgültiges. Eine Zukunftshoffnung ist für immer verbaut. Auch die Vergangenheit wird zum Teil ausgelöscht oder doch uminterpretiert. Kann man sich dann noch an die „schönen alten Tage“ erinnern? Wenn ja, dann aber nur noch allein. Wie soll es dann weitergehen? Oftmals ist die Zukunft genauso problematisch wie die Vergangenheit, weil eine Trennung auch nicht die Lösung bringt, genauso wie eine Beziehung, die eingegangen worden ist, um ein anderes Problem zu übertünchen oder an dessen Verarbeitung vorbeizulaufen. Schließlich holt das Vergangene das Gegenwärtige wieder ein und der neue Anlauf bleibt im Antritt schon stecken.
Worin liegt nun die Lösung? Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. Unser Text enthält auch keinen Lösungsvorschlag, noch nicht einmal eine Ahnung davon. Vielleicht lernt der engstirnige Paulus ja mal etwas Schweizer Diplomatie, oder ein Typ des Barnabas gibt auch einmal klein bei?
Für realistisch halte ich das allerdings nicht. Es wird wohl weitergehen, und die Geschichte der Kirchen wird wohl eine Geschichte des Streits und der Auseinandersetzungen bleiben. Allein, dass Gott ihnen trotz der Zerstrittenheit die Treue hält, bleibt für mich ein Hoffnungsanker. Bei aller Unlösbarkeit des Problems sollte man bedenken, dass dieser Streit, wie so viele, ihren Platz in der Heiligen Schrift gefunden hat. Er ist also ein Streit aufgrund der Transzendenz. Beide Parteien stehen weiter unter Gottes Verheißungen. Es ist nicht einfach nur ein gruppendynamisches Spiel. Dieser Streit gehört mit zur Geschichte Gottes mit den Menschen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Die zweite Reise des Paulus (Kap. 16-18)
5. Multi culti – multi religio
(Apg 16, 11-15)
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
16, 11 Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake, am nächsten Tag weiter nach Neapolis, 12 und von dort begaben wir uns landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. 13 Am Sabbat gingen wir hinaus aus der Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich – wie wir annahmen – eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. 14 Zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. 15 Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf: »Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt als meine Gäste.« Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten.
Liebe Gemeinde,
Gott öffnete einer Frau, einer reichen Frau, Purpurhändlerin aus Thyatira, das Herz. Ich würde gerne ein wenig mehr darüber wissen, was da wirklich geschehen war. Wir hören nur selten davon, dass sich ein Mensch bekehrt. Wir lesen es zwar in Büchern und wir wissen es auch von den großen Theologen, von Martin Luther, von seiner blitzartigen Erkenntnis der Gnade Gottes als „Turmerlebnis“, von Augustinus, wie ihn eine Stimme im Garten von Mailand einlud „nimm und lies“, von Paulus, wie er auf dem Weg von Damaskus zu Boden geworfen wurde und eine Stimme ihn fragte „Was verfolgst Du mich?“. Bei allen hatte sich in ihrem Denken und Fühlen ein radikaler Wandel vollzogen. Aber sonst hören wir relativ selten etwas von dramatischen Bekehrungen. Auch wir selbst sind, und da unterscheiden wir uns von anderen Generationen, nicht mehr so auskunftswillig zu erzählen, wie das eigentlich bei uns gewesen ist, als wir zum Glauben kamen.
Wie unterschiedlich hier auch die Wege gewesen sein mögen, aus reiner Vernunft, nur dass man eins und eins einmal zusammenzählt, wird niemand ein Christ.
Aber die Wege zum Glauben sind so unterschiedlich, wie die Lebensgeschichten und Charaktere der Menschen. Es wäre interessant zu hören, wie der Glaube bei den verschiedenen Persönlichkeiten seinen Weg gefunden hatte. Schon in der Bibel gibt es aber kein einheitliches Schema. Von der Lydia heißt es, dass Gott ihr das Herz aufgetan hat. Paulus wird auf der Straße von Damaskus hart zu Boden geworfen und ist eine zeitlang blind. Andere bekehren sich, weil sie Wunder erlebt haben, weil ihnen Heilung widerfahren ist. Manchmal hören wir auch, wie ausdrücklich vom Heiligen Geist gesprochen wird, auch eine Predigt kann in einem Menschen eine Wandlung hervorrufen.
Die Bekehrung des Kirchenvaters Augustinus hat sich in mehreren Schritten vollzogen und war wohl nicht nur eine Bekehrung zu Christus, sondern auch eine Hinwendung zum Platonismus, zur Philosophie. Fast jede Bekehrung hat diesen Aspekt, dass mit der neuen Einsicht auch eine andere Ebene des Lebens berührt wird. Menschen werden heil, oder sie lassen von den Ungerechtigkeiten ab, die sie begangen haben, wie es bei Zachäus, dem Zöllner (Lk 19, 1-10), berichtet wird. Andere beginnen einen völlig neuen Lebensstil und verlassen ihre angestammte Heimat, suchen ein neues Leben. Doch oftmals bleiben Menschen auch an ihrem bisherigen Ort nach einer inneren Wandlung.
Es scheint hier keine Gesetzmäßigkeit zu geben. Wir können auch nicht die Bedingungen aufrechnen, unter denen eine Bekehrung stattfindet. Bei dem einen war es eine Predigt, beim anderen ein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten. Bei einem war es das Suchen in der Heiligen Schrift, beim anderen ein theologischer Vortrag. Der klassische Ort ist vielleicht die Bibelstunde oder die Sonntagsschule, aber auch dafür gibt es keine Regel. Ein Pfarrer berichtete einmal, dass er beim Studium eines apokryphen Textes zum Glauben gekommen sei.
Weil wir über eine Gesetzmäßigkeit der Wirkung des Heiligen nicht verfügen, können wir nicht sagen, was zu ihm führt. Wir wissen nur, dass es geschieht, immer wieder neu, immer wieder anders, immer wieder überraschend, was die Umstände und Begleitfaktoren auch gewesen seien mögen.
Wir können auch nicht sagen, dass das Erzählen der eigenen Bekehrung beim Zuhörer notwendig zu einer solchen Wandlung führen muss.