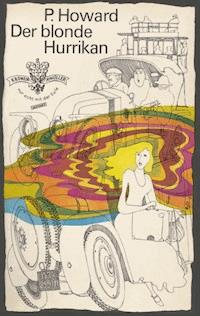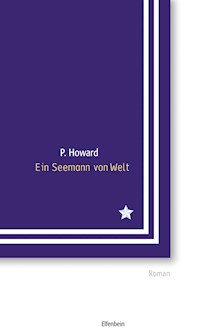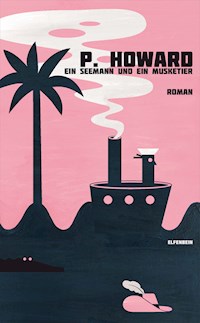Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Rule, Britannia! Britannia, rule the waves!", so schmetterte das Triumphlied der stolzen britischen Weltmacht auf allen Meeren, um die Hegemonie jenes Empires zu verkünden, das der Welt den Five o'Clock Tea brachte. Aber für den aufmerksamen Beobachter waren bereits bedeutungsvolle Risse in diesem Bild zu erkennen: Der junge König dankt wegen einer geschiedenen Frau ab, Mahatma Gandhi mobilisiert barfuß die Massen Indiens, und England verliert zum x-ten Mal die Fußballweltmeisterschaft … Vor allem aber erschütterte ein bisher nie gehörter Skandal das Selbstbewusstsein der englischen Elite, die es verstand, die Geschichte bis heute geheimzuhalten. P. Howard aber erzählt sie: Eine kleine Truppe verwegener Hafendesperados unter der fachmännischen Leitung von "Fred Unrat, dem Kapitän", den die Leser bereits aus dem Roman "Ein Seemann von Welt" kennen, stiehlt den Panzerkreuzer "Radzeer", um in Burma einen englischen Offizier und Erfinder aus den Klauen der Fremdenlegion zu befreien. Zu diesem Zweck eine "Aktiengesellschaft" zu gründen ist die Idee des jungen rothaarigen Schmugglers "Rostig", der sich in einer Seemannspinte von Piräus in "Bubi", die Schwester des Erfinders, verliebt … "Ein Seemann und ein Gentleman" (Originaltitel: "Az elveszett cirkáló", 1938), dieser genial verwickelte, ironische Abenteuerroman, ist der erste in jener legendären Kette weltumspannender Gaunergeschichten P. Howards, die noch nach sechzig Jahren Furore machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
P. Howard
Ein Seemann und ein Gentleman
Roman
Aus dem Ungarischen von
Vilmos Csernohorszky jr.
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1938
unter dem Titel »Az elveszett cirkáló«
bei Nova, Budapest.
»P. Howard« ist ein Pseudonym von Jenő Rejtő.
© 2008 Elfenbein Verlag, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-941184-90-9 (E-Book)
ISBN 978-3-932245-93-0 (Druckausgabe)
Erstes Kapitel
Es findet eine Auseinandersetzung statt. Tatort: eine Schenke im Hafen von Piräus. Der Wirt rettet den Whisky, lässt aber das Fenster nicht richten.
1.
Es war der seltsamste junge Mann, den sie je gesehen hatten. Und wenn man bedenkt, dass sein Hals gerade in den Pranken des Krokodils steckte, verhielt er sich sogar ziemlich ruhig. Es kann aber auch sein, dass er schon erstickt war und deshalb so unbewegt und mit geschlossenen Augen, den Hals zwischen den riesigen Händen des Krokodils eingekeilt, seinen für den Augenblick unbequemen Zustand erduldete. Gegenüber der »Tischgesellschaft der Scharfrichter«, deren Kassenwart das Krokodil war, standen scheinbar gleichgültig, aber trotzdem in einer gewissen Erwartungshaltung, die drei Psychotherapeuten. Ihren Namen verdankten sie dem Verschwinden zweier Matrosen der französischen Kriegsmarine. Die beiden Seeleute hatten früher die Angewohnheit, seitens obiger dreiköpfiger Gesellschaft erbeutetes Diebesgut regelmäßig auf dem Kreuzer »Maréchal Joffre« weiterzubefördern, und zwar ohne Wissen der Vorgesetzten, versteht sich. Eines Tages aber waren sie einfach abgesegelt, ohne den Gegenwert der Ware auszuhändigen. Ihr Schiff befand sich nämlich für längere Zeit in den indischen Ge-wässern. Nach einem Jahr waren sie bar jeglichen Argwohns zurückgekehrt, vertrauten sie doch auf die menschliche Vergesslichkeit. Die drei Schmuggler hatten sich jedoch nicht als zerstreut erwiesen, so dass sich die Spur dieser leichtsinnigen Matrosen verlor. Es heißt, vorher hätten die Geschädigten die Matrosen überredet, sich über das Versteck der mitgebrachten Schmuggelware zu äußern. Die beiden Matrosen pflegten nämlich Schmuggelware nicht nur zu exportieren, sondern auch zu importieren. Es heißt auch, einer von ihnen sei im Laufe der von den Psychotherapeuten zwecks besserer Erinnerung verabreichten Entspannungsübung gestorben. Der andere jedoch habe seinen Assoziationen so weit freien Lauf gelassen, dass der Schaden der drei Schmuggler mittels einer größeren Menge Rauschgift, das in einem Boot versteckt war, ersetzt werden konnte. Seit dieser Zeit heißen die drei Herren die »Psychotherapeuten«.
Die Tischgesellschaft der Scharfrichter entfaltete ihre gemeinnützige Tätigkeit zugunsten stellungsloser Matrosen, was insofern nicht ganz selbstlos war, als die Masse der hilfsbedürftigen Matrosen von den Mitgliedern ebendieser Tischgesellschaft gestellt wurde. Die Tischgesellschaft war im Grunde ein Selbsthilfeverein, und dieses im engeren Sinne des Wortes, insofern man sich selbst half, und zwar ungeachtet der diesem Zwecke dienlichen Mittel, seien es Stemmeisen oder Messer.
Die Lage sah demnach so aus: Die Tischgesellschaft der Scharfrichter stand im Eingangsbereich der Kneipe, in ihrer Mitte ihr Kassenwart namens Krokodil, der den Hals eines Mannes in der Absicht in Händen hielt, den Besitzer des erwähnten Halses mittels angestrengten und längerfristigen Pressens den Erstickungstod sterben zu lassen. Ihnen gegenüber verharrten in scheinbarer Gleichgültigkeit, aber bis zu einem gewissen Grade in Erwartungshaltung die Psychotherapeuten, an ihrer Spitze »Rostig«, mit einem Glimmstengel zwischen den Zähnen. Der andere Psychotherapeut hieß »Herr Chefarzt«, da er einen seiner Freunde, der sich während des Beuteverteilens blöd stellte, stundenlang mit einer solchen Geduld vermöbelte, dass der Betreffende nach einem dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt dennoch bei vollem Verstand in die Gesellschaft der Vorstadt zurückkehrte und – um einer Wiederholung der Heilbehandlung vorzubeugen – den berechtigten Ansprüchen des Chefarztes Genüge leistete. Der dritte der Psychotherapeuten hieß mit anständigem Namen »Keule« und stand ein wenig rechts vom Chefarzt. Er kratzte sich die Achsel, aber nur um unter seinem Mantel nach dem vierfach gedrehten Drahtseil mit dem großen Eisenstück zu tasten. Nach diesem besonderen Schlaginstrument hatte man ihn Keule genannt.
»He, Krokodil! Was wollt ihr von diesem Bengel? Soviel ich sah, hatte er die Absicht, sich an unseren Tisch zu setzen«, sagte Rostig mit schläfriger Stimme.
Das Krokodil ließ den Hals des jungen Mannes ein wenig los, da es ihm nicht behagte, während eines Gesprächs tätlich gegen eine andere Person vorzugehen.
»Wir suchen schon lange nach einem Spitzel, der alles weitermeldet. Und ich glaube, es ist der da, den ich gerade erwürge.«
»Sieh mal, Krokodil, ich gebe zu, es ist jedermanns ernstzunehmende Privatangelegenheit, wen er erwürgt und wen nicht. Aber dieser Junge wollte sich eigentlich an unseren Tisch setzen, als du ihn am Kragen packtest. Zuerst soll er mal sagen, was er uns vielleicht ausrichten sollte, und dann kannst du ihn, wenn du ihn wirklich für einen Polizeispion hältst, in Frieden umbringen.«
»Weißt du was? Zuerst bring ich ihn um, und nachher kannst du mit ihm reden.«
»Ein unrichtiger Standpunkt«, sagte Keule. »Ich glaube nicht, dass wir ihn uns zu Eigen machen.
»Ich auch nicht«, sagte der Chefarzt, und zog ein ungefähr vierzig Zentimeter langes Messer hervor.
»Wollt ihr euch zanken?«, fragte einer der Scharfrichter gekränkt.
»Lasst den Bengel los«, antwortete Rostig etwas entschlossener, aber friedlich, und kam einen Schritt näher. Der junge Mann, seinen Hals zwischen den gewaltigen Händen, blinzelte erschrocken nach rechts und links, wagte aber nicht zu sprechen. Vielleicht konnte er auch nicht. Sein Gesicht war grün vor Entsetzen. Das Krokodil wollte dem Ganzen ein Ende machen und begann sein Opfer zu schütteln. Dabei entfernte er sich von seinen Kumpanen und gelangte in die Mitte der Kaschemme. In Rostigs Hand erschien, wer weiß woher, ein Totschläger, um im nächsten Augenblick auf den Nacken des Krokodils niederzusausen. Der Getroffene stürzte wie ein geschlachteter Ochse gegen die Theke, wahrscheinlich mit gebrochenem Halswirbel. Zwei Flaschen echten schottischen Whiskys klemmte sich der Wirt unverzüglich unter die Achselhöhlen und verzog sich ins hintere Zimmer. Dieses Getränk war sehr teuer. Der Herr Chefarzt beförderte den freigekommenen Jungen mit einem Ruck nach hinten.
Es folgte eine gewichtige Pause von einigen Sekunden. Bei der Affäre waren lauter ruhige Leute zugegen.
Den Psychotherapeuten wurde der Weg abgeschnitten. Im Eingangsbereich standen die Scharfrichter. Sie waren zu fünft, unter ihnen der Harpunier, der die halbzolllange Eisenstange leicht umbog. Neben der Theke lag bewegungslos das Krokodil, von dem man nicht wissen konnte, ob er noch lebte. Hinter der Theke kam der Wirt wieder zum Vorschein: Es war ihm eingefallen, dass es auch um den Brandy schade wäre, war er doch rar geworden in letzter Zeit. Also brachte er ihn auch ins Hinterzimmer und schloss die Tür hinter sich.
In Keules Hand erschien das kurze Drahtseil, an dessen Ende das Eisenstück hing. Rostig wusste genau, dass sie einer Übermacht gegenüberstanden und fliehen mussten, wenn sie konnten. Die fünfköpfige Truppe ging bedrohlich langsam auf sie los. Schnell flüsterte er dem Chefarzt zu:
»Du, die Lampe …«
Und er wartete nicht auf die Antwort, da er genau wusste, dass man ihn verstanden hatte. Stattdessen schnappte er sich einen Tisch und schleuderte ihn mitten in die nahende Gruppe, deren Mitglieder daraufhin für einen Augenblick auseinanderflogen. Inzwischen hatte der Chefarzt mit einem Stuhl auch schon die Lampe zerschlagen.
Es war noch gar nicht richtig dunkel geworden, als Rostig mit seiner Linken einen Stuhl und mit seiner Rechten den jungen Mann ergriff. Zuerst schmiss er den Stuhl durchs klirrende Schaufenster auf die Straße und den jungen Mann hinterher, der unverletzt zwischen den Glasscherben landete. Springend bediente er sich sodann desselben Weges. Der schmale Schatten des Jungen duckte sich dienstbereit neben ihn.
»Lauf, so schnell du kannst!«, rief Rostig und rannte, während er jemanden, der auf ihn losstach, mit dem Schlagstock niederschlug.
Wenn Keule und der Chefarzt ihrem Gesellen hätten hinterherflüchten wollen, wäre das ihr Ende gewesen, denn sie hätten die Messer in ihrem Rücken gehabt. Der einzig richtigen Strategie gemäß warfen sie sich mitten in die ihnen entgegenrennenden Scharfrichter, die vom unerwarteten Zusammenprall zersprengt wurden. Schon schwang sich Keule über die Theke, der Chefarzt sprang hinauf und begann seine Gegner wild mit den Flaschen zu bombardieren. Eine der Fünfliterflaschen zerbarst gleichzeitig mit dem Kopf des Harpuniers. Daraufhin traten die Angreifer ein wenig den Rückzug an. Der Wirt zündete sich – unter seinem Bett – eine Zigarette an, versuchte, den Schaden aufgrund des Geklirrs zu schätzen und beschloss, das Straßenfenster nicht mehr ersetzen zu lassen.
Die Augenblickspause ausnützend stürzten Keule und der Chefarzt das Gestell voller Liköre um, damit es den Verfolgern den Weg abschnitt, zerbrachen dann mit einem Schwung die Zimmertür des Wirts und gelangten von dort durchs Fenster auf die Straße. Sie sahen, wie Rostig mit dem Jungen um die Ecke bog. Ein dunkler Gegenstand flog ihnen hinterher, verfehlte aber ihre Köpfe und schlug klirrend auf dem Pflaster auf. Dann rannten sie. Die Richtung kannten sie bereits, hatten sie doch schon lange die Vereinbarung getroffen, sich nach einer ernsteren Meinungsverschiedenheit in ihrem Stammcafé zu treffen …
Das Kaffeehaus war in der Nähe des Trockendocks, das Publikum bestand aus den bekannteren Persönlichkeiten der Gegend, und in Neonbuchstaben hing ein schönes Firmenschild auf der Tür:
KAFFEEHAUS UND RESTAURANT
»Zu den Vier Leblosen Ratten«
DAS VORNEHME PUBLIKUM TANZT
2.
»Jetzt müssen wir eiligst aus Piräus verschwinden«, sagte Rostig, als sie sich endlich gesetzt hatten.
Der junge Mann starrte entsetzt seine unwirschen Freunde an, im Kaffeehaus und Restaurant »Zu den Vier Leblosen Ratten«, wo das vornehme Publikum tanzte. (»Dining room, Man Spricht deutsch.«)
Das tanzende vornehme Publikum bestand zum Großteil aus arbeitslosen Preisboxern und vergnügungssüchtigen Verkäufern der Markthalle sowie aus deren Begleiterinnen, die sich aus den verschiedensten Volksgruppen rekrutierten und deren Bekleidung ebensowenig nüchtern war wie sie selbst.
»Ich glaube auch, dass es klug wäre, von hier abzuhauen«, sagte der Herr Chefarzt. »Der Scharfrichter sind viele. Ich weiß gar nicht, warum wir uns wegen dieses schmächtigen Jungen so heftig gestritten haben.«
»Bitte, ich bin Ihnen aufrichtig dankbar …«, stotterte der junge Mann, dessen Stimme immer noch zitterte, aber Rostig winkte nur gutmütig:
»Schon gut! Wir sind nicht in der Tanzschule. Ich hatte schon lange Appetit, diesem Rindvieh eine zu schmieren. Außerdem hab ich Piräus satt. Also los! Auf ins lustige Nordafrika! Holla! Gehen wir ins malerische Port Said! Und dich nennen wir ab jetzt Bubi, du siehst nämlich aus, als wärst du gerade den kurzen Hosen entwachsen.
Damit hieß der junge Mann endgültig »Bubi«. So verlief hier die Namensgebung. Man kann die Menschen nicht mit der unbequemen Frage behelligen, wie sie heißen. Lieber gibt man ihnen einen neuen Namen, den er im anderen Hafen einfach von sich werfen kann. Man kennt fast niemanden bei seinem richtigen Namen. Wenn jemand gut zustechen kann, dann nennt man ihn »Mücke«, und wenn einer eine hässliche Haut hat, dann wird er selbstverständlich als »Narbe« bekannt. Einen breitschultrigen, gedrungenen Kerl hatten sie »Büffel« genannt. Da er infolge eines Messerstichs außer der Reihe verschieden war, konnte man seinen richtigen Namen unmöglich herausfinden. Auf seinem Grabholz stand: »unbekannt«. Aber seine Braut hatte mit der Zeit Geld für einen Grabstein aus Granit zusammengespart, und darauf steht heute noch:
HIER RUHT
DER BÜFFEL
ER LEBTE ca. 40 JAHRE
»Jetzt sag uns mal, Bubi«, fragte Keule, »warum du uns eigentlich gesucht hast!«
»Weil man gesagt hat, Herr Rostig sei … aus der Legion entflohen.«
»So?«, bemerkte Rostig. »Daran kann etwas stimmen. Aber warum hat dich das Krokodil getadelt?«
»Weil … weil ich meinen Bruder suche … der verschwunden ist …«
»Das, mein Junge, macht die Leute hier verständlicherweise nervös«, nickte Rostig. »Hier gibt es nämlich kaum einen, der nicht einige verschwundene Herren auf dem Konto hätte. So etwas kommt im Hafen schon mal vor. Jemand verschwindet. Er war hier, und fertig. Es gehört sich nicht, nachzufragen, was aus ihm geworden ist. Was bist du von Beruf?«
»Ich bin Schlosser …«
»Nicht herumlügen, mein Sohn«, schalt ihn Rostig vorwurfsvoll. Er zog Bubis kleine, schmutzige Hand vor seine Augen. »Willst du etwa von dieser Hand behaupten, sie hätte jemals körperliche Arbeit verrichtet?«
Der Junge schwieg.
»Nun sieh mal, mein Junge«, sagte Rostig, »da du uns hier was vorlügst, nehmen wir unsere Hand von dir. Ich bedauere nur, dass wir auch die Hand des Krokodils von dir genommen haben. Lebe wohl …«
»Danke …«, sagte der Junge, dann stand er auf und schlich sich davon. Einige Sekunden lang saßen die Freunde wortlos da.
»Hm …«, sagte Keule, »ein armseliger Typ ist das. Hat aber etwas, dass man ihn bedauern muss.«
»Ich meine«, ventilierte Rostig, »dem Jüngling hat man irgendeine Mischpoche in unserer Gegend abgemurkst. Jetzt streunt er hier herum, dass er sie vielleicht wiederfindet. Muss ein feiner Pinkel sein. Das war ich auch mal. Was lachst du? Denkst du, es kommt jeder mit einem offenen Messer zur Welt?«
»Wo gehen wir jetzt hin?«, fragte Keule.
»Wie wär’s mit Port Said?«
»Großartig«, sagte Rostig gleichgültig und stand auf. »Also tschüs. In der Früh reden wir mit dem Großen Chef, und dann auf nach Port Said. Holla!«
Und er ging. Eine komische Gestalt war dieser Rostig. (Wegen seiner roten Haare nannte man ihn so.) Er war nicht überaus auffallend, aber eben ausgesprochen rothaarig. Und er hatte ein paar Sommersprossen. Das alles stand ihm aber gut. Seiner wohlproportionierten, schlanken Figur war nicht anzusehen, dass er der berüchtigtste Schläger einiger recht bedeutender Häfen war. Sein Gesicht war kindlich, und er grinste fast ununterbrochen.
Kaum hatte er das Restaurant »Zu den Vier Leblosen Ratten« (das vornehme Publikum tanzt) verlassen, als er unter einer blinzelnden Laterne vor einer Gasse den dünnen Jungen erblickte. Bubi machte einen mutlosen Schritt. Rostig winkte großmütig:
»Na komm schon her, du Hornochse!«
Der Junge war sofort neben ihm und begleitete ihn wortlos. Er wusste gar nicht, warum, aber er verspürte eine übergroße Ruhe neben dem sommersprossigen, lustigen Landstreicher mit dem Kindergesicht.
»Also was willst du, he?«, fragte dieser ermutigend. »Ich helfe dir gern, wenn ich kann. Oder hast du nicht auf mich gewartet?«
»Doch … Ich wollte vor den anderen nichts sagen. Ihnen erzähle ich alles ehrlich.«
»Na dann los, fang an! Willst du keine Zigarette?«
»Danke.« Er zündete sich eine an. »Also dann, wenn Sie wollen, sage ich Ihnen alles, Herr Rostig.«
Sie liefen einige Schritte.
»Lassen wir dieses Getue. Sag einfach: ›du, Rostig‹.«
»Nun denn, bitte schön, du, Rostig …«, begann der Junge mutlos, »ich habe das Gefühl, ich kann dir vertrauen. Ich muss dir vertrauen. Der Mann, der verschwunden ist und den ich suche, ist mein Bruder. Vor zwei Jahren war er noch in der englischen Marine, Kapitän im Generalstab. Jahrelang hatte er an einer Erfindung gearbeitet – es war irgendeine technische Neuerung von großer Bedeutung. Ich glaube, es handelte sich im Wesentlichen um einen Sender, mit dem man aus großer Entfernung Minen sprengen konnte. Mein Bruder hatte niemandem von seiner Erfindung erzählt, und nur seine Assistentin wusste davon, die er unglücklicherweise liebte und der er blind vertraute. Das war sein Verderben. Eines Tages nämlich, als mein Bruder die Arbeit abgeschlossen hatte und den Zuständigen melden wollte, dass sie sein Modell besichtigen konnten, da erfuhr er, dass ein anderer Offizier eine ähnliche Erfindung gemeldet hatte. Ich kenne den Namen dieses Offiziers nicht. Hinsichtlich militärischer Erfindungen sind die Verfahren ziemlich undurchsichtig. Mein Bruder holte seine Zeichnungen, um zu beweisen, dass er mit der Erfindung früher dran war. Seine Zeichnungen erwiesen sich jedoch als unvollständig. Jemand hatte einige wichtigere Pläne entwendet. Derselbe Jemand musste es wohl gewesen sein, der die Kopien dieser verschwundenen Zeichnungen dem anderen Offizier übergeben hatte. Tom – mein Bruder heißt nämlich Thomas Leven – wusste jetzt, dass der Täter nur seine Braut sein konnte. Nur sie, Helena Aldington, hatte freien Zutritt zu meinem Bruder, sie hielt sich stundenlang in seiner Wohnung auf, wenn mein Bruder abwesend war. Er eilte sofort zu Helena. Es folgte eine aufgeregte Szene zwischen den beiden. Thomas verlangte wahrscheinlich die beiden Zeichnungen, die im Laufe eines einzigen Tages verschwunden waren. Der Pförtner sah meinen Bruder ohne Hut nervös davonrennen. Nach einer halben Stunde ging einer der Dienstboten zu Helena Aldington. Die Frau war bereits tot, mit einem Brieföffner erstochen. Man fand Toms Hut bei ihr. Auf dem Schreibtisch lag der Revolver meines Bruders. Man wusste, in welchem Zustand er seine Braut verlassen hatte, eine Bedienstete hatte sogar einen lauten Wortwechsel gehört, so dass seine Schuld nicht zu bezweifeln war. Er wäre auch auf der Stelle verhaftet worden, wenn er sich in seiner Wohnung befunden hätte, aber er war nicht nach Hause gegangen. Verzweifelt saß er bei einem Freund, Kapitän Finley. Die Abendblätter brachten bereits den Mord, und dieser Kapitän, der nicht an die Schuld meines Bruders glaubte, half ihm, unter falschem Namen ein nach Griechenland fliegendes Militärflugzeug zu besteigen. Das Militärgericht verhandelte den Fall in seiner Abwesenheit, nahm ihm seinen Rang, stieß ihn aus der Armee aus und verurteilte ihn zum Tod. Mein Bruder hatte zuletzt von hier, aus Piräus, geschrieben. Das ist mehr als anderthalb Jahre her. In diesem Brief erwähnt er, dass er wahrscheinlich zur Legion geht. Meine arme Mutter hat den Schlag nicht überlebt. Ich blieb allein. Von Beruf bin ich Sachbearbeiter bei einer Schiffahrtsgesellschaft …«
»Siehst du, dass du kein Schlosser bist«, brummte Rostig.
»Vor zwei Monaten hatte mich ein ziemlich vornehmer Herr zu sich bestellt: ein General im Ruhestand und meines Wissens Leiter der größten Fabrik Englands für Rüstungsmaterial. Er fragte, ob mein Bruder Zeichnungen zu Hause gelassen habe. Ich sagte, wir hätten keine einzige Zeichnung von ihm gefunden – er habe sie entweder vernichtet oder mitgenommen. Der General berichtete dann über die andere, ähnliche Erfindung, sie habe versagt. Der Offizier, der sie entwickelt hatte, sei ein recht tüchtiger Mann und zu Unrecht von meinem Bruder beschuldigt worden. Aber es sei ihm irgendwo ein Fehler unterlaufen. Die Erfindung habe also bei der Vorführung versagt, und man habe vergeblich versucht, sie zu verbessern. Der General sagte, diese Erfindung sei unglaublich wichtig. Und dass die Idee meines Bruders möglicherweise richtig sei. ›Thomas Leven hat zwar seinen Vorgesetzten zu Unrecht beschuldigt, nur weil dieser zufällig an einer ähnlichen Erfindung arbeitete, und hat dann seine Braut getötet – das alles schließt aber nicht aus, dass er uns bei dieser recht wichtigen Erfindung helfen könnte‹, sagte der General. ›Kann sein, dass seine Lösung die richtige ist. Wenn Thomas Leven seine Erfindung bereits einer anderen Großmacht verkauft hat, so steht es in unserem Interesse, dass auch wir sie von ihm erwerben. Wenn er sie nicht verkauft hat, dann ist es noch wichtiger, dass wir sie als erste erwerben. Mit Thomas Levens Strafsache habe ich nichts zu tun. Für seine Erfindung aber biete ich, sofern sie etwas taugt, fünfzigtausend Pfund. Aus der Summe ersehen Sie, welche Bedeutung wir dieser Erfindung beimessen. Ich gebe mein Ehrenwort, und zwar schriftlich, dass man gegen Leven nichts unternimmt, solange er sich wegen der Erfindung in England aufhält. Wenn sich die Erfindung bewährt, dann zahlen wir fünfzigtausend Pfund, wenn nicht, dann darf er wieder ins Ausland. Ich stelle Ihnen keine Fragen‹, sagte der General, ›aber ich halte es für möglich, dass Sie etwas über Thomas Levens Aufenthaltsort wissen. Ich meine, diese märchenhafte Summe ist es wert, dass Sie Ihren Bruder aufsuchen. Es ist vielleicht klüger, wenn Sie ihn persönlich zu überzeugen versuchen, seine Erfindung für uns zu rekonstruieren, falls er die Zeichnungen inzwischen vernichtet hat. Ich weiß, Sie sind bescheiden, deshalb lasse ich fünfhundert Pfund an Sie überweisen, damit Sie, wenn nötig, nach Südamerika oder Australien reisen können, um Thomas Leven zu sprechen.‹«
Rostig schwieg lange.
»Es ist auf keinen Fall richtig«, sagte er schließlich, dass man seine Braut tötet. Man soll sie vermöbeln, und fertig. Aber diese Erfinder sind alle so. Sie meinen gleich, niemand sonst kann dieselbe Idee haben. Also, hast du das Schreiben, das deinem Bruder freie Ein- und Ausreise gewährt, solange er sich wegen der Erfindung in England aufhält?«
»Ja, hier«, sagte Bubi, und zeigte den offiziellen Schutzbrief.
»Hm … das ist ziemlich interessant …«
»Lieber Rostig … Sie … du bist meine letzte Hoffnung. Ich muss meinen Bruder finden. Der arme, vielleicht muss er irgendwo Schlimmes erleiden und könnte doch glücklich und reich sein, wenn er seine Erfindung an England verkauft.«
»Wie bist du ausgerechnet auf mich gekommen?«
»Jemand hat gesagt, dass du in der Legion warst.«
»Ich war dort, mein Sohn. Ich bin einer jener seltenen Menschen, denen es gelungen ist, ihr zu entkommen. Wenn dein Bruder auch dort ist, dann kannst du ruhig nach London zurück. Denn weder Geld noch Schlauheit noch Gebet vermögen es, einen dort rauszuholen, bevor fünf Jahre abgedient sind. Und der Mensch ist nicht aus Eisen, um diese fünf Jahre ohne Weiteres auszuhalten.«
»Wenn ich wenigstens erfahren könnte … mit Gewissheit, ob er überhaupt bei der Legion ist!«
»Das kann ich eventuell herausbringen. Gehen wir zum ›Pharao‹. Der weiß solche Dinge.«
»Sie gingen zum Pharao. Man kann nicht wissen, warum er so hieß. Er war ein schmutziger, glatzköpfiger Mann mit einer Sperbernase. Er wohnte im Hafen, in einer Bretterbude, auf der ein französisches Ladenschild mit folgender Aufschrift prangte:
OFFICE FRANÇAIS
RENSEIGNEMENTS
POUR VOYAGES
Die Aufschrift bedeutete ungefähr so viel, dass die Bude eigentlich ein französisches Reisebüro war, wo man Informationen bekommen konnte. Die Einrichtung des »Büros« bestand aus einer Ledercouch und einer Schnapsflasche. Im Raum befanden sich nur der Pharao und einige tausend Fliegen. Die Besucher traten ein.
»Guten Tag.«
»Die Tür!«, schrie der Pharao.
»Schnauze«, antwortete Rostig vorwurfsvoll. »Es handelt sich darum, dass du fünf Drachmen verdienen kannst.«
»Interessiert mich nicht. Ich habe dir letztes Mal gesagt, dass ich mit dem Schmuggeln aufgehört hab. Du hast es jetzt mit einem französischen Staatsbeamten zu tun.«
»Du musst nicht schmuggeln. Dieser junge Mann möchte etwas über seinen Bruder erfahren. Verachte ihn nicht wegen seines schmächtigen Gestells. Er wurde heute aus dem Gefängnis entlassen: zwei Jahre, da er einen Fregattenkapitän niedergestochen hat.«
Der französische Staatsbeamte blickte nun etwas respektvoller auf den Jungen und setzte sich sogar, nachdem er bis jetzt gelegen war:
»Nehmen Sie es nicht übel«, wandte er sich höflich an den Jungen, »ich habe keinen Grund, an Ihnen zu zweifeln, aber ihre zweijährige Gefängnisstrafe ist noch keine Garantie dafür, dass Sie meine fünf Drachmen wirklich auszahlen können.«
»Bitte, ich gebe sie Ihnen gleich«, sagte Bubi hastig und bezahlte.
»Nun, worum handelt es sich?«, fragte der Pharao und machte sich daran, die Spitze eines Messers als Zahnstocher zu benützen.
»Ein Engländer namens Tom Leven hat sich hier voriges Jahr von der Legion anwerben lassen. Darüber möchte ich etwas erfahren.«
»Gerne. Wir werden im Archiv nachschauen.«
Der Pharao kniete sich auf den Boden, dann verschwanden seine Hände und sein Kopf unter dem Sofa: Dort befand sich nämlich das »Archiv«. Er hatte irgendwann fünf Jahre in der Legion abgedient und nach seinem Austritt diese Stelle im Hafen von Piräus angeboten bekommen. Wenn sich jemand in der französischen Botschaft meldete, weil er Legionär werden wollte, teilte man ihm mit, dass die Franzosen nicht berechtigt waren, auf griechischem Territorium Legionäre anzuwerben, dass man aber eine Anweisung ausstellen konnte für die Überfahrt nach Dschibuti, zur Legion, und dass bis zur Abfahrt des Dampfers ein französischer Staatsbeamter für ihn sorgen werde, dessen Aufgabe es wäre, arme Durchreisende zu betreuen. Das war der Pharao. Er blätterte nun in seinem Buch.
»Tom Leven, Tom Leven … Da ist er!« Und er zeigte auf den Namen. »Bitte! Tom Leven, sechsunddreißig Jahre, fuhr auf dem Dampfer Constanza nach Dschibuti, vor zwei Jahren, am 9. Februar. Das nenn ich Archivpflege.«
3.
Bubi brachte kein Wort heraus. Rostig betrachtete nachdenklich den Boden.
»Damit du aber siehst, Rostig, was für einen guten Freund du an mir hast, will ich dir ohne Zuzahlung noch etwas Sicheres über diesen Tom Leven verraten, so dass du ihn leicht finden kannst, wenn er euch bestohlen hat. Er hat das Schiff zusammen mit einem Belgier namens Lacroix bestiegen. Und der hat mir nach zwei Monaten geschrieben, damit ich etwas mit seiner Braut erledigte, bei der er einige Sachen zurückgelassen hatte. In diesem Brief hat Lacroix geschrieben, dass man sie beide in Dschibuti innerhalb von drei Wochen ausgebildet hatte, und dass ihr nächstes Ziel Rangun war. Das bedeutet, dieser Mann, der euch bestohlen hat, ist ebenfalls in Rangun. Und jetzt lasst mich schlafen … Die Tür!«, rief er ihnen noch hinterher, als sie ihn verlassen hatten.
Zweites Kapitel
Es regnet. Rostig nimmt seine Hand wieder vom Jungen. Er sucht den Großen Chef auf. Er verprügelt ihn. Dann verwandeln sie sich in eine Aktiengesellschaft, und Fred Unrat wird geschäftsführender Direktor.
1.