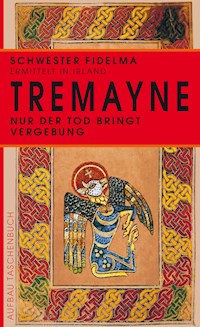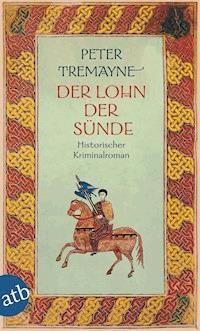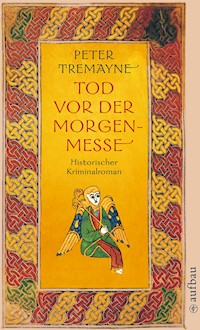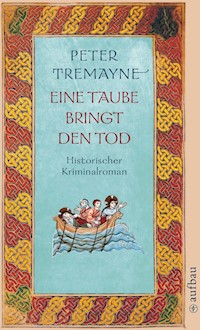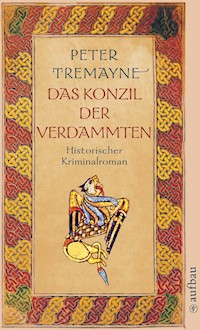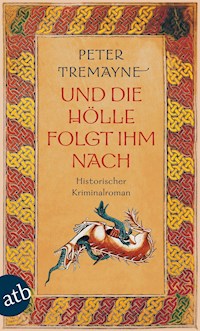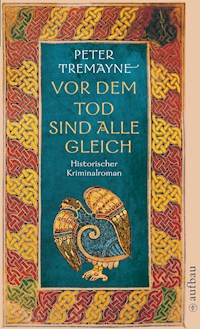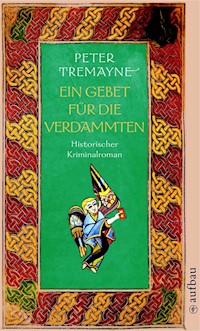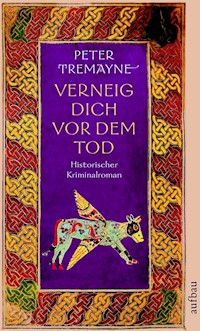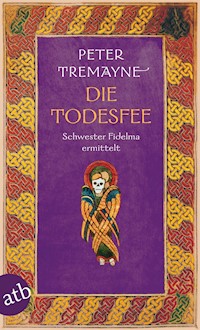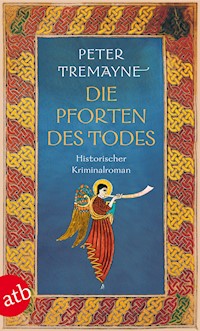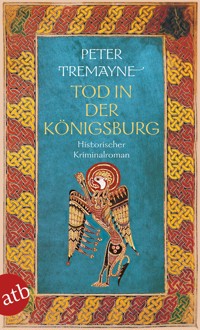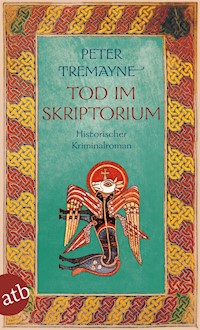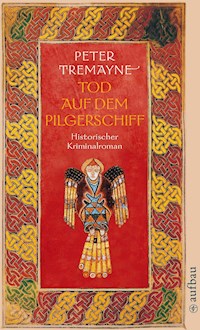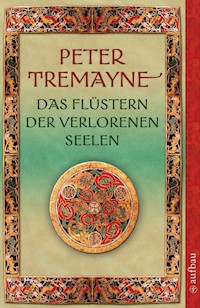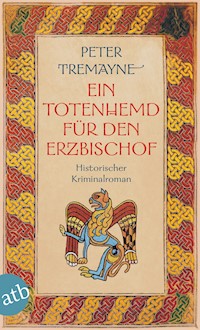
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schwester Fidelma ermittelt
- Sprache: Deutsch
Anno Domini 664. Wighard von Canterbury, der künftige Erzbischof, fällt in Rom augenscheinlich einem Raubmord zum Opfer. Ronan, ein irischer Mönch, gerät in Verdacht, beteuert aber seine Unschuld. Der Fall droht einen Krieg zwischen Angelsachsen und Iren auszulösen. Um das Schlimmste zu verhindern, wird die unbestechliche Schwester Fidelma mit den Ermittlungen betraut. Bei ihren Nachforschungen stößt Schwester Fidelma auf das zwielichtige Vorleben des ermordeten Würdenträgers ...
"Unabhängige, selbstbewusste Frauen, tolerant und gebildet: Sie gab es sicher schon immer, auch im siebten Jahrhundert und ehe sie unnachgiebig als Hexen verfolgt wurden. Es macht Spaß, diesen 'Frühzeitkrimi' in der Welt des frühen Christentums zu lesen." Südwest Presse.
"Das beste an diesem Buch ist Schwester Fidelma - eine kluge, emanzipierte, mutige Frau, die ihre Widersacher in Grund und Boden argumentiert." Südwestrundfunk.
"Spannung und Humor - das ist die unwiderstehliche Mischung dieser irischen Krimis." NRD 1 Radio Niedersachsen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Peter Tremayne
Ein Totenhemd für den Erzbischof
Historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Irmela Erckenbrecht
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
»Shroud for the Archbishop« erschien 1995
bei Headline Book Publishing, London.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0149-2
ISBN PDF 978-3-8412-2149-0
ISBN Printausgabe 978-3-7466-1962-0
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Übersetzung erschien erstmals 2003 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © by Peter Tremayne 1995
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design
unter Verwendung einer Buchmalerei aus dem »Book of Kells«
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
HISTORISCHE ANMERKUNG
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
GLOSSAR
Für Peter Haining, der bei der Taufe Pate stand,
und für Mike Ashley – Schwester Fidelmas erste
»Konvertiten«.
Ein Rechtsprinzip herrscht überall:
Das Interesse des Stärkeren
Plato (427–347 v. Chr.) Der Staat
HISTORISCHE ANMERKUNG
Diese Geschichte spielt im Rom des Spätsommers 664. Leserinnen und Leser, denen dieses »dunkle Zeitalter« bisher noch nicht vertraut war, sollten wissen, daß der Zölibat für Ordensfrauen und -männer sowohl in der römisch-katholischen als auch in der später »keltisch« genannten Kirche noch längst nicht überall verbreitet war. Zwar hat es schon immer Asketen gegeben, die zugunsten der vollkommenen religiösen Hingabe auf die körperliche Liebe verzichteten. Doch erst das Konzil von Nicäa im Jahre 325 mißbilligte die Eheschließung von Geistlichen, ohne sie allerdings ganz zu verbieten. In der römischen Kirche ging der Zölibat auf das Keuschheitsgelübde der heidnischen Vestalinnen und Diana-Priester zurück. Im fünften Jahrhundert verbot Rom allen Klerikern vom Rang eines Abts oder Bischofs den Geschlechtsverkehr mit ihren Ehefrauen; wenig später wurde daraus ein Heiratsverbot, das für Geistliche von niederem Rang allerdings keine Gültigkeit hatte. Erst unter Papst Leo IX. (1049 – 54) unternahm die römische Kirche den ernsthaften Versuch, den gesamten westeuropäischen Klerus zur Unterwerfung unter den Zölibat zu zwingen, während die Priester unterhalb des Rangs eines Abts oder Bischofs in der osteuropäischen orthodoxen Kirche ihr Recht zu heiraten bis auf den heutigen Tag behalten haben.
Der keltischen Kirche dagegen blieb die Verdammung der »sündigen Fleischeslust« auch dann noch fremd, als Rom den Zölibat längst zum Dogma erhoben hatte. Ja, im Einflußbereich der keltischen Kirche kam es recht häufig vor, daß Nonnen und Mönche in conhospitae, sogenannten Doppelhäusern, zusammenlebten und ihre Kinder im Dienste Christi gemeinsam aufzogen. Das muß man wissen, um die in dieser Geschichte dargestellten Verwicklungen zu verstehen.
I
Die Nacht war warm und von einem so schweren Duft erfüllt, wie dies nur bei einer römischen Sommernacht der Fall sein kann. Über dem dunklen Innenhof des Lateranpalasts lag das bittersüße Aroma der in den gepflegten Rabatten wachsenden Kräuter; in der Schwüle war der aufdringliche Geruch nach Basilikum und Rosmarin kaum zu ertragen. Der junge Offizier der Palastwache hob die Hand, um sich die Schweißtropfen abzuwischen, die sich unter dem Visier des Bronzehelms auf seiner Stirn gesammelt hatten. Trotz der Hitze wußte er, daß ihm sein grobwollener, lose über die Schultern hängender sagus in den kühlen Stunden vor der Morgendämmerung gute Dienste leisten würde.
Die einzige Glocke der nahe gelegenen St.-Johannes-Basilika schlug Mitternacht, die Stunde des Angelus. Pflichtbewußt murmelte der junge Offizier das vorgeschriebene Gebet: »Angelus Domini nuntiavit Mariae … Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft …« Er murmelte, ohne nachzudenken, ohne Gefühl für die Worte oder den Sinn der Sätze, und vielleicht lag es gerade an dieser mangelnden Aufmerksamkeit, daß ihm trotz des Gebets das verdächtige Geräusch nicht entging.
Obgleich die Tenorglocke unbeirrt weiterläutete und der kleine Brunnen in der Mitte des Innenhofs stetig plätscherte, hatte er es ganz deutlich vernommen: das Scharren weicher Lederschuhe auf den Pflastersteinen. Der junge custos runzelte die Stirn und neigte angestrengt lauschend den Kopf, um herauszufinden, aus welcher Richtung es gekommen war.
Er war sich sicher, daß er von der anderen Seite des von dunklen Schatten erfüllten Innenhofs schwere Schritte gehört hatte. »Wer da?« fragte er.
Er erhielt keine Antwort.
Vorsichtig zog er sein Schwert, das breite gladius, mit dem die berühmten römischen Legionen einst den Völkern der Welt ihren Willen aufgezwungen hatten. Aber das war jetzt Vergangenheit. Inzwischen verteidigte dieses Schwert die Sicherheit eines Palasts, in dem kein Geringerer residierte als der Bischof von Rom, der Heilige Vater der einzigen christlichen Kirche – Sacrosancta Laternensis ecclesia, omnium urbis et orbis ecclesiarium mater et caput. »Wer da? Zeigt Euch!« befahl er mit barscher Stimme.
Wieder bekam er keine Antwort, jedoch … ja, ganz deutlich vernahm der junge Offizier jetzt hastig davoneilende, schlurfende Schritte. Jemand flüchtete aus dem Innenhof in einen der dunklen Gänge, die in andere Teile des Palasts führten. Der custos verfluchte die undurchdringliche Finsternis, als er rasch über das Pflaster lief, um in den fraglichen Gang zu spähen. In der Dunkelheit konnte er jedoch nur eine geduckt davonhuschende Gestalt erkennen.
»Halt! Stehenbleiben!« rief er, wobei er versuchte, möglichst herrisch zu klingen.
Die Gestalt begann zu rennen, so daß ihre flachen Sandalen laut auf die Pflastersteine klatschten.
Der custos vergaß seine soldatische Würde und stürmte hinterher. Obwohl er jung und wendig war, schien sein Gegner ihm an Geschicklichkeit überlegen zu sein, denn als er das Ende des Durchgangs erreichte, war von dem Verfolgten nichts mehr zu sehen. Der Gang mündete in einen größeren Innenhof, der, anders als der kleinere Hof, in dem der junge custos Wache gehalten hatte, von mehreren lodernden Fackeln hell erleuchtet wurde. Dafür gab es einen einfachen Grund, denn dort lagen die Gemächer der päpstlichen Verwalter, während der kleinere Hof nur zum Gästehaus des Palasts gehörte.
Der Offizier blieb stehen. Argwöhnisch blickte er sich auf dem großen, rechteckigen Platz um und entdeckte auf der anderen Seite, vor dem Eingang zu einem der Hauptgebäude, zwei seiner Kameraden. Doch wenn er sie zur Hilfe rief, würde er den Verfolgten warnen. Er preßte die Lippen zusammen und prüfte noch einmal jede Ecke und jeden Winkel des Innenhofs, aber sosehr er sich auch anstrengte, er konnte niemanden erkennen. Gerade wollte er zu seinen Kameraden gehen, um sie zu fragen, ob sie jemanden aus dem Durchgang hatten kommen sehen, als ihn ein leises Geräusch zu seiner Linken innehalten ließ.
Er wirbelte herum und starrte in die Finsternis.
Vor einer der Türen zum Hof stand eine dunkle Gestalt.
»Wer seid Ihr?« fragte er mit rauher Stimme.
Der Angesprochene fuhr erschrocken zusammen, gab aber keine Antwort.
»Tretet vor und gebt Euch zu erkennen!« befahl der Offizier, das gezückte Schwert vor dem Brustpanzer zum Angriff bereit.
»Im Namen Gottes!« keuchte eine schmeichelnde Stimme. »Zuerst müßt Ihr mir sagen, wer Ihr seid!«
»Ich bin tesserarius Licinius von den Palast-custodes. Und jetzt nennt mir endlich Euren Namen!« entgegnete der junge Mann, überrascht von dieser Antwort. Licinius konnte ein Gefühl des Stolzes nicht unterdrücken, war er doch erst vor kurzem befördert worden. In der alten kaiserlichen Armee war der tesserarius der Offizier, der vom General die schriftliche Tagesparole – die tessera- bekam. Bei den custodes des Lateranpalasts bezeichnete dieser Titel den diensthabenden Wachoffizier.
»Ich bin Bruder Aon Duine«, lautete die mit dem lispelnden Akzent eines Fremden vorgetragene Antwort. Dabei trat der Mann einen Schritt vor, so daß das flackernde Licht einer Fackel auf sein Gesicht fiel. Licinius bemerkte, daß der Fremde recht rundlich war und beim Sprechen keuchte wie jemand, der unter Atemnot litt oder kurz zuvor rasch gelaufen war.
Licinius musterte den Mann mißtrauisch und winkte ihn zu sich, um ihn besser in Augenschein nehmen zu können. Der Bruder hatte ein Mondgesicht und trug die in Rom unübliche Tonsur eines irischen Mönchs: Der vordere Teil seines Kopfes war völlig glattrasiert.
»Bruder ›Eien-Dina‹?« versuchte Licinius den Namen des Fremden auszusprechen.
Der Mann bestätigte lächelnd.
»Und was habt Ihr um diese Stunde hier zu suchen?« fragte der junge Offizier.
Der rundliche Mönch breitete beschwichtigend die Hände aus.
»Ich kam gerade aus meiner Studierstube, tesserarius«, erklärte er und deutete auf die Tür, die hinter ihm lag.
»Seid Ihr drüben im kleinen Innenhof beim Gästehaus gewesen?« erkundigte sich Licinius und zeigte mit dem kurzen, breiten Schwert auf den dunklen Gang, aus dem er gekommen war.
Der mondgesichtige Mönch blinzelte ihn erstaunt an.
»Warum hätte ich dort gewesen sein sollen?« Licinius seufzte verzweifelt.
»Weil ich jemanden durch diesen Gang verfolgt habe. Ihr wart es nicht?«
Der Mönch schüttelte den Kopf.
»Ich habe die ganze Zeit über an meinem Pult gesessen und meine Studierstube eben erst verlassen. Ich war gerade über die Schwelle getreten, als Ihr mich angesprochen habt.«
Licinius steckte sein Schwert in die Lederscheide zurück und strich sich verwirrt mit der Hand über die Stirn.
»Und Ihr habt auch sonst niemanden gesehen?«
Wieder verneinte der Mönch kopfschüttelnd.
»Niemanden. Bis Ihr mich aufgefordert habt, Euch meinen Namen zu nennen.«
»Dann verzeiht mir, Bruder. Ihr könnt in Frieden Eurer Wege gehen.«
Der rundliche Mönch neigte dankbar den Kopf, ehe er über den Hof davoneilte. Das Leder seiner Sandalen klatschte über das Pflaster. Rasch verschwand er durch einen der Rundbögen in die dahinterliegenden Straßen der Stadt.
Eine der Wachen vom Haupttor, ein decurion, kam über den Hof, um sich zu erkundigen, was vorgefallen sei.
»Ah, Licinius! Du bist es! Was war denn los?«
Der tesserarius machte ein ärgerliches Gesicht.
»Jemand hat sich drüben im kleinen Innenhof herumgetrieben, Marcus. Ich habe ihn bis hierher verfolgen können, dann aber ist er mir entwischt.«
Der decurion kicherte leise.
»Warum hast du ihn verfolgt, Licinius? Was ist verdächtig daran, daß sich jemand um diese oder irgendeine andere Stunde im kleinen Innenhof aufhält?«
Licinius schenkte seinem Kameraden einen verdrießlichen Blick. Im Augenblick haderte er mit der ganzen Welt und ärgerte sich vor allem darüber, daß er ausgerechnet heute abend zum Dienst eingeteilt worden war.
»Weißt du nicht, daß dort drüben das domus hospitale, das Gästehaus, liegt? Und Seine Heiligkeit hat ganz besondere Gäste: Bischöfe und Äbte aus den fernen sächsischen Königreichen. Ich wurde beauftragt, sie sorgsam zu bewachen. Es heißt, die Sachsen hätten Feinde in Rom. Und man hat mich strengstens angewiesen, jeden zu befragen, der sich auf verdächtige Weise den Gastquartieren nähert.«
Der andere custos schnaubte verächtlich.
»Und ich dachte immer, die Sachsen wären noch Heiden!« Er hielt inne und deutete in die Richtung, in die der Mönch verschwunden war. »Wen hast du da eben befragt? War das nicht dein Verdächtiger?«
»Das war ein irischer Mönch. Bruder ›Eien-Dina‹ oder so ähnlich. Er kam gerade aus seiner Studierstube. Im ersten Augenblick dachte ich, er wäre der Mann, den ich verfolgt hatte. Wie dem auch sei, er hat niemanden gesehen.«
Der decurion grinste.
»Diese Tür führt zu keiner Studierstube, sondern zum Lagerhaus des sacellarius, des Schatzmeisters Seiner Heiligkeit. Sie ist seit Jahren verschlossen, jedenfalls seitdem ich bei der Palastwache bin.«
Erschrocken sah Licinius seinen Kameraden an, riß die nächste Pechfackel aus dem Wandhalter und ging zu der Tür, auf die der Mönch gedeutet hatte. Der Rost auf Schloß und Riegel bestätigte die Aussage des decurion, und Licinius stieß einen Schwall von Flüchen aus, die für ein Mitglied der Palastwache Seiner Heiligkeit alles andere als schicklich waren.
Der Mann saß an einem Holztisch, den Kopf über ein Pergament gebeugt, die Lippen in höchster Aufmerksamkeit zusammengepreßt. Trotz seiner gekrümmten Haltung konnte man erkennen, daß er von hohem Wuchs war. Sein unbedeckter Kopf wies die unverwechselbare römische Tonsur auf, eine kreisrunde, kahlgeschorene Stelle auf der Mitte des Scheitels, umgeben von kräftigem, pechschwarzem Haar, das zu seiner braunen Haut und seinen dunklen Augen paßte. Sein Gesicht ließ auf ein Leben in einem warmen, sonnigen Klima schließen. Seine Züge waren schmal und hager, er hatte die Adlernase eines römischen Patriziers, und seine Wangenknochen traten deutlich hervor. Seine Haut war mit kleinen Narben bedeckt, vielleicht hatte er sich in der Kindheit die Pocken zugezogen. Die schmalen Lippen waren so rot, daß sie fast künstlich gefärbt aussahen.
Er saß reglos da, stumm in seine Papiere vertieft.
Auch wenn seine Tonsur nichts über seine religiöse Berufung verraten hätte, war seine Kleidung unverwechselbar: Er trug die mappula, ein weißes, mit Fransen gesäumtes Tuch, campagi, flache, schwarze Pantoffeln, und udones, weiße Strümpfe – die überlieferte Tracht eines kaiserlichen Magistrats im römischen Senat, an der man inzwischen hohe geistliche Würdenträger erkannte. Auch die dünne, purpurrote Seidentunica zeigte deutlich, daß er mehr war als ein einfacher Mönch.
Als ihn das leise Bimmeln einer Glocke aus seinen Gedanken riß, blickte er gereizt auf.
Am anderen Ende des großen, kühlen Marmorsaals öffnete sich eine Tür, und ein junger Mann in einer groben, braunen Mönchskutte trat ein. Er schloß die Tür sorgfältig hinter sich, schob die Hände in die weiten Ärmel seines Gewandes und eilte auf den Mann am Holztisch zu. Sein leicht schwankender Gang erinnerte an das Watscheln einer Ente, und seine Sandalen klatschten auf den Mosaikfußboden.
»Beneficio tuo«, sagte der Mönch und beugte ehrerbietig den Kopf.
Ohne den traditionellen Gruß zu erwidern, lehnte der ältere Mann sich seufzend zurück und bedeutete dem Mönch durch ein Handzeichen, sein Anliegen vorzutragen.
»Mit Eurer gütigen Erlaubnis, ehrwürdiger Gelasius, im Vorzimmer ist eine junge Schwester, die verlangt, zu Euch vorgelassen zu werden.«
Gelasius zog eine dunkle Augenbraue hoch.
»Sie verlangt, vorgelassen zu werden? Eine junge Schwester, sagst du?«
»Aus Irland. Sie hat die Regularien ihres Klosters mitgebracht, um sie dem Heiligen Vater vorzulegen und von ihm segnen zu lassen. Außerdem hat sie eine persönliche Nachricht Ultans von Armagh für Seine Heiligkeit.«
Gelasius lächelte schwach. »Die Iren suchen also noch immer den Segen Roms, obwohl sie gegen die römischen Beschlüsse ständig Einwände erheben? Ist das nicht ein seltsamer Widerspruch, Bruder Donus?«
Der Bruder beschränkte sich auf ein Achselzucken.
»Ich weiß wenig über dieses fremde Land. Allerdings glaube ich gehört zu haben, daß die Leute dort noch immer der Ketzerei des Pelagius folgen.«
Gelasius schürzte die Lippen.
»Und die junge Schwester verlangt …?« betonte er das Wort zum zweiten Mal.
»Angeblich wartet sie seit fünf Tagen darauf, vorgelassen zu werden, ehrwürdiger Gelasius. Zwischen den verschiedenen Abteilungen muß es wohl einige Mißverständnisse gegeben haben.«
»Nun, da uns die irische Schwester Nachricht vom Erzbischof von Armagh bringt, sollten wir sie unverzüglich empfangen, vor allem, wenn man bedenkt, daß sie eigens den weiten Weg nach Rom gereist ist. Ja, schauen wir sie uns an, befragen wir sie nach den Regularien, und lassen wir uns von ihr erklären, warum sie der Heilige Vater ihrer Meinung nach persönlich empfangen sollte. Hat diese junge Schwester auch einen Namen, Bruder Donus?«
»Natürlich«, antwortete der junge Mönch. »Aber es ist ein seltsamer Name, den ich nicht behalten habe. Felicitas oder Fidelia oder so ähnlich.«
Ein mattes Lächeln erschien auf Gelasius’ dünnen Lippen.
»Das könnte ein gutes Omen sein. Felicitas war die römische Göttin des Glücks, und Fidelia heißt ›die Vertrauenswürdige, Treue, Standhafte‹. Laß sie eintreten.«
Der junge Mönch verbeugte sich und eilte in seinem eigentümlichen Watschelgang durch den großen Saal zurück zur Tür.
Gelasius schob das Pergament zur Seite und lehnte sich auf seinem geschnitzten Holzstuhl zurück, um das Eintreten der jungen Fremden zu beobachten, die ihm sein Faktotum, Bruder Donus, angekündigt hatte.
Die Tür ging auf, und eine hochgewachsene Gestalt im Nonnengewand trat in den Saal. Ihre Kleidung war für Rom ungewöhnlich: Die camilla aus ungefärbter Wolle und die tunica aus weißem Leinen wiesen die Trägerin in Roms warmem Klima als Neuankömmling aus. Die Nonne durchschritt den großen Saal mit jugendlichem Schwung, der nicht zu der sonst mit religiöser Tracht einhergehenden Demut paßte, jedoch nicht ohne Anmut war. Gelasius bemerkte, daß sie schlank und hochgewachsen war. Ein paar widerspenstige Strähnen roten Haares lugten unter ihrer Haube hervor. Sein Blick glitt über die jungen, ebenmäßigen Gesichtszüge und heftete sich gebannt auf ihre hellgrünen Augen.
Vor dem Holztisch blieb die junge Nonne stehen und runzelte leicht die Stirn. Gelasius erhob sich nicht, sondern streckte ihr die linke Hand entgegen, an der er einen großen, goldenen Smaragdring trug. Nach kurzem Zögern umfaßte die junge Frau seine Finger und neigte leicht den Kopf.
Gelasius hatte Mühe, seine Überraschung zu verbergen. Jedes Mitglied der römischen Geistlichkeit wäre vor ihm niedergekniet und hätte als Zeichen der Ehrfurcht vor seinem hohen Amt den Ring geküßt. Diese seltsame junge Fremde dagegen hatte nur kurz den Kopf gebeugt und damit Anerkennung, nicht aber Unterwürfigkeit zum Ausdruck gebracht. Ihr Gesichtsausdruck wirkte beherrscht, wenn auch ein wenig verärgert.
»Willkommen, Schwester … Fidelia?« begann Gelasius zögernd.
Die junge Frau verzog keine Miene.
»Ich bin Fidelma von Kildare aus dem Königreich Irland.«
Gelasius bemerkte, daß ihre Stimme fest war. Der mit prächtigen Wandbehängen ausgestattete Raum schien sie nicht im mindesten einzuschüchtern. Seltsam, dachte er, daß diese Fremden von der Macht, dem Reichtum und der Heiligkeit Roms völlig ungerührt zu sein schienen. Die Briten und Iren erinnerten ihn an die halsstarrigen Gallier, über die er bei Cäsar und Tacitus gelesen hatte. War nicht ein König der Briten von Claudius als Gefangener nach Rom gebracht worden und beim Anblick der prunkvollen Stadt nicht in Ehrfurcht erstarrt, sondern hatte nur erstaunt gefragt: »Und obgleich Ihr dies alles habt, macht Ihr uns unsere armseligen Hütten in Britannien streitig?« Gelasius war ein Mann, der auf seine römisch-patrizische Vergangenheit stolz war und sich häufig wünschte, unter den frühen Cäsaren in der Blütezeit des Römischen Reiches gelebt zu haben. Bei diesem Gedanken, der im Widerspruch zur bescheidenen Grundhaltung seines Glaubens stand, wurde ihm ein wenig unbehaglich, und er widmete sich wieder seiner Besucherin.
»Schwester Fidelma?« wiederholte er ihren Namen und gab sich große Mühe mit der Aussprache.
Die junge Frau nickte bestätigend.
»Ich bin auf Ersuchen von Ultan, Erzbischof von Armagh, in Eure Stadt gekommen, um …«
Gelasius hob die Hand, um dem Wortschwall Einhalt zu gebieten.
»Seid Ihr das erste Mal in Rom, Schwester?« fragte er ruhig.
Fidelma hielt inne und nickte. Sie fragte sich, ob sie im Umgang mit diesem hochgestellten Kirchenvertreter, dessen Namen ihr das Faktotum nicht verraten hatte, in ein Fettnäpfchen getreten war.
»Und wie lange weilt Ihr schon in unserer schönen Stadt?«
Gelasius glaubte, ein unterdrücktes Seufzen zu vernehmen, und ihre Brust hob und senkte sich heftig.
»Ich versuche schon seit fünf Tagen eine Audienz beim Bischof von Rom zu bekommen … Zu meinem Bedauern muß ich gestehen, daß man mich über Euren Namen und Euren Rang nicht aufgeklärt hat.«
Um Gelasius’ Lippen spielte der Anflug eines Lächelns. Er bewunderte die Offenheit der jungen Frau.
»Ich bin Bischof Gelasius«, antwortete er, »und bekleide das Amt des nomenclators Seiner Heiligkeit. Meine Aufgabe ist es, alle Bittgesuche an den Heiligen Vater zu prüfen, darüber zu befinden, ob er sich persönlich damit befassen soll, und ihm bei seiner Entscheidung mit meinem Rat zur Seite zu stehen.«
Schwester Fidelmas Augen leuchteten auf. »Ah, jetzt verstehe ich, warum man mich zu Euch geschickt hat«, sagte sie erleichtert. Sie ließ die Schultern sinken. »Es ist nicht immer leicht, sich richtig zu verhalten, wenn man nicht in die hiesigen Gepflogenheiten eingeweiht ist. Ich hoffe, Ihr werdet mir verzeihen, wenn ich Fehler mache, und es einzig und allein meiner fremdländischen Herkunft und Erziehung zuschreiben.«
Gelasius neigte gnädig den Kopf. »Hübsch gesagt, Schwester. Für jemanden, der zum ersten Mal in unserer Stadt ist, sprecht Ihr ein ausgezeichnetes Latein.«
»Ich spreche auch Griechisch und Hebräisch. Was das Erlernen fremder Sprachen angeht, besitze ich eine recht rasche Auffassungsgabe. Sogar die Sprache der Sachsen ist mir in groben Zügen geläufig.«
Gelasius sah sie prüfend an, denn er war nicht sicher, ob sie ihn verspotten wollte. Doch im Tonfall der jungen Frau schwang nichts Prahlerisches mit, und wieder war Gelasius höchst beeindruckt von ihrer direkten Art.
»Und wo habt Ihr all diese Sprachen erlernt?«
»Ich habe als Novizin in Kildare, der von der heiligen Brigit gegründeten Abtei, studiert. Und später war ich dann bei Morann in Tara.«
Gelasius war erstaunt. »All Eure Sprachkenntnisse habt Ihr ausschließlich in Irland erworben? Nun, bisher kenne ich Eure berühmten Schulen nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich einen lebenden Beweis für deren Qualität. Nehmt doch Platz, Schwester, und laßt uns über die Gründe Eures Besuches sprechen. Die Reise von Irland muß lang und anstrengend gewesen sein – und sicherlich auch nicht ganz ungefährlich? Bestimmt seid Ihr nicht allein nach Rom gekommen?«
Fidelma nahm den kleinen Holzstuhl, den Gelasius ihr angeboten hatte, und drehte ihn so, daß sie dem Bischof direkt gegenübersaß. Nachdem sie es sich bequem gemacht hatte, antwortete sie: »Bruder Eadulf aus Canterbury hat mich begleitet, der als scriba für Wighard, den zukünftigen Erzbischof von Canterbury, im sächsischen Kent tätig ist.«
Gelasius hob fragend die Augenbrauen.
»Soweit ich im Bilde bin, gibt es zwischen Irland und Canterbury nicht viele Gemeinsamkeiten. Oder gehört Ihr zu den wenigen irischen Ordensleuten, die die Vorherrschaft Roms über Columban anerkennen?«
Ein Lächeln spielte um Fidelmas Lippen. »Ich halte es mit den Glaubensregeln von Patrick und Palladius, die unserer kleinen Insel einst den Glauben brachten«, entgegnete sie ruhig. »Ich habe an der Synode von Witebia teilgenommen und dort die sächsischen Gesandten kennengelernt. Gegen Ende der Synode erkrankte Deusdedit, der Erzbischof von Canterbury, an der Gelben Pest und starb. Sein voraussichtlicher Nachfolger Wighard verkündete seine Absicht, nach Rom zu reisen, da er den Papst um seinen Segen bitten wollte. Und da Ultan mich gebeten hatte, die Regula coenobialis Cill Dara nach Rom zu bringen, beschloß ich, in der Gesellschaft Bruder Eadulfs zu reisen, den ich während der Synode kennen- und schätzengelernt habe.«
»Und was war der Zweck Eurer Teilnahme an der Synode, Schwester? Von dem Disput zwischen den Vertretern Roms und denen der irischen Kirche habe ich gehört. Haben unsere römischen Gesandten in diesem Meinungsstreit nicht den Sieg davongetragen?«
Fidelma überhörte geflissentlich Gelasius’ spöttischen Tonfall.
»Meine Aufgabe war es, den Vertretern unserer Kirche in allen rechtlichen Fragen beratend zur Seite zu stehen.«
Erstaunt sah der Bischof sie an.
»Ihr habt sie in rechtlichen Fragen beraten?« fragte er verblüfft.
»Ja, denn ich bin nicht nur Geistliche, sondern auch eine dálaigh der irischen Brehon-Gerichtsbarkeit, eine Gesetzeskundige oder Advokatin, und sowohl im Senchus Mór, dem Zivilrecht, als auch dem Leabhar Acaill, dem Strafrecht, geschult. Beide zusammen sorgen dafür, daß in unserem Land Frieden und Gerechtigkeit herrschen.«
Gelasius starrte sie ungläubig an. »Ist es bei den Königen von Irland Sitte, Frauen als Gesetzeskundige vor Gericht zuzulassen?«
Fidelma zuckte die Achseln. »In meinem Volk können Frauen jeden Beruf ergreifen, selbst die Königswürde und die Befehlsgewalt im bewaffneten Kampf stehen ihnen offen. Wer hat noch nicht von Macha, unserer größten Kriegerkönigin, gehört? Und doch ist mir zu Ohren gekommen, daß den Frauen in Rom keine vergleichbaren Rechte zugebilligt werden.«
»Ganz bestimmt nicht«, versetzte Gelasius.
»Es ist also wahr, daß den römischen Frauen alle gelehrten Berufe versagt sind und sie kein öffentliches Amt bekleiden dürfen?«
»Allerdings.«
»Dann lebt Ihr in einem wahrhaft merkwürdigen Land, das sich selbst der Hälfte der Talente seiner Bevölkerung beraubt.«
»Nicht merkwürdiger, gute Schwester, als ein Land, das den Frauen gleiche Rechte einräumt wie den Männern. In Rom werdet Ihr überall beobachten, daß der Vater oder Ehemann in jeder Hinsicht über die weiblichen Mitglieder seiner Familie bestimmt.«
»Dann ist es wohl ein Wunder, daß ich unbehelligt durch Eure Straßen gehen kann, ohne für meine Anmaßung angepöbelt zu werden.«
»Eure Tracht wird mit der stola matronalis gleichgesetzt, das heißt, Ihr könnt nicht nur öffentliche Kultstätten, sondern auch Theater, Läden und Gerichtshöfe besuchen – Vergünstigungen, die all denen, die kein geistliches Gewand tragen oder noch unverheiratet sind, nicht zustehen. Jungfrauen müssen sich auf jeden Fall im nahen Umkreis ihres Vaterhauses aufhalten. Trotz allem können hochgestellte Frauen in geschäftlichen Dingen durchaus eine recht einflußreiche Rolle spielen – vorausgesetzt, alles wird in den vier Wänden ihres eigenen Palastes abgewickelt und nach außen von ihren Ehemännern oder Vätern vertreten.«
Fidelma schüttelte mißbilligend den Kopf. »Dann ist Rom für uns Frauen eine sehr traurige Stadt.«
»Es ist die Stadt von Peter und Paul, die das Licht des Glaubens in die Finsternis des Heidentums brachten – und es ist die Stadt, die dazu auserwählt wurde, dieses Licht in die Welt zu tragen.«
Stolz schwang in Gelasius’ Tonfall mit, als er sich zurücklehnte und die junge Irin betrachtete. Er liebte seine Heimat und seine Stadt und war äußerst standesbewußt.
Fidelma schwieg, da sie klug genug war, um es sich nicht mit dem Bischof zu verscherzen. Nach einer Weile fuhr Gelasius fort. »Und Eure Reise verlief ohne Zwischenfälle?«
»Die Überfahrt von Massilia war äußerst ruhig. Nur einmal, als am südlichen Horizont ein fremdes Segel erschien, ließ der Kapitän das Schiff vor lauter Angst fast auf einen Felsen laufen.«
»Es hätte ein Schiff der fanatischen Anhänger Mohammeds aus Arabien sein können, die das gesamte Mittelmeer unsicher machen. Unzählige Male sind unsere Häfen im Süden schon von ihnen geplündert und verwüstet worden. Gott sei Dank ist Euer Schiff von ihnen verschont geblieben.« Einen Augenblick lang hielt Gelasius nachdenklich inne, dann fragte er: »Und habt Ihr eine gute Unterkunft in der Stadt gefunden?«
»O ja. Ich bin in einer kleinen Herberge nicht weit von hier untergekommen, ganz in der Nähe des Oratoriums der heiligen Prassede in der Via Merulana.«
»Ah, die Herberge, die von Diakonus Arsenius und seiner guten Frau Epiphania geleitet wird?«
»Genau.«
»Gut. Dann weiß ich, wo ich Euch erreichen kann. Und jetzt laßt uns über die Botschaft sprechen, die Euch Ultan von Armagh mitgegeben hat.«
Fidelma reckte kampflustig ihr hübsches Kinn. »Sie ist allein für die Augen Seiner Heiligkeit bestimmt.«
Verärgert zog Gelasius die Brauen zusammen. Kurz sah er in die unerschrockenen, grünen Augen, die kühn seinem Blick standhielten. Dann aber überlegte er es sich anders und nickte mit einem breiten Lächeln.
»Ihr habt vollkommen recht, Schwester. Aber hier bei uns herrscht nun mal die Regel, daß ich kraft meines Amtes als nomenclator alle eingehenden Schreiben prüfen muß. Auch die Regularien, die Ihr dem Heiligen Vater zur Segnung mitgebracht habt, müssen vorher von mir durchgesehen werden. Das liegt nun mal in meinem Zuständigkeitsbereich.«
Fidelma sah ein, daß ihr nichts anderes übrig blieb, als einzulenken. Aus den Falten ihrer langen Gewänder zog sie eine dicke Pergamentrolle hervor und reichte sie dem Bischof. Er entrollte sie, überflog ihren Inhalt und legte sie dann auf den Tisch.
»Ich werde alles in Ruhe lesen und anschließend meinen scriptor um eine Prüfung bitten. Wenn alles seine Richtigkeit hat, können wir für heute in sieben Tagen eine Audienz bei Seiner Heiligkeit vereinbaren.«
»Nicht früher?« fragte sie enttäuscht.
»Habt Ihr es denn so eilig, unsere schöne Stadt wieder zu verlassen?« spöttelte Gelasius.
»Mein Herz sehnt sich nach meiner Heimat, werter Bischof, das ist alles. Ich bin jetzt schon so viele Monate von zu Hause fort.«
»Dann, mein Kind, werden ein paar Tage mehr oder weniger auch keinen großen Unterschied machen. Es gibt so vieles, was Ihr Euch vor Eurer Rückkehr anschauen solltet, vor allem, wenn dies Eure erste Pilgerreise ist. Zweifellos werdet Ihr den Vatikanhügel besuchen und die Basilika besichtigen wollen, die man dort über dem Grab des heiligen Petrus errichtet hat – dem Felsen, auf dem nach dem Willen Christi seine Kirche fest und unverbrüchlich steht. Auf diesem Hügel, sagt man, ist der Herr auch dem heiligen Petrus erschienen, als er die Stadt, in der Nero alle Gläubigen verfolgte, verlassen wollte. Petrus kehrte um und ging zurück in die Stadt, um gemeinsam mit seiner Herde den Kreuzigungstod zu erleiden, und auf diesem Hügel wurde er dann zu Grabe getragen.«
Fidelma senkte den Kopf. Es fiel ihr schwer, ihre Verärgerung darüber zu verbergen, daß der Bischof sie für so unwissend hielt.
»Dann werde ich warten, bis Ihr mich rufen laßt, Gelasius«, sagte sie, stand auf und sah ihn an, als wolle sie sich von ihm verabschieden. Wieder staunte Gelasius, der es gewohnt war, in seinen Amtsräumen ganz allein darüber zu entscheiden, wann ein Gespräch beendet war.
»Sagt mir, Fidelma von Kildare, gibt es in Eurem Land viele Frauen wie Euch?«
Fidelma sah ihn fragend an. Offenbar war ihr die Bedeutung seiner Worte nicht ganz klar.
»Ich habe viele Eurer Landsmänner kennengelernt, einige davon sind sogar hier im Lateranpalast für uns tätig, aber meine Erfahrungen mit den Frauen sind sehr begrenzt. Sind sie alle so unverblümt und offen wie Ihr?«
Fidelma lächelte gelassen. »Ich kann nur für mich selbst sprechen, Gelasius. Doch wie ich Euch schon sagte, sind die Frauen in meinem Land den Männern in keiner Weise unterstellt. Wir glauben, daß Gott uns als Wesen mit gleichen Rechten geschaffen hat. Vielleicht solltet Ihr selbst einmal nach Irland reisen und Euch ein Bild von seinen Schönheiten und Schätzen machen.«
Gelasius lachte. »Kein schlechter Einfall. Aber ich glaube, ich bin schon zu alt für eine so anstrengende Reise. Jedenfalls wünsche ich Euch eine schöne Zeit in unserer Stadt. Ihr könnt jetzt gehen. Deus vobiscum.«
Zufrieden darüber, daß es ihm schließlich doch noch gelungen war, das Ende des Gesprächs zu bestimmen, beugte er sich vor und läutete mit einer kleinen silbernen Glocke.
Wieder streckte er die linke Hand aus, und wieder griff Fidelma zu seinem Ärger einfach danach und neigte den Kopf, anstatt seinen Ring zu küssen, wie es in Rom Sitte war.
Ohne ein weiteres Wort wandte die hochgewachsene Schwester sich um und ging quer durch den Saal zu der Tür, die Bruder Donus ihr aufhielt.
II
Erleichtert trat Schwester Fidelma durch die mit reichen Schnitzereien verzierten Eichentüren in die große Haupthalle des Lateranpalasts, wo in den letzten dreihundertfünfzig Jahren alle römischen Bischöfe gekrönt worden waren. Die Halle war zweifellos prachtvoll und in höchstem Maße beeindruckend. Hohe Marmorsäulen reckten sich himmelwärts einer gewölbten Decke entgegen, der Boden wirkte wie ein endloser Teppich aus winzigen Mosaiksteinen, die Wände waren mit bunten Wandteppichen geschmückt, und die gewölbten Baldachine bestanden aus polierter, gedunkelter Eiche. Dieser Palast hätte jedem weltlichen Prinzen zur Ehre gereicht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!