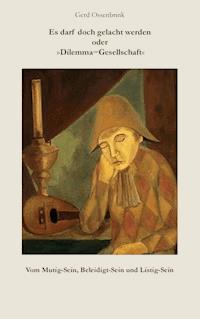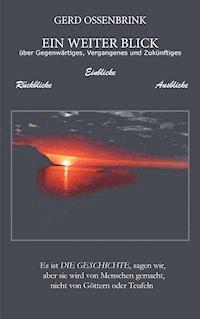
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einblicke: Wurzeln, Das Nähkästchen, Überraschende Wendung, Juvenat, Befreiung, Erwachsen werden: Soldat – Studium –Beruf, Erwachsensein und Verantwortung tragen, Deutschland im Zeitraffer, Schule und Lehrer, Umwandlungen, Anhang Rückblicke: Die Friedensmacher, Weltbeherrschung, Kolonialismus, Imperialismus, Asien im Focus, Dekolonialisierung, Ein deutscher Sonderweg, Hitlers Wahn und der Holocaust, Der deutsche Krieg, Verbrechen überall: Porajmos und Aktion T4, Wewelsburg – eine Erfahrung, Anhang, Ausblicke: Klimaretter von Paris, Der Gipfel, Klima, Wachstum – Wie und Warum?, Grenzen und Überschreitungen, Thule und Tuvalu, Dilemmata, Fossil oder Regenerativ?, Rettung? Katastrophenszenario?, Prognosen? Krisenbewältigungen Momentaufnahme, Januar 2016: Erregung und Skandalisierung, Mediatisierte Zivilisation, Information – Infotainment – Desinformation, Unterhaltung und Bespaßung, Willkommenskultur oder Abschottung, Silvesternacht mit Folgen, Nafris, Deutsche Nabelschau, Frieden im globalen Dorf, Zurück zur Besonnenheit, Ohne Irrationalismen, Ergänzung: April 2016
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZUM AUTOR
Gerd Ossenbrink,
geboren 1943, katholisch sozialisiert, Schüler in einem Ordensinternat und Abitur an einem Jesuitengymnasium, Lehrer und Schulleiter a. D., ehem. Kommunalpolitiker, Öffentliche Interventionen in gesellschaftlichen Diskursen.
Inhalt
Vorwort
Einblicke oder ›Meine‹ siebzig Jahre
Wurzeln
Das Nähkästchen
Überraschende Wendung
Juvenat
Befreiung
Erwachsen werden: Soldat – Studium – Beruf
Erwachsensein und Verantwortung tragen
Deutschland im Zeitraffer
Schule und Lehrer
Umwandlungen
Anhang
Rückblicke
Die Friedensmacher
Weltbeherrschung
Kolonialismus
Imperialismus
Asien im Focus
Dekolonialisierung
Ein deutscher Sonderweg
Hitlers Wahn und der Holocaust
Der deutsche Krieg
Verbrechen überall: Porajmos
Aktion T4
Wewelsburg – eine Erfahrung
Anhang
Ausblicke
Der Gipfel
Klima
Wachstum – Wie und Warum?
Grenzen und Überschreitungen
Thule und Tuvalu
Dilemmata
Fossil oder Regenerativ?
Rettung? Katastrophenszenario?
Prognosen? Krisenbewältigungen?
Momentaufnahme, Januar 2016
Erregung und Skandalisierung
Mediatisierte Zivilisation
Information – Infotainment – Desinformation
Unterhaltung und Bespaßung
Willkommenskultur oder Abschottung
Silvesternacht mit Folgen
Nafris
Deutsche Nabelschau
Frieden im globalen Dorf
Zurück zur Besonnenheit
Ohne Irrationalismen
Ergänzung: April 2016
Schlussbetrachtung
Literaturhinweise
Abbildungsnachweis
Bücher des Autors
Wenn wir die Erde
zu einem besseren Ort machen wollen,
müssen wir uns ändern.
Je freiwilliger wir es tun,
desto weniger Gesetze und Regeln benötigen
wir.
Unsere Zivilisation wurde vom Kulturträger
Mensch
zu einer hochkomplexen Kultur
weiterentwickelt.
Dennoch bleibt sie an die natürlichen
Bedingungen
für das (Über-)Leben gebunden.
Was wir brauchen: aufgeklärtes Denken,
Empathie,
globale Verantwortung und eine
Deeskalationsstrategie
für alle Konflikte.
Waffen sind keine Konfliktlöser.
Religionen müssen sich noch als Friedensstifter
und -bewahrer erweisen.
G. O.
Ein Dankeschön gilt meiner Frau Bernhild und allen diskurswilligen Freundinnen, Freunden und Bekannten.
Vorwort
Kulturfolger
In jeder Sekunde seines Lebens, das ein Teil der Natur ist und deren Gesetzmäßigkeiten und Notwendigkeiten folgt mit Essen und Trinken, Schlafen und Wachsein, Sexualität und Kinderaufzucht, kommunizieren, rivalisieren und Gefahren vermeiden, wird der heutige Mensch zum Kulturschöpfer, zum Gestalter seiner kulturellen Identität.
Gerade etwa 10.000 Jahre ist es her, seit der Mensch der Natur ein Schnäppchen schlagen und sie mehr und mehr (scheinbar) beherrschen konnte. Der Sprung (oder der Auszug aus dem Paradies) konnte gelingen dank der neuen Kraft der Selbsterkenntnis, inbegriffen die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit und der eigenen Schöpfungskraft, die es ihm ermöglichten, die kulturelle Evolution in Gang zu setzen und immer atemberaubendere Kulturschöpfungen hervorzubringen.
Er hat zwar seine Höhlenzeit hinter sich gelassen, nicht aber den Glauben an Zauberkraft und Magie, an Götter und Übersinnliches. Nun aber macht er dank seiner einzigartigen Schöpfungskraft sich alles untertan zum eigenen Vorteil und zum Nachteil aller anderen Spezies, schafft sich sein kulturelles Biotop mit Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Technologie und lebt sein Doppelleben aus Natur und Kultur. Letztere aber bestimmt seine Existenz. Der mit dieser (Hoch) Kultur noch nicht in Berührung gekommene Wilde aus Amazonien oder Papua-Neuguinea wird aussterben oder sich, wohl oder übel, auf den Kulturpfad begeben.
Ein Zurück zur Natur gibt es nicht mehr (allenfalls das herablassende Überlassen eines kleinen Stücks davon). Der Kulturfolger ist zur Kreativität gezwungen, muss immer neue Möglichkeiten finden oder erfinden, um seine Existenz zu verbessern oder zu sichern. Selbst den Weg Out of Planet Erde nimmt er in sein Kalkül, kein guter Ausweg, wie ich finde. Gespielt werden wird hier auf dem Kulturplatz der gegenwärtigen Zivilisation.
Sie aber kämpft um ihr Überleben, wobei die Magie die Wirklichkeit ersetzt: Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von… Die Natur aber lässt sich nicht präsentieren, ist mehrere Milliarden Jahre alt und wird sich dem Schöpfer Mensch nicht ergeben. Der Homo sapiens, der Weise, wird erkennen müssen, dass er nicht auf Dauer über die Natur herrschen kann, er wird wieder zu Ehrfurcht, Demut und Bescheidenheit finden müssen. Es sind die alten humanistischen Tugenden, religiös deuten muss man sie nicht.
Meine‹ siebzig Jahre, also unsere Gegenwart, der Rückblick auf die Epoche meiner Eltern (Jahrhundertwende) und der Ausblick auf die Zeit meiner Söhne und Enkelinnen werfen einen durchaus kritischen Blick auf die Fähigkeiten des Kulturschöpfers Mensch, auch zum Kulturbewahrer Mensch zu werden.
Die Manifestationen der professionellen Kulturschöpfer sind berauschend, beglückend und erregend auf allen Gebieten, der Kulturvollzug durch den Homo normalis, 7,4 milliardenfach täglich, verbleibt in den Mühen der Ebene (Brecht), bei dem Ringen um das Existenzielle, für die einen mehr, für andere (scheinbar) weniger oder gar nicht, und für sehr viele reicht es nicht einmal zum Minimum.
Ökonomische Tatsachen schaffen unterschiedliche Kulturen, eine des sinnlosen Konsums und der Ressourcen- und Zeitverschwendung und die Kulturen des Überlebenskampfes, des Elends und der Armutsfluchten. Immer findet Verteilung statt: von Arm zu Reich und als Rest oder Abfall zurück zu Arm – Logik der globalen Welt.
Katholisch sozialisiertes siebtes Kind eines Dorfschuhmachermeisters und Kleinstlandwirts, Internatszögling und Ordenskadett, Jesuitenschüler, Reserveoffizier, 68er ohne marxistisches Bekenntnis, aber politisch links orientiert, Sozialdemokrat und Kommunalpolitiker, Familienvater mit zwei Söhnen und zwei Enkelinnen, Lehrer und Schulleiter, Mittelständler, Ruheständler mit unruhigem, kritischen Blick und ebensolcher Haltung stehe ich mit über siebzig Jahren staunend vor dieser Vita, aber nicht selbstzufrieden.
Es hat mich bewogen aufzuschreiben, was mich bewegt. Es soll eine zeitgeschichtlich-kritische essayistische Betrachtung sein, faktenbasiert und meinungsstark, religionsfrei denkend und der Aufklärung und der Vernunft verpflichtet.
Die Ereignisse des Januar 2016 in Köln und anderswo haben mich zu einer sehr kritischen Momentaufnahme angetrieben.
Nach einem intensiven Diskurs fragte mich ein Freund, ob ich glaube, dass die Menschheit etwas aus der Geschichte gelernt habe. Ich habe die Frage mit Nein beantwortet, habe aber hinzugefügt, dass wir ja noch nicht am Ende des Lernprozesses angekommen seien. Es bleibt also Raum für Hoffnung.
Mai 2016
Einblicke — ›Meine‹ siebzig Jahre
Wurzeln
Am 11. April 1943 wird das siebte Kind eines Schuhmachermeisters und Kleinlandwirts in einem Tausend-Seelen-Dorf in tiefster westfälisch-katholischer Provinz geboren. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, hatte doch kurz zuvor am 2. Februar 1943 die sechste deutsche Armee unter Feldmarschall Paulus in Stalingrad kapituliert. 300.000 Soldaten waren allein in dieser Schlacht gefallen, 108.000 gingen in Gefangenschaft nach Sibirien, nur 6.000 davon kamen bis 1955 zurück. Aus realistischer Sicht betrachtet war das kein guter Ausgangspunkt für neues Leben während der Götterdämmerung des Tausendjährigen Reiches.
Das Dorf ist kurz beschrieben: Etwa tausend Einwohner, eine schöne romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, ein Adelssitz oberhalb des Dorfes mit gleichem Familiennamen im Adelstitel und einem zugehörigen landwirtschaftlichen Großbetrieb, das Dorf mit Bauern, Kleinbauern und selbständigen Handwerkern, Arbeitern und Tagelöhnern, alles in allem keine wohlhabende Bevölkerung, aber mit Standesunterschieden nach Vermögen.
Neun Familienmitglieder mussten aus dem Kleingewerbe und der kleinen Landwirtschaft ernährt und untergebracht und mit dem Notwendigen versorgt werden, sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber als Selbstversorger auch nicht unmöglich bei geringen Ansprüchen. Zwei Milch- und Arbeitskühe, einige Schweine, Hühner und Gänse waren die Grundlage, darüber hinaus großer Fleiß und handwerkliches Geschick auf allen Gebieten.
Sechs fast schon erwachsene Geschwister, drei Brüder und drei Schwestern nahm ich später als meine Verwandten wahr, deren Aufsicht ich nicht entgehen konnte, die aber auch Zuflucht, Schutz und gegebenenfalls Hilfe gegen väterliche Strenge und bei kleinen Malheuren boten, bis sie als junge Erwachsene, mit Ausnahme eines Bruders, das Elternhaus verließen und der kleine Junge allein zurückblieb, aber mit etwa Gleichaltrigen in der Nachbarschaft eng zusammenlebte. Mein Vater war Schuster, aber auch Schuhmacher, der für zahlungskräftige Kunden handgenähte Schuhe anfertigte. Später baute er noch einen kleinen Schuhladen auf.
Abb. 1: Familie 1951 bei der Silberhochzeit der Eltern
Spätestens um dieses Jahr 1943 herum wurde den Deutschen klar, dass die Feier zu Ende ging, die der Gröfaz, der größte Führer aller Zeiten, Adolf Hitler, dem Deutschen Volk bereitet hatte. Auch seinem größten Propagandisten und Volksverhetzer, Josef Goebbels, war es nicht mehr gelungen, die Deutschen bei seiner Rede im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1942 zum totalen Krieg mitzureißen, nur ein ausgesuchtes Publikum jubelte pflichtschuldigst.
Mein Vater war der Hitler-Partei nicht beigetreten, hatte auch dem mehr oder weniger sanften Druck von Dorfnazis standgehalten, war aber sicherlich, wie viele kleine Leute, Handwerker und Bauern, auch angetan von den Anfangserfolgen des Regimes nach 1933 und den Versprechungen für eine goldene Zukunft und auch beeinflusst von der Propaganda.
Wie fast die gesamte bäuerliche Bevölkerung fuhren meine Eltern mindestens einmal zum großen Reichs-Erntedankfest des Landvolkes nach Bückeburg, bei dem Hitler Begeisterungsstürme entfachte. Zehntausende jubelten ihm zu. So sah das Programm aus: »Der Weg durch das Volk« – das zentrale Ritual des Festes – Überreichung der Erntekrone an Hitler und Wehrmachtsübungen — Exkurs: Christlicher Erntedank und das Reichserntedankfest — Die Schlacht der Zukunft — Erntedank und Panzer? — Zum Nebeneinander von Naturidylle und Militärübung — Hitler spricht — Der Abschluss des Festes« (aus Wikipedia) Es sieht nach einer quasi religiösen Feier aus.
Späteren, sehr wenigen, Äußerungen meines Vaters konnte ich entnehmen, dass er sich von dieser Begeisterung nicht mitreißen ließ, sondern diesem Mann gegenüber skeptisch blieb. In den späten Jahren der Weimarer Republik fühlte sich mein Vater als junger Mann zur Partei des Katholizismus, dem Zentrum, hingezogen, das die bestimmende Partei in unserer Gegend war und bis 1933 blieb, politisch aktiv jedoch wurde er nicht. Was er bei der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes am 24. März 1933, das Hitler die uneingeschränkte diktatorische Macht über Deutschland bescherte, empfunden hat, ist nicht angesprochen worden. Das Zentrum stimmte diesem Gesetz zu (und löste sich wenig später nach dem Konkordat zwischen dem Vatikan und Nazi-Deutschland selbst auf). An anderer Stelle ist darüber zu schreiben. Die zweitstärkste Partei im Reichstag, die SPD, stimmte, ebenso wie die Kommunisten, dagegen und musste bitter dafür bezahlen.
Von all diesen Vorgängen wird man in der fernen Provinz nur wenig mitbekommen haben, die Nazianhänger im Dorf organisierten einen Fackelzug. Bei der letzten freien Wahl vor der Machtübernahme am 31. Juli 1932 hatte die NSDAP im Dorf nur ein mageres Ergebnis erreicht.
Als einigermaßen gesichert ist aber davon auszugehen, dass auch viele Menschen, die Hitler nicht zugetan waren, das Ende der Weimarer Demokratie, die zum Schluss nur noch chaotisch agierte, herbeiwünschten. Den unteren Schichten ging es immer schlechter, was den Nazis in die Hände spielte, und es gab am Ende fast sechs Millionen Arbeitslose.
Abb. 2: 1917 im Kriegslazarett, Josef Ossenbrink zweiter vorne rechts
Mein Vater, Jahrgang 1898, war 1916 zum Fronteinsatz gekommen, wurde schwer verwundet, kam in ein gutes Lazarett nach Würzburg und nach seiner Genesung als Kriegsverletzter nicht mehr zum Einsatz, während sein jüngerer Bruder 1918 fiel. Die Folgen der Verwundung musste er sein Leben lang ertragen, später bekam er eine winzig kleine Kriegsrente. Der Granatsplitter aber wurde als Familientrophäe bewahrt. Es war ein Schicksal, das Millionen Männer teilten.
Zurück zur Familiengeschichte! 1925/26 hatten mein Großvater und mein Vater das alte Wohnhaus vollständig abgerissen und ein neues zweigeschossiges Wohnhaus mit Werkstatt und einem Wirtschaftsanbau für den landwirtschaftlichen Kleinbetrieb errichtet. Geholfen haben der zukünftige Schwiegervater, ein kleiner Bauhandwerker mit eigenem Unternehmen und die zwei älteren der vier zukünftigen Schwäger, die bereits im Baugewerbe tätig waren. Nach der Hyperinflation von 1923 und der gerade sich erholenden Wirtschaft war das für meinen Vater und meine Mutter nach der Heirat 1926 eine gewaltige Schuldenlast, die abzutragen war.
Immerhin zeigt das Beispiel, dass die Menschen nach der Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs, dem Vertrag von Versailles mit seinen schwerwiegenden Auflagen und Restriktionen, dem Ende der Hohenzollern-Monarchie und der Fürstentümer, den revolutionären Umtrieben und der Ausrufung der ersten deutschen Demokratie durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann am 6. Februar 1919, der Verarmung breiter Schichten in der Hyperinflation von 1923 und dem Währungsschnitt und einer neuen stabilen Währung wieder Mut zum Leben gefasst hatten.
Abb. 3: Hochzeit der Eltern 1926 – vor dem neuen Haus
Ich springe nochmals in das Jahr 1923. Viele nennen es ein Schicksalsjahr für Deutschland, denn hier entschied es sich, ob die Demokratie schon stark genug war oder ob die Kräfte der Zerrüttung und des aufkommenden Faschismus beim Hitler-Ludendorff-Putsch in München bereits eine Konterrevolution erfolgreich zu Ende führen konnten. Sie konnten es noch nicht, wie wir heute wissen, aber die furchtbare Verarmung breiter Schichten durch die völlige Geldentwertung war Wasser auf die Mühlen der Demokratieverächter, Antisemiten, Rassisten und Dolchstoß-Fantasten. Von Juli bis November 1923 verlor die Mark vollständig an Wert, für einen Dollar bekam man im Juli 350.000 Mark und am 15. November 4,2 Billionen! »Die systematische Enteignung des deutschen Mittelstandes, nicht etwa durch eine sozialistische Regierung, sondern in einem bürgerlichen Staat, der den Schutz des Privateigentums auf seine Fahne geschrieben hatte, ist ein beispielloses Ereignis. Es war eine der größten Räubereien der Weltgeschichte.« (Arthur Rosenberg, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, a. a. O., S. 395)
Gewinner war der Staat, der mit einem Schlag seine Schulden los war, aber auch die Großindustrie, da deutsche Waren zu Schleuderpreisen exportiert werden konnten. Am 15. November war der Spuk vorbei, es gab den totalen Währungsschnitt: Eine Billion war jetzt gleich einer Goldmark, die ab 1924 Reichsmark hieß und wieder durch Gold und wertbeständige Devisen gedeckt war.
Ich habe diesen Exkurs gemacht, weil nach allen Schrecken des Krieges, der sich aber, bis auf Ostpreußen, außerhalb der Reichsgrenzen abgespielt hatte, nun die Folgen für die Menschen drastisch sichtbar waren. Diese Hyperinflation von 1923 und die Weltwirtschaftskrise von 1929, die zur ungeheuren Arbeitslosigkeit von sechs Millionen Menschen führten, gingen in das kollektive Gedächtnis der Deutschen ein, und man wurde auch noch als Kind des Wirtschaftswunders und später als Politiker immer wieder damit konfrontiert. Wirtschaftskrisen solchen Ausmaßes spielen immer den Feinden der Demokratie in die Hände.
Meine Mutter, Jahrgang 1901, war eine herzensgute, sehr fleißige Frau, die ich fast nur arbeitend oder betend in Erinnerung behalten kann. Als ältestes von sechs Geschwistern aus ähnlichen kleinbürgerlichen Verhältnissen stammend wie mein Vater, hatte sie keinen Beruf erlernt, arbeitete im elterlichen Haushalt, war später Magd und dann Großmagd bei einem Bauern und führte zu Beginn der zwanziger Jahre bei einer Tante im Ruhrgebiet einen großen Haushalt mit vielen Kindern. Alles, was in einem solchen Haushalt und an Arbeiten in einem kleinbäuerlichen Betrieb an Kenntnissen und Fertigkeiten erforderlich war, beherrschte sie perfekt.
Selten hatte ein Arbeitstag nach meiner Erinnerung weniger als zehn bis zwölf Stunden und es gab niemals ein klagendes Wort. Bei besonderen Arbeitstagen wie am Schlachttag, am Dreschtag oder bei besonderen Feldarbeiten gab es manchmal Helferinnen oder Helfer, auch konnten die älteren Schwestern ihr mehr und mehr zur Hand gehen, aber an ihr hing das meiste. Jeden Tag für mindestens zehn Personen das Essen zuzubereiten, war allein schon eine große Aufgabe für die Hausfrau, zumal man sich weitgehend selbst aus Garten und Keller oder Vorratskammer versorgte.
Meine Mutter war fromm, beachtete streng die Regeln der katholischen Kirche, war gehorsam gegenüber Pfarrer und Obrigkeit ohne je zu hinterfragen, war in der Furcht des Herrn erzogen, hätte nie einen Widerspruch gewagt und konnte es sich nie verzeihen, wenn aus Versehen eine Regel einmal nicht vollständig eingehalten worden war. Fasttage, Gebetsrituale, Gottesdienstbesuche und das Einhalten der Beicht- und Kommunion-Vorschriften wurden genauestens beachtet.
Aus meiner heutigen aufgeklärten Sicht und einer säkularen Lebenseinstellung heraus kann ich nur mit Zorn und Verachtung auf die Unterdrückung der kirchlichen Untertanen in der damaligen engen dörflichen Gesellschaft zurückblicken, in der es für Menschen wie meine Mutter keinen Ausweg aus der religiösen Klammer gab.
Dass sie es vielleicht nicht so empfanden, sondern es in der Gewissheit auf die Belohnung im Himmel taten, macht die Sache nicht besser. Als Fünf- bis Sechsjährigen nahm mich meine Mutter morgens mit in die Kirche, wenn die landwirtschaftlichen Arbeitszyklen es zuließen, mit leerem Magen, und zu Hause fiel ich dann hungrig über den Frühstückstisch her.
1953 gab es im Dorf ein katholisches Großereignis, das für mein Leben eine große Bedeutung bekommen sollte. Es nannte sich Volksmission. Dazu kamen zwei Prediger eines Ordens ins Dorf, die das Volk religiös wieder auf Vordermann bringen sollten. Ich erinnere mich, dass die Menschen ergriffen und hingerissen waren, so natürlich auch meine Mutter. Zu allen Veranstaltungen der Prediger war die Kirche berstend voll, berichtet der Dorfchronist. Danach war die Statik der katholischen Welt wieder hergestellt: Gott — Papst — Priester — die Jungfrau und Gottesmutter Maria und alle Engel und Heiligen, eben der ganze katholisch-spirituelle Kosmos, ich nenne es das katholische Pantheon. Und die orthodoxen Regeln waren zunächst wieder zur Geltung gebracht.
Meine Mutter war eine ganz und gar unpolitische Frau, aber sie erkannte sofort, was Recht und Unrecht war. Bei späteren Gelegenheiten habe ich mit ihr über das Schicksal der zwei jüdischen Familien aus dem Dorf gesprochen, die dem Naziterror zum Opfer gefallen waren, und sie äußerte tiefe Bestürzung über die Ereignisse im Dorf, die sich vor aller Augen ereignet hatten und über das Abbrennen der Synagoge in der Nachbarstadt.
Als in der Nachkriegszeit Bettler oder Hausierer (Menschen, die irgendwelche Kleinigkeiten verkauften) an die Türen klopften und um eine Kleinigkeit baten, war sie immer voller Mitleid und nie ging einer ohne einen Bissen oder eine Münze weg. Letzteres stieß sehr wohl manchmal bei meinem Vater auf Ablehnung, wenn er es sah, da auch im eigenen Hause Bescheidenheit und Kargheit herrschten. Empathie mit leidenden Menschen habe ich von meiner Mutter gelernt. Es ist geblieben. Von beiden Eltern aber habe ich gelernt, was es heißt, zu arbeiten ohne zu klagen. Es ihnen nachzutun, wäre unmöglich.
Das Nähkästchen
Als ziemlich neugieriges und wissbegieriges Kind, das mit vielen halberwachsenen Geschwistern und Erwachsenen zusammenlebt und das in der Schusterstube des Vaters heimlich auch oft den Gesprächen der Männer zuhört, die es nicht versteht, beginnt man zu fragen. Oft erfährt man dabei nichts, weil die Älteren einem Kind nicht alles sagen können oder wollen.
Die nun folgende Begebenheit ist, wie ich später nachgeforscht habe, einigermaßen richtig in meiner Erinnerung geblieben, denn durch sie bin ich an das Fragen und Nachforschen gelangt und sie hat mich gelehrt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Es muss zu Beginn meiner Schulzeit, also mit sechs Jahren, gewesen sein. Im Winter saßen die Frauen abends in der Küche zusammen, handarbeiteten und erzählten.
Abb. 4: Der Verfasser 1948 vor dem elterlichen Haus
In der Küche stand neben dem Schrank auf einem Tisch ein wunderschönes Strohkörbchen, in dem meine Mutter und die Schwestern ihre Nähutensilien aufbewahrten. Es war bunt gefärbt und hatte ein Ornament auf seinem Deckel. Ich habe es heute noch vor Augen, obwohl es lange nicht mehr existiert. Die Frauen sprachen von dem Körbchen und es fiel der Name Wassil, für mich ein völlig unbedeutendes Wort, aber fremd, und so kam sofort die Frage, was denn Wassil sei. Die Schwestern blickten die Mutter an, bis diese dann antwortete, das sei der Name eines Mannes, der vor einigen Jahren bei uns gelebt und gearbeitet habe. Das zog natürlich weitere Fragen nach sich: Wo kam er her und wohin ist er gegangen? Er kam aus einem Land, das heißt Russland und das ist ganz weit weg, und er ist wieder nach Russland zurückgegangen. Aber er habe der Mutter ein Geschenk machen wollen und hätte für sie das Strohkörbchen gebastelt. Das Wort Krieg fiel nicht und schon gar nicht das Wort Kriegsgefangener. Nur eine der Schwestern erzählte noch, dass dieser Wassil sehr nett gewesen sei, mich häufiger auf seinen Schoß genommen und in einer fremden Sprache gesungen habe. Vorerst war meine Neugier gestillt.
Es folgten in den nächsten Jahren ähnliche zufällige Begebenheiten, die dem Heranwachsenden zeigten, dass da etwas geschehen sein musste, über das die Erwachsenen und Halberwachsenen nicht sprechen wollten oder konnten. So war es denn mehr oder weniger zufällig oder beiläufig, dass es konkreter wurde, dass sich Begriffe herausschälten und Wörter, die sich allmählich mit Inhalt füllten. Ein gelbbraunes Hemd eines Bruders in der Wäschetruhe führte dazu, dass ich erfuhr, was ein Soldat war, nämlich jemand der gegen Feinde gekämpft hatte, so wie mein ältester Bruder, der aber dann Heiligabend 1945, als ich zweieinhalb Jahre alt war, überraschend aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen war, alles sehr spannend und fast abenteuerlich für einen etwa zehnjährigen Jungen.
Er erfuhr auch, dass die liebe Oma H. und ihre Tochter, die in unserm Haus gewohnt hatten, jetzt wieder in einer Stadt am Niederrhein wohnten (1966 besuchte ich sie in ihrer Heimatstadt Emmerich). Und warum hatten sie im Dorf gewohnt? Die Flieger (vielleicht fielen auch Wörter wie Tommys oder Amis) sind über ihre Stadt geflogen und haben alle Häuser kaputt gemacht und deswegen mussten sie bei uns wohnen (erst später habe ich erfahren, dass noch eine zweite Familie in unserem Haus gewohnt hatte, die man als Evakuierte bezeichnete). Der Kontakt zur Oma H. und ihrer Tochter blieb bis zu ihrem Tod erhalten.
Abb. 5: Der älteste Bruder als Soldat Anfang 1945
Sehr berührt hat es mich, als ich 1953 erfuhr, dass die Schwester des Vaters, meine Tante, 1944 bei einer Panik im Luftschutzbunker zusammen mit ihrer zehnjährigen Tochter, also meiner Kusine, ums Leben gekommen war. Es wurde aber in der Familie nicht weiter thematisiert.
Seit Beginn der Schulzeit war für mich der Begriff Flüchtling alltäglich. Mehrere meiner Klassenkameraden nannte man so. Ich kannte ihre Eltern oder Mütter (häufig waren es Alleinerziehende) und erfuhr, was das Wort bedeutete. Sie waren von weit her gekommen, mussten ihre Häuser verlassen, weil Krieg war und dann andere Menschen ihre Häuser bewohnten. Auch die Eltern und andere Erwachsene sprachen über die Flüchtlinge, die in großer Zahl jetzt im Dorf wohnten; dass sie erbärmlich wohnen mussten, fiel einem Kind noch nicht auf. Aber dass sie von manchem nicht gut gelitten waren, konnte auch ein Kind bemerken, wenn abfällig über die Luther’schen (plattdeutsch für: Flüchtlinge protestantischen Glaubens, die von den Katholiken anfangs abgelehnt wurden) geredet wurde.
Im großelterlichen Haus im Nachbardorf lebten zwei Tanten und meine gleichaltrige Kusine, aber es gab dort keinen Mann, der Vater meiner Kusine war. Auch Flüchtlinge wohnten im Haus. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum ersten Mal das Wort Gefallener hörte und dann auch erklärt bekam. Der Vater meiner Kusine war 1941 in Russland gefallen, d. h. als Soldat gestorben. Als ich das dann begriffen hatte, hatte ich mit meiner Tante und meiner Kusine großes Mitleid. Ich hatte also noch einen Onkel, den ich aber nie kennenlernen konnte.
Ein gleiches Schicksal musste die Mutter meines besten Freundes erleiden. Auch sie war Witwe und jeden Abend saß sie in der Küche und hörte die Nachrichten des Roten Kreuzes im Radio, in denen immer die Namen der Gefallenen oder der in Gefangenschaft geratenen und der vermissten Soldaten durchgegeben wurden. Der Name ihres Mannes war nie darunter. Es war immer eine sehr gedrückte Stimmung im Haus, die wir als Kinder spürten. Aber jetzt hatten sich die Wörter Gefangene, Gefallene und Vermisste mit Inhalt gefüllt. Dass immer der Krieg verantwortlich war, stand nunmehr außer Frage.
Ebenso war dieser Krieg auch dafür verantwortlich, dass häufig Soldaten aus England, später auch aus Belgien im Dorf und in der Umgebung zu Manövern anrückten, mit Panzern und schweren Fahrzeugen und manchmal auch mit gutschmeckenden Wurst-Konserven oder Süßigkeiten, die wir gegen Eier einhandelten, die wir aus heimischen Nestern entwendeten. Klingt nach Abenteuer, war es auch für jetzt bereits Jugendliche. Näheres über den Krieg erfuhren wir aber aus den Mündern von Erwachsenen in dieser Zeit noch nicht und es war auch in späteren Jahren, über die zu berichten ist, ein sehr schwieriges und für die Erwachsenen sperriges Thema oder es wurde zu Landser-Romantik heruntergelogen.
Überraschende Wendung
Für den Elfjährigen erfolgt 1954/55 eine tiefgreifende Zäsur. Der Leser wird in Erinnerung behalten haben, dass 1953 im Dorf eine Volksmission abgehalten worden war. Als Nachgang kam 1954 ein Pater dieses Missionsordens als Vertretung für den erkrankten Pfarrer ins Dorf. Ich ging in die fünfte Klasse und fand den Pater großartig, ein richtiger Begeisterer (Motivator würde man heute sagen) und Menschenfischer, der sogar zaubern konnte. Und er fischte Ordensnachwuchs, was ich natürlich nicht wissen konnte. Er erzählte großartige und abenteuerliche Geschichten von mutigen Missionaren, die den armen Heidenkindern in fernen Ländern die Frohe Botschaft von Jesus Christus brachten und sie zu Christen und damit Gotteskindern machten. Das war meine Sache. Ich ging zu ihm und er erzählte mir, wie man solch ein Missionar werden konnte: Du kommst in unser Juvenat nach Bonn, gehst dort auf das Ordensgymnasium, machst Abitur, studierst Theologie und dann wirst du zum Priester geweiht und kannst als Missionar nach Indonesien gehen und den Menschen dort die frohe Botschaft verkünden.
Wie sollte ich das meinen Eltern, vor allem meinem Vater erklären, der meinen Wunsch, das Gymnasium in der Nachbarstadt zu besuchen, bisher abgelehnt hatte, weil das zu teuer erschien. Pater B. übernahm diese Aufgabe für mich. Später habe ich erfahren, welcher Überredungskünste es bedurft hatte, aber so wurde die Sache beschlossen: der Junge geht zum Schuljahr 1955 nach Bonn auf das Gymnasium Collegium Josephinum der Redemptoristen und lebt dort im Juvenat, so nannte sich nämlich das Internat des Ordens (Juvenat heißt Jungenwohnhaus). Die zweitägige Aufnahmeprüfung für das Gymnasium hatte ich in Bochum abzulegen, wohin mich meine Mutter begleitete und mit mir bei Verwandten übernachtete.
Nie habe ich erfahren, wie die Kosten für Schule und Internat aufgebracht wurden. Ich habe auch nicht gefragt. Aber meine Übersiedlung nach Bonn ist schon eine berichtenswerte Odyssee, vielleicht einmalig, und sie sagt etwas über die Menschen und die Verhältnisse dieser Zeit aus. Mein Vater sah sich nach einer kostengünstigen Transportmöglichkeit um. Er war befreundet mit dem Müller des Dorfes, der jede Woche eine LKW-Ladung Mehl nach Köln lieferte. Mit diesem wurde verabredet, dass meine Eltern und ich im Führerhaus des Lastwagens mitfahren würden bis zum Hauptbahnhof Köln. Vier Personen saßen vorn, beengt, aber ohne Klagen, auf der Ladefläche meine Utensilien, zwei Koffer und das Bettzeug.
Der Fahrer hielt direkt vor dem Bahnhof am Kölner Dom, den ich mit ungeheurer Faszination anstarrte, und dann ging‘s zum Zug, der uns nach Bonn brachte. Ich kann mir die mitleidigen Blicke der anderen Bahnreisenden heute gut vorstellen und muss lächeln. Am Nachmittag kamen wir im Juvenat an, es gab Kakao mit Butterbroten, dann folgte der erste Rundgang für die Eltern, dann der tränenreiche Abschied, dann begannen das Schul- und das Juvenatsleben als Sextaner.
Juvenat
Das erste Heftchen, welches wir in die Hand bekamen, war schwarz eingebunden und hieß: Das Grundgesetz des Juvenates. Es war Pflichtlektüre und wurde in der ersten Zeit ausgiebig erläutert. Es war eine sehr strenge, starre Hausordnung und eine Anleitung zu frommen Übungen für die Vorbereitung auf den Priester- und Ordensberuf. Darüber gab es von Beginn an keinen Zweifel. Ich zitiere den Kernsatz: »Es ist für uns eine besondere Gnade, dass unsere Obern, Erzieher und Lehrer Priester sind. Sie sind nach unseren Eltern unsere gottgewollten Vorgesetzten, Gottes Stellvertreter, mit seiner Autorität ausgestattet, die wir widerspruchslos anerkennen.« Mitdenken muss man das christliche Gottesbild: allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Da ist Unterwerfung selbstverständlich.
Dann lernten wir den Organisationsrahmen des Hauses kennen. Es gab drei (später vier) nach Klassen gestaffelte Juvenatsgruppen: Untergruppe — Sexta, Quinta, Quarta, (die Gruppe wurde ab 1957 geteilt); Mittelgruppe — Untertertia, Obertertia, Untersekunda; Obergruppe — Obersekunda, Unterprima, Oberprima. Die Untergruppe war in einem Schlafsaal untergebracht, der ca. fünfzig Jungen fasste, in der Mitte abgetrennt zum ebenso großen Saal der Mittelgruppe durch die Waschbecken. Alles war offen und gut einzusehen. Jede Klasse hatte einen Studiensaal, der am Vormittag gleichzeitig Unterrichtsraum war und in dem dann bis zu dreißig Schüler saßen. Etwa ein Drittel davon waren externe Schüler aus Bonn und Umgebung. Für nachmittags und abends gab es mehrere Spielezimmer. Gegessen wurde im großen Gemeinschaftsspeisesaal, der nach einem Umbau verlegt und in kleinere Gruppenräume unterteilt wurde. Draußen lag ein großer Sportplatz. Außerdem stand eine Aula zur Verfügung, die auch für den Sport, für Theateraufführungen und Filmvorführungen genutzt wurde. Am wichtigsten aber waren die große und die kleine Hauskapelle für den täglichen Gottesdienst am Morgen und tägliche Gebetsfeiern am Abend und es gab die ständige Aufforderung oder Ermahnung, dort auch immer wieder zu privaten Gebeten (oder Beichten) einzukehren, eben als Gottes-Kadett, wie ich es heute nenne. Ein Hochwürden, das war die übliche Anrede der Patres, war nie weit, das System war hierarchisch aufgebaut und die Kontrolle war (fast) lückenlos, auch durch ältere, dazu beauftragte Juvenisten.
Ein normaler Tagesablauf sah für einen Untergruppen-Juvenisten so aus: 6.00 Uhr: Wecken, Waschen, Ankleiden; 6.30 Uhr: Gottesdienst, danach Frühstück, 7.30 Uhr: Vorbereitung auf den Unterricht; 8.00 Uhr: Unterrichtsbeginn; 10.00 Uhr: Pausenbrot in der Schulpause im Foyer der Schule; 13.30 Uhr: Mittagessen mit Lesung und unter striktem Silentium, 14.00 bis 15.00 Uhr: Studienzeit im Studiensaal, striktes Silentium unter Aufsicht eines Altjuvenisten (Name: Custos (lat.)= Wächter); 15.00 bis 16.30 Uhr: Spielfreizeit, bei guter Witterung draußen, anschließend ggf. Umkleiden (Silentium!); 17.00 Uhr: Rosenkranzgebet (dabei mit dem Rosenkranz einzeln über die Flure wandelnd wie Mönche unter strengstem Silentium); 17.30 Uhr: allgemeiner Reinigungsdienst in zugeteilten Revieren unter Leitung eines Altjuvenisten; 18.00 Uhr: Abendbrot, danach Freizeit (Spiele, Lesen, Studium nach eigenem Gusto; 20.30 Uhr: Abendgebet (oft als Komplet, ein lateinisch gesungenes Gebet) in der Kapelle; 21.00 Uhr (bzw. 21.30 Uhr im Sommer): Bettruhe (zuvor am Bett kniend das Nachtgebet murmelnd) mit absolutem Silentium unter Aufsicht (Custos!). An Sonn- und Feiertagen kamen noch ein zweiter Gottesdienst um 10.00 Uhr und eine Andacht um 14.00 Uhr hinzu.
Alle vier Wochen war am Sonntag ein Ausgang in Gruppen für die Dauer von drei Stunden an den Rhein oder ins Obst-Anbaugebiet, ca. zwei bis drei Kilometer entfernt, vorgesehen, in die Stadt kamen wir nur zum wöchentlichen Schwimmunterricht ins Hallenbad an der Uni, ein kleines Highlight, allerdings immer unter äußerstem Zeitdruck, um keine unziemlichen Gedanken aufkommen zu lassen; dennoch gab‘s am bekannten Kiosk Süßigkeiten zu kaufen, einige sehr mutige Quartaner besorgten sich auch schon mal Zigaretten.
Eine private Sphäre gab es so gut wie nicht, der Briefverkehr unterlag der Kontrolle durch den Präfekten, jedes ankommende Wäschepaket war zu öffnen und wurde kontrolliert, Geld wurde vom Präfekten verwaltet, ein Geschenk der Mutter in Form etwa von einem Glas Konfitüre oder einer Wurst (Hunger hatten wir immer) war abzuliefern und wurde verteilt, was ich aber lieber selbst getan hätte. Die Kleiderschränke wurden ständig kontrolliert, eigene Bücher waren erst nach Genehmigung durch den Präfekten freigegeben, auf den Toiletten und auf dem Schlafsaal galt immer die Schweigepflicht; es gab ein perfektes System von Strafen: Ermahnung und Verwarnung vom Präfekten und (bei schwereren Vergehen) auch vom Pater Direktor, Spielverbot, Ausgehverbot, Leseverbot, verlängerte Studierzeit, Küchenspüldienst oder Kartoffelschäldienst, Brief an die Eltern; aber es wurde auch heftig geprügelt mit schallenden Ohrfeigen bis hin zu Faustschlägen von einem Choleriker, aber es betraf meistens bestimmte Schüler ohne Grund, die armen Prügelknaben, die dann meistens bis zur Quarta wieder Juvenat und Schule verließen, wie auch die Schulversager.
Strengstens untersagt war die sogenannte Partikularfreundschaft (etwa: Einzelfreundschaft) zu einem Mitschüler, bei einem Verdacht schritt man sofort ein. Unterbunden werden sollten wohl homoerotische Umtriebe, die es aber bei pubertierenden Kasernierten trotz göttlicher Totalaufsicht gab. Jeder vernünftige Umgang mit Mädchen war untersagt, sollte unterbunden werden bei den Ausgängen, ließ sich aber nicht vollständig unterbinden, was dann peinliche Befragungen nach sich zog, wenn es herauskam. Solche Verhöre gab es auch nach den Ferienaufenthalten.
Am schlimmsten fand ich es aber, dass man jedem Juvenisten beim Eintritt ein Versprechen, quasi ein Gelübde abnahm, dass er den Priester- und Ordensberuf anstreben wollte.
Abb. 6: Untergruppe des Juvenats 1955 – Gerd als Sextaner, erste Reihe siebter von links
Heute nenne ich es pervers, weil es das Gewissen der Jungen belastete.
Ich verließ am Ende der Quarta das Juvenat und das Gymnasium auf eigenen Wunsch, ohne Not, aber aus Abneigung gegenüber dem ständigen Überwachungsdruck, der meinem Freiheitsgefühl immer mehr entgegenstand, wechselte auf das Jesuitengymnasium in meiner Nachbarstadt, die damals noch Kreisstadt war, war dort Externer, also Fahrschüler, genoss die neuen Freiheiten in vollen Zügen und legte dort später das Abitur ab.