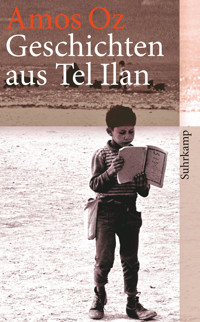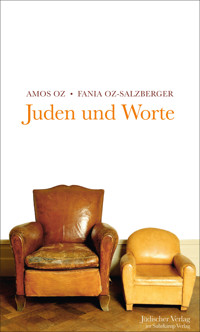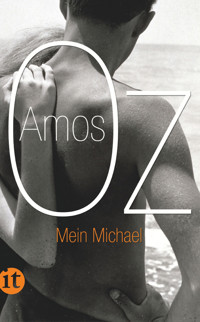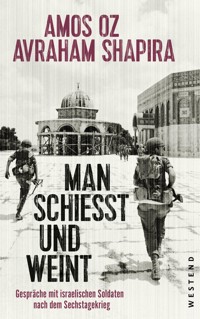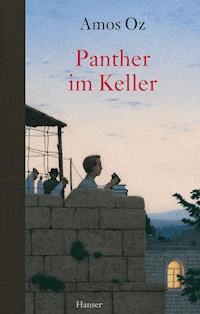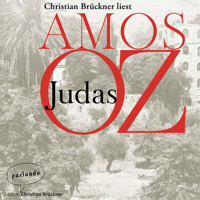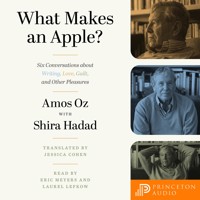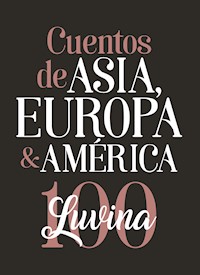14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Bestseller erzählt Amos Oz die Geschichte seiner Familie, voller Zärtlichkeit und Scharfblick. Alles beginnt im Jerusalem der 1940er Jahre, einem Refugium der Juden, die – wie Oz’ Großeltern – vor der antisemitischen Verfolgung fliehen konnten. In der Stadt ringen sie mit ihrer Verzweiflung, hier wächst aber auch ihre gemeinsame Hoffnung auf ein angstfreies Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1144
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Jerusalem der vierziger Jahre ist ein Fluchtpunkt für jene, denen es gelungen ist, den Nazis zu entkommen, und die entschlossen sind, sich nie wieder demütigen zu lassen. Zu ihnen gehören auch Arie und Fania. Ihr Sohn Amos träumt davon, eines Tages wie die Pioniere im Kibbuz zu sein, gelassen und stark. Statt dessen ist der empfindsame Junge mit der Geschichte seiner weitverzweigten, aus Osteuropa geflohenen Verwandtschaft konfrontiert – die von der Furcht vor Mikroben besessene Großmutter Schlomit, der berühmte Gelehrte Onkel Joseph und der so elegante wie lebenslustige Großvater Alexander. Vor allem aber ist es das Schicksal seiner Eltern, das ihn sein Leben lang beschäftigen wird: zwei liebenswürdige Menschen, die einander nur Gutes wünschen und deren Ehe doch in einer Tragödie zu enden droht.
»Ein erhellenderes, klügeres, vielschichtigeres Buch über Israel, über Familien und das, was Menschen zusammenhält und was sie trennt, kann man niemandem empfehlen.« Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
»Ein großartiger und bei aller Trauer und Bedrückung auch heiterer Roman.« Karen Andresen, Spiegel Special
Amos Oz, geboren 1939 in Jerusalem, ist einer der international bekanntesten israelischen Schriftsteller. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1992), dem WELT-Literaturpreis (2004) und dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt (2005). Zuletzt erschien im Suhrkamp Verlag Plötzlich tief im Wald (2006).
Amos Oz
Eine Geschichte von Liebe und Finsternis
Roman
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Suhrkamp Verlag
Die hebräische Originalausgabe Ssipur al ahava we-choschech erschien 2002 im Keter Verlag, Jerusalem.
© Amos Oz 2002
Umschlagfoto: Leonard Freed/Magnum Photos/Agentur Focus
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73920-4
www.suhrkamp.de
1
Geboren und aufgewachsen bin ich in einer kleinen, niedrigen Erdgeschoßwohnung von etwa dreißig Quadratmetern. Meine Eltern schliefen auf einem Bettsofa, das abends, wenn es ausgezogen war, das Zimmer fast von Wand zu Wand ausfüllte. Frühmorgens schoben sie dieses Sofa wieder völlig in sich zusammen, verbargen das Bettzeug im Unterkasten, klappten die Matratze zurück, zurrten alles fest, breiteten einen hellgrauen Überwurf über das Ganze und streuten ein paar bestickte orientalische Kissen darüber, so daß jedes Indiz ihres nächtlichen Schlafes beseitigt war. So diente ihr Schlafzimmer auch als Arbeitszimmer, Bibliothek, Eßzimmer und Wohnzimmer.
Ihm gegenüber lag mein grünliches Zimmerchen, dessen eine Hälfte von einem dickbauchigen Kleiderschrank eingenommen wurde. Ein dunkler, schmaler, niedriger, etwas verwinkelter Flur, ähnlich einem Fluchttunnel aus dem Gefängnis, verband die winzige Küche, den engen Bad- und Toilettenraum und die beiden kleinen Zimmer miteinander. Eine schwache Birne, im eisernen Käfig gefangen, beleuchtete diesen Flur selbst tagsüber nur dürftig. Nach vorn gab es nur ein Fenster im Zimmer meiner Eltern und eines in meinem, beide geschützt von eisernen Läden, beide bemüht, durch blinzelnde Ladenritzen nach Osten zu schauen, zu sehen war aber nur eine verstaubte Zypresse und eine niedrige Mauer aus unbehauenen Steinen. Durch vergitterte Fensterchen spähten Küche und Bad in einen kleinen, von hohen Mauern umgebenen Gefängnishof, einen Hof, auf dem eine bleiche Geranie in einem rostigen Olivenkanister ohne einen einzigen Sonnenstrahl dahinstarb. Auf den Fensterbänken dieser Luken standen bei uns immer Gläser mit eingelegten Gurken und auch ein verbitterter Kaktus in einer gesprungenen und daher zum Blumentopf umfunktionierten Vase.
Es war eigentlich eine Kellerwohnung, denn man hatte das Erdgeschoß des Gebäudes in einen Berghang gehauen. Dieser Berg war unser Nachbar jenseits der Wand – ein schwerer, in sich gekehrter und leiser Nachbar, ein alter und melancholischer Berg mit festen Junggesellengewohnheiten, ein schläfriger, ein winterlicher Berg, nie rückte er Möbel, nie empfing er Besucher, nie lärmte, nie störte er, aber durch die ihm und uns gemeinsamen Wände sickerten immer, wie leichter, hartnäckiger Moderhauch, die Kälte, die Dunkelheit, die Stille und die Feuchtigkeit dieses schwermütigen Nachbarn zu uns.
So hielt sich bei uns den ganzen Sommer lang ein wenig der Winter.
Gäste sagten: Es ist so angenehm bei euch an einem glühendheißen Tag, so kühl und angenehm, richtig frisch, doch wie kommt ihr im Winter zurecht? Lassen diese Wände keine Feuchtigkeit durch? Ist es nicht etwas bedrückend?
Bücher füllten bei uns die ganze Wohnung. Mein Vater konnte sechzehn oder siebzehn Sprachen lesen und elf sprechen (alle mit russischem Akzent). Meine Mutter sprach vier oder fünf Sprachen und konnte sieben oder acht lesen. Sie unterhielten sich auf russisch oder polnisch, wenn ich nichts verstehen sollte. (Und die meiste Zeit wollten sie, daß ich nichts verstand. Als Mutter einmal versehentlich in meiner Gegenwart »Zuchthengst« auf hebräisch sagte, rügte Vater sie verärgert auf russisch: Schto s toboj?! Widisch maltschik rjadom s nami! Was ist denn mit dir los?! Siehst du nicht, daß der Junge dabei ist!) Aus kulturellen Erwägungen heraus lasen sie vorwiegend Bücher auf deutsch oder englisch, und ihre nächtlichen Träume träumten sie sicherlich auf jiddisch. Aber mich lehrten sie einzig und allein Hebräisch. Vielleicht fürchteten sie, Fremdsprachenkenntnisse könnten auch mich den Verlockungen des wunderbaren und tödlichen Europa aussetzen.
Auf der Werteskala meiner Eltern galt: je westlicher, desto kultivierter. Tolstoj und Dostojewski standen ihrer russischen Seele nahe, und doch vermute ich, Deutschland erschien ihnen – trotz Hitler – kultivierter als Rußland und Polen, während Frankreich wiederum Deutschland übertraf. Und England stand für sie sogar noch höher als Frankreich. Was Amerika anging, da waren sie sich nicht so sicher: Dort schoß man schließlich auf Indianer, überfiel Postzüge, ergab sich dem Goldrausch und jagte Mädchen nach.
Europa war ihnen ein verbotenes verheißenes Land, ein Sehnsuchtsort – mit Glockentürmen und kopfsteingepflasterten alten Plätzen, mit Straßenbahnen und Brücken und Kathedralen, mit entlegenen Dörfern, Heilquellen, Wäldern, Schnee und Auen.
Die Worte »Aue«, »Bauernkate«, »Gänsehirtin« hatten meine ganze Kindheit lang etwas Lockendes und Erregendes für mich. Es war in ihnen der sinnliche Duft einer echten Welt, einer sorglosen Welt, fern der staubigen Wellblechdächer und der mit Schrott und Disteln übersäten Brachflächen und der ausgedorrten Hänge Jerusalems, das unter der Last der weißglühenden Hitze fast erstickte. Ich brauchte nur leise »Aue« vor mich hin zu sagen – und schon hörte ich das Muhen von Kühen, die kleine Glocken um den Hals trugen, und das Plätschern der Bäche. Wenn ich die Augen schloß, sah ich die barfüßige Gänsehirtin, beinahe wären mir die Tränen gekommen, so sexy erschien sie mir, noch bevor ich irgend etwas wußte.
Jahre später erfuhr ich, daß das Jerusalem der zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts, das Jerusalem der britischen Mandatszeit, eine faszinierende Kulturstadt gewesen war. Großkaufleute, Musiker, Gelehrte und Schriftsteller lebten dort: Martin Buber, Gershom Scholem, S. J. Agnon und viele andere berühmte Forscher und Künstler. Manchmal, wenn wir die Ben-Jehuda-Straße oder die Ben-Maimon-Allee entlanggingen, flüsterte Vater mir zu: »Schau, dort geht ein Gelehrter von Weltruf.« Ich wußte nicht, was er meinte. Ich dachte, Weltruf habe etwas mit kranken Beinen zu tun, denn häufig war es ein alter Mann, der sich unsicheren Schrittes an einem Stock vorantastete und auch im Sommer einen dicken wollenen Anzug trug.
Das Jerusalem, nach dem sich meine Eltern sehnten, lag fernab unseres Viertels: in Rechavia, durchflutet von Grün und Klavierklängen, in drei oder vier Cafés mit goldfunkelnden Kronleuchtern in der Jaffa- und der Ben-Jehuda-Straße, in den Hallen des YMCA und im King David Hotel, wo sich kulturliebende Juden und Araber mit kultivierten Briten trafen, wo verträumte, langhalsige Damen in Abendkleidern am Arm von Herren in dunklen Anzügen dahinschwebten, wo vorurteilslose Briten mit gebildeten Juden oder Arabern dinierten, wo Konzerte, Bälle, literarische Abende, Tanztees und feinsinnige Kunsterörterungen stattfanden. Möglicherweise existierte dieses Jerusalem mit Kronleuchtern und Tanztees ja auch nur in den Träumen der Bibliothekare, Lehrer, kleinen Angestellten und Buchbinder, die in Kerem Avraham lebten. Bei uns jedenfalls fand es sich nicht. Unser Viertel, Kerem Avraham, gehörte Tschechow.
Jahre später, als ich Tschechow (in hebräischer Übersetzung) las, war ich überzeugt, er sei einer von uns: Onkel Wanja wohnte ja direkt über uns, Doktor Samoilenko beugte sich über mich und tastete mich mit seinen breiten, starken Händen ab, wenn ich an Angina oder Diphtherie erkrankt war, Lajewski mit der ewigen Migräne war ein Vetter zweiten Grades meiner Mutter, und Trigorin hörten wir am Schabbatmorgen bei der Matinee im Bet Ha’am, im Haus des Volkes.
Wir waren von Russen unterschiedlicher Provenienz umgeben: Es gab viele Tolstojaner. Einige sahen sogar genauso aus wie Tolstoj. Als ich Tolstojs sepiabraunes Portrait auf der Rückseite eines Buchumschlags zum ersten Mal erblickte, war ich sicher, ihn schon oft in unserer Nachbarschaft gesehen zu haben: in der Malachi- oder Ovadja-Straße, barhäuptig, mit wehendem weißen Bart und funkelnden Augen, ehrfurchtgebietend wie unser Stammvater Abraham, in der Hand eine Rute, die ihm als Gehstock diente, das über die weite Hose fallende Bauernhemd mit einem groben Strick gegürtet.
Die Tolstojaner unseres Viertels (meine Eltern nannten sie Tolstojschtschiks) waren ausnahmslos alle fanatische Vegetarier, Weltverbesserer, Moralapostel, Freunde der Menschheit, Freunde eines jeden Lebewesens, von tiefem Naturempfinden durchdrungen, und sie alle sehnten sich nach dem Landleben, einem einfachen und reinen Leben der Arbeit auf Feldern und in Obstgärten. Aber nicht einmal ihre bescheidenen Topfpflanzen wollten unter ihren Händen gedeihen: Vielleicht gossen und gossen sie, bis die Pflanzen verfaulten, vielleicht vergaßen sie zu gießen, oder vielleicht war es auch die Schuld der heimtückischen britischen Mandatsmacht, die unserem Wasser Chlor zusetzte.
Einige der Tolstojaner schienen geradewegs aus einem Roman von Dostojewski entstiegen: gepeinigt, redselig, von unterdrückten Leidenschaften und Ideen verzehrt. Aber alle, Tolstojaner wie Dostojewskianer, ja, alle im Viertel Kerem Avraham arbeiteten eigentlich bei Tschechow.
Der Rest der Welt hieß bei uns gewöhnlich »die ganze Welt«, aber sie hatte auch andere Namen: die aufgeklärte Welt, die freie Welt, die scheinheilige Welt, die Außenwelt. Ich kannte sie fast nur aus meiner Briefmarkensammlung: Danzig, Böhmen und Mähren, Bosnien und Herzegowina, Ubangi-Schari, Trinidad und Tobago, Kenia-Uganda-Tanganjika. Die Ganzewelt war fern, anziehend, wunderbar, aber sehr gefährlich und uns feindlich gesinnt: Sie mochte die Juden nicht, weil sie klug, scharfsinnig und erfolgreich waren, aber auch lärmend und vorwitzig. Sie liebte unser Aufbauwerk hier im Lande Israel nicht, weil sie uns sogar dieses Fleckchen Sumpf-, Fels- und Wüstenland nicht gönnte. Dort draußen in der Welt waren alle Wände mit Schmähparolen bedeckt: »Itzig, geh nach Palästina!« Und nun, da wir nach Palästina gegangen waren, schrie die Ganzewelt uns zu: »Itzig, raus aus Palästina!«
Nicht nur die Ganzewelt, sondern sogar Erez Israel, das Land Israel, war fern. Irgendwo dort, hinter den Bergen und in weiter Ferne, wuchs ein neuer Stamm von heldenhaften Juden heran: braungebrannt, kräftig, schweigsam und sachlich, ganz anders als die Diasporajuden, ganz anders als die Menschen in Kerem Avraham. Mutige und starke Pioniere und Pionierinnen, denen es gelungen war, sich das Dunkel der Nacht zum Freund zu machen, die auch in der Beziehung des Mannes zur Frau und in der Beziehung der Frau zum Mann schon alle Grenzen überschritten hatten. Keine Scham kannten. Großvater Alexander sagte einmal: »Sie glauben, künftig wird alles ganz einfach sein: Der junge Mann kann einfach zur jungen Frau hingehen und es von ihr erbitten, oder vielleicht werden die Frauen nicht einmal mehr auf die Bitten der Männer warten, sondern werden es selbst von ihnen erbitten, wie man um ein Glas Wasser bittet.« Der kurzsichtige Onkel Bezalel erklärte mit höflich gezügelter Wut: »Aber das ist doch der reinste Bolschewismus, derart alles Geheimnisvolle und Mysteriöse zu zerstören?! Derart alles Gefühl zu beseitigen?! Derart unser ganzes Leben in ein Glas lauwarmes Wasser zu verwandeln?!« Onkel Nechemja schmetterte in seiner Ecke urplötzlich ein paar Liedzeilen, die sich für mich wie das Brüllen eines in die Enge getriebenen Tieres anhörten: »Oj, so weit, so weit ist der Weg und gewunden der Pfad, oj Mamme, ich bin auf dem Weg, aber du bist so fern, der Mond sogar scheint mir näher!« Und Tante Zippora sagte, auf russisch: »Nu, genug. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Das Kind hört doch zu!« Und damit gingen alle zum Russischen über.
Jene Pioniere lebten jenseits unseres Horizonts, in Galiläa, in der Scharon-Ebene, in den fruchtbaren Tälern: kräftige junge Männer, warmherzig, doch schweigsam und nachdenklich, und starke junge Frauen, offenherzig und selbstbeherrscht, die alles zu kennen und zu verstehen schienen, auch dich und all deine Verlegenheiten, dich aber trotzdem freundlich und respektvoll behandelten, nicht als Kind, sondern als richtigen, wenn auch noch kleinen Mann.
Jene Pionierinnen und Pioniere waren in meiner Vorstellung stark, ernsthaft und verschwiegen, sie vermochten in ihrer Runde Lieder von herzzerreißender Sehnsucht anzustimmen, auch Lieder voller Witz und Lieder voller unerhörter Lust, sie vermochten stürmisch, nahezu schwerelos zu tanzen, sie waren fähig zur Einsamkeit und zur Nachdenklichkeit, zum Leben in der Natur und in Zelten, zu jeder schweren Arbeit. »Stets zu Befehl stehen wir.« »Den Frieden des Pfluges brachten dir deine jungen Männer, heute bringen sie dir Frieden mit dem Gewehr!« »Wohin man uns schickt – dorthin gehen wir.« Sie vermochten wilde Pferde zu reiten und breitraupige Traktoren zu fahren, sie waren des Arabischen kundig, sie kannten jede Höhle und jedes Wadi, sie konnten mit Pistolen und Handgranaten umgehen, und zugleich lasen sie Gedichte und philosophische Schriften. Voller Wißbegier und verborgener Gefühle saßen sie beim Kerzenschein in ihren Zelten und sprachen bis in die frühen Morgenstunden leise über den Sinn unseres Lebens und die schmerzhafte Wahl zwischen Liebe und Pflicht, nationalem Interesse und universaler Gerechtigkeit.
Manchmal ging ich mit Freunden zum Anlieferungshof der Agrargenossenschaft Tnuva, um zu sehen, wie sie von jenseits der Berge kamen, mit einem Laster voll landwirtschaftlicher Erzeugnisse, »in Staub gehüllt, in Waffen und in schweren Schuhen«, und trieb mich in ihrer Nähe herum, um Heugeruch einzuatmen und mich an den Düften ferner Orte zu berauschen: Dort, bei ihnen, dachte ich, ereignen sich die wirklich großen Dinge. Dort baut man das Land auf und verbessert die Welt, dort läßt man eine neue Gesellschaft erblühen, dort drückt man der Natur und dem Gang der Geschichte seinen Stempel auf, dort pflügt man die Felder und legt Weinberge an, dort entsteht ein neuer Gesang, dort reitet man bewaffnet auf dem Rücken der Pferde und erwidert mit Feuer das Feuer der arabischen Angreifer, dort verwandelt man armseligen menschlichen Staub in eine kampfbereite Nation.
Ich träumte insgeheim, sie würden eines Tages auch mich mitnehmen. Würden auch mich in kampfbereite Nation verwandeln. So daß auch mein Leben zu einem neuen Gesang würde, ein Leben so rein und einfach wie ein Glas kaltes Wasser an einem heißen Tag.
Hinter den Bergen und in weiter Ferne lag auch die Stadt Tel Aviv, ein aufregender Ort. Von dort aus erreichten uns die Zeitungen, die Gerüchte von Theater, Oper, Ballett, Kabarett und moderner Kunst, die Parteienpolitik, das Echo stürmischer Debatten und auch verschwommener Klatsch und Tratsch. Große Sportler gab es dort in Tel Aviv. Und es gab dort das Meer, und das ganze Meer war voller braungebrannter Juden, die schwimmen konnten. Wer konnte denn in Jerusalem schon schwimmen? Wer hatte überhaupt je von schwimmenden Juden gehört? Das waren völlig andere Gene. Eine Mutation. »Wie das Wunder der Geburt des Schmetterlings aus der Raupe.«
Es lag ein geheimer Zauber in dem Wort »Tel Aviv«. Sobald ich es hörte, sah ich sofort das Bild eines kräftigen jungen Mannes in blauem Trägerhemd vor mir, braungebrannt und breitschultrig, ein Dichter-Arbeiter-Revolutionär, ein furchtloser Bursche, ein richtiger chevremann, ein prima Kumpel, die Schirmmütze lässig-keck auf den Locken, Zigaretten Marke Matossian rauchend, völlig zu Hause in der Welt: Den ganzen Tag schuftete er beim Fliesenlegen oder Kiesschaufeln, am Abend spielte er Geige, nachts tanzte er mit jungen Frauen oder sang ihnen gefühlvolle Lieder in den Dünen im Vollmondschein vor, und im Morgengrauen zog er eine Pistole oder eine Sten aus dem Waffenversteck und schlüpfte ins Dunkel hinaus, um Häuser und Felder zu schützen.
Wie fern Tel Aviv war! Meine ganze Kindheit über war ich nicht mehr als fünf- oder sechsmal in Tel Aviv: Wir verbrachten gelegentlich die Feiertage bei meinen Tanten, den Schwestern meiner Mutter. Nicht nur unterschied sich das Licht in Tel Aviv damals noch mehr vom Jerusalemer Licht als heute – auch die Schwerkraftgesetze waren völlig andere. In Tel Aviv hatten die Leute einen anderen Gang: Sie hüpften und schwebten, wie Neil Armstrong auf dem Mond.
Bei uns in Jerusalem ging man immer ein wenig wie ein Trauernder bei einer Beerdigung oder wie jemand, der verspätet einen Konzertsaal betritt. Zunächst setzt man tastend die Schuhspitze auf, um vorsichtig das Terrain zu sondieren. Hat man den Fuß jedoch erst einmal aufgesetzt, hebt man ihn nicht so schnell wieder: Nach zweitausend Jahren haben wir in Jerusalem endlich einen Fuß auf den Boden bekommen, das setzt man nicht gleich wieder aufs Spiel. Kaum heben wir den Fuß, kommt sofort ein anderer und nimmt uns unser Fleckchen Boden weg. Andererseits, wenn man den Fuß schon mal gehoben hat, sollte man ihn nicht übereilt wieder aufsetzen: Wer weiß, was für ein Schlangennest voll Widersachern dort lauert. Schließlich haben wir Tausende von Jahren einen blutigen Preis für unsere leichtsinnige Hast bezahlt, wieder und wieder sind wir Feinden und Hassern in die Hände gefallen, weil wir unseren Fuß aufgesetzt haben, ohne zu prüfen, wohin. Das ungefähr war die Jerusalemer Gangart. Aber in Tel Aviv!!! Die ganze Stadt war ein einziger Grashüpfer. Die Menschen sprangen vorbei und die Häuser und die Straßen und die Plätze und der Meereswind und die Dünen und die Alleen und sogar die Wolken am Himmel.
Einmal kamen wir zum Sederabend nach Tel Aviv. Am nächsten Morgen, als alle noch schliefen, zog ich mich an, verließ das Haus und ging allein zum Spielen auf einen kleinen Platz – ein oder zwei Bänke, eine Schaukel, ein Sandkasten und drei, vier junge Bäumchen, auf denen schon Vögel zwitscherten. Ein paar Monate später, an Rosch Haschana, fuhren wir wieder nach Tel Aviv, und da war der Platz nicht mehr da. Man hatte ihn mit den Bäumchen, mit den Vögeln, mit dem Sandkasten, mit der Schaukel und mit den Bänken ans andere Ende der Straße verlegt. Ich war verblüfft: verstand nicht, wie Ben Gurion und die zuständigen Institutionen so etwas zulassen konnten. Wie konnte einfach jemand plötzlich einen Platz nehmen und woanders hinsetzen? Was denn, würde man als nächstes den Ölberg versetzen? Den Davidsturm? Die Klagemauer?
Über Tel Aviv sprach man bei uns in Jerusalem mit Neid und Hochmut, Bewunderung und einer Spur Geheimnistuerei – als wäre Tel Aviv ein lebenswichtiges Geheimprojekt des jüdischen Volkes, ein Projekt, über das man besser nicht zu viele Worte verlor: Denn die Wände haben Ohren, und hinter jeder Ecke lauern feindliche Spione und Agenten.
Tel Aviv: Meer. Licht. Azur. Sand, Baugerüste, Kioske in den Alleen, eine hebräische Stadt, weiß und geradlinig, wächst zwischen Orangenhainen und Sanddünen heran. Nicht einfach ein Ort, zu dem du dir einen Fahrschein löst und mit dem Egged-Bus fährst, sondern ein anderer Kontinent.
Jahrelang hatten wir ein festes Arrangement für die Telefonverbindung mit der Familie in Tel Aviv. Alle drei oder vier Monate riefen wir sie an, obwohl weder wir noch sie Telefon hatten. Als erstes schrieben wir einen Brief an Tante Chaja und Onkel Zvi, um ihnen mitzuteilen: Am 19. des Monats, das ist ein Mittwoch, und mittwochs hat Zvi ja schon um drei Uhr Dienstschluß bei der Krankenkasse, rufen wir um fünf Uhr nachmittags von unserer Apotheke in eurer Apotheke an. Der Brief wurde lange im voraus abgeschickt, und dann warteten wir auf Antwort. In dem Antwortbrief versicherten uns Tante Chaja und Onkel Zvi, Mittwoch, der 19., sei ihnen sehr recht, und sie würden selbstverständlich kurz vor fünf Uhr in der Apotheke sein, aber wir sollten uns keinerlei Sorgen machen, falls es bei uns etwas nach fünf würde, sie liefen bestimmt nicht weg.
Ich weiß nicht mehr, ob wir für den Gang zur Apotheke, zu Ehren des Telefongesprächs nach Tel Aviv, unsere besten Kleider anzogen, aber es würde mich nicht wundern. Es war ein feierliches Unternehmen. Schon am Sonntag davor sagte Vater zu Mutter: Fania, denkst du daran, daß wir diese Woche in Tel Aviv anrufen? Am Montag sagte Mutter: Arie, komm übermorgen bitte nicht zu spät nach Hause, damit nichts schiefgeht. Und am Dienstag sagten beide zu mir: Amos, bereite uns bloß keine Überraschung, werde uns nicht krank, hörst du, erkälte dich nicht und fall nicht hin bis morgen nachmittag. Am Dienstag abend sagten sie zu mir: Geh früh schlafen, damit du morgen am Telefon in Form bist. Du sollst dich nicht so anhören, als hättest du nicht genug gegessen.
So steigerten sie die Erregung. Wir wohnten in der Amos-Straße, und bis zur Apotheke in der Zefanja-Straße waren es zu Fuß gerade einmal fünf Minuten, aber schon um drei Uhr sagte Vater zu Mutter: »Bitte, fang jetzt nichts Neues mehr an, damit du nicht in Zeitnot gerätst.«
»Bei mir ist alles in Ordnung, aber du mit deinen Büchern, vergiß es über ihnen nicht völlig.«
»Ich? Vergessen? Ich schaue doch alle paar Minuten auf die Uhr. Und Amos wird mich erinnern.«
Da bin ich gerade einmal fünf oder sechs Jahre alt, und schon wird mir historische Verantwortung auferlegt. Eine Armbanduhr hatte ich nicht, und so rannte ich alle paar Minuten in die Küche, um nachzusehen, was die Uhr zeigte, und dann meldete ich, wie beim Start eines Raumschiffs: noch fünfundzwanzig Minuten, noch zwanzig, noch fünfzehn, noch zehneinhalb Minuten – und wenn ich »noch zehneinhalb Minuten« verkündete, standen wir auf, schlossen die Wohnung sorgfältig ab und machten uns zu dritt auf den Weg – links bis zu Herrn Austers Lebensmittelladen, rechts in die Secharja-Straße, links in die Malachi-Straße, rechts in die Zefanja-Straße, und schon betraten wir die Apotheke und sagten: »Guten Tag, Herr Heinemann, wie geht es Ihnen? Wir sind zum Telefonieren gekommen.«
Er wußte natürlich, daß wir am Mittwoch kommen würden, um die Verwandten in Tel Aviv anzurufen, wußte auch, daß Zvi bei der Krankenkasse arbeitete, Chaja eine wichtige Funktion im Arbeiterinnenrat ausübte, Jigal einmal Sportler werden würde und daß sie eng mit Golda Meyerson, der späteren Golda Meir, und mit Mischa Kolodny, der hier Mosche Kol hieß, befreundet waren, aber trotzdem erinnerten wir ihn: »Wir sind gekommen, um unsere Verwandten in Tel Aviv anzurufen.« Herr Heinemann erwiderte: »Ja, natürlich. Nehmen Sie doch bitte Platz«, und erzählte uns seinen Standardtelefonwitz: Einmal, während des Zionistischen Kongresses in Zürich, schallte plötzlich schreckliches Gebrüll aus einem Nebenraum. Berl Locker fragte Harzfeld, was da los sei, worauf Harzfeld ihm antwortete, der Genosse Rubaschow spreche gerade mit Ben Gurion in Jerusalem. »Spricht mit Jeruschalajim«, staunte Locker, »warum benutzt er dann nicht das Telefon?«
Vater sagte: »Ich wähle jetzt.« Und Mutter sagte: »Es ist noch zu früh, Arie. Es ist ein paar Minuten vor der Zeit.« Worauf er sagte: »Ja, aber bis wir eine Verbindung bekommen.« (Es gab damals noch keine Direktwahl.) Mutter: »Ja, aber was ist, wenn wir zufällig sofort eine Verbindung bekommen, und sie sind noch nicht da?« Vater entgegnete: »In diesem Fall versuchen wir es einfach noch einmal.« Und Mutter: »Nein, sie werden sich Sorgen machen, sie werden meinen, sie hätten uns verpaßt.«
Während sie noch debattierten, war es beinahe fünf Uhr geworden. Vater hob den Hörer ab, im Stehen, und sagte zu der Telefonistin: »Guten Tag, meine Dame. Ich hätte gern Tel Aviv 648.« (Oder so ähnlich: Wir lebten damals noch in einer dreiziffrigen Welt.) Manchmal sagte die Telefonistin: »Bitte warten Sie noch ein paar Minuten, mein Herr, jetzt spricht gerade der Herr Postdirektor.« Oder Herr Siton. Oder Herr Nashashibi. Und wir wurden ein wenig nervös, denn was würde man dort von uns denken?
Ich konnte ihn regelrecht vor mir sehen, diesen einzigen Draht, der Jerusalem mit Tel Aviv verband – und dadurch mit der ganzen Welt –, und wenn diese Leitung besetzt war, waren wir von der Welt abgeschnitten. Dieser Draht schlängelte sich über Ödland und Felsen, zwischen Bergen und Tälern hindurch, und ich hielt das für ein großes Wunder. Und erschauerte: Was, wenn bei Nacht wilde Tiere kommen und den Draht durchbeißen? Oder böse Araber ihn kappen? Oder Regen in ihn einsickert? Oder ein Feuer ausbricht? Wer weiß. Da windet sich dieser dünne, verletzliche Draht, unbewacht, von der Sonne geröstet, wer weiß. Mich erfüllte tiefe Dankbarkeit gegenüber den Leuten, die ihn verlegt hatten, mutigen und geschickten Menschen, denn es war doch nicht so leicht, einen Draht von Jerusalem bis nach Tel Aviv zu spannen. Aus eigener Erfahrung wußte ich, wie schwer sie es gehabt haben mußten: Einmal hatten wir einen Bindfaden von meinem zu Elijahu Friedmanns Zimmer gespannt, gerade einmal zwei Häuser und einen Hof entfernt, einen einfachen Bindfaden, aber es war eine richtige Affäre: Bäume im Weg, Nachbarn, Schuppen, Mauer, Treppenstufen, Sträucher.
Nach kurzem Warten beschloß Vater, daß der Herr Postdirektor oder Herr Nashashibi ihr Gespräch beendet haben mußten, nahm wieder den Hörer auf und sagte zu der Telefonistin: »Entschuldigen Sie, meine Dame, wie mir scheint, hatte ich Tel Aviv 648 verlangt.« Sie sagte: »Ich habe es notiert, mein Herr. Bitte warten Sie.« (Oder: »Bitte fassen Sie sich in Geduld.«) Darauf Vater: »Ich warte, meine Dame, selbstverständlich warte ich, aber auch am anderen Ende warten Menschen.« Das war seine Art, ihr höflich zu bedeuten, daß wir zwar kultivierte Menschen seien, unsere Selbstbeherrschung und Zurückhaltung aber auch ihre Grenzen hätten. Wir waren zwar wohlerzogene Leute, jedoch keine gutmütigen Trottel, keine Lämmer, die sich zur Schlachtbank führen ließen. Diese Geschichte – daß man Juden mißhandeln und mit ihnen verfahren konnte, wie man wollte –, die war ein für allemal vorbei.
Dann klingelte plötzlich das Telefon in der Apotheke. Das war immer ein aufregender Ton, ein magischer Augenblick, und das Gespräch verlief ungefähr so:
»Hallo Zvi?«
»Am Apparat.«
»Hier ist Arie, aus Jerusalem.«
»Ja, Arie, schalom, hier ist Zvi, wie geht es euch?«
»Bei uns ist alles in Ordnung. Wir sprechen von der Apotheke aus mit euch.«
»Wir auch. Was gibt’s Neues?«
»Es gibt nichts Neues. Wie ist es bei euch, Zvi? Was hast du zu erzählen?«
»Alles in Ordnung. Nichts Neues. Man lebt.«
»Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Auch bei uns gibt es nichts Neues. Bei uns ist alles völlig in Ordnung. Und was ist bei euch?«
»Auch alles völlig in Ordnung.«
»Sehr gut. Nun möchte Fania mit euch sprechen.«
Und wieder dasselbe: Wie geht’s? Was gibt’s Neues? Und danach: »Jetzt möchte auch Amos ein paar Worte sagen.«
Und das war das ganze Gespräch: Wie geht es euch? Gut. Nu, dann werden wir bald wieder sprechen. Gut, euch zu hören. Auch gut, euch zu hören. Wir werden schreiben und den nächsten Termin vereinbaren. Wir werden sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Bald. Auf Wiedersehen. Und paßt auf euch auf. Alles Gute. Euch auch.
Aber es war nicht zum Lachen: Das Leben hing am seidenen Faden. Jetzt verstehe ich, daß sie ganz und gar nicht sicher waren, ob sie sich wirklich wieder sprechen würden oder nicht, vielleicht war es das letzte Mal, denn wer weiß, was kommt, Unruhen, ein Pogrom, ein Blutbad, die Araber könnten sich erheben und uns alle abschlachten, ein Krieg könnte ausbrechen, ein großes Unglück geschehen, Hitlers Panzer waren ja von zwei Seiten her, von Nordafrika und auch über den Kaukasus, fast an unsere Schwelle gelangt, wer weiß, was uns noch bevorstand. Dieses scheinbar leere Gespräch war keineswegs leer – es war nur karg.
Diese Telefongespräche machen mir jetzt deutlich, wie schwer es ihnen fiel – ihnen allen, nicht nur meinen Eltern –, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben. Wenn es nicht um private Dinge ging, hatten sie keinerlei Schwierigkeiten – sie waren emotionale Menschen, und sie konnten reden. Und wie sie reden konnten, sie waren fähig, stundenlang mit ungeheurer Leidenschaft über Nietzsche, Stalin, Freud, Jabotinsky zu diskutieren, die ganze Kraft ihres Seins hineinzulegen, vor lauter Pathos Tränen zu vergießen und ein Lied zu singen von Kolonialismus, von Antisemitismus, von Gerechtigkeit, von der »Bodenfrage«, der »Frauenfrage« und der »Frage Kunst versus Leben«. Aber sobald sie in privaten Dingen ihren Gefühlen Ausdruck zu geben versuchten, hatte das immer etwas Verklemmtes, Dürres und sogar Verschrecktes, das Resultat generationenlanger Verdrängung und Verbote. Ein zweifaches Verbots- und Bremssystem: Die Benimmregeln des europäischen Bürgertums verdoppelten die Hemmungen des religiösen jüdischen Schtetls. Eigentlich war fast alles »verboten« oder »unüblich« oder »unschön«.
Außerdem herrschte damals ein großer Mangel an Worten: Das Hebräische war noch dabei, eine gesprochene Sprache zu werden, und bestimmt noch keine Sprache für Intimes. Es war schwer vorherzusehen, was letztlich herauskam, wenn man Hebräisch sprach. Man konnte nie sicher sein, ob man nicht unfreiwillig etwas Lächerliches sagte, und vor der Lächerlichkeit fürchtete man sich Tag und Nacht. Ängstigte man sich zu Tode. Sogar Menschen wie meine Eltern, die gut Hebräisch konnten, beherrschten die Sprache nicht perfekt. Sie sprachen Hebräisch mit einem gewissen obsessiven Bemühen um Präzision, nahmen häufig etwas zurück und formulierten das eben Gesagte noch einmal um. So fühlt sich vielleicht ein kurzsichtiger Fahrer, der sich nachts im Gassengewirr einer fremden Stadt vorantastet, in einem ihm unvertrauten Wagen.
Einmal kam eine Freundin meiner Mutter, eine Lehrerin namens Lilja Bar-Samcha, am Schabbat zu uns zu Besuch. Man unterhielt sich, und die Besucherin sagte ein paarmal: »Ich bin entsetzt«, und ein-, zweimal sagte sie auch: »Er ist in einem entsetzlichen Zustand.« Ich prustete los. Im modernen Alltagshebräisch hatte das von ihr verwendete Wort auch die Bedeutung »furzen«. Außer mir schien niemand zu verstehen, was so komisch war, oder sie verstanden schon und taten nur so, als verstünden sie nicht. So ging es auch, wenn mein Vater vom Wettrüsten der Großmächte sprach oder wütend die Entscheidung der Nato-Staaten kritisierte, Deutschland wiederaufzurüsten, um so Stalin abzuschrecken. Ihm war nicht bewußt, daß dieses etwas antiquierte Wort für Aufrüsten, lesajen, im modernen Alltagshebräisch auch ein ziemlich derber Slangausdruck für »ficken« war.
Der Blick meinesVaters verdüsterte sich auch jedesmal, wenn ich das Wort lessader benutzte – ordnen; umgangssprachlich: hereinlegen –, ein völlig harmloses Wort. Ich verstand nie, warum es ihn irritierte, und er erklärte es natürlich nicht, und ich hätte ihn auch nicht danach fragen können. Jahre später erfuhr ich des Rätsels Lösung: Bevor ich geboren wurde, in den dreißiger Jahren, war lessader ein Deckwort für »schwängern«. »Jene Nacht im Packhaus hat er sie ›reingelegt‹, und am Morgen hat er doch so getan, als würde er sie überhaupt nicht kennen.« Wenn ich etwa sagte: »Uri hat seine Schwester reingelegt«, verzog Vater also das Gesicht und kräuselte ein wenig die Nasenwurzel. Natürlich hat er es nie erklärt – wie denn auch?
In intimen Momenten sprachen sie nicht Hebräisch miteinander. Und in den intimsten Momenten sprachen sie vielleicht überhaupt nicht. Schwiegen. Alles stand im Schatten der Angst, sich lächerlich zu machen oder sich lächerlich anzuhören.
2
Die Pioniere genossen, so schien es, in jenen Tagen das höchste Ansehen. Doch sie lebten weit weg von Jerusalem, in den fruchtbaren Tälern, in Galiläa, in der Ödnis am Ufer des Toten Meeres. Ihre kräftigen und gedankenschweren Gestalten zwischen Traktor und gepflügter Scholle sahen und bewunderten wir auf den Plakaten des Jüdischen Nationalfonds.
Eine Stufe unter den Pionieren rangierte der sogenannte organisierte Jischuw: diejenigen der jüdischen Bevölkerung des Landes, die im Trägerhemd auf dem sommerlichen Balkon den Davar lasen, die Zeitung der Arbeitergewerkschaft Histadrut, die Mitglieder der Histadrut und der Gewerkschaftskrankenkasse, die Aktivisten der Untergrundarmee Hagana, die Leute in Khaki, die Salat-, Spiegelei- und Dickmilchesser, die Befürworter einer Politik der Zurückhaltung, von Eigenverantwortung, solidem Lebenswandel, Abgaben für den Aufbaufonds, heimischen Produkten, Arbeiterklasse, Parteidisziplin und milden Oliven in den Gläsern von Tnuva. »Von drunten blau, von droben blau, wir bauen uns einen Hafen! Eine Heimat, einen Hafen!«
Diesem organisierten Jischuw entgegen standen die Terroristen der Untergrundgruppen wie auch die Ultraorthodoxen von Mea Schearim und die orthodoxen Kommunisten, die »Zionshasser«, und ein ganzes Sammelsurium von Intelligenzlern, Karrieristen und egozentrischen Möchtegernkünstlern des kosmopolitisch-dekadenten Typs, allerlei Außenseiter und Individualisten und dubiose Nihilisten, Jeckes mit ihrem unheilbaren deutsch-jüdischen Gebaren, anglophile Snobs, reiche französisierte Orientalen, die sich in unseren Augen wie hochnäsige Butler gerierten, dazu Jemeniten und Georgier und Maghrebiner und Kurden und Thessaloniker – alle eindeutig unsere Brüder, alle eindeutig vielversprechendes Menschenmaterial, aber was kann man machen, man wird noch viel Mühe und Geduld in sie investieren müssen.
Daneben gab es noch die Flüchtlinge und die Überlebenden, denen wir im allgemeinen mit Mitleid und auch ein wenig Abscheu begegneten: armselige Elendsgestalten – und ist es denn unsere Schuld, daß sie dort bleiben und auf Hitler warten mußten, statt noch rechtzeitig herzukommen? Und warum haben sie sich wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen, statt sich zu organisieren und Widerstand zu leisten? Und sie sollen auch endlich damit aufhören, ihr nebbiches Jiddisch zu reden und uns all das zu erzählen, was man ihnen dort angetan hat, denn das, was man ihnen dort angetan hat, macht weder ihnen noch uns viel Ehre. Und überhaupt ist unser Blick hier ja in die Zukunft gerichtet, nicht in die Vergangenheit, und wenn man schon die Vergangenheit ausgraben muß, dann haben wir schließlich mehr als genug erfreuliche hebräische Geschichte, die biblische und die hasmonäische, es besteht also keinerlei Notwendigkeit, sie mit einer derart deprimierenden jüdischen Geschichte zu verunstalten, die nichts als Nöte enthält. (Das hebräische Wort für »Nöte«, zarót, sprach man bei uns immer in seiner jiddischen Form aus, zóres, wobei man angewidert das Gesicht verzog, damit das Kind wußte, daß diese zores eine Art von Aussatz waren und zu diesen Leuten, nicht zu uns gehörten.) Einer dieser Überlebenden war Herr Licht, den die Kinder des Viertels »Million Kinders« nannten. Er hatte ein winziges Loch in der Malachi-Straße gemietet, in dem er nachts auf einer Matratze schlief, am Tag rollte er sein Bettzeug zusammen und betrieb dort ein kleines Gewerbe, das er »Chemische Reinigung, Mangelei und Dampfbügelei« nannte. Seine Mundwinkel waren immer wie verachtungsvoll oder angeekelt herabgezogen. Er saß gewöhnlich an der Tür seines Geschäfts und wartete auf Kundschaft, und wenn ein Kind aus dem Viertel vorüberging, spuckte er immer zur Seite und zischte zwischen den zusammengekniffenen Lippen hervor: »Eine Million Kinders haben sie totgemacht! Kinders wie ihr da! Abgeschlachtet!« Nicht traurig sagte er das, sondern mit Haß und mit Abscheu, als wollte er uns verfluchen.
Meine Eltern hatten auf dieser Skala zwischen Pionieren und zores-Behafteten keinen definierten Platz: Mit dem einen Bein standen sie im organisierten Jischuw (sie waren Mitglieder der Gewerkschaftskrankenkasse und zahlten ihre Abgaben für den Aufbaufonds) – und mit dem anderen Bein in der Luft. Mein Vater stand der Ideologie der Zionisten-Revisionisten um Jabotinsky nahe – und war doch weit entfernt von ihren Bomben und Gewehren. Höchstens stellte er dem Untergrund seine Englischkenntnisse zur Verfügung und erklärte sich bereit, von Zeit zu Zeit die verbotenen, flammenden Protestaufrufe gegen das »perfide Albion« zu verfassen. Die Intelligenzia Rechavias lockte meine Eltern von weitem, aber die pazifistischen Ideale des Friedensbundes Brit Schalom um Martin Buber – sentimentale Brüderschaft zwischen Juden und Arabern und gänzlicher Verzicht auf den Traum von einem hebräischen Staat, damit die Araber ein Einsehen mit uns hätten und uns gnädigst erlaubten, hier zu ihren Füßen zu leben –, diese Ideale erschienen meinen Eltern weltfremd, unterwürfig und weichlich-lavierend, von der Art, wie sie für die Jahrhunderte des Diasporalebens typisch gewesen war.
Meine Mutter, die an der Prager Universität ihr Studium begonnen und an der Hebräischen Universität in Jerusalem abgeschlossen hatte, gab Privatstunden für Schüler, die sich auf ihre Prüfungen in Geschichte und Literatur vorbereiteten. Mein Vater hatte einen ersten Studienabschluß in Literatur von der Wilnaer Universität und dann an der Hebräischen Universität auf dem Skopusberg seinen Magister gemacht, hatte dort jedoch keinerlei Aussicht auf einen Lehrposten zu einer Zeit, als die Zahl der qualifizierten Literaturexperten in Jerusalem die Zahl der Studenten bei weitem übertraf. Hinzu kam, daß viele dieser Dozenten akademische Titel erster Güte hatten, glänzende Examensurkunden berühmter deutscher Universitäten, im Unterschied zu Vaters schäbigem Universitätsgrad polnischer und Jerusalemer Provenienz. So fand er nur eine Stelle als Bibliothekar in der Nationalbibliothek auf dem Skopusberg, und nachts schrieb er seine Bücher über die Novelle in der hebräischen Literatur und über die Geschichte der Weltliteratur. Mein Vater war ein kultivierter, höflicher, energischer, doch auch ziemlich schüchterner Bibliothekar mit runder Brille, Krawatte und leicht abgewetztem Jackett, verbeugte sich vor Höherstehenden, hielt Frauen eilfertig die Tür auf, bestand nachdrücklich auf seinen wenigen Rechten, zitierte leidenschaftlich Gedichtverse in zehn Sprachen und erzählte, in seinem steten Bemühen, nett und amüsant zu sein, immer wieder dieselben Witze (die bei ihm Anekdoten oder Scherze hießen). Aber sein Witzeln hatte meist etwas Angestrengtes, war kein Humor von spontaner Lebendigkeit, sondern eher eine Absichtserklärung im Sinn unserer Pflicht, gerade in widrigen Zeiten Heiterkeit zu verbreiten.
Wann immer Vater sich einem Pionier in Khaki gegenübersah, einem Revolutionär, einem zum Arbeiter mutierten Akademiker, geriet er in peinliche Verlegenheit. In Wilna oder in Warschau war völlig klar gewesen, wie man ein Gespräch mit einem Proletarier führte. Jeder kannte seinen Platz, und doch mußte man diesem Arbeiter unmißverständlich zeigen, daß man demokratisch eingestellt war und sich nicht im geringsten für etwas Besseres hielt. Aber hier, in Jerusalem, war alles nicht eindeutig. Nicht auf den Kopf gestellt, nicht wie bei den Kommunisten in Rußland, sondern zweideutig: Einerseits gehörte Vater zum Mittelstand, zwar eher zum unteren Mittelstand, aber immerhin entschieden zum Mittelstand, er war ein gebildeter Mann, der Aufsätze und Bücher schrieb und einen bescheidenen Posten an der Nationalbibliothek innehatte, und sein Gesprächspartner war ein verschwitzter Bauarbeiter in Arbeitskleidung und schweren Schuhen. Andererseits hieß es, dieser Arbeiter habe ein Diplom in Chemie und sei auch ein wahrer Pionier, das Salz des Landes, ein Held der hebräischen Revolution, ein Mann, der von seiner Hände Arbeit lebte, während Vater sich – zumindest tief drinnen – immer als leicht entwurzelten, kurzsichtigen Intellektuellen mit zwei linken Händen betrachtete, eine Art Deserteur, der sich vor der Front – dem Aufbau des Heimatlandes – drückte.
Die meisten unserer Nachbarn waren kleine Angestellte, Händler, Kassierer bei der Bank oder im Kino, Schul- oder Privatlehrer, Zahnärzte. Sie waren nicht religiös, in die Synagoge gingen sie nur an Jom Kippur und manchmal auch an Simchat Tora, aber am Freitagabend zündeten sie dennoch Schabbatkerzen an, um irgendeinen Hauch von Judentum zu bewahren, und vielleicht auch sicherheitshalber: Für alle Fälle, möge der Unglücksfall auch nicht eintreten. Alle waren mehr oder weniger gebildet, aber es war ihnen nicht ganz wohl dabei. Alle hatten ihre festen Ansichten – über das britische Mandat, über die Zukunft des Zionismus, über die Arbeiterklasse, über das kulturelle Leben im Land, über Dührings Kritik an Marx, über Knut Hamsuns Romane, über die »Araberfrage« und die »Frauenfrage«. Es gab auch allerlei Ideologen und Prediger, die beispielsweise dazu aufriefen, den Bann der Orthodoxen über Spinoza aufzuheben oder den Arabern des Landes zu erklären, daß sie eigentlich gar keine Araber, sondern Nachfahren der alten Hebräer seien, oder ein für allemal die Gedanken Kants und Hegels mit der Lehre Tolstojs und dem Zionismus zusammenzuführen, eine Synthese, aus der hier im Lande Israel ein wunderbar reines und gesundes Leben erwachsen würde, oder viel Ziegenmilch zu trinken oder ein Bündnis mit Amerika und sogar mit Stalin einzugehen, um die Engländer fortzujagen, oder allmorgendlich einfache Gymnastikübungen zu machen, die die Trübsal vertreiben und die Seele des Menschen läutern würden.
Diese Nachbarn, die sich am Schabbatnachmittag in unserem kleinen Hof versammelten, um russischen Tee zu trinken, waren fast alle Menschen im Abseits. Wenn es galt, einen durchgeschmorten Sicherungsdraht zu ersetzen oder einen Dichtungsring am Wasserhahn zu wechseln oder ein kleines Loch in die Wand zu bohren, gingen alle schnell Baruch suchen, den einzigen im Viertel, der solche Wunder zu wirken wußte, weshalb er bei uns Baruch Goldhände hieß. All die anderen konnten mit mitreißender Sprachgewalt analysieren, wie wichtig es sei, daß das jüdische Volk endlich zu Landwirtschaft und Handwerk zurückkehre: Intelligenzia, sagten sie, haben wir mehr als genug, aber einfache, redliche Werktätige, daran mangelt es uns. Doch in unserem Viertel gab es, abgesehen von Baruch Goldhände, kaum einfache Werktätige. Auch bergeversetzende Intellektuelle hatten wir nicht. Alle lasen viele Zeitungen, und alle redeten gern. Einige mochten in allerlei Dingen bewandert sein, andere besaßen vielleicht Scharfsinn, aber die meisten rezitierten mehr oder weniger das, was sie in den Zeitungen und in allen möglichen Pamphleten und Parteibroschüren gelesen hatten. Als Kind ahnte ich nur undeutlich die große Kluft zwischen ihrem leidenschaftlichen Weltverbesserungswillen und der Art, wie sie nervös an ihrer Hutkrempe herumfingerten, wenn man ihnen ein Glas Tee anbot, oder der furchtbaren Schamröte in ihrem Gesicht, wenn meine Mutter sich (nur ein wenig) vorbeugte, um ihnen den Tee zu süßen, und ihr züchtiges Dekolleté dabei ein klein bißchen mehr Haut als sonst freigab – die Verlegenheit ihrer Finger, die sich in sich selbst einrollten, in dem Bemühen, keine Finger mehr zu sein.
All das war Tschechow – auch das Gefühl des Lebens im Abseits: Es gibt auf der Welt Orte, an denen sich das wahre Leben abspielt, weit weg von hier, im Europa vor Hitler. Abend für Abend brennen dort viele Lichter, Herren und Damen treffen sich zum Kaffee mit Schlagsahne in holzgetäfelten Räumen, sitzen gemütlich in prächtigen Kaffeehäusern unter goldschimmernden Kronleuchtern, gehen Arm in Arm in die Oper oder zum Ballett, beobachten von nahem das Leben der großen Künstler, die stürmischen Liebesaffären, die gebrochenen Herzen, die Geliebte des Malers, die sich plötzlich in seinen besten Freund, den Komponisten, verliebt und nachts barhäuptig durch den Regen geht, allein auf der alten Brücke steht, die sich zitternd im Wasser des Flusses spiegelt.
In unserem Viertel passierten nie solche Dinge. Solche Dinge ereigneten sich nur hinter den Bergen und in weiter Ferne, an Orten, an denen Menschen ohne Wenn und Aber lebten. Zum Beispiel in Amerika, wo man Gold schürft, Postzüge überfällt, Rinderherden über endlose Prärien treibt, und wer die meisten Indianer tötet, bekommt zum Schluß das schöne Mädchen. So war das Amerika, das wir im Edison-Kino zu sehen bekamen: Das schöne Mädchen war der Preis, den derjenige erhielt, der am besten schießen konnte. Was man mit einem solchen Preis anfängt? Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Hätte man uns in diesen Filmen ein Amerika gezeigt, in dem, umgekehrt, derjenige, der die meisten Mädchen erschießt, dafür am Ende mit einem schönen Indianer belohnt wird, ich hätte bestimmt geglaubt, daß es so und nicht anders ist. Jedenfalls in jenen fernen Welten – in Amerika und an anderen wunderbaren Orten aus meinem Briefmarkenalbum, in Paris, Alexandria, Rotterdam, Lugano, Biarritz, St. Moritz, an Orten, an denen göttergleiche Menschen sich verlieben, höflich miteinander ringen, verlieren, verzichten, weiterziehen, um Mitternacht an den Boulevards regengepeitschter Städte in schummrigen Hotelbars allein auf hohen Hockern am Tresen sitzen und überhaupt ein Leben ohne Wenn und Aber leben.
Auch in den Romanen von Tolstoj und Dostojewski, über die alle pausenlos diskutierten, lebten die Helden ohne Wenn und Aber und starben vor lauter Liebe. Oder für irgendein hehres Ideal. Oder an Schwindsucht und an gebrochenem Herzen. Und jene braungebrannten Pioniere, dort auf den Höhen Galiläas, lebten ebenfalls ohne Wenn und Aber. Bei uns im Viertel starb niemand an Schwindsucht, unglücklicher Liebe oder Idealismus. Alle lebten mit Wenn und Aber. Nicht nur meine Eltern. Alle.
Es war bei uns ein ehernes Gesetz, nichts Importiertes zu kaufen, keinerlei ausländische Erzeugnisse, soweit es entsprechende heimische Produkte gab. Aber wenn man zu Herrn Austers Lebensmittelladen Amos-, Ecke Ovadja-Straße ging, mußte man immer noch wählen zwischen Käse aus dem Kibbuz, vertrieben von Tnuva, und arabischem Käse: War arabischer Käse aus dem Nachbardorf Lifta inländischer oder ausländischer Herkunft? Kompliziert. Der arabische Käse war ein klein wenig billiger. Aber wenn du arabischen Käse kauftest, würdest du dann nicht am Zionismus Verrat üben? Irgendwo in einem Kibbuz oder Moschav, im Jesreel-Tal oder in den Bergen Galiläas, hat eine junge Pionierin als Teil ihres harten Tagewerks, vielleicht unter Tränen, dagesessen und diesen hebräischen Käse für uns abgepackt – wie können wir uns da von ihr abwenden und nichtjüdischen Käse kaufen? Wird uns die Hand nicht erzittern? Andererseits, wenn wir die Erzeugnisse unserer arabischen Nachbarn boykottieren, dann tragen wir doch dazu bei, den Haß zwischen den beiden Völkern zu vertiefen und zu verewigen, und für das Blut, das, Gott behüte, noch vergossen werden würde, wären auch wir dann mitverantwortlich. Der bescheiden lebende arabische Fellache, ein einfacher, redlicher Ackerbauer, dessen Seele noch nicht vom Gifthauch der Großstadt verunreinigt wurde, dieser Fellache war doch der dunkelhäutigere Bruder des schlichten, edelmütigen Muschiks aus Tolstojs Erzählungen! Sollen wir wirklich seinem Käse grausam die kalte Schulter zeigen? Wollen wir tatsächlich so hartherzig sein und diesen Mann bestrafen? Wofür? Dafür, daß die heimtückischen Briten und die korrupten Effendis ihn gegen uns und unser Aufbauwerk aufhetzen? Nein. Diesmal werden wir entschieden arabischen Käse kaufen, der übrigens wirklich ein wenig besser schmeckt als der Käse von Tnuva und auch etwas weniger kostet. Aber dennoch, von dritter Seite betrachtet, was ist, wenn es bei ihnen vielleicht nicht so sauber zugeht? Wer weiß, wie die Molkereien bei denen dort sind? Was ist, wenn sich, zu spät, herausstellt, daß ihr Käse von Bazillen wimmelt?
Bazillen gehörten zu unseren schlimmsten Alpträumen. Sie waren wie der Antisemitismus: Nie bekamst du mit eigenen Augen einen Antisemiten oder eine Bazille zu Gesicht, aber du wußtest sehr wohl, daß sie überall auf dich lauerten, unsichtbar, doch sie sehen dich. Eigentlich stimmt es nicht ganz, daß niemand bei uns je eine Bazille zu Gesicht bekommen hat. Ich schon! Ich starrte sehr lange durchdringend und konzentriert auf ein Stück alten Käse, bis ich plötzlich ein sich windendes Gewimmel zu sehen begann. Wie die Schwerkraft in Jerusalem, die damals sehr viel stärker war als heute, waren auch die Bazillen viel größer und stärker. Ich habe sie gesehen.
Eine kleine Debatte brach des öfteren unter den Kunden in Herrn Austers Lebensmittelladen aus: Arabischen Käse kaufen oder nicht kaufen? Einerseits heißt es: »Die Armen deiner Stadt gehen vor«, und daher sind wir verpflichtet, nur Tnuva-Käse zu kaufen. Andererseits steht geschrieben: »Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt«, deshalb sollte man manchmal den Käse unserer arabischen Nachbarn kaufen, »denn Fremdlinge wart ihr im Lande Ägypten«. Und überhaupt, mit welch tiefer Verachtung würde Tolstoj denjenigen betrachten, der nur wegen der Religionszugehörigkeit oder der nationalen Herkunft den einen Käse kauft und den anderen nicht! Was ist mit den Werten des Universalismus? Des Humanismus? Der Brüderschaft aller nach Gottes Ebenbild Erschaffenen? Und dennoch, welch armseliger Zionismus, welche Schwächlichkeit, welche Kleinlichkeit, arabischen Käse nur deshalb zu kaufen, weil er etwas weniger kostet, und nicht den Käse der Pioniere, die sich schinden und mühen, um das Brot aus der Erde hervorzubringen!
Eine Schande! Eine Schmach und Schande! So oder so, Schmach und Schande!
Das ganze Leben wimmelte von solcher Schmach und Schande.
Ein weiteres typisches Dilemma: Sollte oder sollte man nicht zum Geburtstag Blumen schicken? Und wenn ja, welche Blumen? Gladiolen sind sehr teuer, doch die Gladiole ist eine kultivierte Blume, eine aristokratische Blume, eine empfindsame Blume, nicht so ein halbwildes asiatisches Kraut. Anemonen und Alpenveilchen durften wir damals pflücken, soviel wir wollten (der künftige Naturschützer Asaria Alon war noch jung), aber Anemonen und Alpenveilchen galten nicht als Blumen, die man zum Geburtstag oder zum Erscheinen eines Buches schicken konnte. Gladiolen hatten ein feines Flair von Konzerten, von Bällen, von Theater, von Ballett, von Kultur und von zarten, tiefen Gefühlen.
Also kauft und schickt man Gladiolen. Ohne großes Wenn und Aber. Aber nun stellt sich die Frage, ob sieben Gladiolen nicht etwas übertrieben sind? Und sind fünf nicht zu wenig? Vielleicht sechs? Oder doch lieber sieben? Nein, kein Wenn und Aber. Wir könnten allerdings die Gladiolen mit einem Wald von Spargelkraut umhüllen und mit sechs auskommen. Aber ist das nicht völlig anachronistisch? Gladiolen? Wo schenkt man denn heute noch Gladiolen? Schicken die Pioniere in Galiläa einander etwa Gladiolen? Schert sich denn in Tel Aviv überhaupt noch jemand um Gladiolen? Wozu soll das eigentlich gut sein? Kosten ein Vermögen und wandern nach vier, fünf Tagen geradewegs in den Mülleimer. Was bringen wir dann aber mit? Vielleicht eine Bonbonniere? Eine Bonbonniere? Eine Bonbonniere, das ist ja noch lächerlicher als Gladiolen. Vielleicht wäre es eigentlich am besten, einfach Servietten mitzubringen oder einen Satz Glashalter, verschnörkelt, aus versilbertem Metall, mit hübschen Griffen, damit man heißen Tee servieren kann, ein unaufdringliches Geschenk, ebenso ästhetisch wie praktisch, eines, das man nicht wegwirft, sondern jahrelang im Gebrauch hat, und jedesmal, wenn man diese Glashalter benutzt, wird man sich vielleicht einen Moment lang mit Wohlwollen an uns erinnern.
3
Überall konnte man winzige Botschafter des gelobten Landes Europa entdecken. Zum Beispiel die klejnen mentschelach, die kleinen Menschlein, die die Fensterläden tagsüber offenhalten. Will man die Läden schließen, kippt man diese Metallfiguren in ihren Angeln um, so daß sie die ganze Nacht mit dem Kopf nach unten hängen. So wie man am Ende des Kriegs Mussolini und seine Mätresse Clara Petacci aufgehängt hatte. Das war furchtbar, das war grauenhaft – nicht, daß man sie aufgehängt hatte, das hatten sie verdient, sondern daß man sie mit dem Kopf nach unten aufgehängt hatte. Mir taten sie beinahe ein wenig leid, obwohl ich so nicht hätte fühlen sollen: Bist du übergeschnappt, oder was? Mitleid mit Mussolini? Das ist doch schon fast so wie Mitleid mit Hitler! Aber ich machte ein Experiment, ich ließ mich kopfüber von einem Rohr an der Wand baumeln, und nach zwei Minuten strömte mir das ganze Blut in den Kopf, und ich wurde beinahe ohnmächtig. Und Mussolini und seine Mätresse hatten nicht ein paar Minuten, sondern drei ganze Tage und Nächte so gehangen, und das, nachdem man sie bereits umgebracht hatte! Ich hielt das für eine zu grausame Strafe. Sogar für einen Mörder, sogar für eine Mätresse.
Nicht, daß ich die geringste Ahnung gehabt hätte, was eine Mätresse ist. In ganz Jerusalem gab es damals keine einzige Mätresse. Es gab eine »Gefährtin«, eine »Freundin im doppelten Sinn des Wortes«, vielleicht gab es hier und da sogar Romanzen. Äußerst vorsichtig sagte man beispielsweise, Herr Tschernianski habe »irgendwas« mit der Freundin von Herrn Lupatin, und ich erriet mit heftig pochendem Herzen, daß das Wort »irgendwas« hier eine geheimnisvolle, schicksalhafte Bedeutung hatte, hinter der sich etwas Süßes und Schreckliches und Unerhörtes verbarg. Aber eine Mätresse?! Das war ja etwas aus biblischen Zeiten. Etwas Überlebensgroßes. Etwas Unvorstellbares. Vielleicht gibt es so etwas in Tel Aviv, dachte ich, dort gibt es doch immer alle möglichen Dinge, die es hier bei uns nicht gibt und verboten sind.
Ich habe fast von allein angefangen zu lesen, als ich noch ganz klein war. Was konnten wir sonst auch tun? Die Nächte waren damals viel länger, weil die Erdkugel sich viel langsamer drehte, weil die Schwerkraft in Jerusalem viel stärker war als heute. Die Lampe gab ein fahles gelbes Licht, und sie erlosch häufig bei Stromausfällen. Noch heute löst der Geruch rauchender Kerzen oder einer rußenden Petroleumlampe bei mir die Lust aus, ein Buch zu lesen. Von sieben Uhr abends an waren wir im Haus eingeschlossen wegen der Ausgangssperre, die die Briten über Jerusalem verhängt hatten. Und selbst wenn keine Ausgangssperre herrschte – wer wollte damals in Jerusalem schon im Dunkeln draußen sein? Alle Häuser und Läden waren verschlossen und verriegelt, die Straßen menschenleer, und jeder Schatten, der in den Gassen vorüberhuschte, zog drei oder vier Schatten des Schattens hinter sich her.
Auch wenn kein Stromausfall war, lebten wir immer bei mattem Licht, weil es wichtig war, zu sparen. Meine Eltern wechselten eine Vierzig-Watt-Birne gegen eine Fünfundzwanzig-Watt-Birne aus, nicht nur wegen der Kosten, sondern aus Prinzip, weil helles Licht verschwenderisch und Verschwendung unmoralisch ist. Immer drängten sich die Leidenden der Menschheit in unsere winzige Wohnung: Die hungernden Kinder in Indien, derentwegen ich meinen Teller leer essen mußte. Die Überlebenden des Hitler-Infernos, die die Briten an der Einwanderung hinderten und in Internierungslager auf Zypern deportierten. Die zerlumpten Waisenkinder, die noch immer in den verschneiten Wäldern des zerstörten Europa umherirrten. Vater saß bis zwei Uhr nachts an seinem Schreibtisch und arbeitete beim anämischen Licht einer Fünfundzwanzig-Watt-Funzel, ruinierte seine Augen, weil er es nicht richtig fand, eine stärkere Birne zu benutzen: Die Pioniere sitzen Nacht für Nacht in ihren Zelten und verfassen Gedichte oder philosophische Abhandlungen beim Schein von im Wind flackernden Kerzen, und wie kannst du dich über so etwas hinwegsetzen und einfach so wie Rothschild beim strahlenden Licht einer Vierzig-Watt-Birne sitzen? Und was würden die Nachbarn sagen, wenn sie plötzlich Galabeleuchtung bei uns sähen? Daher verdarb er sich lieber die Augen, als anderen in die Augen zu stechen.
Wir waren nicht wirklich arm: Vater war Bibliothekar in der Nationalbibliothek und hatte ein bescheidenes, aber regelmäßiges Einkommen. Mutter gab ab und an Privatstunden. Ich goß jeden Freitag für einen Shilling Herrn Cohens Garten in Tel Arsa, und mittwochs sortierte ich für vier Piaster hinter Herrn Austers Lebensmittelladen leere Flaschen in Kästen ein, außerdem brachte ich dem Sohn von Frau Finster für zwei Piaster pro Lektion bei, Landkarten zu lesen (aber da wurde angeschrieben, und bis heute hat Familie Finster mir das Geld nicht bezahlt).
Trotz all dieser Einkünfte sparten und sparten wir alle Tage. Das Leben in unserer kleinen Wohnung lief so ab wie in dem Unterseeboot, das ich einmal in einem Film im Edison-Kino gesehen hatte, wo die Matrosen beim Durchgang von Abteilung zu Abteilung immer alle Schotten hinter sich schlossen: Mit einer Hand schaltete ich das Licht in der Toilette an und mit der anderen Hand gleichzeitig das Flurlicht aus, um keinen Strom zu vergeuden. An der Spülungskette zog ich behutsam, denn man durfte keinen ganzen Behälter für einmal Pinkeln verschwenden. Es gab andere Bedürfnisse (diese hatten bei uns überhaupt keinen Namen), die in einigen Fällen einen ganzen Behälter rechtfertigten. Aber für einmal Pinkeln? Einen ganzen Behälter? Während die Pioniere im Negev das Zahnputzwasser sammeln, um Setzlinge damit zu gießen? Während in den Internierungslagern auf Zypern eine ganze Familie drei Tage lang mit einem einzigen Eimer auskommen muß? Und wenn ich die Toilette verließ, löschte ich mit der linken Hand dort das Licht und knipste mit der rechten Hand synchron das Flurlicht an, weil die Shoah erst gestern war, weil noch immer heimatlose Juden zwischen Karpaten und Dolomiten umherirren, in Internierungslagern und auf morschen illegalen Einwandererschiffen Not leiden, zum Skelett abgemagert und in Lumpen, und weil es Entbehrung und Elend auch an anderen Enden der Welt gibt: die Kulis in China, die Baumwollpflücker in Mississippi, die Kinder in Afrika, die Fischer in Sizilien. Es war unsere Pflicht zu sparen.
Außerdem, wer weiß denn, was uns hier noch bevorsteht? Die Sorgen und Nöte sind ja nicht vorüber, und sehr wahrscheinlich kommt das Schlimmste erst noch: Die Nazis mochten zwar besiegt sein, aber in Polen gibt es wieder Pogrome, in Rußland verfolgt man Menschen, die Hebräisch sprechen, und hierzulande haben die Briten noch nicht das letzte Wort gesprochen, der Großmufti redet von einem Blutbad unter den Juden, wer weiß, was die arabischen Staaten noch mit uns vorhaben, und die zynische Welt unterstützt die Araber wegen Erdöl-, Handels- und anderer strategischer Interessen. Leicht wird es hier bestimmt nicht werden.
Nur Bücher gab es bei uns in Hülle und Fülle, sie waren überall, von Wand zu Wand, in den Zimmern, im Flur und in der Küche und auf jeder Fensterbank. Tausende von Büchern in allen Ecken der Wohnung. Ich hatte das Gefühl, Menschen kommen und gehen, werden geboren und sterben, doch Bücher sind unsterblich. Als kleiner Junge wollte ich, wenn ich einmal groß wäre, ein Buch werden. Nicht Schriftsteller, sondern ein Buch: Menschen kann man wie Ameisen töten. Auch Schriftsteller umzubringen ist nicht schwer. Aber Bücher – selbst wenn man versuchte, sie systematisch zu vernichten, bestand immer die Chance, daß irgendein Exemplar überlebte und sich weiterhin eines Regallebens in einer Ecke einer abgelegenen Bibliothek erfreute, in Reykjavik, in Valladolid oder in Vancouver.
Wenn es selten einmal vorkam, daß nicht genug Geld da war, um Essen für den Schabbat einzukaufen, blickte Mutter Vater an, und Vater begriff, daß der Moment gekommen war, ein Opferlamm auszuwählen, und trat an das Bücherregal. Er war ein Mensch mit moralischen Grundsätzen, der wußte, daß Brot wichtiger ist als Bücher und daß das Wohl des Kindes über alles gehen muß. Ich sehe ihn noch gebeugten Rückens aus der Tür gehen, unter dem Arm drei, vier geliebte Bücher, wehen Herzens ging er in Herrn Mayers Antiquariat, um dort die wertvollen Bände zu verkaufen, als risse er sich das eigene Fleisch aus dem Leib. So sah bestimmt unser Stammvater Abraham aus, als er, gebeugten Rückens, Isaak auf der Schulter, frühmorgens das Zelt verließ, auf dem Weg zum Berg Moria.
Ich konnte seinen Kummer erahnen: Vater hatte ein sinnliches Verhältnis zu seinen Büchern. Er liebte es, sie zu betasten, sie zu streicheln, an ihnen zu riechen. Er war ein lüsterner Bücherliebhaber, unfähig, sich zu beherrschen, langte gleich hin, sogar bei den Büchern fremder Leute. Und Bücher waren damals auch tatsächlich von einer viel stärkeren Sinnlichkeit als heute: Es war schön, an ihnen zu riechen, sie zu betasten und zu streicheln. Es gab Bücher mit Goldlettern auf duftenden, ein wenig rauhen Lederrücken, wenn du sie anfaßtest, lösten sie bei dir den wohligen Schauder der Berührung von Haut auf Haut aus, als wärest du beim Ertasten an eine verborgene, unbekannte Stelle gelangt, hättest etwas berührt, das sich unter deinen Fingern ein wenig sträubt und erzittert. Und es gab Bücher mit Kartondeckel, mit Stoff überzogen und mit wunderbar riechendem Klebstoff geleimt. Jedes Buch verströmte seinen eigenen geheimen verführerischen Duft. Zuweilen hatte sich der Überzug etwas vom Karton gelöst und wehte hoch wie ein kesser Rock, so daß man der Versuchung kaum widerstehen konnte, in den dunklen Zwischenraum zwischen Körper und Kleid zu spähen und diese betörenden Düfte einzuatmen.
Zumeist kam Vater ein, zwei Stunden später ohne die Bücher zurück, dafür aber mit braunen Tüten, die Brot, Eier, Käse und manchmal sogar eine Dose Büchsenfleisch enthielten. Doch es kam auch vor, daß er überglücklich von der Opferung Isaaks zurückkehrte, mit einem großen Lächeln, ohne seine geliebten Bücher, aber auch ohne Lebensmittel: Die Bücher hatte er tatsächlich verkauft, dafür aber auf der Stelle andere erworben, weil er in dem Antiquariat auf solch großartige Schätze gestoßen war, wie sie einem vielleicht nur ein einziges Mal im Leben unterkommen, so daß er sich nicht hatte beherrschen können. Mutter verzieh ihm, und ich auch, denn ich hatte eigentlich nie Lust auf Essen, außer auf Mais und Eis. Omeletts und Fleischkonserven konnte ich nicht ausstehen. Ehrlich gesagt, beneidete ich manchmal sogar ein wenig jene hungrigen Kinder in Indien, die nie von jemandem gezwungen wurden, ihre Teller leer zu essen.
Als ich etwa sechs Jahre alt war, kam ein großer Tag in meinem Leben: Vater räumte einen kleinen Platz in einem der Bücherregale frei und erlaubte mir, meine Bücher dort hineinzustellen. Genaugenommen überließ er mir etwa ein Viertel des untersten Bords. Ich nahm all meine Bücher, die bis dahin auf einem Schemel neben meinem Bett gelegen hatten, trug sie in meinen Armen zu Vaters Bücherregal und stellte sie hinein, wie es sich gehört, den Rücken der Außenwelt zugewandt, das Gesicht zur Wand.
Das war eine Reifezeremonie, ein Initiationsritus: Ein Mensch, dessen Bücher stehen, ist kein Kind mehr, ist schon ein Mann. Ich war nun wie Vater. Meine Bücher standen.
Ich beging einen entsetzlichen Fehler. Vater ging zur Arbeit, und ich durfte mit meinem Platz im Regal so verfahren, wie ich Lust hatte, aber ich hatte eine völlig kindliche Vorstellung davon, wie man so etwas tut. So kam es, daß ich meine Bücher der Größe nach einordnete, und die größten waren ausgerechnet die, die schon weit unter meiner Würde waren – Bilderbücher, in Reimen, die man mir als Baby vorgelesen hatte. Ich stellte auch sie hinein, weil ich den mir zugestandenen Platz ganz ausfüllen wollte. Meine Bücherecke sollte richtig überquellen, genau wie bei Vater. Ich war immer noch euphorisch, als Vater von der Arbeit heimkehrte, einen bestürzten Blick auf mein Bücherbord warf und mich dann, ohne ein Wort zu sagen, lange eindringlich ansah, mit einem Blick, den ich nie vergessen werde: Es war ein Blick der Verachtung, der unsäglich bitteren Enttäuschung, ein Blick der vollkommenen Verzweiflung über diesen personifizierten genetischen Fehlschlag. Schließlich quetschte er mühsam hervor: »Bist du denn völlig verrückt geworden? Der Größe nach? Was, sind Bücher denn Soldaten? Eine Ehrengarde? Ist das eine Parade der Feuerwehrkapelle?«
Wieder verstummte er. Es folgte eine lange, furchtbare Stille von Vaters Seite, ein wahres Gregor-Samsa-Schweigen, als hätte ich mich vor seinen Augen in ein Insekt verwandelt. Und auch ich schwieg, schuldbewußt, als wäre ich wirklich schon immer ein elendes Ungeziefer gewesen und erst jetzt als solches entlarvt worden, und jetzt war alles verloren, von nun an bis in alle Ewigkeit.