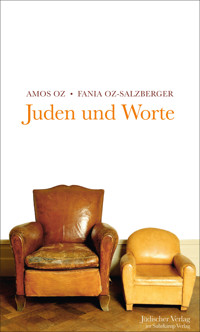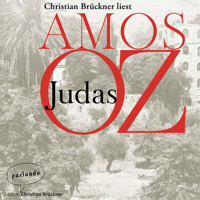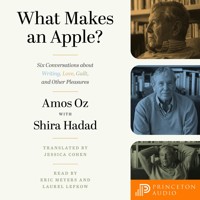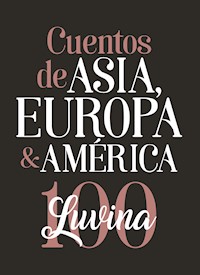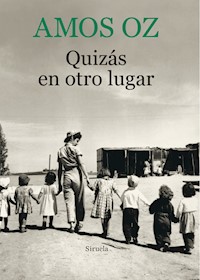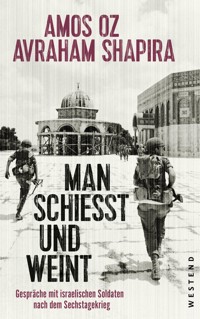
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die andere Seite des Krieges – Gespräche mit den Soldaten des Sechstagekriegs Nach dem Sechstagekrieg von 1967 initiierte Avraham Shapira zusammen mit Amos Oz das wohl einflussreichste israelische Buch: „Gespräche mit israelischen Soldaten“. Es entstand, als „nach dem Sechstagekrieg im Land eine Art Siegesrausch war“, so Oz im Vorwort zur Neuauflage. „Kein Mensch in Israel sprach vom menschlichen Leid und erst Recht nicht vom besiegten Feind. Wir hatten das Gefühl, dass man von Mensch zu Mensch gehen und erfahren muss, was die Kämpfer auf dem Schlachtfeld erlebt haben und was sie nach dem Schlachtfeld erlebten.“ Damals vom israelischen Militär stark zensiert, liefern die inzwischen weitgehend autorisierten Interviews einen beeindruckenden Einblick in die andere Seite auch heutiger Kriege.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ebook Edition
Amos OzAvraham Shapira
Man schießt und weint
Gespräche mit israelischen Soldaten nach dem Sechstagekrieg
Originaltitel: Siach Lochamim
Aus dem Hebräischen übersetzt von Susanne Euler
Diese Neuausgabe folgt der ersten deutschen Ausgabe Gespräche mit israelischen Soldaten, erschienen 1970 im Joseph Melzer Verlag, Frankfurt
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-659-0
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2017
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Amos OzMan schießt und weint
In Hulda fiel ein Sohn, ein Fallschirmspringer. Nachdem ich vom Krieg zurückgekehrt war, ging ich zu seinen Eltern. Einige Freunde waren da. Die Mutter weinte. Der Vater biss auf seinen Lippen herum. Jemand von den Alten versuchte, sie zu trösten, und sagte: »Schaut, wir haben doch, trotz allem, Jerusalem befreit … Er ist doch nicht umsonst gefallen.« Da brach die Mutter in Heulen aus und schrie: »Die ganze Westmauer ist mir nicht einen Fingernagel von Micha wert.« Wenn du mir sagen würdest, dass wir um unsere Existenz kämpften, dann hatte sein Opfer einen Sinn. Wenn du mir aber sagst, wir hätten um die Mauer gekämpft, dann nicht. Verflixt, ich habe eine Beziehung zu diesen Steinen … doch es sind nur Steine. Und Micha war ein Mensch. Und wenn man heute die Westmauer mit Dynamit sprengen würde und dies Micha wieder lebendig machte, dann würde ich sagen: »Sprengt!«
Alles fing an mit einer Unterhaltung zwischen mir und Avraham Shapira. Das Gespräch, bei dem vielleicht dieses Buch geboren wurde, es entstand aus dem gemeinsamen Gefühl, als nach dem Sechstagekrieg im Land ein Art Siegesrausch herrschte: Das Land schäumte regelrecht über und die Euphorie kannte keine Grenzen. Siegesalben, Siegesbücher, Siegeskult, Heldenkult, Nationalkult, Kult um die heiligen Orte. Doch kein Mensch sprach vom menschlichen Leid und erst recht nicht vom besiegten Feind. Wir hatten das Gefühl, dass man von Mensch zu Mensch gehen und erfahren muss, was die Kämpfer auf dem Schlachtfeld erlebt hatten und was sie nach dem Schlachtfeld erlebten.
Bei dieser ersten Begegnung wussten wir noch nicht, dass daraus ein Buch werden sollte, und sprachen nicht über eine mögliche Veröffentlichung. Nur diese Idee, mit den Menschen über das zu reden, was sie im Krieg erlebt hatten, wurde bei dieser Unterhaltung geboren.
Die Schlüsselfrage war: Was habt Ihr gefühlt? Die einzigen Gefühle, die in der Öffentlichkeit zum Ausdruck kamen, waren Gefühle der Euphorie, der Ekstase, des Siegesrausches. Es gab natürlich auch die Eltern, die ihre Söhne verloren hatten, und man hatte sie zu Wort kommen lassen und ihnen zugehört. Es gab ihren Schmerz, aber irgendwie wurde dieser Schmerz von den Siegesfeiern verdeckt. Vielleicht ist das bis zu einem gewissen Punkt sogar verständlich: Das jüdische Volk, das fast 2 000 Jahre lang keine militärische Macht besaß und oft Opfer derselben wurde, stellte plötzlich fest, dass es plötzlich selbst Macht besaß. Da war es fast menschlich, dass es sich berauschte, als es feststellte, dass diese Macht Erfolge bringen, ja, Wunder bewirken konnte. Es nahm auch nicht wunder, dass diese Macht den Menschen zu Kopf stieg und sie außer sich waren.
Auch ich kannte diese Gefühle der Freude und Befreiung: In nur wenigen Tagen wurde aus der Angst der bevorstehenden Vernichtung die Freude über einen fast übernatürlichen Sieg – wir alle empfanden das wie ein Wunder. Doch bei unseren Treffen für Gespräche mit israelischen Soldaten (Anm. d. Übersetzers: Titel der deutschen Erstauflage) wurde deutlich, dass wir alle auch andere Gefühle hatten und darüber sprechen wollten.
Bei den Versammlungen in den Kibbuzim kamen diese Gefühle nicht vor und auch nicht in den Zeitungsinterviews. In den Zeitungen konnte man vor allem lesen: Es gab einen Flankenangriff von rechts, einen Flankenangriff von links, wir haben einen Hinterhalt gelegt, wir haben sie überwältigt, es war sehr schwer, es gab einen grausamen Kampf. Die andere Seite fand keine Beachtung, nirgends, nicht in den Zeitungen, nicht in den öffentlichen Gesprächen – allenfalls in persönlichen Gesprächen zwischen Freunden. Ich weiß es nicht, da diese Gespräche von Natur aus privat sind. Ich vermute aber, dass viele Kämpfer nach ihrer Heimkehr vom Krieg auch die Gefühle der Qual mit ihren Freundinnen oder Frauen geteilt haben. Das Wort »Qual« ist hier ein sehr wichtiges Wort. Es ist gewissermaßen ein Schlüsselwort im Text von Gespräche mit israelischen Soldaten. Denn es gab diese Qual.
Ich weiß nicht, ob wir die Zukunft vorhergesagt haben. Wir erlebten die Gegenwart und sahen, dass diese nicht so einfach war, wie es die allgemeine Stimmung suggerierte. Die Menschen dachten, dass es Frieden geben würde und sich die Araber schon damit abfinden werden, dass sie machtlos sind und ihre Niederlage schließlich akzeptieren. Vielleicht werden wir sogar weitere Gebiete einnehmen – wir haben Jerusalem befreit, wir haben die heiligen Stätten befreit, wir sind bis Scharm el-Scheich gekommen! Im Gegensatz zur allgemeinen Empfindung, dass jetzt alles gut werden würde, hatte ich das Gefühl, dass das, was zu Ende ging, eigentlich erst der Anfang gewesen war. Ich hatte das Gefühl, dass das Blutvergießen und das Leid nicht zu Ende waren.
Ich werde etwas erzählen, was in Gespräche mit israelischen Soldaten nicht vorkommt. Am ersten Kriegstag, am 5. Juni 1967, stand ich um acht Uhr morgens zwischen den gepanzerten Fahrzeugen in der Division von General Tal auf der Straße nach Rafiach – eine halbe Stunde später rollten wir hinter den Panzern und allen übrigen Fahrzeugen in die Stadt ein. Und da sah ich zum ersten Mal einen toten Menschen in diesem Krieg: Am Wegesrand lag ein getöteter ägyptischer Soldat auf dem Rücken. Seine Gliedmaßen waren weit ausgebreitet und seine Augen noch offen. Ich sah ihn an und sagte: »Ich werde in meinem Leben nie wieder essen und trinken können.« Nicht länger als sechs oder sieben Stunden später stand ich in Scheich Zawid, umgeben von ägyptischen Gefallenen. Ich trank Wasser aus meiner Feldflasche und hörte der Musik aus dem Transistor zu. Die Verwandlung, die ich in diesen sieben Stunden erlebt hatte, diese Verwandlung war unbegreiflich.
Ich kann mich an noch etwas erinnern. Ich erinnere mich, wie ich mit einigen anderen Soldaten am Abhang einer Sanddüne im Sinai sitze. Das war am ersten Tag des Krieges, und plötzlich wird auf uns von der nächsten Düne mit einem Mörser geschossen. Natürlich legten wir uns flach hin und suchten Schutz. Ich sah die Menschen, die auf mich schossen. Und was war mein erster Instinkt? Nicht Feuer erwidern, nicht abhauen, nicht nach Verstärkung rufen, sondern: die Polizei rufen! Ich dachte, diese Menschen sind nicht normal, sie kennen mich nicht, warum schießen sie auf mich? Dieser Instinkt, die Polizei zu rufen, war eigentlich vollkommen normal. Aber alles, was danach kam, war nicht mehr normal. Es kam der Wahnsinn des Krieges. Aber dieser Instinkt, die Polizei zu rufen, fremde Menschen schießen auf mich, das war ein völlig normaler Instinkt. Das war der letzte Rest der zivilen Ordnung, der zivilen Moral.
Ich erinnere mich an die Tage, als das Buch herauskam. Ich kann mich an die Angriffe auf das Buch erinnern, allerdings nicht mehr, von wem sie kamen. Man sagte, es sei ein schwarzmalerisches Buch, man sagte, es sei ein pazifistisches Buch, dass es ein Buch sei, welches die Freude am Sieg verdirbt, dass es ein verwöhntes, dass es ein schöngeistiges Buch sei – die ganze Vielfalt diffamierender Ausdrücke wurde über uns gegossen. Aber das war zu erwarten und überraschte uns nicht sonderlich. Das Buch wurde trotzdem ein Bestseller, und auch die Menschen, die es ablehnten, wollten es lesen. Ich kann mich erinnern, dass Menschen zu mir sagten: »Ich habe Gespräche mit israelischen Soldaten gelesen, und obwohl ich mich innerlich gegen das Buch aufgelehnt habe, blieb ich nicht gleichgültig.« Darüber habe ich mich sehr gefreut. Wenn mir jemand sagt, dass er nicht gleichgültig geblieben sei, dann hat das Buch sein Ziel erreicht.
Die Zensoren wollten verhindern, dass die Welt ein allzu schlechtes Bild von Israel bekommen könnte. Zum Glück wurde das Buch nicht im Ganzen verboten – selbst darüber hätte ich mich nicht gewundert. Es wurden aber einige wichtige und besonders scharfe Stellen gestrichen. Dennoch konnte das Buch seine Mission erfüllen. Heute gibt es einige, die behaupten, dass das Buch nicht scharf genug sei, und vergessen dabei oft, dass es zensiert wurde.
Ich sehe heute in der israelischen Gesellschaft mehr Gleichgültigkeit, mehr Stumpfheit als damals. Was derzeit in den besetzten Gebieten geschieht, überschreitet zuweilen die Grenze zu Kriegsverbrechen, aber es berührt niemanden. Die Kommentare zum Geschehen in den Gebieten gleichen sich: »Wer hat ihnen erlaubt, uns zu provozieren?«; »Besatzung ist nun einmal Besatzung und kein Zuckerschlecken« oder »Es sind die anderen, die keinen Frieden wollen«. Es ist ein Mechanismus der Verdrängung und des Leugnens am Werk. Viele Menschen ignorieren einfach die Nachricht, sobald sie erkennen, dass es sich um die besetzten Gebiete handelt. Daher deckt die Presse auch nicht genug von dem auf, was in den besetzten Gebieten geschieht. Tag für Tag, Stunde für Stunde, werden Palästinenser erniedrigt, beleidigt, gedemütigt und bei den Checkpoints mit Schikanen gequält. In den arabischen Dörfern läuft der Abfluss der israelischen Siedlungen durch die Straßen. Erwachsene Menschen werden gedemütigt durch 19 oder 20 Jahre alte Soldatinnen und Soldaten, oft durch kleine, fast unsichtbare Bosheiten. Neulich hat mir jemand eine Geschichte erzählt, die sich an einem Checkpoint abgespielt hat: Ein erwachsener Palästinenser wartet, wartet und wartet, bis irgendeine junge Soldatin, vielleicht 18 Jahre alt, ihm ein herablassendes Handzeichen gibt. Allein diese Handbewegung reicht mir, um zu sagen: Das ist die Demütigung des menschlichen Antlitzes, sowohl seines als auch ihres. Ganz zu schweigen von den Morden an Palästinensern, die nicht oder nicht streng genug bestraft werden.
Ich habe noch während der Kämpfe auf dem Sinai geahnt, dass dieser Sieg zum Fundament des tiefen Hasses gegen Israel werden würde. Ich war zwar davon überzeugt, dass wir im Recht waren mit diesem Krieg, und dachte, dass wir kämpften, um uns zu verteidigen – ansonsten hätte ich mich geweigert, in den Krieg zu ziehen. Ich wusste aber, dass wir am Anfang einer langen und harten Auseinandersetzung mit der ganzen arabischen und moslemischen Welt standen. Ich wusste, dass sie unseren Sieg und ihre Demütigung uns nicht einfach vergeben würden. Ich wusste, dass dieser Krieg nicht unmittelbar zum Frieden führen würde. Ich wusste, dass dieser Frieden durch die Niederlage und Demütigung der Araber zerstört werden würde. Ich wusste auch, dass die Besatzung uns korrumpiert. In Gespräche mit israelischen Soldaten sprach ich nicht darüber, sondern in einem Artikel, den ich wenige Monate nach dem Krieg für die Zeitung Davar schrieb.
Das Gefühl der Erleichterung, das damals im Land herrschte, war verständlich, und auch ich fühlte mich erleichtert: Vorher dachten alle, wir stünden vor unserer Vernichtung, und keiner ahnte, dass wir den Krieg nach nur sechs Tagen mit einem so eindeutigen und großartigen Sieg beenden würden. Der Unabhängigkeitskrieg von 1948 hatte gerade 19 Jahre zuvor stattgefunden, und viele unter uns erinnerten sich, obwohl sie damals noch Kinder waren. Wir erinnerten uns genauso an die Belagerung, an den Hunger und an Bombardierungen, an ein Leben unter der Erde, im Bunker, wie an die Massen von Gefallenen, an die schweren Verluste und an langandauerndes Leid. Keiner glaubte, dass dieser Krieg ein Blitzkrieg werden sollte. Als es nach sechs Tagen zu Ende war, rieben sich die Menschen die Augen und waren fassungslos. Kein Wunder, dass ein ganzes Volk euphorisch wurde.
Aber meine Freunde und ich sahen die andere Seite der Medaille, wir sahen im Krieg das Leid des besiegten Feindes, wir sahen seine Erniedrigung, wir sahen den Preis, den der Feind bezahlt hatte. Und wofür eigentlich? Für die Aggressivität der arabischen Herrscher, für die Prahlerei von Nasser? Wir wussten, dass in diesem Moment Menschen aus der Westbank mit ihren Habseligkeiten, eingewickelt in Tüchern auf den Kopf, ins Exil fliehen mussten – und sahen vor unserem geistigen Auge das Bild des Bauern mit dem Stock in der Hand aus seinem Weg in die Diaspora. Wir wussten, dass er den Preis bezahlte für eine Sünde, die er nicht begangen hatte. Und dieses Gefühl brannte in uns und es war uns allen eine Qual – oder zumindest vielen von uns.
Ich kann mich an unseren Eindruck erinnern, dass uns die Shoa gleich zweimal begegnet war. Zum ersten Mal während des Wartens auf den Krieg, als viele das Gefühl hatten, dass uns eine neue Shoa treffen könnte, dass man uns vernichten würde, weil unser Feind zahlreicher und stärker war als wir, bewaffnet mit modernen sowjetischen Waffen. Gefühlt hatte die andere Seite die Zügel in der Hand und sah dem kommenden Krieg bereits siegessicher entgegen. Wir dachten, sie würden kommen und uns alle vernichten, wie in der Shoa. Das zweite Mal dachten wir an die Shoa, als wir die Karawanen der palästinensischen Flüchtlinge sahen. Einer von uns, der einst selbst ein Flüchtlingskind gewesen war, brachte es zum Ausdruck und sagte, dass er sich selbst in diesem Kind sehe, das von seinen Eltern auf den Armen getragen wird, vom verlassenen Dorf in die Diaspora. Ich selbst bin gegen solche unmittelbaren Vergleiche und war immer der Überzeugung, dass sich das Böse in der Welt auf unterschiedlichste Weise offenbart. Ich glaube, dass die Bereitschaft zur Differenzierung wichtig ist, um nicht unversehens selbst zum Diener des Bösen zu werden.
Das Lied, das damals in der Luft schwebte, hieß »Jerusalem aus Gold«, und es brachte das ganze Glück über den Sieg zum Ausdruck: das Gefühl der vollkommenen Erleichterung, die große Sehnsucht nach Jerusalem und die Freude über die Vorteile, die wir nach dem Sieg genießen würden. In diesem Lied von Naomi Shemer heißt es: »Wie vertrocknet die Brunnen sind, wie leer der Marktplatz. Keiner, der den Tempelberg besucht, in der alten Stadt … Lasst uns wieder hinabsteigen zum Toten Meer, über die Straße nach Jericho.« Kurz nach dem Krieg kritisierte ich die Verfasserin in einem Zeitungsartikel und machte meinem Ärger Luft. Der Marktplatz der Stadt war, bevor wir die Altstadt erobert hatten, nicht leer, sondern voll mit Menschen. Der Weg nach Jericho war nicht leer, täglich kamen und gingen Tausende von Menschen von Jericho nach Jerusalem und von Jerusalem nach Jericho. Die Behauptung, die Stadt sei leer gewesen, gleicht demjenigen, der in ein volles Kaffeehaus geht, nach links und rechts schaut und sagt: »Keiner ist da.« Richtig wäre es zu sagen: »Keiner meiner Freunde ist da.« Stattdessen aber: »Wie leer der Marktplatz« – es gab da eine starke ethnozentrische Neigung und eine große Bereitschaft zu ignorieren, dass es in den besetzten Gebieten einen besiegten Feind gab, dass die Gegend nicht leer war, sondern dort Millionen Menschen lebten, die von uns vergessen wurden, weil sie Araber waren.
Ich kann mich erinnern, dass während unserer Besuche für Gespräche mit israelischen Soldaten heiß diskutiert wurde und die Debatten oft bis in die Nacht andauerten. Anfänglich eher vorsichtig, öffneten sich die Leute während der Gespräche immer mehr und gaben ihre verborgenen Gefühle preis. Das war kein Entschluss, sondern verlief fast spontan. Man sagte uns etwa, dass es im Kibbuz Geva einen Kameraden gebe, der mit uns reden möchte. Also fuhren wir nach Geva. Nahman Raz versammelte eine Gruppe von Menschen, wir setzten uns hin und redeten. Dann sagte man uns, dass es eine weitere Gruppe im Kibbuz Ein Shemer gebe. In der Regel trafen wir uns zunächst mit ein oder zwei Leuten, die dann eine Gruppe anzogen, sodass die Gespräche sehr spontan und dynamisch verliefen. Am Ende unserer Reisen gab es noch etliche Kibbuzim, die wir nicht besucht hatten, und mit Sicherheit viele Menschen, die ihre Erlebnisse eigentlich erzählen wollten. Wir gingen vollkommen spontan und planlos vor. Wir haben nicht beschlossen, dass wir etwa die Negev besonders stark repräsentieren wollen oder Galiläa oder die Linken oder die Rechten. Wir fuhren tatsächlich einfach dorthin, von wo aus wir zuerst angerufen wurden.
Ich kann mich erinnern, dass ich ein wenig erschrocken war, als ich das fertige Buch in den Händen hielt. Ich hatte den Text nicht einmal am Stück gelesen, sondern jede Debatte einzeln. Ich dachte, was haben wir getan? Verderben wir etwa die Freude am Sieg? Trüben wir den nationalen Feiertag? Ich wurde unruhig, denn ich wusste, dass viele Menschen uns das Buch übel nehmen würden. Ich wusste, dass es harte Angriffe gegen uns geben würde, aber ab einem gewissen Punkt hatte ich auch das Gefühl, mit mir selbst eins zu sein: Ich war davon überzeugt, dass es gut war, die Dinge ausgesprochen zu haben, und gut, dass sie aufgeschrieben und in einem Buch erscheinen waren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Buch ein Bestseller werden und man es im ganzen Land lesen würde. Genauso wenig ahnte ich, dass es in viele Sprachen übersetzt werden würde. Daran habe ich nie gedacht.
Gespräche mit israelischen Soldaten wurde zum Ursprung verschiedener Friedensbewegungen. Der Fairness halber muss man sagen, dass es schon vor Erscheinen des Buches kleine Gruppen von Friedensaktivisten gab, auch schon vor dem Sechstagekrieg – Uri Avnery etwa oder die Zeitschrift Matzpen. Darüber hinaus gab es einige kleine radikale Gruppen, die Frieden predigten und die Zweistaatenlösung vorschlugen. Aber Gespräche mit israelischen Soldaten war ein großer Schub in diese Richtung. »Peace Now« wurde 1978, zehn Jahre nach dem Erscheinen des Buches, gegründet und basiert auf den darin ausgedrückten Ideen.
Im Krieg war ich an der Sinai Front, in der Division von General Tal. Ich war ein Reservist und in einer Propagandaeinheit. Ich saß nicht in einem Panzer, aber ich sah den Krieg aus der Nähe, und in einigen Fällen hat man auch auf mich geschossen und ich habe das Feuer erwidert. Solange du auf dem Schlachtfeld bist – bis heute fällt es mir schwer, darüber zu reden –, bist du beherrscht von einem Gefühl der quälenden Last und einer ständigen Angst. Angst davor, dass dir etwas passiert. Angst davor, dass demjenigen etwas passiert, der neben dir steht. Gleichzeitig ist da eine tiefe quälende Last, irgendeine innere Stimme, die dir sagt, dass dies kein Ort für Menschen ist, ein unmenschlicher Ort.
Nach Kriegsende hatte ich eindeutig das Gefühl, dass es mit dem Sechstagekrieg nicht zu Ende sein würde, dass die Araber diese Niederlage und diese Demütigung nicht einfach schlucken würden. Sie werden sich rächen, dachte ich, um zu korrigieren, was passiert ist, und um ihr Ansehen und ihre nationale Ehre wiederherzustellen. Klar war mir auch, dass die Besatzung zu einem Fluch werden würde und die Besetzten unendlich viel leiden würden.
Ich erinnere mich, dass wir kein Problem damit hatten, einen Laster zu besteigen und bis an die äußerste Grenze zu fahren, um mit den Leuten zu sprechen. Oft waren wir bis spät in die Nacht unterwegs und nachdem wir endlich um drei oder vier Uhr morgens zurückgekommen waren, konnte ich nicht schlafen. Ich kann mich an schlaflose Nächte erinnern wegen dieser Gespräche. Sie schwirrten in meinem Kopf umher, gerade so, als ob sie in mir weitergingen und die Dinge, die hätten gesagt werden müssen, aber nicht gesagt wurden, immer weiter in mir schwelten.
Die Menschen, mit denen wir sprachen, wollten vor allem beichten. In diesem Buch kommen die innersten Gefühle zum Ausdruck – Gefühle, die Menschen normalerweise nicht offen miteinander teilen, bestenfalls im Privaten mit dem Partner oder der Partnerin, aber nicht vor einem eingeschalteten Aufnahmegerät. Ich wundere mich noch heute, dass Menschen so bereitwillig waren, sich zu offenbaren und ihre inneren Blockaden zu überwinden, ihre inneren Widerstände. Viele hatten zunächst Zweifel und fragten, was für ein Buch daraus am Ende werden sollte. Wird es unseren Staat in den Schmutz ziehen? Dennoch haben sie diese Bedenken überwunden und geredet.
Die Menschen öffneten sich, und ihre Gefühle wurden sichtbar, weit mehr, als ich erwartet hatte. Unter normalen Umständen bremst der Mensch sich selbst, im Gespräch mit anderen zensiert er sich selbst. Aber jene Gespräche waren vollkommen unzensiert – vielleicht auch weil sie in der Nacht stattgefunden haben und Menschen sich in der Nacht mehr öffnen als am Tag. So ist Gespräche mit israelischen Soldaten auch ein Buch der Nacht. Als im ganzen Kibbuz schon alle schliefen außer dem Nachtwächter, saßen wir uns im Klubhaus oder im Zimmer eines Mitglieds gegenüber und redeten. Der Kaffee kochte, und die Gespräche begannen oft mit banalen Fragen: »Wie läuft es in Geva?« – »Was ist los in Hulda?« – »Was passiert, was gibt es Neues?« – »Wer ist verwundet?« – »Wie geht es ihm?«. Dann fingen wir langsam an, über das zu reden, was wir erlebt hatten. Irgendjemand setzte an, ein Zweiter fuhr fort, und ein Dritter erzählte, dass ihm das auch passiert war oder genau das Gegenteil – und so erwärmte sich das Gespräch und die Menschen öffneten sich. Es war wie ein kleines Wunder. Vorher war ich mir nie sicher, ob die Kameraden sich offenbaren würden. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich mich offenbaren würde.
In der Zeit nach dem Krieg war ich davon überzeugt, dass man uns die Gebiete innerhalb weniger Wochen wieder wegnehmen würde. Die Großmächte würden kommen und die eroberten Gebiete annektieren. Die fanatischen Rufe nach einer Annexion der Westbank, der Golanhöhen und von Gaza sind sicher nur hysterisches Geschrei, dachte ich. Doch ich hatte mich geirrt. Zwar weiß ich, dass damals im ganzen Land eine Bewegung entstanden ist, an deren Spitze große Namen standen, Schriftsteller und Staatsmänner – Menschen, die ich respektiere und verehre. Doch ich konnte nicht verstehen, wieso diese Menschen glaubten, dass die eroberten Gebiete leer seien? Glaubten sie wirklich, dass wir allezeit über mehr als eine Million Palästinenser herrschen könnten und dass sie unsere Herrschaft akzeptieren würden? Vergaß man etwa die Lehren, die wir unter der britischen Herrschaft gelernt hatten, als wir uns gegen die Fremdherrschaft erhoben hatten? Die Geschichte lehrt uns, dass es keine Besatzung gibt, die nicht auf dem Schwert sitzt. Über diese Ignoranz gegenüber den Lehren der Vergangenheit habe ich mich damals sehr gewundert.
Ich freue mich über dieses Buch – freue mich, dass es existiert. Ich freue mich, dass diese Stimme aufbewahrt worden ist, doch ich befürchte, dass ihre Botschaft heute in Vergessenheit gerät.
Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass jede Besatzung ein Fluch ist. Ich denke, dass das, was mit uns passiert ist nach dem Sechstagekrieg – die Besatzung und die Gier nach mehr (weiteren Siedlungen, um genauer zu sein) –, ich denke, dass dies das größte Unrecht ist, das der Zionismus gebracht hat, und gleichzeitig sein größter Fehler.
Aus dem Hebräischen übersetzt von Abraham Melzer
Einführung in die deutsche Ausgabe
Der Sechstagekrieg begann plötzlich und endete schnell. Was zunächst nicht mehr als Prahlerei und verbale Provokation zu sein schien, wurde fast über Nacht zu einer Bedrohung unserer Existenz. Auf zehn Tage der Spannung, Ungewissheit und Besorgnis folgte ein Krieg, den niemand von uns wollte, und ein Sieg, der weitaus größer war, als irgendjemand erwartet hatte. Für alle von uns war die Erfahrung traumatisch, aber für niemanden mehr als für diejenigen, die nie zuvor gekämpft hatten. Diejenigen, die die Wucht des ersten Angriffs ausgehalten hatten, kamen zurück, verwirrt von der Größe ihres Sieges und nicht weniger schockiert von der Enthüllung dessen, was Krieg wirklich ist: eine Enthüllung, auf die sie nicht vorbereitet waren, eine Wahrheit, die man sie gelehrt hatte, abzuweisen. Einer von ihnen, der versuchte, sein Erlebnis in literarische Form zu bringen, schrieb später: »Dieser Moder von Fleisch, der bis jetzt immer tabu für dich war (denn du hattest ja gelernt, »du sollst nicht töten«), liegt jetzt hoch aufgetürmt um dich herum, leblos wie die ausgebrannten Autos. Und du kannst dieses Grauen nicht in dir verarbeiten.«
Viele dieser jungen Männer kamen in einem Schockzustand aus dem Krieg zurück, und wie immer waren die Wirkungen des Schocks unterschiedlich und nicht berechenbar. Manche unterlagen einem Redezwang, sie brachten für sich selbst und ihre Kameraden die Szenen des Grauens und des Triumphs wieder zum Leben, verwischten die Taktiken und schufen eine Legende, aber niemals berührten sie die Tiefe ihrer in Konflikt stehenden Gefühle; sie blieben versteckt hinter der Wand von Worten und Handlung. Andere von ihnen blieben schweigsam, in sich gekehrt und schwermütig. »Ich glaube, ich war in einem Schockzustand«, sagte einer von ihnen später, »Nichts war klar definiert. Ich versuche immer noch, alles von mir wegzuschieben, ich will nicht daran denken … Ich will vergessen … ich bekomme ein schreckliches Gefühl des Abscheus und des Ekels, sobald dieses Thema erwähnt wird.«
So waren die Reaktionen einer ganzen Generation von Sabras, den im Lande geborenen Israelis, deren Zähigkeit eine Legende geworden ist, aber in deren innere Welt man nur schwer eindringen kann. Die Leute, die in Gesprächen mit israelischen Soldaten zu Wort kommen, sind nur ein Teil dieser Generation: diejenigen, die als die jüngere Generation des Kibbuz bekannt sind. Der größte Teil dieser Gruppe sind »Kinder der Kibbuzim«, hervorgegangen aus einer Generation hingebungsvoller Pioniere und erzogen nach dem Prinzip, dass »jeder entsprechend seinen Fähigkeiten und nach seinen Bedürfnissen« leben solle. Es ist ihr Charakter, der in nicht geringem Maße die Gespräche mit israelischen Soldaten zu dem machten, was sie sind. In vieler Hinsicht sind diese jungen Leute nicht anders als der durchschnittliche Sabra: in ihrem Pragmatismus, in ihrer lakonischen Ausdrucksweise, in ihrer Skepsis gegenüber der Rhetorik, den Ismen, dem Sprachstil und dem Gedankengut der älteren Generation. Wie ihre Zeitgenossen überall auf der Welt wurden sie reif nach dem »Ende der Ideologie«. So zögern selbst diejenigen, die dem Kibbuz-Lebensstil in höchstem Maße zugetan sind, ihre Ideale in Begriffen des Sozialismus, Zionismus oder irgendeiner anderen doktrinären Theorie auszudrücken. Ihre Werte drücken sich mehr in Aktionen und Einstellungen aus denn in Worten. Und doch ist das Kibbuzkind, wie schüchtern es auch sein mag, in der Anwendung der Phraseologie in mancher Hinsicht anders als sein in der Stadt aufgewachsener Zeitgenosse. Physisch hat es sein ganzes Leben lang seinen Körper bis zum Äußersten angestrengt, sei es bei der Arbeit oder beim Spiel. Kulturell wuchs es auf in einer Gemeinschaft, die sich bewusst bemüht, die besten Eigenschaften von Stadt und Land miteinander zu verbinden. Sozial gehört es zu einer Gruppe, die nahezu überall in Israel als Elite anerkannt wird, die sich der Förderung der nationalen und sozialen Ideale des Landes widmet. Für dieses Kind drücken sich diese Ideale in höchst konkreter Form aus: in seiner umfassenden Kenntnis des Landes und seiner Geschichte sowie in seiner Fähigkeit, in einer eng verstrickten Gruppe zu leben, deren sozialen und moralischen Standard es akzeptiert, ohne seine eigene Individualität aufzugeben. Einer der Sprecher in Gespräche mit israelischen Soldaten verweist auf den »Grundsatz des Kibbuzlebens: dass jeder Mensch seine eigene Welt hat und das Recht, sie zu gestalten«. Ein anderer findet das Wesen des Kibbuzlebens im Selbstrespekt, in der Konformität mit einer Norm, »in einem Satz: ›Was werden die anderen sagen?‹« Die Kombination dieser beiden Züge charakterisiert das Kind aus dem Kibbuz.
Die Standardbiografie dieser jungen Männer und Frauen ist in ihrer äußeren Form höchst einfach: bis zum Alter von achtzehn Jahren Schule, die eine allgemeine liberale Erziehung mit landwirtschaftlicher Ausbildung verbindet; zweieinhalb bis drei Jahre Militärdienst (mit darauf folgendem Reservedienst); Rückkehr in den Kibbuz und Aufnahme in die Gemeinschaft der Erwachsenen. Zum Zeitpunkt des Sechstagekrieges waren diejenigen, die die Gespräche mit israelischen Soldaten geschaffen haben, zwischen achtzehn und vierzig Jahre alt (die meisten von ihnen waren allerdings zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig), sie dienten in allen Teilen der Armee – als Rekruten, als Berufssoldaten und als Reservisten – und in allen Rängen vom einfachen Soldaten bis zum Oberstleutnant.
Solche Leute machen die große Masse der jüngeren Generation der Kibbuzim aus. Innerhalb derselben Altersstufe gibt es noch zwei andere Gruppen von Kibbuzmitgliedern, die zwar geringer in der Zahl, aber nicht weniger charakteristisch für diese Generation sind: die Graduierten aus Israeli-Jugendbewegungen und aus jüdischen Jugendbewegungen in der Diaspora, die nach ihrem Dienst im Nachal (das Armeekorps, das landwirtschaftlichen mit militärischem Dienst verbindet) neue Kibbuzim gründen oder sich einem bereits bestehenden anschließen.
Einer der Herausgeber von Gespräche mit israelischen Soldaten schrieb: »Die öffentliche Begeisterung, die auf den Krieg folgte, machte es nicht einfach, den privaten Emotionen und der Revolution, die er in der Gefühlswelt des Einzelnen verursachte, Ausdruck zu verleihen. Unsere Generation legte die Uniform ab und stützte sich selbst in Schweigsamkeit.« Solch ein Schweigen war nicht uncharakteristisch. Es war die natürliche Reaktion einer Generation, die das Redenhalten und Philosophieren ihrer Alten nicht zu beachten pflegte. Und als es dann zuerst gebrochen wurde – in den Diskussionen, die viele Kibbuzim abhielten, um zusammenzufassen, was der Krieg für sie als Gemeinschaft bedeutete, in den Zeitungs- und Radiointerviews, im Austausch von Erinnerungen mit Freunden –, war das Thema gewöhnlich die äußere Form des Krieges, mehr »was wir taten«, als »was wir fühlten«. Sie suchten nach einer Reflektion ihrer Erfahrungen in Zeitungsartikeln, in Kriegsalben und Fotografien. »Es war hart, alles zurückzulassen, ohne irgendetwas zu haben, wodurch man sich daran erinnern könnte«, sagte einer von ihnen später, »aber diese ganzen Bilder sagten mir überhaupt nichts.« Was sie suchten, war – wie ein hebräischer Satz sagt – »eine spirituelle Abrechnung«. Und sie brauchten einige Zeit, bis sie in der Lage waren, sie zu machen.
Im Sommer 1967 traf sich eine kleine Gruppe junger Kibbuzniks, um die Möglichkeit zu diskutieren, die Wirkung des Sechstagekrieges auf ihre Generation für immer festzuhalten. Sie waren sich nicht unbekannt, obwohl sie alle zu jeweils anderen Kibbuzim und sogar auch zu anderen Kibbuzbewegungen gehörten. Sie hatten bereits vorher bei drei verschiedenen Unternehmungen zusammengearbeitet: bei einer Zeitschrift für Jugendführer in den Kibbuzim und in den Jugendbewegungen, die mit ihnen verbunden sind; bei der Einrichtung von Clubs mit dem Ziel, den sozialen, kulturellen und intellektuellen Kontakt zwischen der jüngeren Generation in den verschiedenen Kibbuzim zu fördern; und in einer Reihe von literarischen Diskussionsgruppen innerhalb der Kibbuzbewegung. Was Leistung und Fähigkeit betrifft, so waren sie eine außergewöhnliche Gruppe. Darunter befanden sich zwei Autoren von in weiten Kreisen gelesenen Romanen; der Herausgeber einer Zeitschrift, deren Leserschaft weit über die Grenzen der Kibbuzbewegung hinausgeht, für die sie in erster Linie vorgesehen war; der Redakteur einer Tageszeitung; mehrere Schriftsteller, deren Artikel, Kurzgeschichten und Gedichte in Kibbuzzeitungen und in der täglichen Presse veröffentlicht wurden; Jugendführer und Lehrer. In anderer Hinsicht wiederum waren sie eine sehr gewöhnliche Gruppe junger Kibbuzniks. Keiner war über fünfunddreißig Jahre alt. Alle hatten sie etwa den Hintergrund, so wie er vorher beschrieben wurde (entweder waren sie Kinder aus dem Kibbuz oder Graduierte einer Israeli-Jugendbewegung). Alle waren sie in den Krieg verwickelt gewesen: die meisten in den Kampfeinheiten, manche in der Verteidigung ihrer eigenen Kibbuzim an den israelischen Grenzen. Sie wussten, was der Krieg für die jüngere Generation in den Kibbuzim bedeutete, denn sie gehörten selbst zu dieser Generation. Wie sie später sagten: »Wir fühlten in uns selbst das Bedürfnis, uns gegenseitig zuzuhören, miteinander zu sprechen, einen Dialog des Herzens und des Verstandes zu errichten. Wir wollten uns selbst und unseren Kameraden erklären, was mit uns in jenen sechs kurzen Tagen, die so endlos waren, passierte.«
Den Umfang ihrer Aufgabe und die riesige Verantwortung erkennend, baten sie zwei ältere Leute, sich ihnen anzuschließen: Abba Kovner, Ex-Partisane, erfahrener Autor und Kibbuznik, und Oberst Mordechai Bar-On, oberster Ausbildungsoffizier der Israeli-Streitkräfte. Sie erhielten winzige Unterstützungssummen von der Kibbuzbewegung und von der Histadrut, liehen sich Tonbandgeräte aus, überredeten ihre Kibbuzim, sie von Zeit zu Zeit von der Arbeit zu befreien, und reisten von Kibbuz zu Kibbuz, um die informellen Diskussionen zu organisieren und aufzunehmen. Als die Tatsache ihrer Existenz erst einmal bekannt wurde, bedurfte es nur noch wenig Organisation. In allen Teilen der Kibbuzbewegung entstanden spontan Gruppen. »Wir waren überrascht«, schrieb einer von ihnen, »wie offen, wie bereit, wie hoffnungsvoll diese Leute waren, wie erfreut sie waren, ungehemmt ihren versteckten Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu geben.«
Während der ganzen Diskussionen war das einzige Motiv das Sich-Selbst-Ausdrücken. Dies war eine Generation, die mit sich selbst sprach, ein echter Dialog, ohne Gedanken für die Außenwelt. Als die Themen klar wurden, versuchten die Interviewer, sie zu vertiefen, indem sie dieselben Fragen in verschiedenen Kibbuzim stellten, Diskussionsteilnehmer aus den verschiedensten Orten zusammenbrachten, Eltern und Kinder miteinander konfrontierten. Insgesamt gab es ungefähr dreißig Diskussionen, an denen sich insgesamt etwa 140 Personen beteiligten. Einige nahmen an mehreren Diskussionen teil und entwickelten verschiedene Teilaspekte und Persönlichkeitslegenden in verschiedenen Umgebungen. Manche konnten ihre Hemmungen nicht überwinden. Manche kamen und hörten nur zu. Viele blieben einfach weg.
Die Methode der Diskussion beruhte im Großen und Ganzen auf freier Verbindung, gewöhnlich begann sie mit irgendeiner allgemeinen Frage des Interviewers. Manchmal hatte der Interviewer sein eigenes Spezialinteresse oder verfolgte sogar seine Privatinteressen. In diesen Fällen wurde der Sache häufig eine andere Wendung gegeben, und das Interview wurde zu einer vielseitigen Diskussion, zu einer Konfrontation mehrerer Ansichten. Aber was immer der Ausgangspunkt war, eine gewisse Anzahl von Themen tauchte immer wieder in praktisch jeder Diskussion auf. »Der Dialog öffnet das, was auf keinem anderen Weg geöffnet werden kann«, schrieb Martin Buber. Solch ein Dialog ist der Kern der Gespräche mit israelischen Soldaten.
Der gewöhnliche Inhalt, mit dem Kriegsbücher angefüllt werden – Strategie, Taktiken, detaillierte Beschreibungen der Aktionen – spielt in diesem Buch praktisch keine Rolle. Die Aktion ist der allgemeine Rahmen, von dem die Teilnehmer ihre Erinnerungen, ihre Reaktionen und ihr Zögern abstrahieren. Auch dient sie mehr als einmal als Zuflucht: wenn die Emotionen zu stark werden, die moralischen Probleme nicht zu bewältigen sind, ist es leichter, die Erzählung zu wechseln oder über Taktiken zu sprechen. Aber in einer Hinsicht hatte der Verlauf des Krieges eine entscheidende Wirkung. Mehr als zwei Wochen war die Armee mobilisiert, jeden Moment einsatzbereit, aber inaktiv. Während dieser Periode gab es Zeit zum Nachdenken, Zeit für Freundschaften, die sich unter den Soldaten herauskristallisierten, Zeit, sich auf das vorzubereiten, was vor einem lag. Manche betonen die Zweifel und die verborgene Angst dieser Periode, manche die außergewöhnlich hohe Moral: »Die Antwort auf den Aufruf war 120-prozentig – niemand wollte ausgelassen werden.« Andere sprechen von politischen Zweifeln und Zögern (›Verdammt noch mal, warum machen sie nicht Dajan zum Verteidigungsminister?‹) und unterstreichen ihre widersprüchlichen Emotionen: die Bereitschaft zu kämpfen und das Gefühl der Angst.
Eine Frage ist kaum diskutiert, denn es ist die Voraussetzung, die all ihren Gedanken zugrunde liegt, eine Vorbedingung ihrer Bereitschaft zu kämpfen. Dies war ein defensiver Krieg, der dem Volk Israels durch eine nicht provozierte Bedrohung seiner Existenz aufgezwungen wurde. ›Jeder wusste, dass die Krise durch Nasser heraufbeschworen wurde, als er seine Truppen mobilisierte. Es war für uns einfach eine Frage von Leben und Tod.‹ Hätten sie irgendwelche Zweifel gehabt, sie wären in den eroberten Gebieten durch eigene Anschauung zerstreut worden: Propagandaplakate und Schulbücher, die Hass einprägen sollten, Kampfanweisungen für die Vernichtung jüdischer Siedlungen. Manche waren für die Herausforderung besser gewappnet als andere. Der junge Pilot, der sagt: »Ich roch den Duft des Krieges, und es war ein süßer Duft«, ist in der Minderheit. Andere sagen einfach: »Es gab keine Alternative.« Zusammen geben sie die Stimmung vom 5. Juni 1967 wieder.
»Plötzlich war dies Geschichte.« Es war auch für viele, das Tal des Todes, die Zeit härtester Prüfung und größter Leistung. Und dann, fast genauso plötzlich, wurde David zu Goliath, und diese selben Helden sahen sich der »Tragödie« gegenüber, »Sieger zu sein«. Da war es kein Wunder, dass sie eine lange Periode der Ruhe brauchten, um ihre komplexen angehäuften Emotionen wieder zu sammeln.
Einige dieser Emotionen sind universell und können in der Literatur über irgendeinen Krieg gefunden werden. Der plötzliche Schock des Kontaktes mit dem Tode paralysierte sogar die an Härtefälle gewöhnten Ärzte. »Genau wie die schreckliche Angst – so verlässt dich dein Verstand.« Und oft scheint es, als hätten sie sich noch nicht erholt von dem Trauma; immer noch besteht ein Widerwille, die Folgerungen des Todes zu untersuchen oder sie mit ihrem persönlichen Gewissen in mehr als höchst allgemeinen Begriffen in Beziehung zu setzen. Wie ein Fallschirmspringer bemerkt: »Wenn ich sicher hinunterkomme, dann sehe ich die Dinge mehr ausgewogen.«
Mit der Gegenwärtigkeit des Todes kommt die Angst. Alle fürchteten sie sich, und niemand leugnete es. Wie konnten sie dann überhaupt kämpfen? »Du hast Angst, bis die erste Kugel kommt«, sagte einer, und das scheint das allgemeine Gefühl zu sein. In der Hitze des Kampfes bleibt nur Zeit zum Handeln. Die Offiziere behaupten, dass das Gefühl der Verantwortung die Angst vertreibt; andere fassen Mut am Beispiel ihrer Offiziere. Alle sprechen von ihrer Ausbildung, ihrer technischen Kompetenz, davon, dass sie automatisch handeln. Niemand will zugeben, ein Held zu sein; selbst der junge Hauptmann, der fragt, »Was ist Heldentum?«, wird nicht zu einer Antwort bereit sein. Die Wahrheit, beurteilt nach den Handlungen, die sie beschreiben, scheint zu sein, dass die akzeptierte Norm nahe ans Heldentum heranreicht; aber sie zögern, es bei diesem Namen zu nennen. Wie wurde dieser Standard erreicht? Ein Teil der Antwort liegt klar in der Überzeugung, dass der Krieg sowohl unvermeidlich als auch berechtigt war, viel auch in der hohen Moral und der Brüderschaft der Waffen, die man in allen Nationen in Momenten höchster Gefahr findet und wie sie oft in diesen Diskussionen beschrieben wird, dann aber auch in dem hohen Standard technischer Ausbildung, die die israelische Armee charakterisiert. In nicht geringem Maße aber resultierte er aus der Eigenart dieser Armee.
Es ist in erster Linie eine Armee von Dienstpflichtigen. Die große Mehrheit ihrer Soldaten, sowohl Offiziere wie auch einfache, wurde in den letzten Tagen des Mai 1967 von ihren Beschäftigungen in der Friedenszeit einberufen; und es war nicht übertrieben zu sagen: »Diese Armee ist jetzt die Nation, sie gehört der Nation.« Diese Vorstellung wird auch hier in den Diskussionen zwischen den Soldaten und ihren Eltern, die zurückblieben, betont, sei es in Worten des Vaters, der eine fast mystische Einheit mit seinen Kindern an der Front empfindet, sei es im Offizier, der fühlte, dass das Weiterbestehen des Lebens in seinem Kibbuz ein Symbol für ihn während des ganzen Krieges war. Ihre zweite besondere Charakteristik ist zusammengefasst in dem Satz »nach mir«. Der Offizier wird erzogen, der Erste in der Feuerlinie zu sein, durch sein persönliches Beispiel anzuführen. Dieses Thema taucht immer wieder in allen Diskussionen über persönliche Tapferkeit auf: »Heldentum ist fast eine Sache der Technik geworden«, sagt ein junger Offizier. Natürlich, es ist dies und mehr. »Wie kann man vielleicht einen Soldaten zwingen, dir vorauszugehen?« fragt ein anderer. »So wie ich das sehe, ist das einfach nicht ethisch, es ist nicht logisch.« Das ist keine militärische Technik. Es ist soziale Moral.
Ein historischer Bericht über die Entwicklung der israelischen Armee würde besonders den Einfluss der Palmach unterstreichen, der besten Einheiten der Hagana1, die sich größtenteils aus den Kibbuzim rekrutieren und von deren Gedankengut erfüllt sind. Er würde das Prinzip des »Nach mir« zurückverfolgen auf das Kibbuzprinzip, das bekannt ist als »Selber arbeiten«: der Glaube, dass es falsch ist, sich darauf zu verlassen, dass andere irgendeinen Job machen, angefangen bei physischer Arbeit bis zur Selbstverteidigung. Es ist leicht, den Vergleich zu verstehen, der in Gesprächen mit israelischen Soldaten oft zwischen der Armee und dem Kibbuz gezogen wird. Dieselbe Beziehung ist ausgedrückt in anderen Aspekten des Armeelebens: besonders in der Rolle, die die Frauen im Armeeleben spielen, und in der informellen Beziehung, die zwischen Offizieren und Männern besteht. Als ein kommandierender Offizier sagte: »Ich will Befehle hören und nicht ›Kommt her, Jungs, lasst uns dies oder jenes machen‹«, hätte er wissen müssen, dass sein Protest nur geringe Wirkung haben würde.
In dieser Art von Armee ist der Kibbuznik, physisch zäh, mit seinem scharfen Sinn für soziale Werte sehr gesucht. Die Zahl der Offiziere, die Mitglieder von Kibbuzim sind, liegt weit über ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung; und sie zahlten den Preis für den Sechstagekrieg mit einer ähnlich disproportional hohen Zahl von Toten und Verwundeten. Das Interesse an und der Einfluss auf die Gespräche mit israelischen Soldaten ist nicht nur ein Tribut an dieses Opfer. Es ist die Bestätigung, dass diese jungen Männer in einem sehr realen Sinne den Geist der israelischen Armee repräsentieren.
›Der Unterschied zwischen dem Dienstverpflichteten und dem Berufssoldaten besteht in der moralischen Beurteilung, die der Dienstverpflichtete für sich selbst macht.‹ Auch in dieser Hinsicht typisieren die Gespräche mit israelischen Soldaten eine ganze Armee. Da gibt es nichts von jenem Pazifismus, zu dem der Erste Weltkrieg viele Engländer gebracht hatte; dafür saß die Überzeugung, dass Israels Sache gerecht sei, viel zu tief. Hingegen besteht ein überwältigender Eindruck der Abkehr, des Protestes gegen den Umsturz all derjenigen Werte, die sie und ihre Gesellschaft hoch schätzen. Beim Anblick eines in der Wüste Sinai zertrümmerten ägyptischen Konvois sagt einer: »Man soll jungen Menschen so etwas nicht zeigen. Auf keinen Fall aber darf man es Israelis zeigen, denn unsere ganze Erziehung zielt auf Konstruktion. Und dies ist ein klassisches Beispiel für Destruktion.« Aber die Zerstörung von Besitz ist noch der geringste Teil der Tragödie eines Krieges. In diesem Buch ist der Frage der Einstellung des Soldaten gegenüber seinem Feind weitaus mehr Platz gewidmet als irgendeinem anderen Einzelproblem. Immer wieder taucht dasselbe Thema auf: Angst vor den brutalisierenden Wirkungen des Krieges und die Gefahr, ›die Ähnlichkeit mit einem Menschen zu verlieren‹. Diese Soldaten sind nicht übermenschlich; ihre düsteren Instinkte erwachen unter dem Druck des Krieges. In einer Passage in Platons Republik diskutieren einige das Verlangen, ihre Augen sich am Anblick von Leichen als Symbol der Entmenschlichung weiden zu lassen. Und dann ist die Frage des Hasses fast eine fixe Idee. »Wie kann man kämpfen, ohne zu hassen?«, fragen sie. Und wirklich, sollte man es tun? Nicht alle von ihnen denken so. »Ich hasse die Araber, so einfach ist das«, sagt der Pilot, dessen Kameraden nach der Gefangennahme gelyncht und gefoltert wurden. Andere sondern die Syrier aus – auf natürliche Weise. nicht wegen ihres Anteils, den sie am Ausbruch des Krieges haben, sondern wegen ihrer barbarischen Behandlung der Gefangenen. Andere wiederum bekennen, dass sie Nasser hassen, weil er sein eigenes Volk enttäuscht hat. Aber die weitaus größere Mehrheit gibt zu, keinerlei Hass zu verspüren. »Ich hatte keine Gewissensskrupel, auf (einen Araber) zu schießen«, sagt einer, »aber ich war froh, als er davonkam.« Vielleicht kann man in den Worten von einem von ihnen, der dieselbe Frage bezüglich seiner deutschen Verfolger stellte, einen Aufschluss für diesen Widerspruch finden: ›Richtiger Hass muß irgendeinen definierten Brennpunkt haben – irgendjemand, zu dem man eine Art persönlicher Beziehung hat. Zu sagen, du hasst Araber – das ist nur Gerede.‹ Derselbe Flieger, der die Araber hasst, sagt später: »Verstehst du nicht den Unterschied zwischen mir und dir? Von der Luft aus sehe ich die Leute einfach gar nicht sterben.« Diejenigen, die den Araber verwundet, besiegt, sich ergebend sehen, können ihn als einen Menschen sehen, der leidet und Gnade verdient. Die quälenden Probleme des Krieges liegen in solch doppelsinnigen Situationen. Wird der Mann, dem du Wasser in der Wüste Sinai gabst, überleben, um dich dann in den Rücken zu schießen? Kannst du es riskieren, nicht auf einen Mann zu schießen, der Zivilist sein kann, wenn er auch Soldat sein kann? Sollst du dein eigenes Leben riskieren, um arabische Kinder aus dem Kampfgebiet zu befreien? Es kann darauf keine einfache Antwort geben und kein klares Abgrenzen. In einer Sache sind sie sich jedoch alle einig: Der Krieg wird mit den arabischen Armeen geführt, nicht mit den arabischen Völkern; und als Folge enthält man sich des Plünderns. Damit soll nicht behauptet werden, dass die israelische Armee nie Handlungen der Grausamkeit, des Plünderns oder der mutwilligen Zerstörung begangen habe. Obwohl solche Handlungen relativ selten waren, erhalten sie hier eine moralische Bedeutung außerhalb ihrer materiellen Wirkung. Aber wenn man den Bericht des Offiziers liest, der seine Truppen warnt, nicht zu plündern, und seine Worte mit Zitaten aus der Bibel und Kommentaren der Rabbiner unterstreicht oder seinen ausdrücklichen Befehl, Zivilisten keinen Schaden zuzufügen, mit den biblischen Worten abschließt, »Ihr Blut soll auf eure Häupter kommen«, wie kann man dann die Frage, die einer dieser jungen Männer stellte, nicht ständig wiederholen: »Ist dies eine normale Armee? Ist dies ein normales Volk?«.
Die Bibel spielt eine entscheidende Rolle in der Erziehung eines jeden Israeli. Aber dies waren keineswegs nur literarische Referenzen. In weiten Kreisen war man der Ansicht, dass der moralische Eifer des Krieges eine Rückkehr zu den geistigen Quellen des Judaismus mit sich bringen würde; und das Kriegsergebnis gab diesem Gefühl eine recht spezifische Empfehlung. Orte, die aus der Bibel und der jüdischen Geschichte vertraut waren, wurden plötzlich physisch zugänglich. »Ich habe ein Gefühl, als hätte sich ein Vorhang gehoben, und das Ewige Buch wäre zum Leben erwacht, wohl vertraut und unmittelbar. Das ganze Gelobte Land gehört uns.« Diese Gefühlswelle erreicht ihren Höhepunkt mit der Eroberung von Jerusalem und besonders der westlichen Stadtmauer, dem Symbol des alten jüdischen Reichs und des jüdischen Sehnens seit Jahrhunderten. Es war vielleicht nicht überraschend für die religiösen Juden, die dreimal täglich für die Rückkehr in die Heilige Stadt beten. Für andere war es eine Offenbarung. »Ich hatte das Gefühl, als möchte ich gern meine ganzen Vorfahren aus allen Generationen herholen und zu ihnen sagen ›Seht her, ich stehe an der westlichen Stadtmauer‹«, sagte ein Flieger, der zum Atheismus erzogen war.
Für ihn und für viele seiner Generation war dies der Höhepunkt einer vollendeten geistigen Offenbarung. Der Durchschnittssabra im Kibbuz oder in der Stadt fühlt sich als ein anderer Jude als seine Brüder in der Diaspora. Wenige sind in der Lage zu verstehen, wie die Juden Europas fast ohne Kampf abgeschlachtet werden konnten. Die meisten empfinden mehr Verwandtschaft mit ihren Vorfahren aus der biblischen Periode, die im Lande Israel lebten, als mit ihren Ahnen jüngerer Zeit in Europa und dem Mittleren Osten. Plötzlich von Vernichtung bedroht, identifizierten sie sich mit den Juden der Hitler-Ära. ›In jenen Tagen vor dem Krieg erlitten wir wieder fast jenes Schicksal, vor dem wir wie von Geistern verfolgt all diese Jahre weggelaufen sind.‹ Und nach dem Sieg wurden Jerusalem und die westliche Stadtmauer als Symbole betrachtet, die sie mit den langen Generationen des Diaspora-Judentums vereinten. Mehr als dies. Unter dem Druck des Krieges hatten sie entdeckt, dass die Phraseologie, die sie in den Worten ihrer Väter vermutet hatten, eine neue Bedeutung für sie hatte. »Vor dem Krieg habe ich immer gedacht, dass dies ganze Gerede über die Liebe zum eigenen Land vor allem Phraseologie war. Aber während des Krieges stellte ich fest, dass dies die Dinge waren, die einem Kraft gaben.« Diese Emotionen und ihre Implikationen werden in den Diskussionen zwischen Eltern und Kindern untersucht. In gewisser Weise unterstreichen sie eher die Lücken zwischen den Generationen, als dass sie sie schließen: Der Ex-Partisane kann nicht glauben, dass diese jungen Helden wirklich gedacht haben, der Staat Israel könnte vernichtet werden; der ehemalige Zionist kann nicht die Art und Weise akzeptieren, in der seine Söhne ihren Patriotismus in Begriffen ihrer eigenen physischen Verbundenheit mit dem Land ausdrücken. Auch innerhalb der Generationen selbst gibt es verschiedene Meinungen: in ihren Haltungen zu den Arabern, zur Diaspora, zur jüdischen Geschichte. Aber der Dialog zeigt die zionistische Bewegung und ihr menschliches Ergebnis, den Sabra, in historischer Perspektive.
Er berührt auch einen weiteren Aspekt, der durch das ganze Buch hindurch auf unterschiedlichen Ebenen untersucht wird. Wenn der Arzt, der einen arabischen Gefangenen behandelt, mit Schreien von ›Lang lebe Israel‹ begrüßt wird, reagiert er mit Verständnis, aber auch mit Abscheu. Wie können sie so gänzlich frei von Nationalstolz sein? Der siegreiche Soldat identifiziert sich selbst emotional mit den arabischen Flüchtlingen. Schulmeister und Autor diskutieren in intellektuellen Begriffen den Konflikt nationaler und menschlicher Rechte, die die zionistische Siedlung mit sich bringt. Einer weicht sogar von der allgemeinen Übereinstimmung ab und sieht das arabische Jerusalem als eine fremde Stadt. Es ist keine klare Lösung da, denn es kann keine geben, nur eine Erforschung und ein tiefes Verstehen der »Tragödie des Zionismus«.
Diese Tragödie drückt sich in humanitären Begriffen aus: Verfolgung und Ermordung einerseits, Krieg und Vertreibung andererseits. Ein großer Teil der Gedanken richtet sich auch auf die politischen Folgerungen. Trotz ihrer tiefen emotionalen Verbundenheit mit dem biblischen Land Israel fühlen nur wenige, wenn überhaupt welche, dieser jungen Männer, dass es ihnen gehört durch unveräußerliches Recht der Eroberung. Sie wissen nicht, was der Preis für den Frieden sein wird, aber sie sind bereit, ihn zu zahlen; denn das ist es, was sie in erster Linie wollen. »Friede ist die erste Sache, die man erstreben muß. Er ist wichtiger als die Liebe zum Land und all die anderen Dinge, die so wichtig in sich selbst sind.«
Aber wird er kommen? Hier gehen sie in ihren Meinungen auseinander. »Sie müssen jetzt mit uns verhandeln«, sagt einer. Andere sehen die Zukunft als die Fortführung einer Vergangenheit, in der der Krieg ein häufig auftauchendes Motiv in ihrem Leben war. »So leben wir, und so müssen wir unsere Kinder erziehen.« Und von hier wieder zum moralischen Problem, mit dem der Krieg sie konfrontiert hat. »Wie lange können wir es ertragen als gewöhnliches Fleisch und Blut? Werden wir das Schwert immer nur in einer Hand halten?« Kann ein Individuum oder eine Nation im Kriegszustand leben, ohne dass das Leben etwas Billiges wird und moralische Werte verkommen? Und wiederum die Antwort: Was können wir anderes tun als zu versuchen? Und so kehren diese jungen Männer und Frauen ohne Frohlocken über ihren Sieg zurück zu den Problemen der Wiederanpassung an ein normales Leben, das jetzt, angesichts der Gefahr und des Todes, um so kostbarer erscheint. Nach jedem großen Krieg scheint es eine Chance für einen neuen Anfang zu geben: Soziale Schranken waren niedergerissen, neue Horizonte haben sich aufgetan. In diesem Krieg kam eine ganze Generation zu ihrem Geburtsrecht. Sie kamen von Eltern, deren Heldentum sie anerkannten (»Ich brauche es dir, der du es dein ganzes Leben lang getan hast, nicht zu erklären, was es genau bedeutet, alles zu geben«, schrieb einer von ihnen am Vorabend des Krieges an seinen Vater) und welches selbst in diesem heroischen Buch hervorsticht. Erst jetzt fühlten sie, dass sie ihnen ebenbürtig waren. In diesem Prozeß spielten die Gespräche mit israelischen Soldaten eine entscheidende Rolle. Innerhalb der Kibbuzbewegung brachte ihnen die Entwicklung des Dialoges als solche zunehmende Selbsterkenntnis, die Kristallisierung neuer Haltungen und neuer Fragen. Außerhalb wurden sich die Leute plötzlich des besonderen Charakters einer Generation im Kibbuz bewusst, von deren Existenz sie kaum etwas gemerkt hatten. Durch die Gespräche mit israelischen Soldaten begann diese Generation, sich selbst zu finden.
Der Prozeß geht weiter. Ein ganzes Netz von Diskussionsgruppen und Inter-Kibbuz-Aktivitäten ist entstanden, das frühere organisatorische und ideologische Barrieren überwindet und eine frische, positive und idealistische Kraft in der Kibbuzbewegung und im Staate Israel ist. Eine weitere Serie von Dialogen ist aufgenommen, die sich mit den praktischen, moralischen und kulturellen Problemen des Kibbuz im modernen Zeitalter beschäftigt. Vor allem aber geht der Dialog, so wie er in Gesprächen mit israelischen Soldaten begonnen wurde, im Herzen und Verstand eines jeden Kibbuznik und Israeli weiter.
Die Interviewer wurden zu einem Redaktionsstab. Die Tonbänder wurden abgeschrieben, und die Themen, die immer wieder bei allen Diskussionen auftauchten, wurden isoliert. Sie wurden untermauert durch Hinzufügung »fertiger Stücke« aus Kibbuzzeitungen, Auszügen aus Tagebüchern und Ähnlichem. Von Anfang bis Ende wurde versucht, die zögernde wiederholende Natur des gesprochenen Wortes wiederzugeben. Es wurde beschlossen, eine grobe chronologische Aufteilung des Materials vorzunehmen und anschließend das Material auf die Überschriften, unter denen die Abschnitte dieses Buches stehen, zu verteilen. Aber diese Einteilung wurde nicht streng durchgeführt, um etwas von der kameradschaftlichen Natur der ursprünglichen Diskussionen beizubehalten.
Im Oktober 1967 erschien die erste Auflage. Zwanzigtausend Stück wurden hergestellt – genug für jede Familie in der Kibbuzbewegung – und zum Herstellungspreis verkauft. Innerhalb von Wochen hatte sich der Ruf des Buches in ganz Israel verbreitet. Es ging von Hand zu Hand. Eine weitere Auflage wurde verlangt und innerhalb von Wochen ausverkauft. Es wurde deutlich, dass das Buch Themen allgemeiner Bedeutung berührte und ein Interesse weit über die Grenzen des Kibbuz hinaus erregte. Rezensionen und Auszüge wurden in der Tagespresse gedruckt, obwohl das Buch im eigentlichen Sinn des Wortes nicht veröffentlicht worden war.
Der Redaktionsstab befand sich in einem Dilemma. Die Diskussionen waren privat, ja, fast intim gewesen. Würde eine Auflage für die allgemeine Öffentlichkeit nicht Missbrauch des Vertrauens bedeuten? Die Teilnehmer und ihre Kibbuzim waren schnell zu identifizieren. Würden sie Publicity dieser Art nicht übel aufnehmen? Und würde die Veröffentlichung nicht zu unaufhaltsamen Anfragen der Massenmedien führen, die den Charakter der ursprünglichen Diskussionen verdrehen würden? Man hatte bereits Anfragen für Radioadaptionen und sogar dramatische Fernsehversionen erhalten. Selbst die erfahrensten und professionellsten der Redakteure hatten Angst vor dem Druck der Kommerzialisierung.
Das Dilemma wurde durch die israelische Öffentlichkeit gelöst. Es wurde offensichtlich, dass die Ausgabe, die ›nur für interne Verteilung‹ bestimmt war, weit außerhalb der Kibbuzbewegung in Umlauf gewesen war. Eine allgemeine Ausgabe wurde aufgelegt, und bis jetzt sind insgesamt etwa siebzigtausend Exemplare verkauft worden – für den israelischen Büchermarkt mit Abstand der Bestseller.
Während sie diese Ausgabe vorbereiteten, wurden die Herausgeber mit Vorschlägen und Gegenvorschlägen belagert, was der israelischen Öffentlichkeit angeboten werden sollte: Einige meinten, dass die Protagonisten als zu pazifistisch, andere wieder als zu blutdurstig erschienen; einige fanden, dass die politischen Fragen zu sehr im Vordergrund stünden, andere wieder, dass sie nicht ausdrücklich genug betont seien; manche beschwerten sich über die Anonymität der Teilnehmer, andere darüber, dass sie zu leicht zu erkennen seien. Die Herausgeber widerstanden all diesen Anforderungen, und die allgemeine Ausgabe war in allen essentiellen Hinsichten eine genaue Wiedergabe der Originalversion. Auf dieser Ausgabe basiert die Übersetzung.
Ein Teil der Begeisterung der Öffentlichkeit für die Gespräche mit israelischen Soldaten beruhte auf dem allgemeinen Interesse am Sechstagekrieg, zum anderen Teil auch auf der einzigartigen literarischen (oder nicht-literarischen) Form, die es nie zuvor in der hebräischen und vielleicht irgendeiner anderen Literatur gab. Am wichtigsten jedoch war der Inhalt: die direkte und ehrliche Weise, in der das Buch die Fragen behandelte, die durch den Kontakt mit Krieg, Tod und Leiden entstanden waren; die Anteilnahme an Problemen, die fundamental für den Staat Israel sind, und die offene Art, in der sie diskutiert wurden ohne Nachgiebigkeit gegenüber akzeptierten Ansichten oder akzeptierter Bilderstürmereien. Es half, Konflikte und Einstellungen zu kristallisieren, die für jeden israelischen Staatsbürger relevant waren – und sind.
Lutz Unterseher und Wolf Keienburg, Frankfurt 1970
Die Übersetzung
Das Zögern, dass die Herausgeber vor der Auflage der allgemeinen Ausgabe befiel, wiederholte und intensivierte sich, als eine Übersetzung vorgeschlagen wurde. Es wurde überwunden durch folgende Überlegung: der Glaube, dass eine Veröffentlichung zu dem Verständnis im Ausland für die Natur Israels und seiner Jugend, seiner moralischen Errungenschaften und seiner Probleme beitragen könnte.
Der gesamte Text erscheint nicht in der Übersetzung. Manches ist überholt, manches bezieht sich nur auf ganz spezifische Probleme der Kibbuzbewegung; und die Bemühung, das gesprochene Wort wiederzugeben, führte zu Wiederholungen, die dem ausländischen Leser nichts weiter geben. Aber wir glauben, dass wir sowohl den Geist des Originals als auch das Wichtigste seines Inhalts wiedergegeben haben.
Ich hatte kein schlechtes Gewissen, als ich zu schießen begann – doch freute ich mich, als er entkam …
Aus einem Gespräch in Yif’atInterviewer: Rachel Halprin und Avraham Shapira
Yif’at ist ein großes, gut entwickeltes Kibbuz etwa dreißig Kilometer östlich von Haifa mit mehr als tausend Einwohnern, darunter der jetzige Landwirtschaftsminister und viele andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und der Kibbuzbewegung. Seine Wirtschaft beruht auf hoch intensiver Landwirtschaft und einer Fabrik für Herstellung und Montage landwirtschaftlicher Geräte.
Teilnehmer: Amram, zweiundzwanzig, ein Jugendleiter, der mit Gruppen unterprivilegierter Jugendlicher zusammenarbeitet, die im Kibbuz erzogen werden. Im Sechstagekrieg diente er als Sergeant (Reservist) bei den Fallschirmjägern und kämpfte am Jordan und in den Golanhöhen in der Division, die von Elisha Shelem befehligt wurde. Aaron, dreiundzwanzig und Vater eines Kindes, arbeitet in der Fabrik von Yif’at und besucht jetzt technische Kurse für Fortgeschrittene am Technion in Haifa. Er diente als einfacher Soldat bei den Fallschirmjägern und kämpfte in Jerusalem. Lotan, dreißig, Vater eines sechs Monate alten Kindes, wurde im Kibbuz Mizra erzogen und folgte seiner Frau bei ihrer Heirat nach Yif’at. Er arbeitet als Landvermesser in Yif’at und in anderen Siedlungen der Umgebung. Im Sechstagekrieg kämpfte er als Sergeant in einer Spähpatrouilleneinheit. Rafael, fünfundzwanzig, Vater von zwei Kindern, ist ein enger Freund von Aharon ben Shachar und war mehrere Jahre als Jugendführer aktiv. Nach seinem Armeedienst verbrachte er ein Jahr in einem jungen Kibbuz, Sde Boker. Im Sechstagekrieg kämpfte er in einer bewaffneten Einheit, die Nablus einnahm, und dann in den syrischen Höhen. Chagai, einundzwanzig und seit einer Woche vor Kriegsausbruch verheiratet, arbeitet im Getreideanbau. In seiner Freizeit ist er Jugendleiter und Archäologe. Er ist Sergeant bei den Fallschirmspringern, aber wurde nach einem Unfall während eines Übungssprunges für dienstuntauglich erklärt. Anfang Juni 1967 ›lief er von zu Hause weg‹ und kämpfte im Sechstagekrieg bei einem Infanteriebataillon am Jordan.
Amram: Zwar war es nicht der erste Krieg … ich war eine kurze Zeit in Samo’a, das war aber nichts Ernstes. Auf jeden Fall – bis ich einem feindlichen Soldaten Auge in Auge gegenüberstand … oder … ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll … dieses Gefühl zu töten … und was ich empfinden würde … wusste ich nicht genau, wie ich reagieren würde. Als wir auf ein paar ihrer Leute stießen und an ihnen vorbeiliefen … zwar war das noch nicht viel … woanders gab es eine viel größere Anzahl von Toten. Bei uns und auch bei ihnen. Einer langte mir, der zerschmettert am Boden lag und noch zappelte … unwichtig, von welcher Seite. Ich weiß, dass ich ein sehr unangenehmes Gefühl hatte. Mir war übel. Ich muss gestehen, dass ich weiß nicht, ob ich es Mitleid nennen kann … ob es richtig ist … doch irgend so was wird’s sein. Sogar wenn es … manchmal … wenn es Soldaten waren, die vor einer Minute gerade noch auf uns geschossen hatten, genau wie wir auf sie. Wie sie Deckung suchen, tun wir’s auch … und dann stürmen sie, oder wir stürmen … Und plötzlich, als er dalag und man schoss noch auf ihn, und er zappelte noch irgendwie, da war er für mich nur eine bemitleidenswerte Kreatur, und wir liefen schnell vorbei. Es war schwer, sich das lange anzusehen. Dort war einer von ihnen, ein Syrer. Er war verwundet, sehr schwer verwundet und hatte Schmerzen. Er gehörte zur El-Fatah, und in unseren Soldaten – in allen – brannte der Hass auf sie. Einer schlug vor, ihn zu liquidieren. Selbstverständlich waren wir dagegen.
Ich gehe vom Standpunkt aus, dass dieser Araber ein Mensch ist … gleichgültig, was er vorher getan hat. Als dieser Mann dort lag, von einer Granate zerschmettert, dachte ich … für mich … er bleibt immer noch ein Mensch. Selbst wenn er im Sterben liegt. Deshalb wäre ich auch nicht hingegangen und hätte ihn umgebracht. Ich habe so was noch nie erlebt, dass ein Soldat dalag und man ihn umgebracht hat. Für mich gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen einem Soldaten, der in den Kampf zieht, um zu töten oder getötet zu werden, und einem Soldaten, der die Arme hebt.