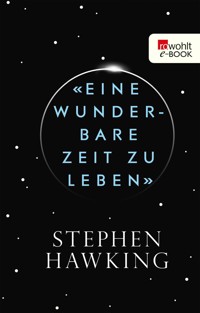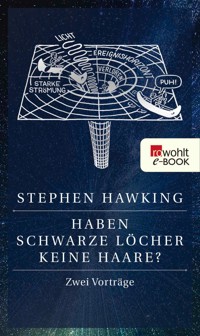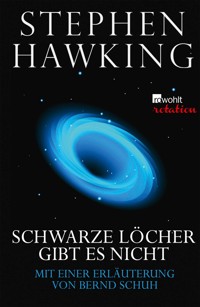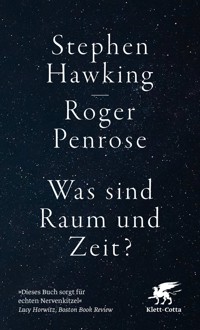12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das meistverkaufte Sachbuch der Welt: besser, umfangreicher und schöner als je zuvor Seit Stephen Hawking ist das Universum ein anderes: Es gibt eine Zeit vor ihm und nach ihm, denn er hat die Astronomie und unser Verständnis für das Rätsel des Universums revolutioniert. Mit »Eine kurze Geschichte der Zeit« gelang Stephen Hawking ein Meilenstein des Sachbuchs und ein weltweites Phänomen: Es wurde in vierzig Sprachen übersetzt und über elf Millionen Mal verkauft. Wenn wir nachts den Sternenhimmel beobachten, tun wir etwas, was die Menschheit von Anfang an erstaunt und begeistert hat. Nachgelassen hat diese Faszination nie. Niemand dürfte unser Wissen über das Weltall, die Schwerkraft und über Raum und Zeit so umfassend erweitert, so sehr vertieft haben wie Stephen Hawking. Sein ganzes Leben war er auf der Suche danach, das Rätsel des Universums zu lösen: Dieses Geheimnis aufzuheben, gelingt ihm mit seinem epochemachenden Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit«. Das weltweit bestverkaufteste Sachbuch der letzten Jahrzehnte macht anspruchsvolle physikalische und astronomische Zusammenhänge anschaulich und eröffnet ein völlig neues Verständnis unseres Universums. Er reist mit uns an den Rand des Kosmos, in die unendlichen Weiten, an die Ereignishorizonte der Schwarzen Löcher und darüber hinaus in das immer weiter expandierende Weltall – ein einmaliges, ein unvergessliches Leseerlebnis. »›Eine kurze Geschichte der Zeit‹: Es ist die verlegerische Sensation des letzten Jahrzehnts.« Spectator »Er hat Generationen dazu inspiriert, über unseren eigenen blauen Planeten hinauszuschauen und unser Verständnis des Universums zu erweitern.« Astronaut Tim Peake
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stephen Hawking
Eine kurze Geschichte der Zeit
Die Suche nach der Urkraft des Universums
Aus dem Englischen von Hainer Kober unter Beratung von Dr. Markus Pössel
Klett-Cotta
Impressum
Die deutschsprachige Ausgabe ist erstmals 1988 im Rowohlt Verlag, Hamburg, erschienen. Der Text der vorliegenden Ausgabe wurde vollständig überarbeitet und enthält in den deutschen Ausgaben bislang nicht veröffentlichte Erweiterungen von Stephen Hawking sowie eine aktualisierte Bildauswahl.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes«
© 1988, 1996, 2016 by Space Time Publications, London
Für die deutsche Ausgabe
© 2023, 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos und Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Shutterstock, Peter Hermes Furian
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von C.H.Beck, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98895-6
E-Book ISBN 978-3-608-12195-7
Vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1
Unsere Vorstellung vom Universum
2
Raum und Zeit
3
Das expandierende Universum
4
Die Unschärferelation
5
Elementarteilchen und Naturkräfte
6
Schwarze Löcher
7
Schwarze Löcher sind gar nicht so schwarz
8
Ursprung und Schicksal des Universums
9
Der Zeitpfeil
10
Wurmlöcher und Zeitreisen
11
Die Vereinheitlichung der Physik
12
Schluss
Einstein, Galilei, Newton
Ausblick (2016)
Dunkle Energie und die sich beschleunigende Expansion des Universums
Kosmische Hintergrundstrahlung und Keine-Grenzen-Bedingung
Ewige Inflation und Multiversum
Gravitationswellen
Das Informationsparadoxon
Ausblick
Anmerkungen
Dank
Glossar
Register
Bildnachweis
Vorwort
Für die Originalauflage von Eine kurze Geschichte der Zeit verfasste ich kein Vorwort. Das übernahm Carl Sagan. Stattdessen schrieb ich eine kurze Danksagung (siehe Seite 323), in der ich, wie man mir geraten hatte, allen dankte. Einige Stiftungen, die mich unterstützt hatten, waren über diese Erwähnung jedoch nicht sonderlich erfreut, weil sich dadurch die Zahl der Anträge vervielfachte.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand – weder mein Verlag noch mein Agent noch ich selbst – im Entferntesten mit diesem Erfolg des Buchs gerechnet hatte. Auf der Bestsellerliste der Londoner Sunday Times stand es 237 Wochen, länger als irgendein anderes Buch (offenbar werden Bibel und Shakespeare nicht mitgezählt). Es wurde in etwa vierzig Sprachen übersetzt, und auf die Weltbevölkerung bezogen, kommt auf 750 Männer, Frauen und Kinder ein verkauftes Exemplar. Wie Nathan Myhrvold von Microsoft (ein ehemaliger Postdoc von mir) feststellte, habe ich über Physik mehr Bücher verkauft als Madonna über Sex.
Der Erfolg von Eine kurze Geschichte der Zeit lässt darauf schließen, dass ein weit verbreitetes Interesse an den großen Fragen besteht wie etwa: Woher kommen wir? Warum ist das Universum so, wie es ist?
Außerdem habe ich die Gelegenheit genutzt, das Buch zu aktualisieren, indem ich neue theoretische Ansätze und Beobachtungsergebnisse berücksichtigte, die bei der ersten Auflage (1. April 1988) noch nicht vorlagen. Ich habe ein neues Kapitel über Wurmlöcher und Zeitreisen eingefügt. Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie scheint die Möglichkeit zuzulassen, dass wir stabile Wurmlöcher konstruieren, kleine Röhren, die verschiedene Regionen der Raumzeit miteinander verbinden. Ginge das, könnten wir sie zu einer raschen Umrundung der Galaxis oder zu einer Reise zurück in der Zeit verwenden. Natürlich haben wir noch niemanden aus der Zukunft gesehen (oder doch?), aber ich erörtere eine mögliche Erklärung dafür.
Außerdem berichte ich von den Fortschritten, die wir in jüngerer Zeit bei der Suche nach »Dualitäten« oder »Korrespondenzen« zwischen scheinbar verschiedenen physikalischen Theorien gemacht haben. Diese Korrespondenzen sind ein starker Hinweis darauf, dass es eine vollständige vereinheitlichte Theorie der Physik gibt, aber sie lassen auch vermuten, dass sie sich nicht in einer einzigen fundamentalen Formulierung ausdrücken lässt. Stattdessen müssen wir in unterschiedlichen Situationen mit verschiedenen Aspekten der grundlegenden Theorie arbeiten. Das ähnelt unserer Unfähigkeit, die Erdoberfläche auf einer einzigen Karte darzustellen, und der daraus folgenden Notwendigkeit, in verschiedenen Regionen verschiedene Karten zu benutzen. Für unsere Auffassung von der Vereinheitlichung der wissenschaftlichen Gesetze wäre es eine Revolution, würde an dem wichtigsten Punkt aber nichts ändern: dass das Universum von einer Reihe rationaler Gesetze bestimmt wird, die wir entdecken und verstehen können.
Was unsere Beobachtungen angeht, so war die bei Weitem wichtigste Entdeckung die Messung der Fluktuationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung durch COBE (den NASA-Satelliten Cosmic Background Explorer) und andere Forschungsgruppen. Diese Fluktuationen sind die Fingerabdrücke der Schöpfung, winzige Unregelmäßigkeiten aus der Anfangszeit in dem ansonsten glatten und gleichförmigen frühen Universum, die sich später zu Galaxien, Sternen und allen anderen Strukturen entwickelten, die wir in unserer Umgebung sehen. Das deckt sich mit den Vorhersagen der Hypothese, nach der das Universum in der imaginären Zeitrichtung keine Grenzen hat; allerdings werden weitere Beobachtungen erforderlich sein, um diese Hypothese von anderen möglichen Erklärungen für die Fluktuationen in der Hintergrundstrahlung zu unterscheiden. Doch in wenigen Jahren sollten wir wissen, ob wir in einem Universum leben, das vollkommen in sich abgeschlossen ist und weder Anfang noch Ende hat.
(Mai 1996)
***
Richard Feynman hat einmal gesagt: »Wir haben das Glück, in einer Zeit zu leben, in der noch Entdeckungen gemacht werden. Und in dem Zeitalter, in dem wir leben, entdecken wir die fundamentalen Gesetze der Natur.« Zwischen der Erstveröffentlichung dieses Buchs am 1. April 1988 und seiner letzten Revision 1996 gab es etliche bemerkenswerte Entdeckungen in der Forschung. Zwar haben sich einige der Theorien, die ich im ursprünglichen Text erörtert habe, nicht verändert, doch andere entwerfen ein neues Bild der Wirklichkeit. Daher bin ich glücklich über die Gelegenheit, im Anhang der neuen Ausgabe manche Aktualisierungen von Themen aufnehmen zu können, die einige meiner stolzesten Leistungen als Physiker widerspiegeln: die mit Roger Penrose zusammen entwickelten Singularitäten-Theoreme, die sogenannte »Hawking-Strahlung« Schwarzer Löcher und meine Keine-Grenzen-Bedingung, ein Versuch, Einsteins Arbeit mit der Quantentheorie zu vereinheitlichen. Wie immer ist es mein Ziel, allen Lesern, die an den großen, grundlegenden Fragen des Universums interessiert sind, vor Augen zu führen, wie aufregend diese Entdeckungen sind.
Stephen Hawking
Cambridge, Juli 2016
1
Unsere Vorstellung vom Universum
Ein namhafter Wissenschaftler (man sagt, es sei Bertrand Russell gewesen) hielt einmal einen öffentlichen Vortrag über Astronomie. Er schilderte, wie die Erde um die (1)Sonne(1) und die (2)Sonne ihrerseits um den Mittelpunkt einer riesigen Ansammlung von Sternen kreist, die wir unsere Galaxie nennen. Als der Vortrag beendet war, stand hinten im Saal eine kleine alte Dame auf und erklärte: »Was Sie uns da erzählt haben, stimmt alles nicht. In Wirklichkeit ist die Welt eine flache Scheibe, die von einer Riesenschildkröte auf dem Rücken getragen wird.« Mit einem überlegenen Lächeln hielt der Wissenschaftler ihr entgegen: »Und worauf steht die Schildkröte?« – »Sehr schlau, junger Mann«, parierte die alte Dame. »Ich werd’s Ihnen sagen: Da stehen lauter Schildkröten aufeinander.«
Die meisten Menschen werden über die Vorstellung, unser Weltall sei ein unendlicher Schildkrötenturm, den Kopf schütteln. Doch woher nehmen wir die Überzeugung, es besser zu wissen? Was wissen wir vom Weltall und wieso wissen wir es? Woher kommt das Universum und wohin entwickelt es sich? Hatte es wirklich einen (1)Anfang? Und wenn, was geschah davor? Was ist die Zeit? Wird sie je ein Ende finden? Neuere Erkenntnisse in der Physik, die teilweise fantastischen neuen Technologien zu verdanken sind, legen einige Antworten auf diese alten Fragen nahe. Eines Tages werden uns diese Antworten vielleicht so selbstverständlich erscheinen wie die Tatsache, dass die Erde um die (3)Sonne kreist – oder so lächerlich wie der Schildkrötenturm. Nur die Zukunft (was immer das sein mag) kann uns eine Antwort darauf geben.
Schon 340 v. Chr. brachte der griechische Philosoph Aristoteles(1) in seiner Schrift »Vom Himmel« zwei gute Argumente für seine Überzeugung vor, dass die Erde(1) keine flache Scheibe, sondern kugelförmig sei. Erstens verwies er auf seine Erkenntnisse über die Mond(1)finsternis. Sie werde, schrieb er, dadurch verursacht, dass die Erde zwischen (4)Sonne und Mond(2) trete. Der Erdschatten auf dem Mond(3) sei immer rund, also müsse die Erde(2) eine Kugel sein. Wäre sie eine Scheibe, hätte der Schatten eine längliche, elliptische Form, es sei denn, die Mondfinsternis träte immer nur dann ein, wenn sich die (5)Sonne direkt unter dem Mittelpunkt der Scheibe befände. Zweitens wussten die Griechen von ihren Reisen her, dass der Polarstern im Süden niedriger am Himmel erscheint als in nördlichen Regionen. (Aufgrund der Lage des Polarsterns über dem Nordpol scheint er sich dort direkt über einem Beobachter zu befinden, während er vom Äquator aus betrachtet knapp über dem Horizont zu stehen scheint.) Aus der unterschiedlichen Position des Polarsterns für Beobachter in Ägypten und Griechenland glaubte Aristoteles sogar den Erdumfang errechnen zu können. Er kam auf 400 000 Stadien. Die exakte Länge eines Stadions ist nicht bekannt, sie dürfte aber über 180 Meter betragen haben, wonach Aristoteles’ Schätzung doppelt so hoch läge wie der heute angenommene Wert. Die Griechen hatten noch ein drittes Argument dafür, dass die Erde(3) eine Kugel sein muss. Wie sollte man es sich sonst erklären, dass man von einem Schiff, das am Horizont erscheint, zuerst die Segel und erst dann den Rumpf sieht?
Aristoteles glaubte, die (6)Sonne, der Mond(4), die (1)Planeten und die Sterne bewegten sich in kreisförmigen Umlaufbahnen um die Erde, während diese in einem unbewegten Zustand verharre – eine Auffassung, der seine mystische Überzeugung zugrunde lag, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums und dass die kreisförmige Bewegung die vollkommenste sei. Diese Vorstellung gestaltete Ptolemäus im 2. Jahrhundert n. Chr. zu einem vollständigen kosmologischen Modell aus. In ihm bildet die Erde(4) den Mittelpunkt, umgeben von acht Sphären, die den Mond(5), die (7)Sonne, die Sterne und die fünf Planeten tragen, die damals bekannt waren – Merkur, Venus, Mars, Jupiter(1)(2)und Saturn (Abb. 1). Die (2)Planeten selbst bewegen sich in kleineren Kreisen, die mit ihren jeweiligen Sphären verbunden sind. Diese Annahme war nötig, um die ziemlich komplizierten Bahnen zu erklären, die man am Himmel beobachtete. Die äußerste Sphäre trägt in diesem Modell die sogenannten (1)»Fixsterne«, die immer in der gleichen Position zueinander bleiben, aber gemeinsam am Himmel kreisen. Was jenseits der letzten Sphäre lag, wurde nie deutlich erklärt; mit Sicherheit aber gehörte es nicht zu dem Teil des (1)Kosmos, der der menschlichen Beobachtung zugänglich war.
Abbildung 1
Der (1)Ptolemäische Kosmos lieferte ein Modell, das hinreichend genau war, um die Positionen der Himmelskörper vorherzusagen. Doch zur präzisen Vorherbestimmung dieser Positionen musste (1)Ptolemäus von der Voraussetzung ausgehen, dass der Mond(6) einer Bahn folgte, die ihn manchmal doppelt so nahe an die Erde heranführte wie zu den anderen Zeiten. Das wiederum bedeutete, der Mond(7) müsste manchmal doppelt so groß erscheinen wie sonst! (2)Ptolemäus war sich dieser Schwäche seines Systems bewusst. Dennoch wurde es allgemein, wenn auch nicht ausnahmslos, akzeptiert, Die christliche Kirche übernahm es als Bild des Kosmos, da es sich in Einklang mit der Heiligen Schrift bringen ließ, denn es hatte den großen Vorteil, dass es jenseits der Sphäre der Fixsterne noch genügend Platz für Himmel und Hölle ließ. Ein einfacheres Modell schlug 1514 Nikolaus Kopernikus(1)[1], Domherr in Frauenburg (Polen), vor. (Vielleicht aus Angst, von seiner Kirche als Ketzer gebrandmarkt zu werden, brachte er seine Thesen zunächst anonym in Umlauf.1) Er vertrat die Auffassung, die (8)Sonne ruhe im Mittelpunkt, um den sich die Erde und die (1)Planeten in kreisförmigen Umlaufbahnen bewegten. Fast ein Jahrhundert verging, bis man sein ((1)heliozentrisches) Modell ernst zu nehmen begann. Den Anstoß gaben zwei Astronomen, Johannes Kepler(1) in Deutschland und Galileo Galilei(1) in Italien, die für die Kopernikanische Theorie(1) öffentlich eintraten, und das, obwohl die von ihr vorhergesagten Umlaufbahnen mit den tatsächlich beobachteten nicht ganz übereinstimmten. Zur endgültigen Widerlegung(1) des Aristotelisch-Ptolemäischen (geozentrischen) Kosmos-Modells kam es 1609. In diesem Jahr begann Galilei(2), den Nachthimmel mit einem Fernrohr zu beobachten, das gerade erfunden worden war. Als er den Planeten Jupiter(2) betrachtete, entdeckte er, dass dieser von einigen kleinen Satelliten oder Mond(8)en begleitet wird, die ihn umkreisen. Galileis Schlussfolgerung: Nicht alles muss direkt um die Erde(5) kreisen, wie Aristoteles und Ptolemäus gemeint hatten. (Natürlich konnte man auch jetzt noch glauben, die Erde(6) ruhe im Mittelpunkt des Weltalls und die Jupitermonde bewegten sich auf äußerst komplizierten Bahnen um die Erde, wobei sie lediglich den Eindruck erweckten, als ob sie um den Jupiter kreisten. Doch die Kopernikanische Theorie(2) hatte einen entscheidenden Vorteil: Sie war weitaus einfacher.) Zur gleichen Zeit hatte Johannes Kepler(2) an einer Abwandlung der Kopernikanischen Theorie(3) gearbeitet und schlug vor, dass sich die (1)Planeten nicht in Kreisen, sondern in Ellipsen bewegten (eine Ellipse ist ein länglicher Kreis). Jetzt deckten sich die Vorhersagen endlich mit den Beobachtungen.
Für Kepler(3) waren die (2)elliptischen Umlaufbahnen lediglich eine Ad-hoc-Hypothese und eine ziemlich abstoßende dazu, weil Ellipsen weit weniger vollkommen sind als Kreise. Nachdem er fast zufällig entdeckt hatte, dass (3)elliptische Umlaufbahnen den Beobachtungen recht genau entsprachen, konnte er sie jedoch nicht mit seiner Vorstellung in Einklang bringen, dass magnetische Kräfte die (1)Planeten um die Sonne bewegten. Eine Erklärung wurde erst viel später geliefert, im Jahre 1687, als Sir Isaac Newton(1) die »Philosophiae naturalis principia mathematica« veröffentlichte, wahrscheinlich das wichtigste von einem Einzelnen verfasste physikalische Werk, das jemals erschienen ist. Dort entwarf Newton(1)(1)(2) nicht nur eine (1)Theorie der Bewegung von Körpern in Raum und Zeit, sondern entwickelte auch das komplizierte mathematische Instrumentarium, das zur Analyse dieser Bewegungen erforderlich war. Darüber hinaus postulierte er ein allgemeines Gravitationsgesetz, nach dem jeder Körper im Weltall von jedem anderen Körper durch eine Kraft angezogen wird, die umso größer ist, je mehr Masse die Körper haben und je näher sie einander sind. Dieselbe Kraft bewirkt auch, dass Gegenstände zu Boden fallen. (Die Geschichte, ein Apfel, der Newton(2)(3) auf den Kopf gefallen sei, habe ihm zu dieser Eingebung verholfen, gehört wohl ins Reich der Legende. Newton(4) selbst hat lediglich erklärt, der Gedanke an die Schwerkraft(1) sei durch den Fall eines Apfels ausgelöst worden, als er »sinnend« dagesessen habe.) Daraus leitete Newton(3)(5) dann ab, dass nach seinem Gesetz die Schwerkraft(2) den Mond(9) zu einer elliptischen Bewegung um die Erde und diese sowie die anderen (4)Planeten zu elliptischen Bahnen um die Sonne veranlasst.
Das Kopernikanische Modell(4) löste sich von den (3)Ptolemäischen Himmelssphären und damit von der Vorstellung, das (1)Weltall habe eine natürliche Grenze. Da die »Fixsterne«(2) ihre (1)Positionen nicht zu verändern schienen – von einer Rotation am Himmel abgesehen, die durch die Drehung der Erde um ihre eigene Achse verursacht wird –, lag die Annahme nahe, dass sie Himmelskörper wie die Sonne seien, nur sehr viel weiter entfernt.
Newton(6) bemerkte, dass sich die (1)Sterne seiner Gravitationstheorie zufolge gegenseitig anziehen mussten; also konnten sie doch nicht in weitgehender Bewegungslosigkeit verharren. Mussten sie nicht alle in irgendeinem Punkt zusammenstürzen? In einem Brief an Richard Bentley, einen anderen bedeutenden Gelehrten der Zeit, meinte Newton(7) 1691, dies geschähe in der Tat, wenn es nur eine endliche Zahl von (2)Sternen gebe, die über ein (1)endliches Gebiet des (1)Raums verteilt seien. Wenn hingegen, so fuhr er fort, die Anzahl der (3)Sterne unendlich sei und sie sich mehr oder minder gleichmäßig über den (1)unendlichen (2)Raum verteilten, käme es nicht dazu, weil es keinen Mittelpunkt gebe, (1)in den sie stürzen könnten.
Dieses Argument ist ein typisches Beispiel für die Fallen, die auf uns lauern, wenn wir über das (1)Unendliche reden. In einem (1)(2)unendlichen (2)Universum kann jeder Punkt als Zentrum betrachtet werden, weil sich von jedem Punkt aus eine unendliche Zahl von (4)Sternen nach jeder Seite hin erstreckt. Erst sehr viel später erkannte man, dass der richtige Ansatz darin besteht, vom ersten Fall auszugehen, einem (2)endlichen (3)Raum, in dem alle (5)Sterne (2)ineinanderstürzen, um dann zu fragen, was sich verändert, wenn man mehr (6)Sterne hinzufügt, die sich in etwa gleichmäßig außerhalb dieser Region verteilen. Nach Newton(8)s Gesetz würden die äußeren Sterne im Mittel ohne Einfluss auf das Verhalten der inneren bleiben, die also genauso rasch ineinanderstürzen würden wie in der zuvor beschriebenen Situation. Wir können so viele (7)Sterne hinzufügen, wie wir wollen, stets würden sie zusammenfallen. Heute wissen wir, dass kein unendliches, (1)statisches Modell des Universums denkbar ist, in dem die Gravitation durchgehend anziehend wirkt.
Die Tatsache, dass bis dahin niemand den Gedanken vorgebracht hatte, das (1)Universum könnte sich ausdehnen oder zusammenziehen, spiegelt das allgemeine geistige Klima vor Beginn des 20. Jahrhunderts in einer interessanten Facette wider. Man ging allgemein davon aus, das Weltall habe entweder seit jeher in unveränderter Form bestanden oder es sei zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr oder weniger in dem Zustand erschaffen worden, den wir heute beobachten können. Zum Teil mag dies an der Neigung der Menschen gelegen haben, an ewige Wahrheiten zu glauben, und vielleicht ist es auch dem Trost zuzuschreiben, den sie in dem Gedanken fanden, dass sie selbst zwar alterten und starben, das Universum aber ewig unveränderlich sei.
Selbst diejenigen, die wissen mussten, dass nach Newton(9)s Gravitationstheorie(3) das Universum nicht statisch sein kann, kamen nicht auf die Idee, es könnte sich ausdehnen. Statt dessen versuchten sie, die Theorie zu modifizieren, indem sie die Gravitationskraft bei sehr großen Entfernungen zur Abstoßungskraft(1) erklärten. Das hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf ihre Vorhersagen über die (1)Planetenbewegungen, gestattete es aber einer unendlichen Verteilung von (8)Sternen, im Gleichgewicht zu verharren. Die Erklärung nach dieser Theorie: Die Abstoßungskräfte(2) von den weiter entfernten (9)Sternen heben die Anziehungskräfte(1) zwischen nahe zusammenliegenden auf. Heute hat sich indessen die Auffassung durchgesetzt, dass ein solches Gleichgewicht instabil wäre: Wenn die (10)Sterne in irgendeiner Region nur ein wenig näher rückten, würden sich die Anziehungskräfte(2) zwischen ihnen verstärken und die Oberhand über die Abstoßungskräfte(3) gewinnen, sodass das (3)Ineinanderfallen der (11)Sterne nicht aufzuhalten wäre. Wenn sich die (12)Sterne andererseits ein bisschen weiter voneinander entfernten, würden die Abstoßungskräfte(4) überwiegen und die (13)Sterne unaufhaltsam auseinandertreiben.
Ein anderer Einwand gegen ein unendliches, (2)statisches Universum wird meist dem deutschen Philosophen Heinrich Olbers(1) zugeschrieben, der sich 1823 zu dieser Theorie äußerte. Tatsächlich aber haben schon verschiedene Zeitgenossen Newton(10)s dazu Stellung genommen, und Olbers(2)’ Abhandlung war keineswegs die erste Zusammenstellung begründeter Gegenargumente. Doch fand er mit ihnen als Erster allgemeine Beachtung. Die Schwierigkeit liegt darin, dass in einem unendlichen, (3)statischen Universum nahezu jeder Blick auf die Oberfläche eines Sterns treffen müsste. Deshalb müsste der Himmel selbst nachts so hell wie die Sonne sein. Olbers(3) wandte dagegen ein, das Licht ferner (14)Sterne würde infolge der Absorption durch dazwischenliegende Materie matt werden. Träfe dies jedoch zu, würde sich diese Materie erhitzen, sodass sie schließlich ebenso hell glühte wie die (15)Sterne. Die Schlussfolgerung, dass der gesamte Nachthimmel hell wie die Sonnenoberfläche sein müsste, ist nur durch die Annahme zu vermeiden, die (16)Sterne leuchteten nicht seit jeher, sondern hätten zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit mit der Emission begonnen. Diese Annahme ließe die Erklärung zu, dass sich die absorbierende Materie noch nicht erhitzt oder dass das Licht ferner (17)Sterne uns noch nicht erreicht habe. Und das bringt uns zu der Frage, was die (18)Sterne ursprünglich zum Leuchten gebracht haben könnte.
Über den Beginn des Universums hatte man sich natürlich schon lange zuvor den Kopf zerbrochen. Einer Reihe früher Kosmologien(1) und der jüdisch-christlich-islamischen Überlieferung zufolge entstand der Kosmos zu einem bestimmten und nicht sehr fernen Zeitpunkt in der Vergangenheit. Ein Grund für einen solchen (2)Anfang war die Überzeugung, dass man eine »erste Ursache« brauche, um das Vorhandensein des Universums zu erklären. (Innerhalb des Kosmos erklärt man ein Ereignis(1) immer als ursächliche Folge irgendeines früheren Ereignisses, doch das Vorhandensein des Universums ließe sich auf diese Weise nur erklären, wenn es einen Anfang hätte.) Ein anderes Argument trug Augustinus(1) in seiner Schrift »Der Gottesstaat« vor. Unsere Kultur, schrieb er, entwickle sich ständig weiter, und wir erinnerten uns daran, wer diese Tat vollbracht und jene Technik entwickelt habe. Deshalb könne es den Menschen und vielleicht auch den Kosmos noch nicht allzulange geben. Ausgehend von der Genesis kam Augustinus(2) zu dem Ergebnis, dass Gott(1) die Welt ungefähr 5000 v. Chr. erschaffen habe. (Interessanterweise ist dieser Zeitpunkt nicht sehr weit vom Ende der letzten Eiszeit entfernt, das nach Auffassung der Archäologie der eigentliche Beginn der Zivilisation ist.)
Aristoteles und die meisten anderen griechischen Philosophen dagegen fanden keinen Gefallen an der Vorstellung einer Schöpfung, weil sie zu sehr nach göttlicher Intervention(1) aussah. Der Mensch und die Welt um ihn her hätten schon immer existiert, behaupteten sie, und daran werde sich auch nichts ändern. Sie hatten sich bereits mit dem oben beschriebenen Fortschrittsargument auseinandergesetzt und es entkräftet, indem sie erklärten, es sei immer wieder zu großen Überschwemmungen und anderen Katastrophen gekommen, die die Menschen stets gezwungen hätten, wieder am Punkt Null zu beginnen.
Die Fragen, ob das Weltall einen Anfang in der Zeit habe und ob es räumlich begrenzt sei, behandelte später Immanuel Kant(1) ausführlich in seinem monumentalen (und äußerst anspruchsvollen) Werk »Kritik der reinen Vernunft«, das 1781 erschien. Er bezeichnete diese Fragen als Antinomien (das heißt Widersprüche) der reinen Vernunft, weil nach seiner Meinung ebenso überzeugende Gründe für die These sprachen, dass das Weltall einen Anfang habe, wie für die Antithese, dass es seit jeher existiere. Sein Argument für die These: Wenn das Universum keinen Anfang hätte, läge ein unendlicher Zeitraum vor jedem Ereignis. Das hielt er für absurd. Das Argument für die Antithese: Wenn das Universum einen Anfang hätte, läge ein unendlicher Zeitraum vor diesem Anfang. Warum aber sollte das Universum dann zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt begonnen haben? Kant bedient sich also des gleichen Argumentes, um These und Antithese zu begründen. Beide beruhen sie auf der stillschweigenden Voraussetzung, dass die (1)Zeit unendlich weit zurückreicht, ganz gleich, ob das Universum einen (3)Anfang hat oder nicht. Wie wir noch sehen werden, ist ein Zeitbegriff vor Beginn des Universums sinnlos. Darauf hat schon Augustinus(3) hingewiesen. Als er gefragt wurde: Was hat Gott(2) getan, bevor er das Universum erschuf?, erwiderte er nicht: Er hat die Hölle gemacht, um einen Platz für Leute zu haben, die solche Fragen stellen. Seine Antwort lautete: Die (2)Zeit sei eine Eigenschaft des von Gott(3) geschaffenen Universums und habe vor dessen Beginn nicht existiert.
Solange die meisten Menschen das Universum für weitgehend (4)statisch und unveränderlich hielten, gehörte die Frage, ob es einen (4)Anfang habe oder nicht, in den Bereich der Metaphysik und Theologie. Was man beobachtete, ließ sich mittels der Vorstellung von einem seit jeher existierenden Universum ebenso erklären wie anhand der Theorie, es sei zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine Weise in Bewegung gesetzt worden, dass es den Anschein ewigen Bestehens erwecke. Doch im Jahre 1929 machte Edwin Hubble(1) die bahnbrechende Entdeckung, dass sich die fernen Galaxien, ganz gleich, wohin man blickt, rasch von uns fortbewegen(1). Mit anderen Worten: Das (2)Universum dehnt sich aus, was wiederum bedeutet, dass in früheren Zeiten die Objekte näher beieinander waren. Es hat sogar den Anschein, als hätten sie sich vor ungefähr zehn bis zwanzig Milliarden Jahren alle an ein und demselben Ort befunden und als sei infolgedessen die Dichte des Universums unendlich gewesen. Mit dieser Entdeckung rückte die Frage nach dem (5)Anfang des Universums in den Bereich der Wissenschaft.
Hubbles(2) Beobachtungen legten die Vermutung nahe, dass das Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt, (1)(1)Urknall genannt, (1)unendlich klein und unendlich dicht gewesen ist. Unter solchen Bedingungen würden alle Naturgesetze ihre Geltung verlieren, und damit wäre auch keine Voraussage über die Zukunft mehr möglich. Wenn es Ereignisse gegeben hat, die vor diesem Zeitpunkt lagen, so können sie doch nicht beeinflussen, was gegenwärtig geschieht. Man kann sie außer acht lassen, weil sie sich nicht auf unsere Beobachtungen auswirken. Man kann sagen, dass die Zeit mit dem (1)(2)Urknall beginnt – in dem Sinne, dass frühere Zeiten einfach nicht definiert sind. Es sei betont, dass sich dieser Zeitbeginn grundlegend von jenen Vorstellungen unterscheidet, mit deren Hilfe man ihn sich früher ausgemalt hat. In einem (5)unveränderlichen (3)Universum muss ein (6)Anfang in der Zeit von einem Wesen außerhalb dieser Welt veranlasst werden – es gibt keine physikalische Notwendigkeit für einen (7)Anfang. Die Erschaffung des (4)Universums durch Gott ist buchstäblich zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit vorstellbar. Wenn sich das (5)Universum hingegen (2)ausdehnt, könnte es physikalische Gründe für einen (8)Anfang geben. Man könnte sich noch immer vorstellen, Gott habe die Welt im Augenblick des (3)Urknalls erschaffen oder auch danach, indem er ihr den Anschein verlieh, es habe einen (4)Urknall gegeben. Aber es wäre sinnlos anzunehmen, sie sei vor dem (5)Urknall geschaffen worden. Das Modell eines expandierenden (6)Universums schließt einen Schöpfer(1) nicht aus, grenzt aber den Zeitpunkt ein, da er sein Werk verrichtet haben könnte!
Wenn wir uns mit der Beschaffenheit des (7)Universums befassen und Fragen erörtern wollen wie die nach seinem (9)Anfang oder seinem Ende, müssen wir eine klare Vorstellung davon haben, was eine wissenschaftliche Theorie ist. Ich werde hier von der einfachen Auffassung ausgehen, dass eine Theorie aus einem Modell des (8)Universums oder eines seiner Teile sowie aus einer Reihe von Regeln besteht, die Größen innerhalb des Modells in Beziehung zu unseren Beobachtungen setzen. Eine Theorie existiert nur in unserer Vorstellung und besitzt keine andere Wirklichkeit (was immer das bedeuten mag). Gut ist eine Theorie, wenn sie zwei Voraussetzungen erfüllt: Sie muss eine große Klasse von Beobachtungen auf der Grundlage eines Modells beschreiben, das nur einige wenige beliebige Elemente enthält, und sie muss bestimmte Voraussagen über die Ergebnisse künftiger Beobachtungen ermöglichen. So war beispielsweise die Aristotelische Theorie, dass alles aus den vier Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser bestehe, einfach genug, um den genannten Bedingungen zu genügen, führte aber zu keinen deutlichen Vorhersagen. Newtons Gravitationstheorie(4) dagegen, die auf einem noch einfacheren Modell beruht – Körper(1) ziehen sich mit einer Kraft an, die ihrer Masse proportional und dem Quadrat der Entfernung zwischen ihnen umgekehrt proportional ist –, sagt die Bewegungen der Sonne, des Mondes und der (5)Planeten mit großer Präzision voraus.
Jede physikalische Theorie ist insofern vorläufig, als sie nur eine Hypothese darstellt: Man kann sie nie beweisen. Wie häufig auch immer die Ergebnisse von Experimenten mit einer Theorie übereinstimmen, man kann nie sicher sein, dass das Ergebnis nicht beim nächsten Mal der Theorie widersprechen wird. Dagegen ist eine Theorie widerlegt, wenn man nur eine einzige Beobachtung findet, die nicht mit den aus ihr abgeleiteten Voraussagen übereinstimmt. In seiner »Logik der Forschung« nennt Karl Popper als Merkmal einer guten Theorie, dass sie eine Reihe von Vorhersagen macht, die sich im Prinzip auch jederzeit durch Beobachtungsergebnisse widerlegen, falsifizieren, lassen müssen. Immer wenn die Beobachtungen aus neuen Experimenten mit den Vorhersagen übereinstimmen, überlebt die Theorie und man fasst ein bisschen mehr Vertrauen zu ihr; doch sobald man auch nur auf eine Beobachtung stößt, die von den Vorhersagen abweicht, muss man die Theorie(1) aufgeben oder modifizieren. Zumindest sollte das der Fall sein, doch es sind natürlich stets Zweifel erlaubt an der Fähigkeit derer, die die Experimente durchführen.
In der Praxis sieht dies oft so aus, dass man eine neue Theorie entwickelt, die in Wahrheit nur eine Erweiterung der vorigen ist. Beispielsweise ergaben sehr genaue Beobachtungen des Planeten Merkur, dass seine Bewegung geringfügig von den Vorhersagen der Newtonschen Gravitationstheorie(5) abweicht. Genau diese Abweichung sagte Einsteins (2)Allgemeine Relativitätstheorie(1) voraus. Die Übereinstimmung der Einsteinschen(1) Vorhersagen mit dem, was man sah, und die Unstimmigkeit der Newtonschen Vorhersagen(6) gehörten zu den entscheidenden Bestätigungen der neuen Theorie. Für alle praktischen Zwecke verwenden wir jedoch nach wie vor Newtons Theorie, weil der Unterschied zwischen ihren Vorhersagen und denen der (3)Allgemeinen Relativität in den Situationen, mit denen wir normalerweise zu tun haben, verschwindend klein ist. (Newtons Theorie hat überdies den großen Vorteil, dass es sich mit ihr sehr viel einfacher arbeiten lässt als mit der Einsteinschen!)
Letztlich ist es das Ziel der Wissenschaft, eine einzige (1)(1)Theorie zu finden, die das gesamte Universum beschreibt. In der Praxis aber zerlegen die meisten Wissenschaftler das Problem in zwei Teile: Erstens gibt es die Gesetze, die uns mitteilen, wie sich das Universum im Laufe der Zeit verändert. (Wenn wir wissen, wie das Universum zu einem gegebenen Zeitpunkt aussieht, so teilen uns diese physikalischen Gesetze mit, wie es zu irgendeinem späteren Zeitpunkt aussehen wird.) Zweitens gibt es die Frage nach dem (1)Anfangszustand des Universums. Manche Menschen finden, dass sich die Wissenschaft nur mit dem ersten Teil des Problems befassen sollte – sie halten die Frage nach der Anfangssituation für eine Angelegenheit der Metaphysik oder Religion. Sie würden vorbringen, dass Gott in seiner Allmacht die Welt in jeder von ihm gewünschten Weise hätte beginnen lassen können. Das mag zutreffen, doch dann hätte er auch ihre Entwicklung in völlig beliebiger Weise gestalten können. Aber anscheinend hat er sich für eine sehr regelmäßige (1)Entwicklung des Universums, für eine Entwicklung in Übereinstimmung mit bestimmten Gesetzen entschieden. Deshalb scheint es genauso vernünftig, Gesetze anzunehmen, die den (2)Anfangszustand bestimmt haben.
Es hat sich als eine sehr schwierige Aufgabe erwiesen, eine (2)Theorie zu entwickeln, die in einem einzigen Entwurf das ganze Universum beschreibt. Statt dessen zerlegen wir das Problem in einzelne Segmente und arbeiten Teiltheorien aus. Jede dieser Teiltheorien beschreibt eine eingeschränkte Klasse von Beobachtungen und trifft jeweils nur über sie Voraussagen, wobei die Einflüsse anderer Größen außer acht gelassen oder durch eine Hand voll Zahlenwerten repräsentiert werden. Vielleicht ist dieser Ansatz völlig falsch. Wenn im Universum grundsätzlich alles von allem abhängig ist, könnte es unmöglich sein, einer Gesamtlösung dadurch näher zu kommen, dass man Teile des Problems isoliert untersucht. Trotzdem haben wir in der Vergangenheit auf diesem Wege zweifellos Fortschritte erzielt. Das klassische Beispiel ist abermals die Newtonsche Gravitationstheorie(7), nach der die Schwerkraft(4) zwischen zwei Körpern(1)(2) außer vom Abstand nur von einer mit jedem Körper verknüpften Zahl abhängt, ihrer Masse, sonst aber unabhängig von deren Beschaffenheit ist. So braucht man keine Theorie über den Aufbau und Zustand der Sonne und der (6)Planeten, um ihre Umlaufbahnen zu berechnen.
Heute beschreibt die Physik das Universum anhand zweier (1)grundlegender Teiltheorien: der (4)Allgemeinen Relativitätstheorie(1) und der (1)Quantenmechanik. Sie sind die großen geistigen Errungenschaften aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Die (5)Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft und den Aufbau des Universums im Großen, das heißt in der Größenordnung von ein paar Kilometern bis hin zu einer Million Million Million Million (einer 1 mit 24 Nullen) Kilometern, der Größe des (2)beobachtbaren Universums. Die (2)Quantenmechanik dagegen beschäftigt sich mit Erscheinungen in Bereichen von außerordentlich geringer Ausdehnung wie etwa einem millionstel millionstel Zentimeter. Leider sind diese beiden (3)Theorien nicht miteinander in Einklang zu bringen – sie können nicht beide richtig sein. Eine der Hauptanstrengungen in der heutigen Physik gilt der Suche nach einer neuen (4)Theorie, die beide Teiltheorien enthält – nach einer Quantentheorie der Gravitation. Über eine solche Theorie verfügen wir bislang nicht, und möglicherweise sind wir noch weit von ihr entfernt, aber wir kennen bereits viele der Eigenschaften, die sie aufweisen muss. Und wir werden in späteren Kapiteln sehen, dass wir schon recht genau die Voraussagen bestimmen können, die eine Quantentheorie der Gravitation liefern muss.
Wenn man der Meinung ist, dass das (9)Universum nicht vom Zufall, sondern von bestimmten Gesetzen regiert wird, muss man die Teiltheorien zu einer vollständigen einheitlichen (5)Theorie zusammenfassen, die alles im (10)Universum beschreibt. Es gibt jedoch ein grundlegendes Paradoxon bei der Suche nach einer vollständigen einheitlichen (6)Theorie. Die Vorstellungen über wissenschaftliche Theorie, wie sie oben dargelegt wurden, setzen voraus, dass wir vernunftbegabte Wesen sind, die das (11)Universum beobachten und aus dem, was sie sehen, logische Schlüsse ziehen können. Diese Vorstellung erlaubt es uns, davon auszugehen, dass wir die Gesetze, die unser (12)Universum regieren, immer umfassender verstehen. Doch wenn es tatsächlich eine vollständige einheitliche (7)Theorie gibt, würde sie wahrscheinlich auch unser Handeln bestimmen. Deshalb würde die Theorie selbst die Suche nach ihr determinieren! Und warum sollte sie bestimmen, dass wir aus den Beobachtungsdaten die richtigen Folgerungen ableiten? Könnte sie nicht ebensogut festlegen, dass wir die falschen oder überhaupt keine Schlüsse ziehen?
Die einzige Antwort, die ich auf dieses Problem weiß, beruht auf Darwins Prinzip der natürlichen Selektion. Danach wird es in jeder Population sich selbst fortpflanzender Organismen bei den verschiedenen Individuen Unterschiede in der Erbanlage und in der Aufzucht geben. Diese Unterschiede bewirken, dass einige Individuen besser als andere in der Lage sind, die richtigen Schlussfolgerungen über die Welt um sie her zu ziehen und entsprechend zu handeln. Für diese Individuen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie überleben und sich fortpflanzen, und deshalb werden sich ihr Verhalten und Denken durchsetzen. Für die Vergangenheit trifft sicherlich zu, dass Intelligenz und wissenschaftliche Entdeckungen von Vorteil für unser Überleben waren. Weniger sicher ist, ob dies noch immer der Fall ist: Unsere wissenschaftlichen Entdeckungen könnten uns vernichten, und selbst wenn sie es nicht tun, so wird eine vollständige einheitliche (8)Theorie unsere Überlebenschancen nicht wesentlich verbessern. Doch von der Voraussetzung ausgehend, das Universum habe sich in regelmäßiger Weise entwickelt, können wir erwarten, dass sich die Denk- und Urteilsfähigkeit, mit der uns die natürliche Selektion ausgestattet hat, auch bei der Suche nach einer vollständigen einheitlichen (9)Theorie bewähren und uns nicht zu falschen Schlüssen führen wird.
Da die Teiltheorien, die wir bereits haben, von ganz außergewöhnlichen Situationen abgesehen, ausreichen, um genaue Vorhersagen zu liefern, scheint sich die Suche nach der endgültigen Theorie des Universums aus praktischer Sicht nur schwer rechtfertigen zu lassen. (Hier lässt sich allerdings anmerken, dass man ähnliche Einwände auch gegen die Relativitätstheorie(1) und die (3)Quantenmechanik hätte vorbringen können, und dann haben uns diese beiden Theorien die Kernenergie und die mikroelektronische Revolution gebracht!) Möglicherweise wird also die Entdeckung einer vollständigen einheitlichen (10)Theorie keinen Beitrag zum Überleben der Menschheit liefern, ja sie wird sich noch nicht einmal auf unsere Lebensweise auswirken. Doch seit den ersten Anfängen ihrer Kultur haben die Menschen es nie ertragen können, das unverbundene und unerklärliche Nebeneinander von Ereignissen hinzunehmen. Stets waren sie bemüht, die der Welt zugrunde liegende Ordnung zu verstehen. Nach wie vor haben wir ein unstillbares Bedürfnis zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kommen. Das tiefverwurzelte Verlangen der Menschheit nach Erkenntnis ist Rechtfertigung genug für unsere fortwährende Suche. Und wir haben dabei kein geringeres Ziel vor Augen als die vollständige Beschreibung des Universums, in dem wir leben.
2
Raum und Zeit
Unsere gegenwärtigen Vorstellungen über die Bewegung von Körpern gehen zurück auf Galilei(3) und Newton. Vorher hielt man sich an Aristoteles(3), der sagte, der natürliche Zustand eines Körper(1)s sei die Ruhe und er bewege sich nur, wenn eine Triebkraft auf ihn einwirke. Danach müsse ein schwerer Körper(2) schneller als ein leichter fallen, weil er stärker zur Erde gezogen würde.
Nach (1)aristotelischer Tradition war man davon überzeugt, dass man alle Gesetze, die das Universum bestimmen, allein durch das Denken ausfindig machen könne und dass es nicht notwendig sei, sie durch Beobachtungen zu überprüfen. So war vor Galilei(4) niemand daran interessiert festzustellen, ob Körper(3) von verschiedenem Gewicht tatsächlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fallen(1). Es heißt, Galilei(5) habe die Überzeugung des Aristoteles(4) dadurch widerlegt, dass er Gewichte vom Schiefen Turm von Pisa habe fallen lassen. Die Geschichte ist wahrscheinlich erfunden, aber Galilei(6) tat etwas Vergleichbares: Er ließ verschieden schwere Kugeln eine glatte Schräge hinunterrollen. Die Situation ist ähnlich wie bei senkrecht fallenden schweren Körper(4)n, aber leichter zu beobachten, weil die Geschwindigkeiten geringer sind. Galileis Messungen waren eindeutig: Die Geschwindigkeit aller Körper(5) nahm in gleichem Maße zu, unabhängig von ihrem Gewicht. Wenn man beispielsweise einen Ball einen Hügel hinunterrollen lässt, der auf zehn Meter ein Gefälle von einem Meter aufweist, so wird sich der Ball nach einer Sekunde mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einem Meter pro Sekunde bewegen, nach zwei Sekunden zwei Meter pro Sekunde zurücklegen und so fort, ganz gleich, wie schwer er ist. Natürlich fällt ein Bleigewicht schneller als eine Feder, aber das ist nur darauf zurückzuführen, dass der Fall der Feder durch den Luftwiderstand gebremst wird. Wenn man zwei Körper(6) ohne erheblichen Luftwiderstand fallen lässt – zum Beispiel zwei Bleigewichte –, fallen sie mit gleicher Geschwindigkeit. (Da es auf dem Mond keine Luft gibt, die fallende Körper abbremst, führte der Astronaut David R. Scott einen Versuch mit Feder und Hammer durch und stellte fest, dass sie den Boden in der Tat gleichzeitig berührten.)
Galileis(7) Messungen bildeten die Grundlage der Bewegungsgesetze, die Newton(8)(2) entwickelte. Wenn in Galileis(8) Experimenten ein Körper(7) den Abhang hinunterrollte, wirkte stets dieselbe Kraft auf ihn ein (sein Gewicht), mit dem Effekt, dass seine Geschwindigkeit konstant zunahm. Dies zeigte, dass die wirkliche Wirkung einer Kraft stets darin besteht, die Geschwindigkeit eines Körper(8)s zu verändern, ihn also nicht nur in Bewegung zu versetzen, wie man früher gedacht hatte. Und es bedeutete zugleich, dass ein Körper(9), auf den keine Kraft einwirkt, sich in gerader Linie und mit konstanter Geschwindigkeit fortbewegt. Diesen Gedanken entwickelte erstmals Newton(3) 1687 in seinen »Principia mathematica«, und er wird als das erste Newtonsche Gesetz bezeichnet. Was mit einem Körper(10) geschieht, wenn eine Kraft auf ihn einwirkt, gibt das zweite Newtonsche Gesetz(9) an: Es besagt, dass der Körper(11) beschleunigt wird, das heißt seine Geschwindigkeit verändert, und zwar proportional zur Kraft. (Bei doppelt so großer Kraft verdoppelt sich auch die Beschleunigung(1).) Zugleich ist die Beschleunigung umso kleiner, je größer die Masse (oder Materiemenge) des Körper(12)s ist. (Wenn die gleiche Kraft auf einen Körper(13) von doppelter Masse einwirkt, wird die Beschleunigung auf die Hälfte reduziert.) Ein vertrautes Beispiel ist das Auto: Je stärker der Motor, desto größer die Beschleunigung, doch je schwerer das Auto, desto geringer die Beschleunigung bei gleichem Motor.
Neben den Bewegungsgesetzen entdeckte Newton auch ein Gesetz, das die Gravitation(10)(5) beschreibt. Es besagt, dass jeder (19)Körper(14) jeden anderen mit einer Kraft anzieht(3), die der Masse jedes Körper(15)s proportional ist. Die Kraft zwischen zwei Körper(16)n A und B wäre also zweimal so groß, würde sich die Masse eines der Körper(17) (sagen wir von A) verdoppeln. Das entspricht auch der Erwartung, denn man kann sich vorstellen, der neue Körper(18) A sei aus zwei Körper(19)n der ursprünglichen Masse entstanden. Jeder würde Körper(20) B mit der ursprünglichen Kraft anziehen. Und wenn einer der Körper(21) die doppelte und der andere die dreifache Masse hätte, dann wäre die Kraft sechsmal so groß. Nun wird ersichtlich, warum alle Körper(22) gleich schnell fallen: Ein Körper(23) mit doppeltem Gewicht wird mit doppelter Schwerkraft zu Boden gezogen, aber er besitzt auch die doppelte Masse, was nur die halbe Beschleunigung bedeutet. Nach dem zweiten Newton(11)schen Gesetz heben sich diese beiden Wirkungen exakt auf, sodass die Beschleunigung in allen Fällen gleich ist.
Ferner ist nach Newtons Gravitationsgesetz(12) die Kraft umso kleiner, je weiter die Körper(24) voneinander entfernt sind. Newtons Gravitationsgesetz sagt aus, dass die Massenanziehung eines Sterns genau ein Viertel derjenigen eines ähnlichen Sterns beträgt, der halb so weit entfernt ist. Es sagt die Umlaufbahnen der Erde, des Mondes und der (7)Planeten mit großer Genauigkeit vorher. Gäbe es ein Gesetz, dem zufolge die Anziehung rascher mit der Entfernung abnähme, wären die Umlaufbahnen der (8)Planeten nicht elliptisch, sondern würden spiralförmig auf die Sonne zulaufen. Nähmen die Anziehungskräfte langsamer ab, würde sich die Gravitation ferner Sterne gegenüber der der Erde durchsetzen.
Der große Unterschied zwischen den Vorstellungen des (5)Aristoteles auf der einen und denen Galileis(9) und Newtons auf der anderen Seite liegt darin, dass jener an einen bevorzugten Ruhezustand glaubte, den jeder Körper(1)(25) einnehmen würde, wenn nicht irgendeine Kraft, irgendein Impuls auf ihn einwirkte. Vor allem meinte er, die Erde befände sich im Ruhezustand. Doch aus den Newtonschen Gesetzen(13) folgt, dass es keinen eindeutigen Ruhezustand gibt. Man kann mit gleichem Recht sagen, dass sich Körper(26) A im Ruhezustand befindet, während sich Körper(27) B, bezogen auf Körper A, mit gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt, oder dass Körper B unbeweglich verharrt, während Körper A sich bewegt. Wenn wir beispielsweise die Erdumdrehung und die Kreisbahn unseres Planeten um die Sonne(2) einen Moment lang unberücksichtigt lassen, so könnten wir entweder sagen, dass die Erde sich in Ruhe(1) befindet, während ein Zug auf ihrer Oberfläche mit 150 Stundenkilometern nordwärts fährt, oder dass der Zug sich im Ruhezustand befindet, während sich die Erde mit 150 Stundenkilometern südwärts bewegt. Auch bei Experimenten mit sich bewegenden Körpern im Zug blieben Newtons(4) Gesetze gültig. Bei einem Tischtennismatch im Zug würde man zum Beispiel feststellen können, dass der Ball den Newtonschen(5) Gesetzen genauso gehorcht wie ein Ball draußen auf einer Tischtennisplatte, die an der Eisenbahnstrecke aufgestellt ist. Es lässt sich also nicht entscheiden, ob sich der Zug oder die Erde bewegt.
Das Fehlen eines absoluten Zustands der Ruhe bedeutet, dass man nicht bestimmen kann, ob zwei Ereignisse, die zu verschiedenen Zeitpunkten stattfanden, am gleichen Ort im (4)Raum passierten. Nehmen wir an, der Tischtennisball im Zug springt senkrecht hoch und runter, sodass er im Abstand von einer Sekunde zweimal an derselben Stelle des Tisches aufprallt. Für jemanden, der am Gleis steht, würden die beiden Reflexionen des Balles etwa fünfzig Meter auseinanderliegen, weil der Zug diese Strecke in der Zwischenzeit zurückgelegt hätte. Das Nichtvorhandensein eines absoluten (1)Ruhezustandes bedeutet also, dass man einem Ereignis entgegen der Auffassung des Aristoteles keine absolute Position im (5)Raum zuweisen kann. Die Positionen von Ereignissen und die Abstände zwischen ihnen wären verschieden, je nachdem, ob sich der Beobachter im Zug oder am Gleis befindet, und es gibt keinen Grund, die eine Beobachterposition der anderen vorzuziehen.
Dieses Fehlen einer absoluten Position oder eines absoluten (6)Raumes, wie man sagte, machte Newton schwer zu schaffen, weil es nicht in Einklang zu bringen war mit seiner Vorstellung von einem absoluten Gott(4). Ja, er weigerte sich, diesen Mangel hinzunehmen, obwohl er sich aus seinen Gesetzen ergab. Wegen dieser irrationalen Überzeugung wurde er von vielen kritisiert, vor allem von George Berkeley(1), einem Theologen und Philosophen, der alle materiellen Gegenstände ebenso wie (3)Zeit und Raum für bloße Täuschung hielt. Als der berühmte Dr. Johnson von Berkeleys Ansichten hörte, rief er aus: »Das widerlege ich so!« und stieß mit seinem Zeh gegen einen großen Stein.
(6)Aristoteles wie Newton(11) glaubten an eine (1)absolute (4)Zeit. Das heißt, sie glaubten, man könnte das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen(2) eindeutig bestimmen und diese (5)Zeit bliebe stets die Gleiche, wer auch immer sie messe – vorausgesetzt, die Uhr geht richtig. Nach dieser Auffassung ist (6)Zeit getrennt und unabhängig vom Raum. Die meisten Leute würden ihr wohl zustimmen; aus der Sicht des gesunden Menschenverstandes spricht nichts dagegen. Doch wir waren gezwungen, unsere Vorstellungen von (7)Zeit und Raum zu ändern. Zwar kommen wir mit den alltäglichen, vom gesunden Menschenverstand anscheinend nahegelegten Begriffen zurecht, wenn wir uns mit Dingen wie Äpfeln oder Planeten beschäftigen, die sich verhältnismäßig langsam bewegen, doch sie lassen uns im Stich, wenn wir uns Objekten zuwenden, die sich mit (oder fast mit) Lichtgeschwindigkeit(1) bewegen.
Dass Licht sich mit einer endlichen, wenn auch sehr hohen Geschwindigkeit bewegt, wurde erstmals 1676 von dem dänischen Astronomen (1)Ole Christensen Rømer entdeckt. Er beobachtete, dass zwischen den Zeitpunkten, zu denen die Jupitermonde(1) auf ihren Umlaufbahnen um den Jupiter(3) hinter diesem Planeten verschwinden, keine gleichmäßigen Intervalle liegen, wie zu erwarten gewesen wäre, vorausgesetzt natürlich, die Monde umkreisen ihren Planeten mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Während Erde und Jupiter(4) ihren Bahnen um die Sonne folgen, verändert sich ständig der Abstand zwischen ihnen. Rømer stellte fest, dass die Verfinsterungen der Jupitermonde(2) umso später aufzutreten schienen, je weiter die Erde vom Jupiter(5) entfernt war. Seine Erklärung für dieses Phänomen: Das Licht der Monde braucht länger, uns zu erreichen, wenn wir weiter von ihnen entfernt sind. Allerdings hat er die Entfernungsschwankungen zwischen Erde und Jupiter nicht sehr genau gemessen; so kam er auf eine Lichtgeschwindigkeit von 224 000 Kilometern pro Sekunde, während man heute von 300 000 Kilometern pro Sekunde ausgeht. Doch dies soll die bemerkenswerte Leistung Rømers, der nicht nur bewies, dass sich das Licht(1) mit endlicher Geschwindigkeit bewegt, sondern diese Geschwindigkeit auch maß, keineswegs schmälern – veröffentlichte er doch seine Ergebnisse elf Jahre vor Newtons »Principia mathematica«.
Eine eigentliche Theorie über die Ausbreitung des Licht(2)s schlug erst 1865 der englische Physiker James Clerk Maxwell(1) vor, dem es gelang, die Teiltheorien zu vereinigen, mit denen man bis dahin die Kräfte der Elektrizität(1) und des Magnetismus beschrieben hatte. Maxwells(2) Gleichungen sagten voraus, dass es zu wellenartigen Störungen im zusammengesetzten elektromagnetischen(1) Feld kommen könne und dass diese sich mit einer konstanten Geschwindigkeit wie (1)Wellen in einem Teich bewegen würden. Wenn die Länge dieser (2)Wellen (der Abstand zwischen zwei Wellenkämmen) einen Meter oder mehr beträgt, so handelt es sich um (1)Radiowellen, wie wir heute sagen. Kürzere (3)Wellen werden als Mikrowellen(1) (ein paar Zentimeter lang) oder Infrarot (länger als ein zehntausendstel Zentimeter) bezeichnet. Sichtbares Licht(3) hat eine (1)Wellenlänge zwischen vierzig und achtzig millionstel Zentimeter. Und es sind noch kürzere (2)Wellenlängen bekannt, zum Beispiel Ultraviolett, (1)Röntgen- und Gammastrahlen(1).
Aus Maxwells(3) Theorie folgt, dass sich Radio- oder Lichtwellen(1) mit einer bestimmten konstanten Geschwindigkeit bewegen. Aber Newtons Theorie ließ die Vorstellung von einem absoluten (2)Ruhezustand nicht mehr zu. Wenn man also annahm, dass das Licht