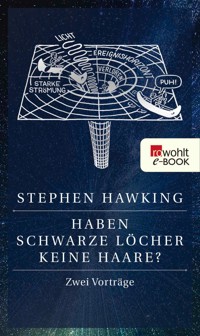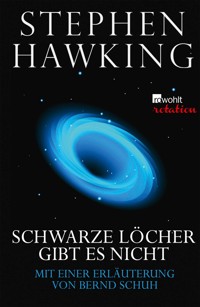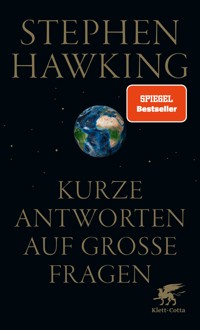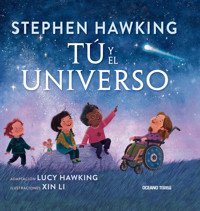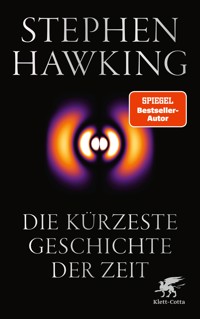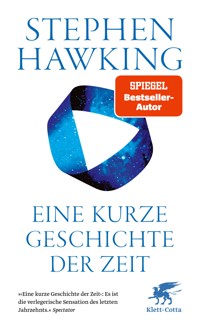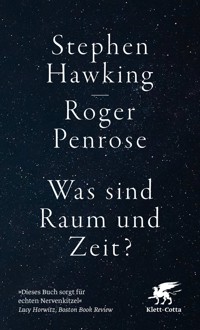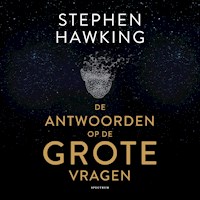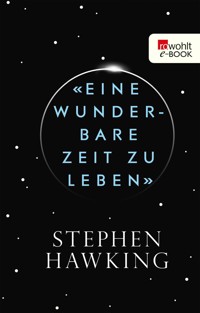
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stephen Hawking ist der berühmteste Wissenschaftler unserer Zeit. Ein Meister der eleganten Vereinfachung, der Mann, der Astrophysik und Kosmologie weltweit populär gemacht hat. Dieses kleine Lesebuch, zusammengestellt aus Anlass des 75. Geburtstages, präsentiert in Selbstzeugnissen den privaten Stephen Hawking — Kindheit, Studium, Karrierebeginn und das Leben mit ALS – und sein wissenschaftliches Credo in ausgewählten Texten. Es ist für alle gedacht, die sich wichtige Stationen in Leben und Werk des großen Physikers noch einmal vor Augen führen oder anhand von einigen seiner Texte Zugang finden möchten zu Stephen Hawkings Universum. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? – Menschheitsfragen, die uns alle beschäftigen, Fragen nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Für die Welt der Physik, der Kosmologie, hat Stephen Hawking sein eigenes Bild dazu entworfen. Hawkings Aufsatz «Informationserhaltung und Wettervorhersage für Schwarze Löcher» und der Essay «Die Haare der Schwarzen Löcher» von Bernd Schuh werden hier zum ersten Mal in einer Printausgabe publiziert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Stephen Hawking
«Eine wunderbare Zeit zu leben»
Über dieses Buch
Stephen Hawking ist der berühmteste Wissenschaftler unserer Zeit. Ein Meister der eleganten Vereinfachung, der Mann, der Astrophysik und Kosmologie weltweit populär gemacht hat. Dieses kleine Lesebuch, zusammengestellt aus Anlass des 75. Geburtstages, präsentiert in Selbstzeugnissen den privaten Stephen Hawking — Kindheit, Studium, Karrierebeginn und das Leben mit ALS – und sein wissenschaftliches Credo in ausgewählten Texten. Es ist für alle gedacht, die sich wichtige Stationen in Leben und Werk des großen Physikers noch einmal vor Augen führen oder anhand von einigen seiner Texte Zugang finden möchten zu Stephen Hawkings Universum.
Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? – Menschheitsfragen, die uns alle beschäftigen, Fragen nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Für die Welt der Physik, der Kosmologie, hat Stephen Hawking sein eigenes Bild dazu entworfen.
Hawkings Aufsatz «Informationserhaltung und Wettervorhersage für Schwarze Löcher» und der Essay «Die Haare der Schwarzen Löcher» von Bernd Schuh werden hier zum ersten Mal in einer Printausgabe publiziert.
Vita
Stephen Hawking wurde am 8. Januar 1942 in Oxford geboren und ist am 14. März 2018 in Cambridge gestorben. Der Astrophysiker ist der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit. 1962 erfuhr der junge Student, dass er an einer unheilbaren Motoneuronen-Erkrankung litt und nur noch wenige Monate zu leben habe. Trotz dieser schrecklichen Diagnose setzte er seine Studien fort und ging an die Universität Cambridge, wo ihm freie Hand für seine einflussreichen Arbeiten insbesondere über Schwarze Löcher gegeben wurde. Dreißig Jahre lang, von 1979 bis 2009, war er «Lucasischer Professor für Mathematik» im Fachbereich für angewandte Mathematik und theoretische Physik, ein Lehrstuhl, den in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Isaac Newton innehatte. Für seine Beiträge zur modernen Kosmologie hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 2009 die US Presidential Medal of Freedom und 2013 den Special Fundamental Physics Prize. Hawking war Mitglied der Royal Society und der US National Academy of Sciences.
Impressum
Die Texte von Stephen Hawking sind entnommen dem 2013 im Verlag Bantam Books, New York, erschienenen Buch «My Brief History», deutsch «Meine kurze Geschichte», Rowohlt Verlag 2013; dem 1993 im Verlag Bantam Books, New York, erschienenen Buch «Black Holes and Baby Universes and Other Essays», deutsch «Einsteins Traum. Expeditionen an die Grenzen der Raumzeit», Rowohlt Verlag, Reinbek 1993; dem 2010 im Verlag Bantam Books, New York, erschienenen Buch «The Grand Design», deutsch «Der Große Entwurf», Rowohlt Verlag, Reinbek 2010, sowie dem E-Book «Schwarze Löcher gibt es nicht», Rowohlt Verlag, Reinbek 2014 mit der Übersetzung von «Information Preservation and Weather Forcasting for Black Holes» auf ArXiv, Copyright © by Stephen Hawking 2013.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2017
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© 1993, 2019, 2013, 2014, 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«My Brief History» © by Stephen Hawking 2013
«Black Holes and Baby Universes and Other Essays» © by Stephen Hawking 1993
«The Grand Design» © by Stephen Hawking 2010
«Information Preservation and Weather Forcasting for Black Holes»
© by Stephen Hawking 2013
Übersetzung der ausgewählten Texte von Stephen Hawking: Hainer Kober
Übersetzung von «Informationserhaltung und Wettervorhersage
für Schwarze Löcher»: Bernd Schuh
Lektorat Frank Strickstrock
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-40068-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
[Kapitel]
Kindheit
St. Albans
Oxford
Meine Erfahrung mit ALS
Was ist Wirklichkeit?
Schwarze Löcher und Baby-Universen
Informationserhaltung und Wettervorhersage für Schwarze Löcher
Abstract (Kurzfassung)
Die Haare der Schwarzen Löcher
Physikerhumor
Dunkle Sterne
Gravitation reloaded
Schwarzschild findet den schwarzen Schild
Monster der Milchstraßen
Schwarze Löcher müssen nicht zum Friseur
Entropie und Information
Wie heiß ist ein Schwarzes Loch?
Die Quanten kommen
Das Informationsparadoxon
Die Welt als Hologramm
Hawking leugnet das Loch – zum ersten Mal
Die Feuerwand
Hawking leugnet das Loch – zum zweiten Mal
Schmetterling schluckt Information
Reaktionen
Wo genau ist die Information?
Zurück zum Friseur
Kleiner Exkurs über «Symmetriebrechung»
Haarimplantate für Schwarze Löcher
Keine Grenzen
Nachweise
Texte
Abbildungen
Stephen Hawking
Vorwort
Stephen Hawking ist zweifellos der berühmteste Wissenschaftler unserer Zeit. Ein Meister der kreativen Übertragung und eleganten Vereinfachung, der Mann, der Astrophysik und Kosmologie weltweit populär gemacht hat und dazu auch so schwierige Gebiete wie die Relativitätstheorie und die Quantenphysik. Ein Wissenschaftler von außerordentlichem Charisma, dessen Faszination, wie er selbst verschiedentlich anmerkte, sich auch dem frappierenden Gegensatz zwischen seinem bewegungsunfähigen Körper und seinem weit ausgreifenden Geist verdankt. Bis heute verblüfft er die Fachwelt und die breite Öffentlichkeit mit neuen, erklärenden Variationen zu seinem großen Thema, den Schwarzen Löchern, kollabierte Sterne, deren Gravitationskraft so groß ist, dass sie alles in sich hineinziehen, was in ihr Schwerefeld gerät. Ist das wirklich so? Und was passiert dann damit? Zwei große Fragen, die Hawking seit Jahrzehnten beschäftigen. Zumal eine noch größere Frage dahintersteht: Welche Rolle spielen Schwarze Löcher für die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantentheorie den Makrokosmos und den Mikrokosmos mit unterschiedlichen Naturgesetzen ausstatten, die zueinander einstweilen nicht passen wollen?
Zum Anlass von Stephen Hawkings 75. Geburtstag ist dieses kleine Lesebuch entstanden. Es ist für jene Leserinnen und Leser gedacht, die sich entweder einige wichtige Stationen in Leben und Werk des großen Physikers noch einmal vor Augen führen möchten – oder aber anhand von einigen seiner wichtigsten Texte Zugang finden möchten zu Stephen Hawkings Universum. Deshalb beginnt das Buch mit autobiographischen Schilderungen seiner Kindheit und Jugend und mit einer Frage, die viele seiner Leser immer wieder bewegt hat: Wie lebt Stephen Hawking mit seiner ALS-Krankheit, die ihn mit zwanzig zu lähmen begann und dann zum Leben und Arbeiten im Rollstuhl zwang? Auch in seinem wunderbaren Text am Schluss des Buches gibt er in einer kurzen Lebensbilanz darauf eine bewegende Antwort.
Neben dem persönlichen Credo steht das wissenschaftliche, durch die ausgewählten drei Texte angesichts eines reichen publizistischen Schaffens selbstverständlich nur episodisch darstellbar. Die Frage, was denn eigentlich die Wirklichkeit ist, beschäftigt nicht nur Philosophen seit Jahrtausenden, sondern immer auch die moderne Physik. Ohne sie zu beantworten, ist es kaum möglich zu klären, worauf wissenschaftliche Erkenntnis sich bezieht. Stephen Hawking gibt hier seine Antwort darauf. Die beiden weiteren Texte sind ein früheres und ein aktuelles Beispiel für Hawkings Auseinandersetzung mit Schwarzen Löchern, deren Bedeutung für die theoretische und praktische Physik Hawking schon erkannte, als viele das Phänomen noch gar nicht akzeptiert hatten.
Der zweite Text, «Informationserhaltung und Wettervorhersage für Schwarze Löcher», ist zugleich ein Beispiel dafür, wie Physiker schreiben, wenn sie «unter sich» diskutieren. Er bedarf also der Erklärung. Der Physiker und Autor Bernd Schuh, für den Rowohlt Verlag als Fachlektor für Physik und Mathematik tätig, gibt sie in dem darauf folgenden Essay. Mehr noch erklärt er, was man über Schwarze Löcher wissen muss, und beschreibt Hawkings Auseinandersetzung damit bis zu seinem jüngsten Aufsatz über das Thema aus dem Jahr 2016. Eine erhellende Lektüre. Diese beiden Texte sind bisher allein als E-Book erhältlich gewesen und erscheinen hier zum ersten Mal im Druck.
Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? – Menschheitsfragen, die der Maler Paul Gauguin 1897 in sein berühmtes Bild gefasst hat. Es sind Fragen, die uns alle beschäftigen, Fragen nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Für die Welt der Physik, der Kosmologie, hat Stephen Hawking sein eigenes Bild dazu entworfen. Hier sind einige interessante Ausschnitte daraus. Mögen sie die Neugier wecken auf das Ganze.
Frank Strickstrock
Kindheit
Mein Vater Frank stammte aus einer Familie von Pachtbauern in Yorkshire. Sein Großvater John Hawking, mein Urgroßvater, war ein wohlhabender Landwirt. Doch er hatte zu viele Höfe gekauft und verlor sein ganzes Vermögen in der landwirtschaftlichen Depression zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Sein Sohn Robert – mein Großvater – versuchte, seinem Vater zu helfen, machte aber selbst Bankrott. Zum Glück besaß Roberts Frau ein Haus in Boroughbridge, in dem sie eine Schule betrieb und für ein bescheidenes Einkommen sorgte. So ermöglichten sie es ihrem Sohn, in Oxford Medizin zu studieren. Mein Vater bekam eine Reihe von Stipendien und Preisen, die ihm erlaubten, seinen Eltern etwas Geld zurückzuschicken. Dann wandte er sich der Tropenmedizin zu und ging 1937 im Rahmen seiner Forschungsarbeiten nach Ostafrika. Bei Kriegsbeginn reiste er auf dem Landweg quer durch Afrika den Kongo-Fluss hinab, gelangte per Schiff nach England und meldete sich freiwillig zum Militärdienst. Man teilte ihm jedoch mit, er werde dringender in der medizinischen Forschung gebraucht.
Meine Mutter stammte aus Dunfermline in Schottland und wurde als drittes von acht Kindern eines praktischen Arztes geboren. Das älteste war ein Mädchen mit Downsyndrom und lebte getrennt von der Familie in Pflege, bis es mit dreizehn Jahren starb. Als meine Mutter zwölf war, zog die Familie ins südlich gelegene Devon. Wie die Familie meines Vaters war auch die meiner Mutter nicht sehr begütert. Trotzdem ließ sie meine Mutter in Oxford studieren. Nach dem Studium arbeitete sie in verschiedenen Berufen, unter anderem als Finanzinspektorin, was ihr nicht gefiel. Sie gab diese Stellung auf und wurde Sekretärin. In dieser Funktion lernte sie Anfang des Krieges meinen Vater kennen.
Ich wurde am 8. Januar 1942 geboren, genau dreihundert Jahre nach Galileis Tod. Aber ich schätze, dass noch ungefähr zweihunderttausend andere Kinder an diesem Tag geboren worden sind. Ob sich eines von ihnen später für Astronomie interessierte, weiß ich nicht.
Ich kam in Oxford zur Welt, obwohl meine Eltern in London wohnten. Das hatte einen guten Grund: Die Deutschen hatten versprochen, Oxford und Cambridge mit ihren Bomben zu verschonen. Im Gegenzug hatten sich die Engländer bereit erklärt, Heidelberg und Göttingen nicht zu bombardieren. Es ist sehr schade, dass man derart zivilisierte Vereinbarungen nicht für mehr Städte hat treffen können.
Wir lebten in Highgate, im Norden Londons. Achtzehn Monate nach mir wurde meine Schwester Mary geboren. Es heißt, ich sei über diesen Zuwachs nicht sehr erfreut gewesen. Unsere ganze Kindheit hindurch gab es eine gewisse Spannung zwischen uns, die durch den geringen Altersunterschied genährt wurde. Später, als wir erwachsen wurden und verschiedene Wege gingen, hat sich das gelegt. Sehr zur Freude meines Vaters wurde sie Ärztin.
Meine Schwester Philippa wurde geboren, als ich fast fünf war und besser begreifen konnte, was vor sich ging. Ich weiß noch, dass ich mich auf ihre Geburt freute, wegen der Aussicht, zu dritt spielen zu können. Sie war ein sehr lebhaftes und aufgewecktes Kind. Ich habe immer viel auf ihr Urteil und ihre Meinung gegeben. Wesentlich später wurde mein Bruder Edward adoptiert. Ich war damals vierzehn, sodass er kaum noch eine Rolle in meiner Kindheit gespielt hat. Er entwickelte sich ganz anders als wir anderen drei. Seine Interessen waren nicht im Geringsten akademischer und intellektueller Natur. Wahrscheinlich war das gut für uns. Er war ein recht schwieriges Kind, aber man musste ihn einfach gernhaben. 2004 starb er aus nie ganz geklärten Ursachen; höchstwahrscheinlich wurde er von den Dämpfen des Klebstoffs vergiftet, den er für die Renovierung seiner Wohnung verwendete.
In meiner frühesten Erinnerung stehe ich im Kindergarten Byron House in Highgate und schreie mir die Lunge aus dem Hals. Um mich herum spielten Kinder mit, wie mir schien, herrlichem Spielzeug. Ich wollte mitspielen, aber ich war erst zweieinhalb Jahre alt und zum ersten Mal allein bei Menschen, die ich nicht kannte, und hatte Angst. Ich glaube, meine Eltern hat meine Reaktion ziemlich überrascht. Da ich ihr erstes Kind war, hatten sie kluge Bücher über die frühkindliche Entwicklung gelesen, in denen stand, dass Kinder ihre ersten sozialen Kontakte mit zwei Jahren knüpfen. Dennoch nahmen sie mich nach jenem schrecklichen Morgen aus der Tagesstätte und schickten mich erst anderthalb Jahre später wieder hin.
Damals, während des Krieges und kurz danach, war Highgate eine Gegend, in der viele Wissenschaftler und Akademiker lebten. (In einem anderen Land hätte man sie als Intellektuelle bezeichnet, aber die Engländer haben niemals zugegeben, dass es unter ihnen Intellektuelle gibt.) Alle diese Eltern schickten ihre Kinder in die Byron House School, die für damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich war.
Ich weiß noch, dass ich mich bei meinen Eltern beklagte, man bringe mir dort nichts bei. Die Lehrer dieser Schule glaubten nicht an die damals üblichen Methoden, Kindern den Stoff einzutrichtern. Stattdessen sollten wir lesen lernen, ohne zu merken, dass es uns beigebracht wurde. Schließlich lernte ich tatsächlich lesen, allerdings erst, als ich bereits mein achtes Lebensjahr erreicht hatte. Meine Schwester Philippa lernte nach eher herkömmlichen Methoden lesen, mit dem Ergebnis, dass sie es mit vier Jahren konnte. Aber sie war damals sowieso eindeutig klüger als ich.
Wir wohnten in einem hohen, schmalen Haus aus Viktorianischer Zeit, das meine Eltern während des Krieges billig erworben hatten, als alle Welt glaubte, London würde unter dem Bombenhagel dem Erdboden gleichgemacht. Tatsächlich schlug nur wenige Häuser weiter eine V2-Rakete ein. Ich war zu diesem Zeitpunkt mit meiner Mutter und meiner Schwester unterwegs, aber mein Vater war zu Hause. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt und das Haus nicht sonderlich beschädigt. Allerdings befand sich noch jahrelang ein großes Ruinengrundstück in unserer Straße, auf dem ich mit meinem Freund Howard spielte, der drei Häuser weiter in die andere Richtung wohnte. Howard war für mich eine Offenbarung, weil seine Eltern keine Intellektuellen waren wie die Eltern aller anderen Kinder, die ich kannte. Er besuchte die staatliche Grundschule, nicht Byron House, und kannte sich in Fußball und Boxen aus, Sportarten, für die sich meine Eltern nicht im Traum interessiert hätten.
Ich erinnere mich auch noch, wie ich meine erste Spielzeugeisenbahn bekam. Während des Krieges wurde kein Spielzeug hergestellt, zumindest nicht für den Binnenmarkt. Aber ich hatte eine Leidenschaft für Modelleisenbahnen entwickelt. Mein Vater versuchte, mir einen Holzzug zu basteln, aber damit war ich nicht zufrieden, denn ich wollte etwas, das sich in Bewegung setzte. Also kaufte mein Vater eine gebrauchte Eisenbahn zum Aufziehen, reparierte sie mit einem Lötkolben und schenkte sie mir zu Weihnachten, als ich fast drei war. Die Eisenbahn fuhr nicht besonders gut. Aber dann, unmittelbar nach dem Krieg, unternahm mein Vater eine Reise nach Amerika. Als er mit der «Queen Mary» zurückkehrte, brachte er meiner Mutter Nylonstrümpfe mit, die damals in England nicht zu bekommen waren. Für meine Schwester Mary hatte er eine Puppe, die die Augen schloss, wenn man sie hinlegte, und für mich einen amerikanischen Zug mit Kuhfänger an der Lok und einem Gleis in Form einer Acht. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich die Schachtel öffnete.
Mit einer Eisenbahn zum Aufziehen ließ sich schon etwas anfangen, aber was ich mir wirklich wünschte, war eine elektrische. Stundenlang betrachtete ich die Auslage eines Modelleisenbahnklubs in Crouch End in der Nähe von Highgate. Ich träumte von elektrischen Eisenbahnen. Eines Tages schließlich, als meine Eltern beide unterwegs waren, nutzte ich die Gelegenheit und hob von meinem Postbankkonto den bescheidenen Betrag ab, der sich dort – zusammengespart von Geldgeschenken zu besonderen Anlässen, etwa zur Taufe – angesammelt hatte. Davon kaufte ich mir eine elektrische Eisenbahn, die aber zu meiner großen Enttäuschung auch nicht sehr gut funktionierte. Ich hätte die Eisenbahn zurückbringen und vom Geschäft oder vom Hersteller Ersatz verlangen müssen. Doch damals hielt man es für ein Privileg, etwas kaufen zu dürfen, und es war eben Schicksal, wenn es sich als mangelhaft