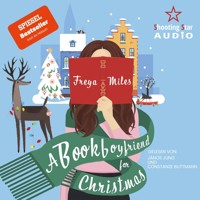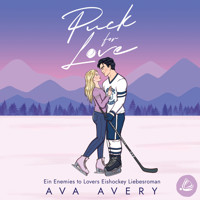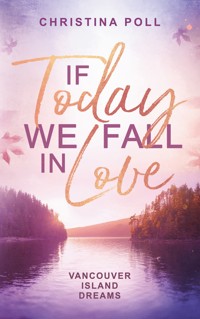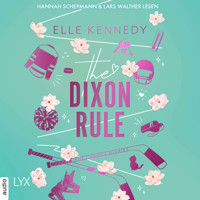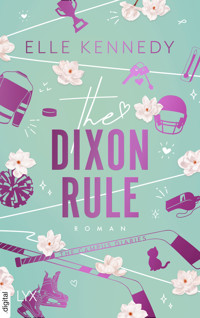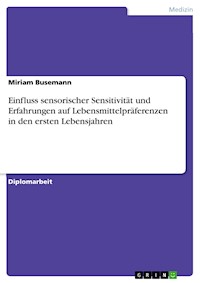
Einfluss sensorischer Sensitivität und Erfahrungen auf Lebensmittelpräferenzen in den ersten Lebensjahren E-Book
Miriam Busemann
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Gesundheit - Ernährungswissenschaft, Note: 1,0, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Voraussetzung für die Ableitung gesicherter Empfehlungen zur Ernährungserziehung von Kindern ist das Verständnis der Entstehung von Lebensmittelpräferenzen. Schon von frühester Kindheit an ist ein günstiges Ernährungsverhalten von Bedeutung, da in der Kindheit erlernte Verhaltensweisen oft bis ins Erwachsenenalter beibehalten werden. In dieser Arbeit sollen Einflussfaktoren auf die Ausbildung von Lebensmittelpräferenzen in den ersten Lebensjahren aufgezeigt werden. Dabei werden einerseits genetische Veranlagungen, wie die Sensitivität auf die Grundgeschmacksqualitäten und die genetisch bestimmte Schmeckfähigkeit von PROP näher betrachtet. Andererseits wird eine Vielzahl von verschiedenen Umweltfaktoren beleuchtet, die einen Einfluss auf Vorlieben und Abneigungen für bestimmte Lebensmittel und Geschmacksrichtungen haben. Es wird deutlich, dass Geschmackspräferenzen bereits durch die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft und der Stillzeit geprägt werden. Durch das Fruchtwasser bzw. die Muttermilch sammeln Kinder, auch schon vor der Geburt, erste Erfahrungen mit Aromen der Lebensmittel die von der Mutter konsumiert werden. Aber auch nicht gestillte Säuglinge werden durch die Art der erhaltenen ersten Nahrung in ihren Geschmackspräferenzen geprägt. So bilden sich sensorisch spezifische Präferenzen je nach Art der erhaltenen Säuglingsnahrung aus. Dem soziokulturellen Umfeld des Kindes, sowie seinen Eltern, Geschwistern und sonstigen Bezugspersonen, wird ebenfalls ein Einfluss auf die Ausbildung von Lebensmittelpräferenzen zugeschrieben. Gerade durch die Beobachtung Anderer beim Verzehr von Lebensmitteln werden das Essverhalten und damit auch die Lebensmittelpräferenzen beeinflusst. Eltern und Erziehende beeinflussen allerdings nicht nur durch ihre Vorbildfunktion die Präferenzen und Abneigungen des Kindes. Sie fördern bzw. hemmen die Akzeptanz bestimmter Lebensmittel zudem durch Maßnahmen, wie die Beschränkung des Zugangs zu beliebten Lebensmitteln oder durch den Einsatz von Belohnungen für den Verzehr von unbeliebten Lebensmitteln. Zur Förderung eines günstigen Ernährungsverhaltens des Kindes lassen sich somit Empfehlungen an Eltern und Erziehende, sowie an Verantwortliche im Bereich der Ernährungserziehung von Kindern ableiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen der Sensorik
2.1 Sinnesphysiologie
2.1.1 Sinneseindrücke und Empfindungen
2.1.2 Das Zusammenspiel der verschiedenen Sinneseindrücke beim Essen und Trinken
2.1.3 Anatomische und physiologische Grundlagen der Sinne
2.1.4 Geruchswahrnehmung
2.1.5 Geschmackswahrnehmung
2.1.6 Wahrnehmung von Flavor und Aroma
2.2 Sensorische Prüfmethoden
2.2.1 Sensorische Prüfmethoden bei Säuglingen
2.2.2 Hedonische Prüfungen bei Kleinkindern und Kindern
3 Grundlagen der Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern
3.1 Die Ernährung des Säuglings
3.1.1 Ernährungsplan für das erste Lebensjahr
3.1.2 Muttermilch und Säuglingsanfangsnahrungen
3.2 Ernährungsverhalten von Säuglingen und Kleinkindern
3.2.1 Psychologische Einflussfaktoren bei der Entwicklung des Ernährungsverhaltens
3.2.2 Einfluss der Eltern auf das Ernährungsverhalten des Kindes
3.2.3 Ähnlichkeiten im Ernährungsverhalten von Eltern und Kindern
4 Bildung von Nahrungsmittelpräferenzen
4.1 Angeborene Geschmackspräferenzen
4.2 Konditionierte Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen
4.3 Kulturelle Einflüsse
4.4 Nahrungsmittelaversionen
4.5 Nahrungsmittelneophobien und die Akzeptanz neuer Nahrungsmittel
5 Sensorische Studien mit Säuglingen, Kleinkindern und jungen Schulkindern
5.1 Frühkindliche Geschmackserfahrungen
5.1.1 Geschmackserfahrungen durch Muttermilch
5.1.2 Geschmackserfahrungen durch Säuglingsanfangsnahrung
5.2 Reaktionen auf die Grundgeschmacksqualitäten und ihre Auswirkungen auf Geschmackspräferenzen
5.2.1 Geschmacksqualität süß
5.2.2 Geschmacksqualität sauer
5.2.3 Geschmacksqualität salzig
5.2.4 Geschmacksqualität bitter
5.3 Olfaktorische Studien bei Säuglingen
5.3.1 Pränatale Gerüche
5.3.2 Pränatale und postnatale Gerüche im Vergleich
5.3.3 Postnatale Gerüche
5.4 Entwicklung der Akzeptanz von Lebensmitteln in den ersten Lebensjahren
5.4.1 Einfluss der Eltern
5.4.2 Neue / unbekannte Lebensmittel
6 Vergleich der Studiendesigns
7 Schlussbetrachtung und Ausblick
8 Zusammenfassung
9 Abstract
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Sensogramm
Abbildung 2: Zusammenwirken verschiedener Teilfaktoren des Flavors
Abbildung 3: Veränderung des Gesichtsausdruck von Neugeborenen als Reaktion auf verschiedene Gerüche
Abbildung 4: Testvorrichtung für Geruchstest mit Säuglingen
Abbildung 5: Hedonische Gesichterskala
Abbildung 6: Der Ernährungsplan für das 1. Lebensjahr
Abbildung 7: Veränderung der Wechselwirkung innerer Signale, äußerer Reize und Einstellungen & Überzeugungen im Lebenszyklus
Abbildung 8: Veränderung der Aufnahmemenge eines neuen Lebensmittels im Zeitverlauf
Abbildung 9: Durchschnittliche Aufnahmemenge (g) der erhaltenen Gemüsevariante bei gestillten und nicht gestillten Kindern
Abbildung 10: Anzahl der in den Studien untersuchten Altersgruppen
Abbildung 11: Anzahl primärer und sekundärer Messmethoden
Abbildung 12: Untersuchte Einflussfaktoren auf die Ausbildung von Lebens-mittelpräferenzen im Kindesalter
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Einteilung der Sinneseindrücke
Tabelle 2: Ähnlichkeiten von Vorlieben und Abneigungen verschiedener Lebensmittel bei Mutter und Kind
Tabelle 3: Klassifikation menschlicher Nahrungsversionen
Tabelle 4: Häufigkeit der Messmethoden in den Untersuchungsfeldern
Tabelle 5: Häufigkeit der Messmethoden in den verschiedenen Altersgruppen
1 Einleitung
Die Bedeutung einer angemessenen Ernährung für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung von frühster Kindheit an ist seit Langem bekannt.[1] In den letzten Jahren ist darüber hinaus deutlich geworden, dass die Ernährung während der Kindheit und Jugend mit dem Auftreten verschiedener, vor allem chronischer Erkrankungen im Erwachsenenalter zusammenhängt. Somit hat die Ernährung schon im Kindsalter eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Auswirkungen der Ernährung in den ersten Lebensjahren zeigen sich bis ins Erwachsenenalter.[2] Sowohl Ernährungsgewohnheiten als auch Geschmacks-präferenzen werden schon in den ersten Monaten des Lebens geprägt. So hat die Wahl der ersten Nahrung – Muttermilch oder Säuglingsnahrung – schon Einfluss auf die Ausbildung von Geschmackspräferenzen.
Die Ernährung der Bevölkerung westlicher Industrienationen, insbesondere die von Kindern, entspricht nicht den Empfehlungen für eine gesundheitsförderliche Ernährungsweise. Kampagnen zur Verbesserung der Ernährungsweise, wie z.B. „5-am-Tag“, zielen meist auf eine Steigerung des Ernährungswissens und auf eine daraus resultierende Änderung der Einstellung ab. Eine langfristige Änderung des Ernährungsverhaltens hat sich allerdings als schwierig erwiesen, da eine Verhaltensänderung durch die Steigerung des Ernährungswissens allein kaum erreicht wird. Eine alternative Perspektive zielt auf hedonische Faktoren ab, wie Geschmack, Geruch, Textur und Aussehen eines Lebens-mittels. Versuche zu erklären, weshalb beispielsweise der Gemüsekonsum bei Erwachsenen und bei Kindern nicht den Empfehlungen entspricht, haben als Hindernis oft Geschmackspräferenzen hervorgehoben. Bei Kindern hat das Mögen eines Lebensmittels den größten Einfluss auf dessen Verzehr. Wenn also das Nicht-Mögen der wichtigste Grund für eine geringe Gemüseaufnahme ist, so könnten bei Kindern Interventionen, die eine Änderung der Lebensmittel-präferenzen bewirken wollen, Einflüsse auf die Änderung der Akzeptanz von Gemüse haben.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, wodurch Lebensmittel-präferenzen beeinflusst werden können und wie diese Einflussfaktoren zusammenwirken. Dabei sollen sowohl genetische Einflüsse als auch Erfahrungswerte im Kindesalter behandelt werden.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes[3] der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) soll die sensorische Akzeptanz von öko-logischen Lebensmitteln bei Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren im Zusammenhang mit potentiellen sensorischen Prägungen durch ihre Ernährung im ersten Lebensjahr untersucht werden. Es soll insbesondere geprüft werden, ob gestillte Säuglinge und Säuglinge, die mit selbst hergestellter Beikost ernährt wurden, im Kleinkind-, Vorschulalter und jungem Schulalter größere Geschmacksvariationen – wie bei ökologischen Lebensmitteln – akzeptieren als Kinder, die überwiegend mit industriell hergestellter Säuglingsnahrung und Beikost ernährt wurden.
Mit der vorliegenden Arbeit werden mögliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Geschmackspräferenzen in den ersten Lebensjahren beleuchtet und verschiedene Untersuchungen auf diesem Fachgebiet vergleichend dargelegt. Dabei wird bereits ein möglicher Einfluss auf den Fötus im Mutterleib näher betrachtet. Weiter werden die Akzeptanzmuster gestillter und mit Säuglingsnahrung ernährter Säuglinge vergleichend gegenübergestellt. Einen weiteren Untersuchungsgegenstand stellen der Einfluss der Ernährung des Kindes und die Fütterungspraxis der Eltern auf die Ausbildung von Geschmackspräferenzen im Kindesalter dar. Damit liefert diese Arbeit wichtige Hintergrundinformationen für das oben beschriebene Forschungsprojekt.
1.1 Problemstellung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Einflussfaktoren auf die Ausbildung von Geschmackspräferenzen in den ersten Lebensjahren aufzuzeigen. Hierbei sollen sensorische Studien mit Säuglingen, Kleinkindern und jungen Schul-kindern beleuchtet werden, die sich mit der sensorischen Sensitivität und Geschmackspräferenzen befassen. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der Betrachtung von Studien aus den Jahren 1994 bis 2006, da ältere Untersuchungen schon umfassend in einer vorangegangenen Diplomarbeit dargestellt wurden.[4] Die in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Studien befassen sich ausschließlich mit gesunden Säuglingen, Kleinkindern und Kindern, die in westlichen Industrienationen leben. Nicht berücksichtigt werden sowohl Untersuchungen mit Kindern, die eine bestimmte Krankheit aufweisen und Untersuchungen mit Kindern aus Entwicklungsländern. In erster Linie werden Studien aus den USA beschrieben, da auf dem Gebiet der Kinderernährung dort die meiste Forschung betrieben wird. In Deutschland werden vergleichsweise wenig sensorische Studien mit Kindern durchgeführt.[5]
1.2 Aufbau der Arbeit
Nach der Einleitung soll zunächst eine kurze Einführung in die Sinnes-physiologie mit besonderem Augenmerk auf die Geschmacks- und Geruchs-wahrnehmung erfolgen. Im Anschluss daran werden eine Auswahl von sensorischen Prüfmethoden bei Untersuchungen mit Säuglingen und Klein-kindern vorgestellt, die ihre Anwendung in zahlreichen Untersuchungen des 5. Kapitels finden.
Darauf folgend sollen die Grundlagen der Ernährung von Säuglingen und das Ernährungsverhalten von Säuglingen und Kleinkindern beschrieben werden. Damit bilden die Kapitel 2 und 3 die Ausgangsbasis und das Verständnis der Untersuchungen im 5. Kapitel.
Im anschließenden Kapitel 4 werden Faktoren beschrieben, die die Bildung von Nahrungsmittelpräferenzen im Kindesalter prägen. Dabei werden sowohl angeborene, als auch erlernte Geschmacks- und Nahrungsmittelpräferenzen näher betrachtet. Zudem werden Nahrungsmittelneophobien und die Entstehung von Nahrungsmittelaversionen beschrieben.
Im darauf folgenden 5. Kapitel werden, unterteilt nach verschiedenen Themen-gebieten, einige sensorische Studien mit Säuglingen, Kleinkindern und jungen Schulkindern vorgestellt und vergleichend gegenübergestellt. Die Studien-designs der sensorischen Untersuchungen werden im anschließenden 6. Kapitel unter unterschiedlichen Gesichtspunkten miteinander verglichen.
Im Schlussteil werden zunächst die untersuchten Einflussfaktoren auf die Ausbildung von Lebensmittelpräferenzen im Kindesalter zusammengetragen. Anschließend werden daraus Empfehlungen für Eltern und Erziehende abgeleitet.
Die Arbeit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung der Arbeit, sowie einem Abstract.
2 Grundlagen der Sensorik
Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung in die Sinnesphysiologie, in der ein Überblick über die menschlichen Sinne und die Sinneseindrücke gegeben wird. Alle fünf Sinne werden dargestellt und die anatomischen und physiologischen Grundlagen der Sinne werden näher gebracht. Im Folgenden wird genauer auf die Geruchs- und Geschmackswahrnehmung eingegangen, da diese zum Verständnis folgender Kapitel unerlässlich sind. Sensorische Prüfmethoden, die sich mit der Untersuchung von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern befassen, werden im Anschluss vorgestellt.
2.1 Sinnesphysiologie
Sinne werden von Mensch und Tier benötigt, um Informationen aus der Umwelt aufzunehmen und um den Zustand ihres Organismus zu kontrollieren.[6] Traditionellerweise wurden die einzelnen Sinnesfühler, die oft in größeren Sinnesorganen zusammengeschlossen sind, Rezeptoren genannt. Mittlerweile hat sich der Rezeptorbegriff aber gewandelt; für Sinnes-Rezeptor wird heute hauptsächlich der Begriff Sensor verwandt. Beim Menschen gibt es verschiedene Arten von Empfindungen, die von verschiedenen Sinnessystemen vermittelt werden: Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen. Diese Grundtypen der Empfindung werden Sinnesmodalitäten genannt. Innerhalb einer Sinnesmodalität werden wiederum verschiedene Qualitäten unter-schieden, z.B. Süß- oder Salzigschmecken.
Bereits in der Embryonalphase werden alle Sinne angelegt und reifen unter-schiedlich schnell und lang.[7] Im letzten Drittel der Schwangerschaft sucht der Fötus z.B. Berührungsreize, und es ist ihm möglich, zu hören und zu schmecken. Der Tastsinn ist zum Zeitpunkt der Geburt am weitesten entwickelt, der Geruchs- und Geschmackssinn recht weit und das Gehör mäßig entwickelt. Der Gesichtssinn ist zu diesem Zeitpunkt nur bruchstückhaft entwickelt.
2.1.1 Sinneseindrücke und Empfindungen
Die Sinneseindrücke werden durch die Sinnesorgane an das Zentralnerven-system weitergeleitet.[8] In entsprechenden Empfindungen äußern sich daraufhin die hervorgerufenen Reaktionen. Den Sinnesorganen entsprechend verfügt der Mensch über fünf Sinne (Empfindungsmodalitäten). Das Zusammenwirken aller Sinne macht den sensorischen Gesamteindruck aus. Einen genaueren Überblick über die Zusammenhänge von Sinnesorgan, Empfindungsmodalität, Sinneseindruck und Empfindungsqualität gibt Tabelle 1.
Tabelle 1: Einteilung der Sinneseindrücke [9]
2.1.2 Das Zusammenspiel der verschiedenen Sinneseindrücke beim Essen und Trinken
Gewöhnlich geschieht der erste Kontakt mit einem Lebensmittel durch das Sehen, dem das Riechen, Hören und Tasten folgen können.[10] Verschiedene Sinneseindrücke, wie Aussehen und der Geruch von frisch gebackenen Brötchen, Geräusche beim Kauen und der Unterschied von knuspriger Kruste und weicher Krume im Mund, können auch gleichzeitig ablaufen. Beim Essen tasten zunächst die Lippen; Konsistenz und Beschaffenheit werden im Mundraum weiter ertastet. Die Wahrnehmung von Kälte, Wärme und Schmerz erfolgt ebenso wie die Vermittlung von Kaugeräuschen durch das Hören. Darauf folgen unmittelbar das Schmecken auf der Zunge und das damit verbundene Riechen einer Vielfalt von Aromen, indirekt vermittelt über den Nasen-Rachenraum. Von diesen Empfindungen wird unser Gesamturteil über ein Lebensmittel, vereinfacht auch als Geschmack bezeichnet, beeinflusst. In Abbildung 1 ist die Komplexität der sinnlichen Wahrnehmung dargestellt.
Abbildung 1: Sensogramm[11]
2.1.3 Anatomische und physiologische Grundlagen der Sinne
Gesichtssinn
Das Sinnesorgan des Gesichtssinns ist das Auge mit Sehnerv und Sehzentrum im Gehirn.[12] Das Sehen wird durch das einwandfreie Zusammenwirken ermöglicht. Über Kornea und Linse dringt Licht in das Auge ein und trifft auf die Retina (Netzhaut). Auf dieser befinden sich zwei unterschiedliche Sehzellen: die Stäbchen und Zäpfchen. Während wir mittels Zäpfchen Farben wahrnehmen können, sind die Stäbchen für das Schwarz-Weiß-Sehen verantwortlich.
Der Gesichtssinn ist für die sensorische Beurteilung von Produkten von großer Bedeutung. Farbe, Form, Größe, Struktur, Trübheit oder Glanz sind mit dem Auge wahrnehmbare Merkmale, die Aufschluss über ein Produkt geben und eine gewisse Produkterwartung erzeugen: die Farbe grün kann beispielsweise bei manchen Früchten mangelnde Reife signalisieren.[13] Die erste Sinnes-wahrnehmung eines Produkts erfolgt meist mit dem Auge.[14] Mit der Farbe werden bestimmte Gerüche und Geschmacksrichtungen assoziiert, mit rot z.B. Erdbeere oder braun mit Schokolade. Der visuelle Sinn wirkt also dominierend und ist in der Lage, die chemischen Sinne Geruch und Geschmack irre-zuführen.[15]
Geruchssinn
In jeder Nasenhöhle befinden sich drei mit Schleimhaut ausgestattete Conchen.[16] Auf der obersten Conche befindet sich, beschränkt auf einen nur etwa 2 x 5 cm² großen Bereich, die olfaktorische Region (Riechepithel). Das Riechepithel besteht wiederum aus drei verschiedenen Zelltypen: den eigentlichen Riechzellen, den Stützzellen und den Basalzellen. Der Mensch besitzt etwa 30 Millionen Riechzellen mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von einem Monat. Die Riechsinneszellen sind primäre Sinneszellen, die durch zahlreiche in den Schleim ragende dünne Sinneshaare (Zilien) mit der Außenwelt verbunden sind.[17]
Geschmackssinn
In einer ganzheitlichen Betrachtungsweise versteht man unter Geschmack eines Stoffes alle Empfindungen, die über orale Reize während der Nahrungs-aufnahme entstehen.[18] Neben dem klassischen Geschmackssinn sind auch verschiedene andere Sinnesorgane beteiligt, wie insbesondere oral-trigeminale und olfaktorische Anteile. Der Geschmackssinn soll in diesem Abschnitt aber eher im traditionell anatomischen und physiologischen Ansatz beschrieben werden.
Auf dem Zungenrücken (Oberseite der Zunge) liegen die Geschmacks-papillen.[19] Es lassen sich drei Typen von Papillen morphologisch unterscheiden: Über die ganze Oberfläche verstreut sind die Pilzpapillen und stellen mit 200 bis 400 die zahlenmäßig größte Gruppe dar. Die 15 bis 20 Blätterpapillen finden sich am hinteren Seitenrand der Zunge und die großen Wallpapillen, von denen der Mensch nur sieben bis zwölf besitzt, liegen an der Grenze zum Zungen-grund.
Erwachsene besitzen etwa 2000-4000 Geschmacksknospen,[20] die sich in den Wänden und Gräben der Geschmackspapillen sowie vereinzelt am weichen Gaumen, der hinteren Rachenwand und am Kehldeckel befinden. Pilzpapillen enthalten jeweils nur drei bis vier Geschmacksknospen, die Blätterpapillen ca. 50 und die Wallpapillen oft mehr als 100.[21] Auf jeder Geschmacksknospe befinden sich wiederum etwa zehn bis 50 Geschmackssinneszellen, die nur eine mittlere Lebensdauer von zehn Tagen haben und aus Basalzellen der Geschmacksknospe regeneriert werden. Die geschätzte Zahl der Geschmacks-knospen reduziert sich mit zunehmendem Alter.[22]
Hautsinn