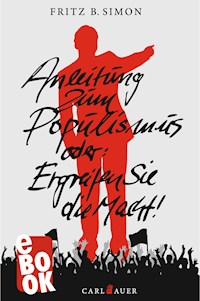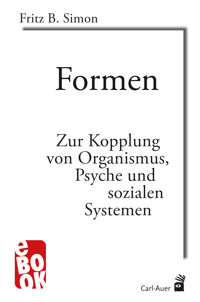Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Carl-Auer Compact
- Sprache: Deutsch
Familienunternehmen stellen mehr als zwei Drittel aller Unternehmen in Deutschland. Trotz ihrer unbestritten großen volkswirtschaftlichen Bedeutung bieten die zuständigen Wissenschaftsdisziplinen wie Betriebswirtschaftslehre oder Soziologie bisher keine tragfähigen Modelle zur Beschreibung dieser besonderen Kopplung von Familie und Unternehmen. Fritz B. Simon legt mit dieser Einführung eine verständliche Theorie für alle vor, die praktisch und wissenschaftlich mit Familienunternehmen zu tun haben, sei es als Familienmitglied, als Angestellter eines solchen Unternehmens, als Berater oder Forscher. Auf Grundlage der System- und Gesellschaftstheorie Luhmann'scher Prägung und des Konstruktivismus werden Familie und Unternehmen als soziale Systeme mit je eigener Kommunikation und Dynamik beschrieben, deren Zusammentreffen in einem Familienunternehmen die Beteiligten vor eine Reihe von Paradoxien und Doppelbindungen stellt. Auf diese Weise gelingt es, die Spielregeln der Systeme zu verstehen, Widersprüche zu managen und Erfolg versprechende Handlungsanweisungen abzuleiten. Das Buch bietet Orientierung für den Führungsalltag bis hin zum Mehr-Generationen-Familienunternehmen, für den Umgang mit Konflikten und Machtkämpfen und nicht zuletzt für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritz B. Simon
Einführung in die Theoriedes Familienunternehmens
eBook 2020
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Umschlaggestaltung: Uwe Göbel
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in the Czech Republic
Druck und Bindung: FINIDR, s. r. o.
Erste Auflage, 2012
ISBN 978-3-89670-843-4 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8236-8 (ePub)
© 2012 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/. Wenn Sie Interesse an unseren monatlichen Nachrichten haben, können Sie dort auch den Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
1Einleitung
1.1Wozu Theorie?
1.2Welche Theorie?
1.3Definition von Familienunternehmen
2Familien und Unternehmen – Unterschiedliche Typen sozialer Systeme und ihre unterschiedlichen Rationalitäten
2.1Historischer Rückblick
2.2Zwei Rationalitäten
2.3Familie und Unternehmen als koevolutionäre Einheit
2.4Identität und Zugehörigkeit
2.5Paradoxien in Familienunternehmen
3Paradoxiemanagement
3.1Scheiterstrategien
3.2Überlebensstrategien – Erfolgsmuster
4Die Familie
4.1Die Kernfamilie: Das Drei-Generationen-Schema
4.2Die Gründerfamilie
4.3Die Familie der zweiten Generation
4.4Die Familie der dritten, vierten … Generation: Mehr-Generationen-Familien
4.4.1Die Re-Inszenierung der Kleinfamilie
4.4.2Die Stammesorganisation
4.4.3Mehr-Familien-Unternehmen
4.4.4Die organisierte Großfamilie
4.4.5Die Großfamilie: Hybrid zwischen Familie und Organisation
5Das Unternehmen
5.1Entscheidungsprämissen
5.2Das Gründerunternehmen
5.3Unternehmenskultur
5.4Fremdmanagement
5.5Diversifizierung
6Kopplungen
6.1Lose und feste Kopplungen
6.2Familienunternehmen vs. börsennotierte Aktiengesellschaft
7Das Nachfolgeproblem
7.1Unterschiedliche Entwicklungs- und Veränderungsgeschwindigkeiten
7.2Zur Psychologie der Nachfolge
8Konflikte
8.1Konfliktvermeidung vs. Konfliktbetonung
8.2Die Institutionalisierung von Konflikten
8.3Machtkämpfe
9Einige Tipps für Familienmitglieder, Gesellschafter, Nachfolger, Fremdmanager …
Literatur
Über den Autor
1 Einleitung
1.1 Wozu Theorie?
Wer weiß, was er wann wie zu tun hat, braucht keine Theorie. Oder anders formuliert: Wer den Weg kennt, braucht keine Landkarte.
Es gibt Menschen, die intuitiv – ihrem »Bauchgefühl« folgend – lebenswichtige Entscheidungen treffen und erfolgreich damit sind: in der Familie, im Unternehmen, der eine entweder in der Familie oder im Unternehmen, der andere sowohl in der Familie als auch im Unternehmen … Alle diejenigen, die sich nicht auf die Treffsicherheit ihrer Intuition verlassen können, brauchen eine Theorie, sie benötigen eine Landkarte, um sich orientieren und ihren Weg finden zu können.
Theorien vermitteln eine Außenperspektive auf ein Geschehen (griech. theoréo, »ich schaue zu«, »ich betrachte«, »ich bin Zuschauer«). Sie gewinnen ihre Nützlichkeit dadurch, dass sie dem Akteur, der in das Geschehen verwickelt ist, den Blick auf Möglichkeiten, Chancen und Risiken eröffnen, die ihm andernfalls aufgrund der Beschränktheit seiner Innenperspektive verborgen bleiben würden. Deswegen sind Theorien sehr praktisch.
Beschäftigt man sich mit dem Thema Familienunternehmen – z. B. als Familienmitglied, Gesellschafter, Nachfolger, Fremdmanager (Innenperspektive), Wissenschaftler oder Berater (Außenperspektive) –, so muss man feststellen, dass das Angebot an Theorien, die einem das Leben leichter machen könnten, (zumindest im deutschsprachigen Raum) nur sehr begrenzt ist.
Erklären lässt sich dies durch die Struktur des Wissenschaftssystems: Betriebswirtschaft und die Managementforschung beschäftigen sich mit Unternehmen im Allgemeinen und unterscheiden bestenfalls kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) von großen Konzernen. Die Tatsache, dass ein Unternehmen im Eigentum oder unter der politischen Kontrolle einer Familie steht, scheint für sie und ihre Theorien keinen Unterschied zu machen. Sie gehen von der stillschweigenden Vorannahme aus, dass es eine einheitliche, objektivierbare Rationalität der Unternehmensführung gibt und deswegen die Eigentümerstruktur nicht relevant ist.
Analoges kann über die Familienforschung gesagt werden. Familien scheinen ihre spezifische, von der Psychologie ihrer Mitglieder bestimmte Dynamik zu haben, die unabhängig davon abläuft, ob die Familie ein Unternehmen besitzt oder nicht. Reichtum oder Armut sind zwar Faktoren, die für Sozialwissenschaftler von Interesse sind, aber die Familien von Familienunternehmen waren bis vor Kurzem kein Thema der Forschung.
Wirtschaftswissenschaftler auf der einen Seite stehen Soziologen und Psychologen auf der anderen Seite gegenüber. Diese Disziplinen sind klar gegeneinander abgegrenzt, sie sprechen verschiedene Sprachen, folgen unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und -methoden. So kommt es, dass die Familienunternehmen bzw. die Familien, die Unternehmen gründen, erhalten und vererben, durch den Rost des Wissenschaftssystems fallen. Keine der genannten Teilwissenschaften fühlt sich für sie in ihrer Ganzheit – Familie und Unternehmen umfassend – zuständig.
Bleiben noch die Rechtswissenschaften: Anwälte haben zwar viel mit Familienunternehmen zu tun, beispielsweise in Erb- und Nachfolgestreitigkeiten, aber auch sie sehen keinen Unterschied zu anderen Streitfällen und wenden ihre mehr oder weniger bewährten Beobachtungs- und Problemlöseraster an. Da »Familienunternehmen« keine eigene Rechtsform darstellen, sind sie wissenschaftlich auch für die Jurisprudenz nicht von Bedeutung.
Diese wissenschaftliche Ignoranz ist schon merkwürdig, angesichts der Tatsache, dass mehr als zwei Drittel aller Unternehmen in der westlichen Welt (und im Osten nicht weniger) als Familienunternehmen charakterisiert werden können.
Das erste Institut an einer deutschen Universität, das sich speziell dem Thema Familienunternehmen widmete, wurde erst Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts gegründet.1 Seither sind es einige mehr geworden, und Familienunternehmen erfreuen sich des Interesses der Öffentlichkeit. Als Resultat dieser zunehmenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit Familienunternehmen sind die Grundzüge einer Theorie des Familienunternehmens gelegt worden, die wirtschaftswissenschaftliche, soziologische, psychologische und juristische Perspektiven umfasst. Mit ihrer Hilfe kann auf der einen Seite erklärt werden, warum Familienunternehmen anders geführt und gemanagt werden (müssen) als etwa börsennotierte Aktiengesellschaften und warum Familienunternehmen extrem chancenreich, aber auch extrem risikoreich sind. Auf der anderen Seite wird auch erkennbar, warum Familien bzw. deren Mitglieder, die durch Eigentum ihre eigene Entwicklung mit der eines Unternehmens verbinden, anderen Herausforderungen ausgesetzt sind als durchschnittliche Familien.
Ziel der vorliegenden Einführung ist, eine Art Landkarte zu skizzieren, an der sich orientieren kann, wer praktisch oder wissenschaftlich mit Familienunternehmen zu tun hat – sei es als Familienmitglied, Mitglied des Unternehmens usw., sei es als Forscher oder Berater etc.
Obwohl die verwendete Theorie (Systemtheorie/Konstruktivismus)2 sehr abstrakt ist, werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Wo gelegentlich aus wissenschaftlicher Sicht notwendige Erörterungen konzeptueller Art nötig sind, werden sie – soweit möglich – in einer allgemein verständlichen Sprache formuliert. Außerdem ist wert darauf gelegt, den Fokus der Aufmerksamkeit immer wieder auf praktische Konsequenzen zu lenken, die sich aus der Theorie ergeben.3
1.2 Welche Theorie?
Wohl kaum eine Konzeptualisierung scheint zum Verständnis von Familienunternehmen so gut geeignet wie die Systemtheorie. Sie hat in ihren unterschiedlichen Varianten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung vieler Wissenschaftsgebiete maßgebend beeinflusst, von den »harten« Naturwissenschaften über die Informationstheorie bis hin zu »weicheren« sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, insbesondere die Familienforschung und Familientherapie, die Organisationsforschung und Organisationsberatung. Den umfassendsten und im Folgenden zugrunde gelegten Ansatz hat der Soziologe Niklas Luhmann in seiner Gesellschaftstheorie entworfen (Luhmann 1984, 1988a, 1997, 2000). Sie untersucht soziale Systeme aller Art und kann deshalb sowohl auf die Familie als auch das Unternehmen als soziales System angewandt werden. Da es sich um eine Theorie der Gesellschaft und ihrer spezielle Funktionen erfüllenden Subsysteme (wie Wirtschaft, Rechtssystem, Politik, Wissenschaft, Erziehung usw.) handelt, überschreitet sie von vornherein die traditionellen Grenzen der Einzelwissenschaften bzw. der von ihnen entwickelten Theoriearchitekturen.
Umgangssprachlich wird der Begriff »soziales System« (griech. systema »Vereinigung«, »Zusammengestelltes«) zur Bezeichnung einer Vereinigung von Menschen (z. B. in der Familie oder im Unternehmen) gebraucht. Die Familie wird dann als zusammengesetzte Einheit (= System) betrachtet, die, beispielsweise, aus sechs Elementen besteht: Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Oma und der Hund (na ja, über dessen Status als Familienmitglied kann man sich natürlich streiten). Allerdings schafft solch eine Definition Probleme: Wenn man die Individuen als die Elemente eines sozialen Systems betrachtet, dann wird es nahezu unmöglich, die Interaktionsdynamik einer Familie zu erklären. Die Komplexität, mit welcher der Beobachter konfrontiert ist, ist zu groß. Denn schließlich ist schon jedes der Familienmitglieder, jedes Individuum, jedes psychische System, ein hochkomplexes System und weder von außen in seiner Funktionsweise durchschaubar noch in seinem Verhalten berechenbar. Wenn nun fünf oder sechs solch komplexer Systeme miteinander in Interaktion treten und sich gegenseitig beeinflussen, dann potenziert sich die Komplexität – jeder Versuch, die Familiendynamik als Summe der Psychodynamiken ihrer Mitglieder zu analysieren, ist zum Scheitern verurteilt. Dasselbe gilt in noch stärkerem Maße für die interne Dynamik eines Unternehmens, bei dem ja manchmal Zigtausende von Individuen miteinander umgehen und ihr Verhalten koordinieren müssen.
Mit dem Problem einer nicht zu beherrschenden Komplexität ist allerdings nicht nur der Wissenschaftler konfrontiert, der sich mit Familien und/oder Unternehmen beschäftigt, sondern jedes Mitglied von Familie und/oder Unternehmen. In der Familie mag es ja noch vorkommen, dass ein Einzelner versucht, alle »seine Lieben« zu verstehen (wenn auch in der Regel mit wenig Erfolg), in Unternehmen, deren Größe eine Handvoll Leute überschreitet, ist dies von vornherein unmöglich. Trotz dieser gegenseitigen Undurchschaubarkeit – ja gerade deswegen – gelingt jeden Tag in Unternehmen und anderen Organisationen die Kooperation einer Unzahl von Menschen, die sich nur oberflächlich kennen. Der Grund dafür: Sie orientieren sich und ihr Verhalten an Spielregeln der Kommunikation.
In jeder Familie, in jedem Unternehmen gibt es bestimmte Weltbilder (»Wirklichkeitskonstruktionen«), die bewusst oder unbewusst von den Mitgliedern geteilt werden. Dazu gehören Erwartungsmuster, die das Verhalten und den Umgang miteinander steuern. Man erwartet vom anderen bestimmte Verhaltensweisen, und man erwartet, dass sie von einem selbst auch erwartet werden. So stabilisieren Erwartungen und Erwartungs-Erwartungen die Spielregeln des Umgangs miteinander. Mit anderen Worten: In jedem der genannten sozialen Systeme lassen sich Verhaltensweisen benennen, die den Mitgliedern (offen oder verdeckt) vorgeschrieben sind, und andere, die ihnen (wiederum offen oder verdeckt) verboten sind (v. Wright 1963). Innerhalb des durch derartige Gebote und Verbote gesetzten Rahmens haben sie einen Spielraum für ihre freien Entscheidungen. Das Überschreiten seiner Grenzen ist mit dem Verlust der Mitgliedschaft in Familie oder Unternehmen bedroht. Dass in Familie und Unternehmen unterschiedliche Verhaltensweisen geboten/verboten sind, dürfte deutlich sein, und dass es schwerer ist, aus (s)einer Familie »rauszufliegen« als aus einem Unternehmen, ebenfalls …
Solche Spielregeln werden kommuniziert, indem sie praktiziert werden, und sie betreffen nicht nur das Verhalten, sondern die gesamte Kommunikation. Wer neu dazukommt, schaut sich in der Regel erst einmal genau an, »wie man das denn hier macht«, um dann nach einiger Zeit zu wissen, welche Verhaltensweisen man besser unterlässt (z. B. Vorgesetzte beleidigen) und welche man auf jeden Fall realisieren muss (z. B. zur Arbeit erscheinen).
Um es auf eine Formel zu bringen: Die Spielregeln eines sozialen Systems zu verstehen, ist einfacher, als seine Mitglieder zu verstehen. Die Spielregeln einer Familie oder eines Unternehmens sind immer weniger komplex als die Psyche eines jeden Mitglieds.
Dieser konzeptuelle Schritt ist es, den auch die neuere soziologische Systemtheorie vollzogen hat. Sie untersucht Kommunikationssysteme. Denn Kommunikation ist das Mittel, mit dessen Hilfe unterschiedliche autonome Akteure (z. B. Mitarbeiter, Familienmitglieder) ihr Verhalten koordinieren und gemeinsam zum Entstehen gemeinsam befolgter Spielregeln der Interaktion beitragen und sie erhalten. Deswegen werden in dieser Konzeptualisierung soziale Systeme als Kommunikationssysteme definiert und Kommunikationen als ihre basalen Elemente betrachtet.
Wenn man die Unterscheidung zwischen Teil und Ganzem betrachtet, so sind in dieser Modellbildung nicht menschliche Individuen die Teile (Elemente) des Ganzen (soziales System), sondern die einzelnen Prozessschritte, die das Verhalten der Individuen koordinieren (d. h. einzelne Kommunikationen). Zu betonen ist hier, dass der Begriff »Kommunikation« nicht – wie es der alltägliche Gebrauch des Wortes nahelegt – die Handlung eines Menschen bezeichnet (»XY ist ein großer Kommunikator«). Betrachtet wird stattdessen ein Prozess, zu dem in der Regel mindestens zwei Akteure nötig sind: Ein Mensch redet und verhält sich in irgendeiner Weise (»Sender«), was von einem zweiten als »Mitteilung« irgendeiner Information »verstanden« (interpretiert) wird (»Empfänger«). Beide sind dabei aktiv, denn beide schreiben ihren Selbst- und Fremdbeobachtungen Bedeutung und Sinn zu. Der zweite Akteur reagiert auf die Aktionen des ersten, was nunmehr vom diesem als »Mitteilung« gedeutet wird usw. Im Laufe der Zeit entwickeln sich Erwartungen an das gegenseitige Agieren und Reagieren, die sich wechselseitig stabilisieren, das heißt, ein Kommunikationsmuster entsteht (vgl. Luhmann 1984, S. 193 ff.).
Der Einzelne – das muss betont werden – kann das sich entwickelnde Muster nicht einseitig kontrollieren. Denn er kann nicht allein kommunizieren. Es sind immer die anderen, die seinem äußerlich beobachtbaren Verhalten einen Sinn zuschreiben (= es »verstehen«), und deren Interpretation muss nicht mit dem übereinstimmen, was er selbst »gemeint« hat oder ausdrücken wollte.
Soziale Systeme lassen sich als Kommunikationssysteme definieren, die so lange ihre Struktur erhalten, wie die dazu nötige Kommunikation fortgesetzt bzw. reproduziert wird …
Das macht sie zu »autopoietischen Systemen« (griech. autós »selbst«, poiéo »ich bringe hervor«). Mit diesem Begriff werden selbstorganisierte Systeme bezeichnet, die sich durch ihre eigenen, internen Prozesse erschaffen und erhalten, indem sie eine Innen-außen-Grenze ihren Umwelten gegenüber bilden (Maturana 1975). Als Prototyp solcher Systeme dienen lebende Systeme bzw. die Logik von Lebensprozessen. Am Organismus ist das Konzept entwickelt worden: Solange der Stoffwechsel funktioniert (= interne Prozesse), bleibt die Einheit und Struktur des Körpers erhalten; wenn das nicht mehr der Fall ist (= Tod), dann löst sich nicht nur die Innen-außen-Grenze (= Haut) auf, sondern auch die Einheit des Systems, das heißt, der Organismus verwest. Solche Systeme existieren, solange die Autopoiese, d. h. die Prozesse, welche diese Einheit herstellen und erhalten, fortgeführt werden.
Übertragen auf soziale Systeme heißt dies: Solange die (Kommunikations-)Prozesse fortgesetzt werden, die ein Unternehmen oder eine Familie als abgegrenzte Einheit erzeugen und erhalten, bleibt das Unternehmen bzw. die Familie erhalten (Abb. 1).
Abb. 1: Soziale Systeme lassen sich durch einen Kreis mit einem Pfeil symbolisieren, der für die durch den Kommunikationsprozess vollzogene und erhaltene Innenaußen-Unterscheidung steht.
Wenn bislang von Spielregeln der Kommunikation die Rede war, dann auch, weil sich soziale Systeme in ihrer Dynamik gut mit Spielen (wie Schach und Fußball) vergleichen lassen. Sie sind durch ihre Regeln definiert und existieren so lange, wie nach diesen Regeln gespielt wird. Diese Regeln definieren auch, welche Kommunikationen zum jeweiligen Spiel gehören (z. B. »Schach!« sagen, den Ball ins Tor schießen) und welche nicht (etwa zwischendurch übers Wetter reden). Verschiedene Typen sozialer Systeme – also beispielsweise Familien und Unternehmen – unterscheiden sich dabei (wie Schach und Fußball) durch ihre Spielregeln oder, abstrakter formuliert, durch unterschiedliche Selektionskriterien der Kommunikation.
Daraus resultieren die vielfachen psychologischen Probleme, die sich für Familienmitglieder ergeben, die im Familienunternehmen arbeiten: Sie haben es mit unterschiedlichen Kontexten zu tun, in denen sie als Personen auch unterschiedliche Identitäten haben. Vater und Chef sind, z. B., ganz unterschiedliche Rollen, und die Vater-Sohn-Beziehung unterscheidet sich gravierend von der Chef-Mitarbeiter-Beziehung. Wenn beide Personen mal im einen, mal im anderen Kontext aufeinandertreffen, dann kann es zu Verwirrungen kommen, nach welchen Regeln sich beide zu verhalten haben …
Diese zwangsläufig sehr verkürzte theoretische Darstellung ist hier vorausgeschickt, um einige abstrakte Vorannahmen explizit zu machen, die der hier skizzierten Theorie des Familienunternehmens zugrunde liegen.
1.3 Definition von Familienunternehmen
Was macht ein Unternehmen zum Familienunternehmen? Das Spektrum der Unternehmen, die sich selbst so bezeichnen, ist breit: von der italienischen Osteria, in der Papa in der Küche steht, während Mutter, Sohn und Neffe bedienen, bis zum global agierenden Konzern, der Zigtausende in aller Welt beschäftigt und an dem die Familie nur noch einen Minderheitsanteil an Aktien hält.
Da es keine formaljuristischen Kriterien gibt, die ein Unternehmen zum Familienunternehmen machen, und die Größe nicht als Unterscheidungsmerkmal taugt, ja, offenbar nicht einmal die Eigentumsverhältnisse ausschlaggebend sind, muss es sich um andere, »weichere« Charakteristika handeln, die zur Definition verwendet werden können.
In den letzten Jahren hat sich zunehmend folgende Definition durchgesetzt:
Ein Unternehmen ist ein Familienunternehmen, wenn eine Familie einen maßgeblichen Einfluss auf die Politik des Unternehmens hat (Wimmer et al. 1996, S. 19 f.).
Folgt man dieser Definition, wird deutlich, dass sowohl die Pizzeria an der Ecke als auch Unternehmen wie BMW als Familienunternehmen zu betrachten ist. Klar ist dann ebenfalls, dass dazu auch Unternehmen zu rechnen sind, in denen weder ein Familienmitglied in der Geschäftsleitung tätig ist, noch die Familie als (alleiniger oder Mehrheits-)Eigentümer des Unternehmens zu betrachten ist. Es reicht, wenn ihr politischer Einfluss – durch welche rechtlichen Regelungen (Stimmrechtsbeschränkung etc.) auch immer – gesichert ist.
1Das Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU), Universität Witten/Herdecke.
2Der an den allgemeinen theoretischen Grundlagen näher Interessierte sei auf die Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus (Simon 2006) verwiesen.
3Die im Folgenden entwickelten theoretischen Modelle sind in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen Rudolf Wimmer (mit mir Gründungsprofessor des Wittener Instituts für Familienunternehmen) und Thorsten Groth (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut) entstanden. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt. Dennoch sind selbstverständlich alle eventuellen Fehler und Fehleinschätzungen allein mir zuzurechnen.
2 Familien und Unternehmen – Unterschiedliche Typen sozialer Systeme und ihre unterschiedlichen Rationalitäten
2.1 Historischer Rückblick
Ein Blick in die abendländische Geschichte zeigt, dass die Unterscheidung zwischen Arbeit und Privatleben relativ jung ist. Im klassischen Altertum gab es zwei Typen eindeutig gegeneinander abgegrenzter Systeme: das Haus (griech. oikos) und den Staat bzw. die Stadt (griech. pólis). Das Haus war zum einen wirtschaftliche Überlebenseinheit (daher der Begriff »Ökonomie«), aber es war auch Lebensgemeinschaft und emotionales Bezugssystem für seine Mitglieder. Zu ihm gehörten nicht nur die Familienmitglieder im engeren, verwandtschaftlichen Sinne, sondern auch Sklaven und Bedienstete. Der Begriff »Familie« (lat. famulus »Diener«) stand in diesem Sinne für das »ganze Haus«, d. h. eine Gemeinschaft, die weit über den Kreis der Blutsverwandten hinausging. Nur als Mitglied solch eines »Hauses« hatte der Einzelne die Möglichkeit zu (über)leben (Mitterauer u. Sieder 1977).