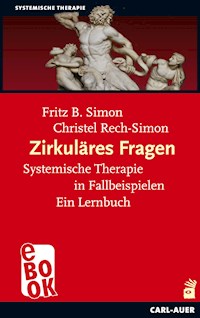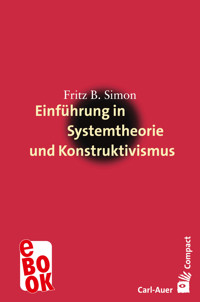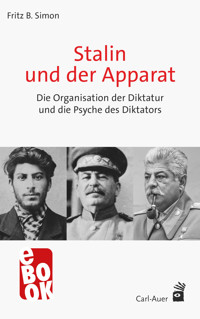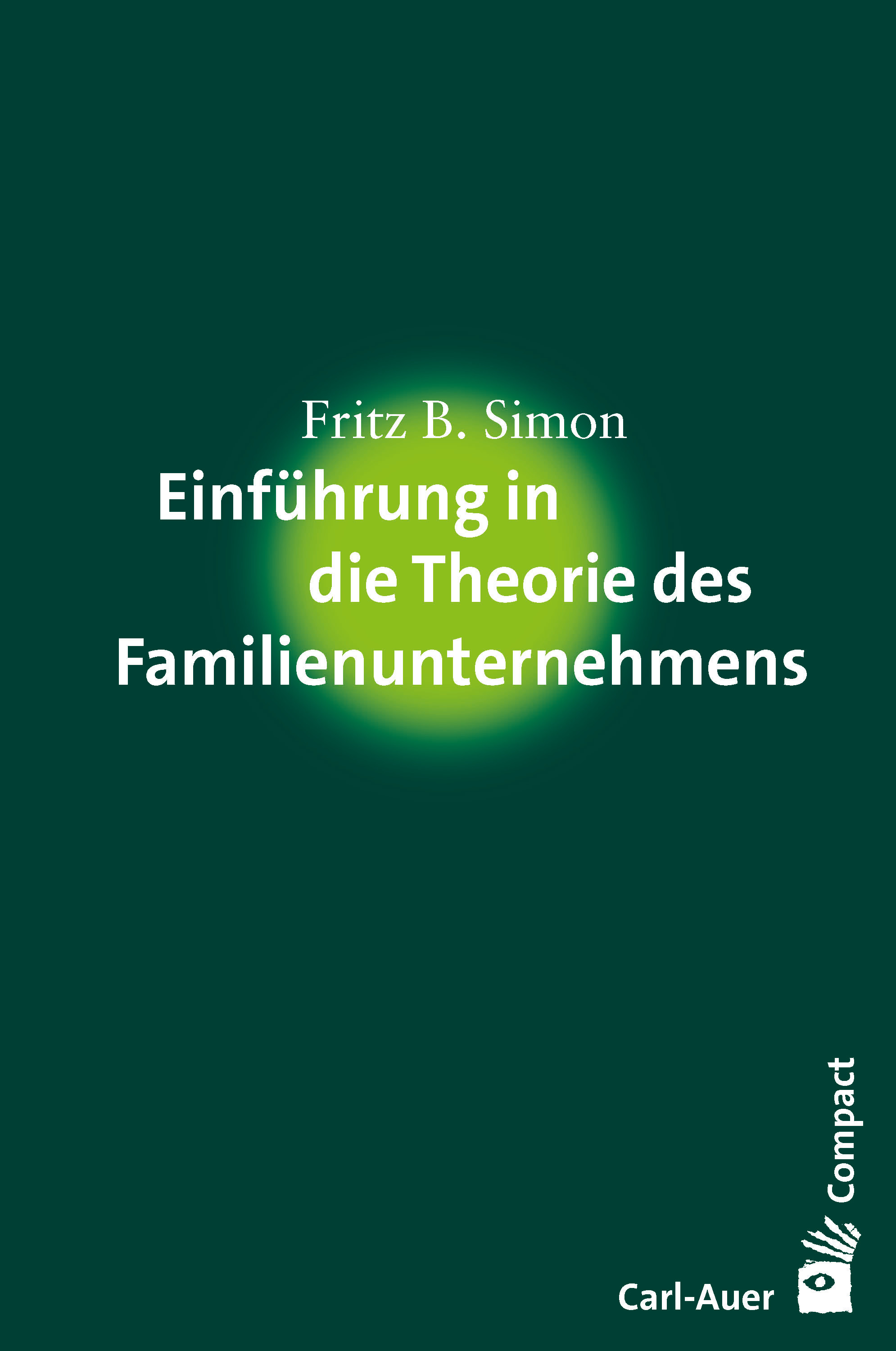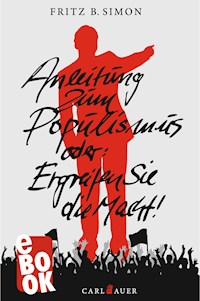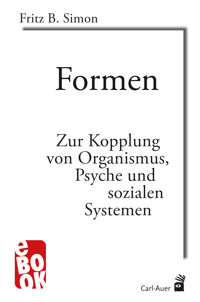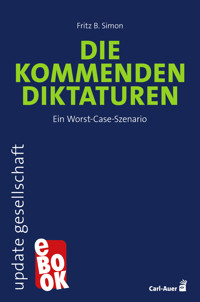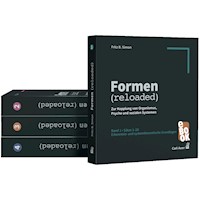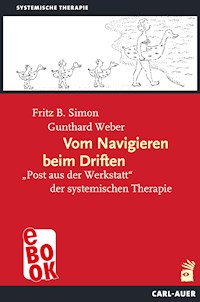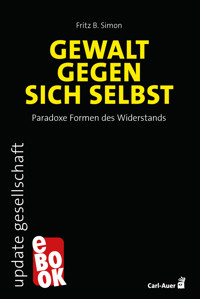
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: update gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Formen der Macht Warum tun Menschen sich selbst in unterschiedlichsten Formen und Kontexten Gewalt an? Diese Frage wird meist aus psychodynamischer Sicht angegangen und zu beantworten versucht. Mit erhellenden Ergebnissen. Fritz B. Simon richtet nun den Blick auf dabei nicht belichtete Aspekte: die kontextspezifischen, sozialen Wirkungen und Funktionen von Autoaggression und Autodestruktion und die damit verbundenen sozialen Dynamiken. Der systemtheoretisch orientierte Zugang erweist dabei einmal mehr seine Vorteile – analytisch und konkret: "So hab ich das noch nicht gesehen." Simon wählt für seinen Essay einen Beobachtungsfokus, der – jenseits vorhandener individueller Intentionen und Motivationen – Gewaltakte von Individuen gegen sich selbst als besondere Akte der Insubordination verstehbar macht. Als paradoxe Form des Widerstands in unterschiedlichen sozialen Systemen, in denen der Einzelne unmittelbar Machtverhältnissen unterworfen ist: politische Systeme (Staaten), Organisationen, Familien, Religionsgemeinschaften. Der Autor: Fritz B. Simon, Dr. med., Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten/Herdecke; Systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut; Mitbegründer der Simon, Weber & Friends Systemische Organisationsberatung GmbH. Autor bzw. Herausgeber von ca. 300 wissenschaftlichen Fachartikeln und 34 Büchern, die in 15 Sprachen übersetzt sind, u. a.: Der Prozeß der Individuation (1984), Die Sprache der Familientherapie (1984, mit Helm Stierlin und Ulrich Clement), Lebende Systeme (1988), Unterschiede, die Unterschiede machen (1988), Meine Psychose, mein Fahrrad und ich (1990), Radikale Marktwirtschaft (1992, mit CONECTA), Die andere Seite der Gesundheit (1995), Die Kunst, nicht zu lernen (1997), Zirkuläres Fragen (1999, mit Christel Rech-Simon), Tödliche Konflikte (2001), Die Familie des Familienunternehmens (2002), Gemeinsam sind wir blöd!? (2004), Mehr-Generationen-Familienunternehmen (2005, mit Rudi Wimmer und Torsten Groth), Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus (2006), Einführung in die systemische Organisationstheorie (2007), Einführung in die systemische Wirtschaftstheorie (2009), Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Systemische Aspekte des Fußballs (2009), Einführung in die Systemtheorie des Konflikts (2010), "Zhong De Ban" oder: Wie die Psychotherapie nach China kam (2011, mit Margarete Haas-Wiesegart und Zhao Xudong), Einführung in die Theorie des Familienunternehmens (2012), Wenn rechts links ist und links rechts (2013), Einführung in die (System-)Theorie der Beratung (2014), Formen. Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen (2018), Anleitung zum Populismus oder: Ergreifen Sie die Macht! (2019), Der Streit ums Nadelöhr. Körper, Psyche, Soziales, Kultur. Wohin schauen systemische Berater? (2019, mit Jürgen Kriz), Lockdown: Das Anhalten der Welt (2020, mit Heiko Kleve und Steffen Roth), Formen (reloaded). Zur Kopplung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen (2022), Stalin und der Apparat. Die Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators (2023), Die kommenden Diktaturen (2024).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carl-Auer
Fritz B. Simon
GEWALT GEGEN SICH SELBST
Paradoxe Formen des Widerstands
2025
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr. h. c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Karsten Trebesch (Dallgow-Döberitz)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Tom Levold (Köln)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Burkhard Peter (München)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihe »update gesellschaft«
hrsg. von Matthias Eckoldt
Umschlagentwurf: B. Charlotte Ulrich
Layout und Satz: Melanie Szeifert
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0589-3 (Printversion)
ISBN 978-3-8497-8539-0 (ePub)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 · 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 · Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Einleitung – Gewalt als Grundlage von Macht
Staaten
Kamikaze
Selbstmordattentate
Selbstverbrennungen
Organisationen
Suizid
Hungerstreik
Religionsgemeinschaften (Kirchen/Sekten/Kulte)
Flagellanten
Sündiger Suizid
Massensuizid
Zölibat, Selbstkasteiung, Fasten-Gebot
Familien
Selbstverletzungen (»Ritzen«)
Magersucht (Anorexia nervosa)
Autoaggressive Muster – Versuch einer Analyse
Aktive vs. passive Negation des Organismus bzw. seiner Bedürfnisse
Ereignis vs. Prozess
Theatralisierung vs. Heimlichkeit
Erklärungen/kausale Zurechnung
Beziehungsmuster zwischen Organismus, Psyche und sozialen Systemen
Organismus/Psyche
Psyche/soziales System
Ausweitung der Perspektive – Zwei Spekulationen
Autoimmunkrankheiten
»Protestwahlen«
Nachbemerkung
Anmerkungen
Literatur
Einleitung – Gewalt als Grundlage von Macht
Die Anwendung körperlicher Gewalt ist eine der Grundlagen der Macht, die Menschen über Menschen ausüben.1 Das Erleben, einer überlegenen Macht ausgeliefert zu sein, ist von Kindheit an mit der Drohung verbunden, dass man der Gewalt anderer ausgesetzt ist. Das beginnt in der Familie, in der die körperlich überlegenen Eltern ihren körperlich unterlegenen Kindern gelegentlich immer noch eine »Tracht Prügel« als Erziehungsmaßnahmen androhen oder auch angedeihen lassen. Das Spektrum reicht von dem mehr oder weniger harmlosen »Klaps« (»Hat noch niemandem geschadet«) über die Ohrfeige bis zu Schlägen auf das nackte Hinterteil. In der westlichen Welt ist dies als »schwarze Pädagogik« in vielen Ländern gesetzlich verboten, aber früher war es der Normalfall. In manchen Kulturen ist die Prügelstrafe immer noch Bestandteil des Katalogs möglicher Strafen. Generationen von Kindern haben auch in Mitteleuropa ihre familiären und außerfamiliären Gewalterfahrungen machen müssen. Denn auch in der Schule waren körperliche »Züchtigungen« durch Lehrer – die Autoritäten – ein Mittel, um »Zucht und Ordnung« herzustellen. Auch dies ist heute verpönt und gegebenenfalls strafbewehrt. Doch auf dem Schulhof und auch unter Geschwistern gilt weiterhin oft das Recht des körperlich Stärkeren. Männer bringen ihre Frauen »zur Räson«, und wenn dazu die blauen Augen und Blutergüsse (»Ich bin gegen eine Tür gelaufen«) nicht reichen, dann schrecken die Männer auch vor dem Femizid nicht zurück. (Es gibt zwar auch Gewalt gegen Männer, aber von Gleichheit der Geschlechter kann in der Hinsicht keine Rede sein.) Auch wer beabsichtigt, sich in Kneipen mit anderen Leuten zu streiten, sollte sich für die anstehenden Schlägereien besser regelmäßig im Fitness-Studio stählen. Hooligans erteilen einander nach verlorenen Fußballspielen »eine Lektion« usw. Und auf der Gegenseite erleben Menschen, die sehr groß sind, dass sich kleinere Leute ihnen gegenüber gehemmt fühlen und nicht selten auch machtlos, ganz unabhängig von den tatsächlichen Absichten und Zielen der Personen, die das Glück oder Unglück haben, andere körperlich zu überragen.
Eine der Voraussetzungen dafür, dass ein Land als zivilisiert betrachtet wird, ist das staatliche Gewaltmonopol. Nur im Wilden Westen galt es als legitim, selbst mit Waffengewalt für sein Recht zu sorgen. In zivilisierten Staaten ist dafür das Rechtssystem zuständig. Es folgt gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensweisen und kommt auf diese Weise – ganz ohne Gewaltanwendung – in geordneten und gewaltfreien Prozessen zu seinen Entscheidungen in Konfliktfällen. Aber das funktioniert nur, weil jeder weiß, dass es im Zweifelsfall auf die staatliche Gewalt – die Polizei, Vollzugsbeamte usw. – zurückgreifen kann, um seine Urteile durchzusetzen. Die staatliche Macht funktioniert, das ist der Clou an der Angelegenheit, auch wenn in einem konkreten Konflikt der Staat gar keine Gewalt anwendet. Es reicht, dass alle Beteiligten sich den staatlichen Regeln – Gesetzen – unterordnen, weil klar ist, dass der Staat Gewalt anwenden könnte, wenn er müsste oder wollte (wobei es seine an Vorschriften gebundene Repräsentanten sind, die »müssen« oder »wollen«). Das wird zwar immer wieder mal überprüft, zum Beispiel in Silvesternächten in Berlin oder anderen deutschen Großstädten, wenn mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten und Feuerwehrleute geschossen wird. Deswegen müssen dann aus dem ganzen Land Polizisten schon im Voraus zusammengezogen werden, um die staatliche Autorität gegebenenfalls wiederherzustellen (was allerdings meist nur zum Teil gelingt).
Aber auch Staaten setzen in der Beziehung zu anderen Staaten auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt. Als die russischen Truppen an den Grenzen der Ukraine aufmarschierten, war dies der Versuch, die brüchig gewordene Machtbeziehung zwischen dem »großen« Russland und der »kleinen« Ukraine, die über Jahrhunderte zur Zeit der Zaren und der Sowjetunion funktioniert hatte, durch Demonstration der möglichen Gewaltanwendung wiederherzustellen. Das klappte nicht, das heißt, die Regierenden der Ukraine haben das russische Beziehungsangebot – die Unterwerfungsforderung – nicht akzeptiert, deswegen wurde geschossen, um wieder eine Situation herbeizuführen, in der nicht mehr geschossen werden muss, weil beide Seiten die Machtbeziehung akzeptieren (wenn auch nur gezwungenermaßen). Der Beginn des Kriegs war – nüchtern betrachtet – ein Symptom des russischen Machtverlustes, d. h. der Nicht-Unterwerfung der Ukraine; der Versuch, eine früher einmal – zur Sowjetzeit – bestehende Machtbeziehung zu reanimieren.
Und wenn der 47. US-Präsident Donald Trump seine illegitimen Ansprüche auf Grönland oder den Panamakanal erhebt, so versucht er ihnen Gewicht zu verleihen, indem er militärische Mittel nicht ausschließt – das heißt, er kündigt an, sich nicht von der zivilisierenden Wirkung des Völkerrechts in seiner Handlungsfreiheit begrenzen zu lassen, sondern setzt auf das Recht des Stärkeren – wobei Stärke als Möglichkeit der Anwendung von Gewalt definiert ist.
Dass Gewalt die basale Grundlage von Machtbeziehungen ist, hat mit einer anthropologischen Konstante zu tun, die universell und auch durch kulturelle Faktoren nur wenig modifiziert wirksam ist: dem sogenannten »Selbsterhaltungstrieb« des Menschen sowie seinem Schmerzempfinden und dem damit verbundenen Leiden. Menschen bewerten in der Regel ihr Überleben höher als fast alle anderen weltlichen Werte. Wenn Folterknechte die Unterwerfung ihrer Opfer – ihre Geständnisse, den Verrat von Geheimnissen, die Aufgabe heiliger Prinzipien etc. – erreichen wollen, setzen sie auf Schmerz als Mittel zum Zweck (wie die »schwarze Pädagogik«, nur konsequenter). Und wenn nach den Gesetzen der Scharia einem Dieb gedroht wird, ihm die Hand abzuhacken, oder im Iran oder in Texas unter öffentlicher Anteilnahme Hinrichtungen vollzogen werden, dann ist dies u. a. als Kriminalitätsprophylaxe gedacht (wenn auch nur wenig wirksam).
Das Bestreben, Schmerz zu vermeiden und sein Leben zu erhalten, gehört offenbar zu den stillschweigend voraussetzbaren anthropologischen Konstanten, d. h. individuellen Reaktionsmustern, mit denen »selbstverständlich« gerechnet werden kann; der Körper des Individuums und seine Schmerzempfindlichkeit bzw. das von Freud2 einmal so titulierte »Unlustprinzip«, das auf Vermeidung unangenehmer Gefühle setzt, fungieren als eine steuernde Randbedingung der Entwicklung sozialer Strukturen. Daraus ergeben sich soziale Interventionsmöglichkeiten und potenzielle Machtstrategien.
Kommunikationstheoretisch ist nämlich festzustellen: Wer von seinem Nachbarn nicht zur Kenntnis genommen wird, braucht ihm nur vor das Schienbein zu treten (ihn mit einem Messer zu bedrohen oder gar zu verletzen), spätestens dann weiß dieser Nachbar, dass es den Schienbeintreter oder Messerstecher gibt. Das ist einer der Gründe für terroristische Strategien.
Um es abstrakt und theoretisch mit den Worten des Soziologen Niklas Luhmann zu sagen:
»Die Möglichkeit von Gewaltanwendung ist für den Betroffenen nicht ignorierbar; sie bietet dem Überlegenen hohe Sicherheit in der Verfolgung seiner Ziele; sie ist nahezu universell verwendbar, da sie als Mittel weder an bestimmte Motivlagen noch an bestimmte Situationen oder an bestimmte Motivlagen des Betroffenen gebunden ist; sie ist schließlich, da es um relativ einfaches Handeln geht, gut organisierbar und unter Ausschluss von Selbstbefriedigung zentralisierbar. Dazu kommt, dass Gewalt jene Eigenschaft einer asymmetrischen Ordnung der relativen Präferenzen aufweist, die bei der Machtbildung erforderlich ist: Sie ist für den Überlegenen weniger unangenehm als für den Unterlegenen.«3
All diese Prämissen wie auch die daraus resultierenden sozialen Konsequenzen werden in Frage gestellt, wenn Individuen die übliche (Gewalt-)Täter-Opfer-Unterscheidung auflösen, indem sie sich selbst bzw. ihren Körper zum Gegenstand der eigenen Gewaltakte machen und in einer paradoxen Weise dem »Selbstbefriedigungsverbot« wie auch der »Zentralisierung« der Gewalt zuwiderhandeln.
Die Wirkung von gegen sich selbst gerichteten Gewaltakten von Individuen soll im Folgenden in unterschiedlichen Typen sozialer Systeme näher betrachtet werden, in denen der Einzelne unmittelbar Machtverhältnissen unterworfen ist oder sein könnte: politischen Systemen (Staaten), Organisationen (speziell »totalen Institutionen«, z. B. Gefängnissen, psychiatrischen Anstalten), Religionsgemeinschaften, Familien.
Ganz generell soll dabei bewusst die Psychodynamik autoaggressiver Aktionen außer Acht gelassen werden und stattdessen die kontextspezifische, soziale Wirkung autoaggressiver Akte in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Denn sobald die individuelle Psychodynamik dessen, der sich selbst Gewalt antut, in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird, besteht das Risiko, das soziale System, innerhalb dessen solche Akte vollzogen werden, aus dem Blickfeld zu verlieren. Die soziale Wirkung autodestruktiven Handelns muss von den Motiven oder Intentionen dessen, der sich etwas antut, unterschieden werden, denn aus den Absichten eines Täters ist generell nur selten die soziale Wirkung der Tat abzuleiten. Wenn hier der Fokus der Aufmerksamkeit ausschließlich auf das soziale System gerichtet wird, wird – das sei eingestanden – zwangsläufig die Psychodynamik des Täters vernachlässigt. Zur Entschuldigung sei aber angemerkt, dass dazu eine reichhaltige Literatur verfügbar ist.
Zur Orientierung: Der Plan ist, nachfolgend unterschiedliche Typen sozialer Systeme daraufhin zu untersuchen, welche Beispiele für autodestruktive Handlungen dort im Laufe der Geschichte zu beobachten waren und welche Wirkungen sie entfaltet haben oder auch immer noch entfalten. Dass solch eine Untersuchung nicht allumfassend sein kann, sondern vielmehr ganz bescheiden lediglich versuchen kann, aufgrund von Beispielen verallgemeinerbare Hypothesen aufzustellen, sei vorausgeschickt.