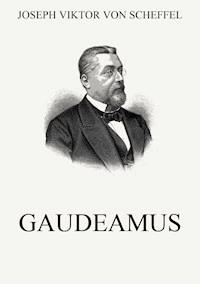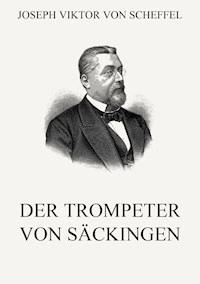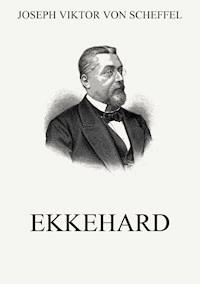
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman beruhend auf der Lebensgeschichte des St. Gallener Mönches Ekkehard.
Das E-Book Ekkehard wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ekkehard
Joseph Viktor von Scheffel
Inhalt:
Joseph Viktor von Scheffel – Biografie und Bibliografie
Ekkehard
Vorwort.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
AnmerkungenA1.
Ekkehard, J. von Scheffel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639099
www.jazzybee-verlag.de
Joseph Viktor von Scheffel – Biografie und Bibliografie
Namhafter Dichter, geb. 16. Febr. 1826 in Karlsruhe, gest. daselbst 9. April 1886. Sein Vater war Major im badischen Geniekorps und Oberbaurat; seine Mutter Josephine, geborene Krederer (geb. 22. Okt. 1803 in Oberndorf, gest. 5. Febr. 1865 in Karlsruhe), war eine begabte Gelegenheitsdichterin, die sich auch dramatisch versuchte, vielfach philanthropisch betätigte und sehr schön Märchen erzählte (mit A. v. Freydorf gab sie heraus: »In der Geißblattlaube, ein Märchenstrauß«, Dresd. 1886). 1843–47 studierte S. in München, Heidelberg und Berlin Rechtswissenschaft, aber auch Philosophie und Kunstgeschichte (germanistische Studien betrieb er erst viel später, während und nach seiner juristischen Praxis), promovierte zum Doktor der Rechte und begleitete im Sommer 1848 den Reichskommissar Welcker als Sekretär auf seiner Reise nach Lauenburg in Sachen Schleswig-Holsteins. 1850–1851 arbeitete S. als Rechtspraktikant in Säckingen, 1852 im Sekretariat des Hofgerichts zu Bruchsal, doch entsagte er der juristischen Laufbahn, auch nachdem er 1854 zum Referendar ernannt worden war. Er wollte Maler werden und zog deshalb im Mai 1852 nach Rom. Hier aber gelangte er zur Erkenntnis, dass er nicht zur Malerei, sondern zur Dichtkunst veranlagt sei, und im Winter 1853 schrieb er einsam auf Capri sein dichterisches Erstlingswerk: »Der Trompeter von Säckingen«, ein Sang vom Oberrhein (Stuttgart 1854, 272. Aufl. 1905), das mit dem kurze Zeit später in Heidelberg und in einer Meierei am Fuße des Hohentwiel gereiften und geschriebenen historischen Roman »Ekkehard« (Frankf. a. M. 1857; 214. Aufl., Stuttg. 1906; Illustrationen von H. Jenny, Hamb. 1898, und von Stumpf, Düsseld. 1903) seinen Ruhm begründete. Beide Werke ließen in S. einen durch Originalität, die prächtigste Frische und einen seltenen Humor ausgezeichneten Dichter erkennen, dem noch dazu aus der Fülle innerer Anschauung und lebendig gewordener Studien die reichsten Farben für Schilderung verschiedener Zeiten und Zustände zu Gebote standen. Durch sein »Gaudeamus. Lieder aus dem Engeren und Weiteren« (Stuttg. 1867, 66. Aufl. 1904) wurde S. der Liebling der deutschen Studenten. Die Mehrzahl der darin gedruckten Gedichte, die um ihrer geistreichen Frische und ihres keck studentischen Tones willen so außerordentlichen Beifall fanden, entstand in Heidelberg, wo sich S. 1854 und dann noch häufig aufhielt. 1856–57 lebte er in München, mit einem Roman beschäftigt, an dessen Ausführung ihn der schmerzliche Tod seiner Schwester störte, und der niemals vollendet wurde; 1858–59 in Donaueschingen, wo er Bibliothek und Archiv des Fürsten Egon von Fürstenberg ordnete und katalogisierte. Nach verschiedenen Reisen in Italien und Frankreich (Rhone) ließ er sich 1864 dauernd in Karlsruhe nieder, wo er noch in demselben Jahre Karoline v. Malzen, die Tochter des bayrischen Gesandten, heiratete. Gelegentlich seines 50. Geburtstages (1876), der für den inzwischen berühmt Gewordenen von ganz Deutschland gefeiert wurde, ward S. vom Großherzog von Baden in den erblichen Adelstand erhoben. Seine späteren Dichtungen konnten aber die Beliebtheit der ersten nicht erreichen. In »Frau Aventiure. Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit« (Stuttg. 1863, 19. Aufl. 1902) sowie in der Erzählung: »Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers« (das. 1868, 5. Aufl. 1895) überwogen die zum Erweis gründlicher Studien dienenden Einzelzüge zwar nicht die warme Darstellungskraft, aber sie nahmen diesen Dichtungen doch die volle Unmittelbarkeit. Beide waren gleichsam Splitter eines geplanten großen historischen Romans, der die Entstehung des Nibelungenliedes und den Sängerkrieg auf der Wartburg schildern sollte, aber unausgeführt blieb. Ferner veröffentlichte S.: »Bergpsalmen« (Stuttg. 1870, 7. Aufl. 1907); das lyrische Festspiel: »Der Brautwillkomm auf Wartburg« (Weim. 1873); »Waldeinsamkeit«, Dichtungen zu zwölf landschaftlichen Stimmungsbildern von Jul. Mařak (Stuttg. 1880, 6. Aufl. 1903); »Der Heini von Steier«, Dichtung (Münch. 1883) und »Hugideo. Eine alte Geschichte« (Stuttg. 1884, 9. Aufl. 1900). Zu einer Anzahl seiner Werke hat Anton v. Werner treffliche Illustrationen geliefert. Die letzten Jahre seines Lebens brachte S. weltflüchtig auf seiner Besitzung zu Radolfzell am untern Bodensee zu. Peinliche Lebenserfahrungen hatten die Reizbarkeit des ursprünglich so heiter veranlagten Dichters gesteigert, und er suchte die Einsamkeit. In Heidelberg wurde 1891 sein Standbild aus Erz errichtet, 1892 in Karlsruhe seine Büste, von Volz, weitere Denkmäler in Mürzzuschlag (1895), im Eichenhain Serpentara bei Olevano Romano (1897), in Säckingen (1901), auf dem Aggstein (1903; vgl. »S., Blätter zur Erinnerung etc.«, Wien 1903) u.a.; ein großes Nationaldenkmal am Bodensee wird geplant. Nach seinem Tod erschienen noch: »Fünf Dichtungen« (Stuttg. 1887, 2. Aufl. 1898); »Reisebilder« (hrsg. von J. Proelß, das. 1887; 3. Aufl. 1904), »Gedichte aus dem Nachlaß« (das. 1888, 4. Aufl. 1889), »Aus Heimat und Fremde«, Lieder und Gedichte (das. 1892, 2. Aufl. 1902), »Episteln« (das. 1892, 2. Aufl. 1901), »Das Gabelbachlied« (Ilmenau 1900) und »Scheffels Briefe an Karl Schwanitz, nebst Briefen der Mutter Scheffels« (Stuttg. 1906). Scheffels »Briefe an Schweizer Freunde« gab A. Frey (Zür. 1898) heraus. Seine »Gesammelten Werke« erschienen in 6 Bänden (Stuttg. 1907, mit biographischer Einleitung von J. Proelß). Vgl. Zernin, Erinnerungen an Joseph Viktor v. S. (2. Aufl., Darmst. 1887); Ruhemann, Joseph Viktor v. S., sein »Leben und Dichten« (Stuttg. 1887); Pilz, Viktor v. S. (Leipz. 1887); J. Proelß, Scheffels Leben und Dichten (Berl. 1887; Volksausgabe: »S., ein Dichterleben«, Stuttg. 1902); Ad. Hausrath, S. und Anselm Feuerbach (in der »Deutschen Rundschau«, 1887); »Literaturbilder fin de siècle; I.: S.« (Leipz. 1896); Weiß, Hohentwiel und Ekkehard in Geschichte, Sage und Dichtung (St. Gallen 1900); Ford, S. als Romandichter (Dissertation, Münch. 1900); Luise v. Kobell, J. V. v. S. und seine Familie (Wien 1901); Boerschel, J. V. v. S. und Emma Heim, eine Dichterliebe (Berl. 1906). – Der 1890 in Wien gegründete Scheffelbund veröffentlichte: »Scheffel-Gedenkbuch« (Wien 1890, Dresd. 1895) und ein Jahrbuch u. d. T. »Nicht rasten und nicht rosten« (Leipz. 1897, Berl. 1898, Wien 1900 ff.).
Ekkehard
Vorwort.
Dies Buch ward verfaßt in dem guten Glauben, daß es weder der Geschichtschreibung noch der Poesie etwas schaden kann, wenn sie innige Freundschaft miteinander schließen und sich zu gemeinsamer Arbeit vereinen.
Seit Jahrzehnten ist die Hinterlassenschaft unserer Vorfahren Gegenstand allseitiger Forschung; ein Schwarm fröhlicher Maulwürfe hat den Boden des Mittelalters nach allen Richtungen durchwühlt und in fleißiger Bergmanns arbeit eine solche Masse alten Stoffes zutage gefördert, daß die Sammelnden oft selbst davor erstaunten: eine ganze, schöne, in sich abgeschlossene Literatur, eine Fülle von Denkmalen bildender Kunst, ein organisch in sich aufgebautes politisches und soziales Leben liegt ausgebreitet vor unsern Augen. Und doch ist es all der guten auf diese Bestrebungen gerichteten Kraft kaum gelungen, die Freude am geschichtlichen Verständnis auch in weitere Kreise zu tragen; die zahllosen Bände stehen ruhig auf den Brettern unserer Bibliotheken, da und dort hat sich schon wieder gedeihliches Spinnweb angesetzt, und der Staub, der mitleidlos alles bedeckende, ist auch nicht ausgeblieben, so daß der Gedanke nicht zu den undenkbaren gehört, die ganze altdeutsche Herrlichkeit, kaum erst ans Tageslicht zurückbeschworen, möchte eines Morgens, wenn der Hahn kräht, wieder versunken sein in Schutt und Moder der Vergessenheit, gleich jenem gespenstigen Kloster am See, von dem nur ein leise klingendes Glöcklein tief unter den Wellen dunkle Kunde gibt.
Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, inwiefern der Grund dieser Erscheinung dem Treiben und der Methode unserer Gelehrsamkeit beizumessen.
Das Sammeln altertümlichen Stoffes kann wie das Sammeln von Goldkörnern zu einer Leidenschaft werden, die zusammenträgt und zusammenscharrt, eben um zusammen zu scharren, und ganz vergißt, daß das gewonnene Metall auch gereinigt, umgeschmolzen und verwertet werden soll. Denn was wird sonst erreicht?
Ein ewiges Befangenbleiben im Rohmaterial, eine Gleichwertschätzung des Unbedeutenden wie des Bedeutenden, eine Scheu vor irgendeinem fertigen Abschließen, weil ja da oder dort noch ein Fetzen beigebracht werden könnte, der neuen Aufschluß gibt, und im ganzen – eine Literatur von Gelehrten für Gelehrte, an der die Mehrzahl der Nation teilnahmslos vorübergeht und mit einem Blick zum blauen Himmel ihrem Schöpfer dankt, daß sie nichts davon zu lesen braucht.
Der Schreiber dieses Buches ist in sonnigen Jugendtagen einstmals mit etlichen Freunden durch die römische Campagna gestrichen. Da stießen sie auf Reste eines alten Grabmals, und unter Schutt und Trümmern lag auch, von graugrünem Akanthus überrankt, ein Haufe auseinandergerissener Mosaiksteine, die ehedem in stattlichem Bild und Ornamentenwerk des Grabes Fußboden geschmückt. Es erhub sich ein lebhaftes Gespräch darüber, was all die zerstreuten gewürfelten Steinchen in ihrem Zusammenhang dargestellt haben mochten. Einer, der ein Archäolog war, hob die einzelnen Stücke gegen's Licht und prüfte, ob weißer, ob schwarzer Marmor; ein anderer, der sich mit Geschichtforschung plagte, sprach gelehrt über Grabdenkmale der Alten, – derweil war ein dritter schweigsam auf dem Backsteingemäuer gesessen, der zog sein Skizzenbuch und zeichnete ein stolzes Viergespann mit schnaubenden Rossen und Wettkämpfern und viele schöne jonische Ornamentik darum; er hatte in der einen Ecke des Fußbodens einen unscheinbaren Rest des alten Bildes erschaut: Pferdefüße und eines Wagenrades Fragmente, da stand das Ganze klar vor seiner Seele, und er warf's mit kecken Strichen hin, derweil die andern in Worten kramten ...
Bei jener Gelegenheit war einiger Aufschluß zu gewinnen über die Frage, wie mit Erfolg an der geschichtlichen Wiederbelebung der Vergangenheit zu arbeiten sei.
Gewißlich nur dann, wenn einer schöpferisch wiederherstellenden Phantasie ihre Rechte nicht verkümmert werden, wenn der, der die alten Gebeine ausgräbt, sie zugleich auch mit dem Atemzug einer lebendigen Seele anhaucht, auf daß sie sich erheben und kräftigen Schrittes als auferweckte Tote einherwandeln.
In diesem Sinn nun kann der historische Roman das sein, was in blühender Jugendzeit der Völker die epische Dichtung, ein Stück nationaler Geschichte in der Auffassung des Künstlers, der im gegebenen Raume eine Reihe Gestalten scharf gezeichnet und farbenhell vorüberführt, also daß im Leben und Ringen und Leiden der einzelnen zugleich der Inhalt des Zeitraumes sich wie zum Spiegelbild zusammenfaßt.
Auf der Grundlage historischer Studien das Schöne und Darstellbare einer Epoche umspannend, darf der Roman auch wohl verlangen, als ebenbürtiger Bruder der Geschichte anerkannt zu werden, und wer ihn achselzuckend als das Werk willkürlicher und fälschender Laune zurückweisen wollte, der mag sich dabei getrösten, daß die Geschichte, wie sie bei uns geschrieben zu werden pflegt, eben auch nur eine herkömmliche Zusammenschmiedung von Wahrem und Falschem ist, der nur zu viel Schwerfälligkeit anklebt, als daß sie es, wie die Dichtung, wagen darf, ihre Lücken spielend auszufüllen.
Wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist unsere Zeit in einem eigentümlichen Läuterungsprozeß begriffen.
In allen Gebieten schlägt die Erkenntnis durch, wie unsäglich unser Denken und Empfinden unter der Herrschaft der Abstraktion und der Phrase geschädigt worden; da und dort Rüstung zur Umkehr aus dem Abgezogenen, Blassen, Begrifflichen zum Konkreten, Farbigen, Sinnlichen, statt müßiger Selbstbeschauung des Geistes Beziehung auf Leben und Gegenwart, statt Formeln und Schablonen naturgeschichtliche Analyse, statt der Kritik schöpferische Produktion, und unsere Enkel erleben vielleicht noch die Stunde, wo man von manchem Koloß seitheriger Wissenschaft mit der gleichen lächelnden Ehrfurcht spricht, wie von den Resten eines vorsündflutlichen Riesengetiers, und wo man ohne Gefahr, als Barbar verschrien zu werden, behaupten darf, in einem Steinkrug alten Weines ruhe nicht weniger Vernunft als in mancher umfangreichen Leistung formaler Weisheit.
Zur Herstellung fröhlicher, unbefangener, von Poesie verklärter Anschauung der Dinge möchte nun auch die vorliegende Arbeit einen Beitrag geben, und zwar aus dem Gebiet unserer deutschen Vergangenheit.
Unter dem unzähligen Wertvollen, was die großen Folianten der von Pertz herausgegebenen »Monumenta Germaniae« bergen, glänzen gleich einer Perlenschnur die sanktgallischen Klostergeschichten, die der Mönch Ratpert begonnen und Ekkehard der Jüngere (oder, zur Unterscheidung von drei gleichnamigen Mitgliedern des Klosters, der Vierte benannt) bis ans Ende des zehnten Jahrhunderts fortgeführt hat. Wer sich durch die unerquicklichen und vielfältig dürren Jahrbücher anderer Klöster mühsam durchgearbeitet hat, mag mit Behagen und innerem Wohlgefallen an jenen Aufzeichnungen verweilen. Da ist trotz mannigfacher Befangenheit und Unbehilflichkeit eine Fülle anmutiger, aus der Überlieferung älterer Zeitgenossen und den Berichten von Augenzeugen geschöpfter Erzählungen, Personen und Zustände mit groben, aber deutlichen Strichen gezeichnet, viel unbewußte Poesie, treuherzige brave Welt- und Lebensansicht, naive Frische, die dem Niedergeschriebenen überall das Gepräge der Echtheit verleiht, selbst dann, wenn Personen und Zeiträume etwas leichtsinnig durcheinandergewürfelt worden und ein handgreiflicher Anachronismus dem Erzähler gar keinen Schmerz verursacht.
Ohne es aber zu beabsichtigen, führen jene Schilderungen zugleich über die Schranken der Klostermauern hinaus und entrollen das Leben und Treiben, Bildung und Sitte des damaligen alemannischen Landes mit der Treue eines nach der Natur gemalten Bildes.
Es war damals eine vergnügliche und einen jeden, der ringende, unvollendete, aber gesunde Kraft geleckter Fertigkeit vorzieht, anmutende Zeit im südwestlichen Deutschland. Anfänge von Kirche und Staat bei namhafter, aber gemütreicher Roheit der bürgerlichen Gesellschaft, – der aller spätern Entwickelung so gefährliche Geist des Feudalwesens noch harmlos im ersten Entfalten, kein geschraubtes, übermütiges und geistig schwächliches Rittertum, keine üppige unwissende Geistlichkeit, wohl aber ehrliche grobe Gesellen, deren sozialer Verkehr zwar oftmals in einem sehr ausgedehnten System von Verbal- und Realinjurien bestand, die aber in rauher Hülle einen tüchtigen, für alles Edle empfänglichen Kern bargen, – Gelehrte, die morgens den Aristoteles verdeutschen und abends zur Erholung auf die Wolfsjagd ziehen, vornehme Frauen, die für das Studium der Klassiker begeistert sind, Bauern, in deren Erinnerung das Heidentum ihrer Vorväter ungetilgt neben dem neuen Glauben fortlebt, – überall naive, starke Zustände, denen man ohne rationalistischen Ingrimm selbst ihren Glauben an Teufel und Dämonenspuk zugute halten darf. Dabei zwar politische Zerklüftung und Gleichgiltigkeit gegen das Reich, dessen Schwerpunkt sich nach Sachsen übertragen hatte, aber tapferer Mannesmut im Unglück, der selbst die Mönche in den Klosterzellen stählt, das Psalterbuch mit dem Schwert zu vertauschen und gegen die ungarische Verwüstung zu Feld zu rücken, – trotz reichlicher Gelegenheit zur Verwilderung eine dem Studium der Alten mit Begeisterung zugewandte Wissenschaft, die in den zahlreich besuchten Klosterschulen eifrige Jünger fand und in ihren humanen Strebungen an die besten Zeiten des sechzehnten Jahrhunderts erinnert, leises Emporblühen der bildenden Künste, vereinzeltes Aufblitzen bedeutender Geister, vom Wust der Gelehrsamkeit unerstickte Freude an der Dichtung, fröhliche Pflege nationaler Stoffe, wenn auch meist in fremdländischem Gewand.
Kein Wunder, daß es dem Verfasser dieses Buches, als er bei Gelegenheit anderer Studien über die Anfänge des Mittelalters mit dieser Epoche vertraut wurde, erging wie einem Manne, der nach langer Wanderung durch unwirtsames Land auf eine Herberge stößt, die, wohnsam und gut bestellt in Küche und Keller, mit liebreizender Aussicht vor den Fenstern, alles bietet, was sein Herz begehrt.
Er begann, sich häuslich drin einzurichten und durch mannigfaltige Ausflüge in verwandtes Gebiet sich möglichst vollständig in Land und Leute einzuleben.
Den Poeten aber ereilt ein eigenes Schicksal, wenn er sich mit der Vergangenheit genau bekannt macht.
Wo andere, denen die Natur gelehrtes Scheidewasser in die Adern gemischt, viel allgemeine Sätze und lehrreiche Betrachtungen als Preis der Arbeit herausätzen, wachsen ihm Gestalten empor, erst von wallendem Nebel umflossen, dann klar und durchsichtig, und sie schauen ihn ringend an und umtanzen ihn in mitternächtigen Stunden und sprechen: Verdicht' uns!
So kam es auch hier. Aus den naiven lateinischen Zeilen jener Klostergeschichten hob und baute es sich empor wie Turm und Mauern des Gotteshauses Sankt Gallen, viele altersgraue ehrwürdige Häupter wandelten in den Kreuzgängen auf und ab, hinter den alten Handschriften saßen die, die sie einst geschrieben, die Klosterschüler tummelten sich im Hofe, Horasang ertönte aus dem Chor und des Wächters Hornruf vom Turme. Vor allen anderen aber trat leuchtend hervor jene hohe gestrenge Frau, die sich den jugendschönen Lehrer aus des heiligen Gallus Klosterfrieden entführte, um auf ihrem Klingsteinfelsen am Bodensee klassischen Dichtern eine Stätte sinniger Pflege zu bereiten; die schlichte Erzählung der Klosterchronik von jenem dem Virgil gewidmeten Stilleben ist selbst wieder ein Stück Poesie, so schön und echt, als sie irgend unter Menschen zu finden.
Wer aber von solchen Erscheinungen heimgesucht wird, dem bleibt nichts übrig, als sie zu beschwören und zu bannen. Und in den alten Geschichten hatte ich nicht umsonst gelesen, auf welche Art Notker, der Stammler, einst ähnlichen Visionen zu Leibe ging: er ergriff einen knorrigen Haselstock und hieb tapfer auf die Dämonen ein, bis sie ihm die schönsten Lieder offenbartenA1.
Darum griff auch ich zu meinem Handgewaffen, der Stahlfeder, und sagte eines Morgens den Folianten, den Quellen der Gestaltenseherei, Valet und zog hinaus auf den Boden, den einst die Herzogin Hadwig und ihre Zeitgenossen beschritten; und saß in der ehrwürdigen Bücherei des heiligen Gallus und fuhr in schaukelndem Kahn über den Bodensee und nistete mich bei der alten Linde am Abhang des Hohentwiel ein, wo jetzt ein trefflicher schwäbischer Schultheiß die Trümmer der alten Feste behütetA2, und stieg schließlich auch zu den luftigen Alpenhöhen des Säntis, wo das Wildkirchlein keck wie ein Adlerhorst herunterschaut auf die grünen Appenzeller Täler. Dort in den Revieren des Schwäbischen Meeres, die Seele erfüllt von dem Walten erloschener Geschlechter, das Herz erquickt von warmem Sonnenschein und würziger Bergluft, hab' ich diese Erzählung entworfen und zum größten Teil niedergeschrieben.
Daß nicht viel darin gesagt ist, was sich nicht auf gewissenhafte kulturgeschichtliche Studien stützt, darf wohl behauptet werden, wenn auch Personen und Jahrzahlen, vielleicht Jahrzehnte mitunter ein weniges ineinander verschoben wurden. Der Dichter darf sich, der inneren Ökonomie seines Werkes zulieb', manches erlauben, was dem strengen Historiker als Sünde anzurechnen wäre. Sagt doch selbst der unübertroffene Geschichtschreiber Macaulay: Gern will ich den Vorwurf tragen, die würdige Höhe der Geschichte nicht eingehalten zu haben, wenn es mir nur gelingt, den Engländern des neunzehnten Jahrhunderts ein treues Gemälde des Lebens ihrer Vorfahren vorzuführen.
Dem Wunsche sachverständiger Freunde entsprechend, sind in Anmerkungen einige Zeugnisse und Nachweise der Quellen angeführt, zur Beruhigung derer, die sonst nur Fabel und müßige Erfindung in dem Dargestellten zu wittern geneigt sein könnten. Wer aber auch ohne solche Nachweise Vertrauen auf eine gewisse Echtheit des Inhalts setzt, der wird ersucht, sich in die Noten nicht weiter zu vertiefen, sie sind Nebensache und wären überflüssig, wenn das Ganze nicht als Roman in die Welt ginge, der die Vermutung leichtsinnigen Spiels mit den Tatsachen wider sich zu haben pflegt.
Den Vorwürfen der Kritik wird mit Gemütsruhe entgegengesehen. »Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert?« werden sie rufen, »wer reitet so spät durch Nacht und Wind?« Und steht's nicht im neuesten Handbuch der Nationalliteratur im Kapitel vom vaterländischen RomanA3 gedruckt zu lesen: »Fragen wir, welche Zeiten vorzugsweise geeignet sein dürften in der deutschen Geschichte das Lokale mit dem Nationalinteresse zu versöhnen, so werden wir wohl zunächst das eigentliche Mittelalter ausschließen müssen. Selbst die Hohenstaufenzeit läßt sich nur noch lyrisch anwenden, ihre Zeichnung fällt immer düsseldorfisch aus.«
Auf all die Einwände und Bedenken derer, die ein scharfes Benagen harmlosem Genießen vorziehen, und den deutschen Geist mit vollen Segeln in ein alexandrinisches oder byzantinisches Zeitalter hineinzurudern sich abmühen, hat bereits eine literarische Dame des zehnten Jahrhunderts, die ehrwürdige Nonne Hroswitha von Gandersheim, im fröhlichen Selbstgefühl eigenen Schaffens die richtige Antwort gegeben. Sie sagt in der Vorrede zu ihren anmutigen Komödien: »Si enim alicui placet mea devotio, gaudebo. Si autem pro mei abiectione vel pro viciosi sermonis rusticitate nulli placet: memet ipsam tamen iuvat quod feci«. Zu deutsch: »Wofern nun jemand an meiner bescheidenen Arbeit Wohlgefallen findet, so wird mir dies sehr angenehm sein; sollte sie aber wegen der Verleugnung meiner selbst oder der Rauheit eines unvollkommenen Stils niemanden gefallen, so hab' ich doch selber meine Freude an dem, was ich geschaffen!«
Heidelberg,im Februar 1855.
Fußnoten
A1Ekkehardi IV. »Casus, S. Galli«, cap. 3., bei Pertz, »Mon.«, II, 98.
A2 Vgl. das Gedicht »Poetennot«, Bd. 1, S. 244 dieser Ausgabe.
A3 Julian Schmidt, »Geschichte der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert.« 1. Band, S. 424 (Leipzig 1853).
Erstes Kapitel.
Hadwig, Herzogin von Schwaben.
Es war vor beinahe tausend Jahren. Die Welt wußte weder von Schießpulver noch von Buchdruckerkunst.
Über dem Hegau lag ein trüber, bleischwerer Himmel, doch war von der Finsternis, die bekanntlich über dem ganzen Mittelalter lastete, im einzelnen nichts wahrzunehmen. Vom Bodensee her wogten die Nebel übers Ries und verdeckten Land und Leute. Auch der Turm vom jungen Gotteshaus Radolfszelle war eingehüllt, aber das Frühglöcklein war lustig durch Dunst und Dampf erklungen, wie das Wort eines verständigen Mannes durch verfinsternden Nebel der Toren.
Es ist ein schönes Stück deutscher Erde, was dort zwischen Schwarzwald und Schwäbischem Meer sich auftut. Wer's mit einem falschen Gleichnis nicht allzu genau nimmt, mag sich der Worte des DichtersA1 erinnern:
»Das Land der Alemannen mit seiner Berge Schnee,
Mit seinem blauen Auge, dem klaren Bodensee,
Mit seinen gelben Haaren, dem Ährenschmuck der Auen,
Recht wie ein deutsches Antlitz ist solches Land zu schauen.«
– wiewohl die Fortführung dieses Bildes Veranlassung werden könnte, die Hegauer Berge als die Nasen in diesem Antlitz zu preisen.
Düster ragte die Kuppe des hohen Twiel mit ihren Klingsteinzacken in die Lüfte. Als Denkstein stürmischer Vorgeschichte unserer alten Mutter Erde stehen jene schroffen malerischen Bergkegel in der Niederung, die einst gleich dem jetzigen Becken des Sees von wogender Flut überströmt war. Für Fische und Wassermöven mag's ein denkwürdiger Tag gewesen sein, da es in den Tiefen brauste und zischte, und die basaltischen Massen glühend durch der Erdrinde Spalten sich ihren Weg über die Wasserspiegel bahnten. Aber das ist schon lange her. Es ist Gras gewachsen über die Leiden derer, die bei jener Umwälzung mitleidlos vernichtet wurden; nur die Berge stehen noch immer, ohne Zusammenhang mit ihren Nachbarn, einsam und trotzig wie alle, die mit feurigem Kern im Herzen die Schranken des Vorhandenen durchbrechen, und ihr Gestein klingt, als säße noch ein Gedächtnis an die fröhliche Jugendzeit drin, da sie zuerst der Pracht der Schöpfung entgegengejubelt.
Zur Zeit, da unsere Geschichte anhebt, trug der hohe Twiel schon Turm und Mauern, eine feste Burg. Dort hatte Herr Burkhard gehaust, der Herzog in Schwaben. Er war ein fester Degen gewesen und hatte manchen Kriegszug getan; die Feinde des Kaisers waren auch die seinen, und dabei gab es immer Arbeit: wenn's in Welschland ruhig war, fingen oben die Normänner an, und wenn die geworfen waren, kam etwann der Ungar geritten, oder es war einmal ein Bischof übermütig oder ein Grafe widerspenstig, – so war Herr Burkhard zeitlebens mehr im Sattel als im Lehnstuhl gesessen. Demgemäß ist erklärlich, daß er sich keinen sanften Leumund geschaffen.
In Schwaben sprachen sie, er habe die Herrschaft geführt, sozusagen als ein Zwingherr, und im fernen Sachsen schrieben die Mönche in ihre Chroniken, er sei ein kaum zu ertragender Kriegsmann gewesen1.
Bevor Herr Burkhard zu seinen Vätern versammelt ward, hatte er sich noch ein Ehgemahl erlesen. Das war die junge Frau Hadwig, Tochter des Herzogs in Bayern. Aber in das Abendrot eines Lebens, das zur Neige geht, mag der Morgenstern nicht freudig scheinen. Das hat seinen natürlichen Grund2. Darum hatte Frau Hadwig den alten Herzog in Schwaben genommen ihrem Vater zu Gefallen, hatte ihn auch gehegt und gepflegt, wie es einem grauen Haupt zukam, aber wie der Alte zu sterben ging, hat ihr der Kummer das Herz nicht gebrochen.
Da begrub sie ihn in der Gruft seiner Väter und ließ ihm von grauem Sandstein ein Grabmal setzen und stiftete eine ewige Lampe über das Grab; kam auch noch etliche Male zum Beten herunter, aber nicht allzuoft.
Dann saß Frau Hadwig allein auf der Burg Hohentwiel; es waren ihr die Erbgüter des Hauses und mannigfalt Befugnis, im Land zu schalten und zu walten, verblieben, sowie die Schutzvogtei über das Hochstift Konstanz und die Klöster um den See, und hatte ihr der Kaiser gebrieft und gesiegelt zugesagt, daß sie als Reichsverweserin in Schwaben gebieten solle, solange der Witwenstuhl unverrückt bleibe. Die junge Witib war von adeligem Gemüt und nicht gewöhnlicher Schönheit. Aber die Nase brach unvermerkt kurz und stumpflich im Antlitz ab, und der holdselige Mund war ein wenig aufgeworfen, und das Kinn sprang mit kühner Form vor, also, daß das anmutige Grüblein, so den Frauen so minnig ansteht, bei ihr nicht zu finden war. Und wessen Antlitz also geschaffen, der trägt bei scharfem Geist ein rauhes Herz im Busen und sein Wesen neigt zur Strenge. Darum flößte auch die Herzogin manchem ihres Landes trotz der lichten Röte ihrer Wangen einen sonderbaren Schreck ein3.
An jenem nebligen Tag stand Frau Hadwig im KlosettA2 ihrer Burg und schaute in die Ferne hinaus. Sie trug ein stahlgrau Unterkleid, das in leichten Wellen über die gestickten Sandalen wallte, drüber schmiegte sich eine bis zum Knie reichende schwarze Tunika; im Gürtel, der die Hüften umschloß, glänzte ein kostbarer Beryll. Ein goldfadengestricktes Netz hielt das kastanienbraune Haar umfangen, doch unverwehrt umspielten sorgsam gewundene Locken die lichte Stirn.
Auf dem Marmortischlein am Fenster stand ein phantastisch geformtes dunkelgrün gebeiztes Metallgefäß, drin brannte ein fremdländisch Räucherwerk und wirbelte seine duftig weißen Wölklein zur Decke des Gemachs. Die Wände waren mit buntfarbigen gewirkten Teppichen umhangen.
Es gibt Tage, wo der Mensch mit jeglichem unzufrieden ist, und wenn er in Mittelpunkt des Paradiesgartens gesetzt würde, es wär' ihm auch nicht recht. Da fliegen die Gedanken mißmutig von dem zu jenem und wissen nicht, wo sie anhalten sollen, – aus jedem Winkel grinst ein Fratzengesicht herfür, und wenn einer ein fein Gehör hat, so mag er auch der Kobolde Gelächter vernehmen. Man sagt dortlands, der schiefe Verlauf solcher Tage rühre gewöhnlich davon her, daß man frühmorgens mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett gesprungen sei, was bestimmtem Naturgesetz zuwider.
Die Herzogin hatte heute ihren Tag. Sie wollte zum Fenster hinausschauen, da blies ihr ein feiner Luftzug den Nebel ins Angesicht; das war ihr nicht recht. Sie hub einen zürnenden Husten an. Wenn Sonnenschein weit übers Land geglänzt hätte, sie würde auch an ihm etwas ausgesetzt haben.
Der Kämmerer Spazzo war eingetreten und stand ehrerbietig am Eingang. Er warf einen wohlgefälligen Blick auf seine Gewandung, als wär' er sicher, seiner Gebieterin Augen heut auf sich zu lenken, denn er hatte ein gestickt Hemde von Glanzleinwand angelegt und ein saphirfarbiges Oberkleid mit purpurnen Säumen, alles nach neustem Schnitt; erst gestern war des Bischofs Schneider von Konstanz damit herübergekommen4.
Der Wolfshund dessen von Fridingen hatte zwei Lämmer der Burgherde zerrissen, da gedachte Herr Spazzo pünktlichen Vortrag zu erstatten und Frau Hadwigs fürstliches Gutachten einzuholen, ob er in friedlichem Austrag sich mit dem Herrn des Schädigers vergleichen oder am nächsten Gaugericht Wehrgeld und Buße einklagen solle5. Er hub seinen Spruch an. Aber eh' und bevor er zu Ende gekommen, sah er, daß ihm die Fürstin ein Zeichen machte, dessen Bedeutung einem verständigen Mann nicht fremd bleiben konnte. Sie fuhr mit dem Zeigefinger der Rechten erst nach der Stirn, dann wies sie mit gleichem Finger nach der Tür. Da merkte der Kämmerer, daß es seinem eigenen Witz anheimgestellt sei, nicht nur den Bescheid wegen der Lämmer zu finden, sondern auch sich mit möglichster Beschleunigung zu entfernen. Er verbeugte sich und ging.
Mit heller Stimme rief Frau Hadwig jetzt: »Praxedis!« – Und wie's nicht sogleich die Stufen zum Saal herauf huschte, rief sie noch einmal schärfer: »Praxedis!«
Es dauerte nicht lange, so schwebte die Gerufene ins Klosett herein.
Praxedis war der Herzogin in Schwaben Kammerfrau, von griechischer Nation, ein lebend Angedenken, daß einst des Byzantiner Kaisers Vasilius Sohn um Hadwigs Hand geworben6. Der hatte das des Gesangs und weiblicher Kunstfertigkeit erfahrene Kind samt vielen Kleinodien und Schätzen der deutschen Herzogstochter geschenkt und als Gegengabe einen Korb erbeutet. Man konnte damals Menschen verschenken, auch kaufen. Freiheit war nicht jedem zu eigen. Aber eine Unfreiheit, wie sie das Griechenkind auf der schwäbischen Herzogsburg zu tragen hatte, war nicht drückend.
Praxedis war ein blasses feingezeichnetes Köpfchen, aus dem zwei große dunkle Augen unsäglich wehmütig und lustig zugleich in die Welt vorschauten. Das Haar trug sie in Flechten um die Stirn geschlungen; sie war schön.
»Praxedis, wo ist der Star?« sprach Frau Hadwig.
»Ich werd' ihn bringen«, sagte die Griechin. Und sie ging und brachte den schwarzen Gesellen, der saß so breit und frech in seinem Käfig, als wenn sein Dasein im Weltganzen eine klaffende Lücke auszufüllen hätte. Der Star hatte bei Hadwigs Hochzeit sein Glück gemacht7. Ein alter Fiedelmann und Gaukler hatte ihm unter langwieriger Mühsal einen lateinischen Hochzeitsgruß eingetrichtert; das gab einen großen Jubel, wie beim Festschmaus der Käfig auf den Tisch gestellt ward und der Vogel seinen Spruch sprach: »Es ist ein neuer Stern am Schwabenhimmel aufgegangen, der Stern heißt Hadwig, Heil ihm!« und so weiter.
Der Star war aber tiefer gebildet. Er konnte außer dem gereimten Klingklang auch das Vaterunser hersagen. Der Star war auch hartnäckig und konnte seine Grillen haben, so gut wie eine Herzogin in Schwaben.
Heute mußte dieser eine Erinnerung an alte Zeit durch den Sinn geflogen sein, der Star sollte den Hochzeitsspruch sagen. Der Star aber hatte seinen frommen Tag. Und wie ihn Praxedis ins Gemach trug, rief er feierlich: »Amen!« und wie Frau Hadwig ihm ein Stück Honigkuchen in den Käfig reichte und schmeichelnd fragte: »Wie war's mit dem Stern am schwäbischen Himmel, Freund Star?« da sprach er langsam: »Führe uns nicht in Versuchung!« Wie sie aber zur Ergänzung seines Gedächtnisses ihm zuflüsterte: »Der Stern heißt Hadwig, Heil ihm!« – da fuhr der Star in seiner Melodie fort und intonierte würdig: »Erlöse uns von dem Übel!«
»Fürwahr, das fehlt noch, daß auch die Vögel heutigentages unverschämt werden«, rief Frau Hadwig, »Burgkatze, wo steckst du?« und sie lockte die schwarze Katze herbei, der war der Star schon lange ein Dorn im Auge, mit funkelnden Augen kam sie geschlichen.
Frau Hadwig erschloß den Käfig und überantwortete ihr den Vogel, der Star aber, dem schon die scharfen Krallen das Gefieder zausten und etliche Schwungfedern geknickt hatten, ersah noch ein Gelegenheitlein und entwischte durch einen Spalt am Fenster.
Bald war er verschwunden, ein schwarzer Punkt im Nebel.
»Eigentlich«, sprach Frau Hadwig, »hätt' ich ihn auch im Käfig behalten können. Praxedis, was meinst du?«
»Meine Herrin hat bei allem recht, was sie tut«, erwiderte diese.
»Praxedis«, fuhr Frau Hadwig fort, »hol' mir meinen Schmuck. Mich gelustet, eine goldene Armspange anzulegen.«
Da ging Praxedis, die immerwillige, und brachte der Herzogin Schmuckkästchen. Das war von getriebenem Silber, mit starken unfertigen Strichen waren etliche Gestalten darin angebracht in erhabener Arbeit, der Heiland als guter Hirt und Petrus mit dem Schlüssel und Paulus mit dem Schwert, samt allerhand Blattwerk und reich verschlungener Zierart, als wenn es früher zur Aufbewahrung von Reliquien gedient hätte. Es war durch Herrn Burkhard eingebracht worden, doch sprach er nie gern davon, denn er kam zu selber Zeit von einer Fehde heimgeritten, darin er einen burgundischen Bischof schwer überrannt und niedergeworfen hatte.
Wie die Herzogin das Kästchen aufschlug, gleißten und glänzten die Kleinodien mannigfalt auf dem roten Sammtfutter. Bei solchen Denkzeichen der Erinnerung kommen allerhand alte Geschichten herangeschwirrt. Auch das Bildnis des griechischen Prinzen Konstantin lag dort, zierlich, geleckt und sonder Geist vom Byzantiner Meister auf Goldgrund gemalt.
»Praxedis«, sprach Frau Hadwig, »wie wär's geworden, wenn ich deinem spitznasigen, gelbwangigen Prinzen die Hand gereicht hätte?«
»Meine Herrin«, war Praxedis' Antwort, »es wäre sicher gut geworden.«
»Ei«, fuhr Frau Hadwig fort, »erzähl' mir etwas von deiner langweiligen Heimat, ich möchte mir gern vorstellen, was ich für einen Einzug in Konstantinopolis gehalten hätte.«
»O Fürstin«, sprach Praxedis, »meine Heimat ist schön« – wehmütig ließ sie ihr dunkles Aug' in die neblige Ferne gleiten – »und solch trüber Himmel wenigstens wär' Euch am Ufer des Marmormeers für immer erspart. Auch Ihr hättet den Schrei des Staunens nicht unterdrückt, wenn wir auf stolzer Galeere dahingefahren wären: an den sieben Türmen vorbei, da heben sich zuerst die dunklen Massen, Paläste, Kuppeln, Gotteshäuser, alles im blendend weißen Marmor, aus den Brüchen der Insel Prokonnesos, groß und stolz steigt die Lilie des Meeres aus dem blauen Grunde auf, dort ein dunkler Wald von Zypressen, hier die riesige Wölbung der hagia Sophia, auf und ab das weite Vorgebirg' des Goldenen Horns; gegenüber am asiatischen Gestade grüßt eine zweite Stadt, und als blaugoldener Gürtel schlingt sich das schiffbelastete Meer um den Zauber – o Herrin, auch im Traum vermag ich hier im schwäbischen Land den Glanz jenes Anblicks nicht wieder zu schauen.
Und dann, wenn die Sonne niedergestiegen und über flimmernden Meereswellen die schnelle Nacht aufgeht, der Königsbraut zu Ehren alles im blaufahlen Glanz griechischen Feuers, – jetzt fahren wir in Hafen ein, die große Kette, die ihn sonst absperrt, löst sich dem Brautschiff, Fackeln sprühen am Ufer, dort steht des Kaisers Leibwache, die Waräger mit ihren zweischneidigen Streitäxten, und die blauäugigen Normänner, dort der Patriarch mit zahllosen Priestern, überall Musik und Jubelruf, und der Königssohn im Schmucke der Jugend empfängt die Verlobte, nach dem Palaste von Blacharnae wallt der Festzug ...«
»Und all diese Herrlichkeit habe ich versäumt«, spottete Frau Hadwig. »Praxedis, dein Bild ist nicht vollständig. Und schon des andern Tags kommt der Patriarch und erteilt der abendländischen Christin einen scharfen Glaubensunterricht, was von all den Ketzereien zu halten, die auf eurem verstandesdürren Erdreich aufsprießen wie Stechapfel und Bilsenkraut, – und was von den Bildern der Mönche und dem Konzilschluß zu Chalcedon und Nicaea; dann kommt die Großhofmeisterin und lehrt die Gesetze der Sitte und Bewegung: so die Stirn gefaltet und so die Schleppe getragen, diesen Fußfall vor dem Kaiser und jene Umarmung der Frau Schwiegermutter und diese Höflichkeit gegen jenen Günstling und jene gigantische Redensart gegen dieses Untier: Eure Gravität, Eure Eminenz, Eure erhabene und wunderbare Größe! – was am Menschen Lebenslust und Kraft heißt, wird abgetötet, und der Herr Gemahl gibt sich auch als gefirnißtes Püppchen zu erkennen, eines Tages steht der Feind vor den Toren oder der Thronfolger ist den Blauen und Grünen des Zirkus nicht genehm, der Aufstand tobt durch die Straßen, und die deutsche Herzogstochter wird geblendet ins Kloster gesteckt ... Was frommt's ihr dann, daß ihre Kinder schon in der Wiege mit dem Titel Alleredelster begrüßt wurden? Praxedis, ich weiß, warum ich nicht nach Konstantinopolis ging.«
»Der Kaiser ist der Herr der Welt«, sprach die Griechin; »was der Wille seiner Ewigkeit ordnet, ist wohlgetan: so hat man mich gelehrt.«
»Hast du auch schon darüber nachgedacht, daß es dem Menschen ein kostbar Gut ist, sein eigener Herr zu sein?«
»Nein«, sprach Praxedis.
Das angeregte Gespräch behagte der Herzogin.
»Was hat denn«, fuhr sie fort, »euer Byzantiner Maler für einen Bescheid heimgebracht, da er mein Konterfei fertigen sollte?«
Die Griechin schien die Frage überhört zu haben. Sie hatte sich erhoben und stand am Fenster.
»Praxedis«, sprach Frau Hadwig scharf, »antworte!«
Da lächelte die Gefragte mild und sagte: »Das ist schon eine lange Zeit her, aber Herr Michael Thallelaios hat wenig Gutes von Euch gesprochen. Die schönsten Farben habe er bereitgehalten, so erzählt er uns, und die feinsten Goldblättchen, Ihr seiet ein reizend Kind gewesen, wie man Euch zum Gemaltwerden vor ihn führte, und es hab' ihn feierlich angemutet, als sollt' er seine ganze Kunst zusammennehmen, wie damals, als er die Mutter Gottes fürs Athoskloster malte. Aber die Prinzessin Hadwig hätten geruht, die Augen zu verdrehen, und wie er eine bescheidene Einwendung erhoben, hätten Eure Gnaden die Zunge gewiesen und beide Hände mit gestreckten Fingern an die Nase gehalten und in anmutig gebrochenem Griechisch gesagt, das sei die rechte Stellung.
Der Herr Hofmaler nahm Veranlassung, vieles über den Mangel an Bildung in deutschen Landen dran zu knüpfen, und hat einen hohen Schwur getan, daß er zeitlebens dort kein Fräulein mehr malen wolle. Und der Kaiser Basilius hat auf den Bericht hin grimmig in seinen Bart gebrummt ...8«
»Laß Seine Majestät brummen«, sprach die Herzogin. »Und flehe zum Himmel, daß er jeder andern die Geduld verleihen möge, die mir damals ausging. Ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, einen Affen zu sehen, aber allem zufolge, was glaubwürdige Männer erzählen, reicht Herrn Michaels Ahnentafel zu jenen Mitgliedern der Schöpfung hinauf.«
Sie hatte inzwischen die Armspange angelegt, es waren zwei ineinander verstrickte Schlangen, die sich küssen, jede trug ein Krönlein auf dem Haupt9. Da ihr unter dem vielen Geschmucke jetzt ein schwerer silberner Pfeil unter die Hände geraten war, so mußte auch er seinen Aufenthalt im Gefängnis des Schreins mit anderem Platze vertauschen. Er ward in die Maschen des goldfadigen Haarnetzes gezogen.
Als wollte sie des Schmuckes Wirkung prüfen, ging Frau Hadwig mit großen Schritten durchs Gemach. Ihr Gang war herausfordernd. Aber der Saal war leer; selbst die Burgkatze war von dannen geschlichen. Spiegel waren keine an den Wänden. Der Zustand wohnlicher Einrichtung überhaupt ließ damals manches zu wünschen übrig.
Praxedis' Gedanken waren noch bei der vorigen Geschichte. »Gnädige Gebieterin«, sprach sie, »er hat mich doch gedauert.«
»Wer?«
»Des Kaisers Sohn. Ihr seid ihm im Traum erschienen«, sagt' er, »und all sein Glück hab' er von Euch erhofft. Er hat auch geweint ...«
»Laß die Toten ruhen«, sprach Frau Hadwig ärgerlich. »Nimm lieber die Laute und sing mir das griechische Liedlein:«
»Konstantin, du armer Knabe,
Konstantin, und laß das Weinen!«
»Sie ist zersprungen«, war die Antwort, »und alle Saiten zugrund' gerichtet, seit die Frau Herzogin geruhten, sie ...«
»Sie dem Grafen Boso von Burgund an Kopf zu – werfen«, ergänzte Hadwig. »Dem ist nicht zu viel geschehen, 's war gar nicht notwendig, daß er uneingeladen zur Leichenfeier Herrn Burkhards kam und mir Trost zusprechen wollte, als wär' er ein Heiliger. Laß die Laute flicken.«
»Sag' mir indes, du griechische Goldblume, warum hab' ich heut den festlichen Schmuck angelegt?«
»Gott ist allwissend«, sprach die Griechin, »ich weiß es nicht.« Sie schwieg. Frau Hadwig schwieg auch. Da trat eine jener schwülen inhaltsvollen Pausen ein, wie sie der Selbsterkenntnis vorangehen. Endlich sprach die Herzogin: »Ich weiß es auch nicht!«
Die Jünger des heiligen Gallus.
Des andern Tages fuhr die Herzogin samt Praxedis und großer Gefolgschaft im lichten Schein des Frühmorgens über den Bodensee. Der See war prächtig blau, die Wimpel flaggten lustig, und war viel Kurzweil auf dem Schiff. Wer sollt' auch traurig sein, wenn er über die kristallklare Wasserfläche dahinschwebt, die baumumsäumten Gestade mit Mauern und Türmen ziehen im bunten Wechsel an ihm vorbei, fern dämmern die schneeigen Firnen und der Widerschein des weißen Segels verzittert im Spiele der Wellen?
Keines wußte, wo das Ziel der Fahrt. Sie waren's! aber so gewohnt.
Wie sie an der Bucht von Rorschach10 anfuhren, hieß die Herzogin einlenken. Zum Ufer steuerte das Schiff, übers schwanke Brett stieg sie ans Land. Und der Wasserzoller kam herbei, der dort den Welschlandfahrern das Durchgangsgeld abnahm, und der Weibel des Marktes und wer immer am jungen Hafenplatz seßhaft war, sie riefen der Landesherrin ein rauhes: »Heil Herro! Heil Liebo11!« zu und schwangen mächtige Tannenzweige. Grüßend schritt sie durch die Reihen und gebot ihrem Kämmerer, etliche Silbermünzen auszuwerfen, aber es galt kein langes Verweilen. Schon standen die Rosse bereit, die waren zur Nachtzeit insgeheim vorausgeschickt worden; wie alle im Sattel saßen, sprach Frau Hadwig: »Zum heiligen Gallus!« Da schauten sich die Dienstleute verwundert an: Was soll uns die Wallfahrt? Zum Antworten war's nicht Zeit, schon ging's im Trab das hügelige Stück Landes hinauf, dem Gotteshause entgegen.
Sankt Benedikt und seine Schüler haben die bauliche Anlage ihrer Klöster wohl verstanden. Land ab, Land auf, so irgendwo eine Ansiedelung steht, die gleich einer Festung einen ganzen Strich beherrscht, als Schlüssel zu einem Tal, als Mittelpunkt sich kreuzender Heerstraßen, als Hort des feinsten Weinwuchses: so mag der Vorüberwandernde bis auf weitere Widerlegung die Vermutung aussprechen, daß sotanes Gotteshaus dem Orden Benedicti zugehöre oder vielmehr zugehört habe, denn heutigentages sind die Klöster seltener und die Wirtshäuser häufiger, was mit steigender Bildung zusammenhängt.
Auch der irische Gallus hatte einen löblichen Platz erwählt, da er, nach Waldluft gierig12, in helvetischer Einöde sich festsetzte; ein hochgelegenes Tal, durch dunkle Bergrücken von den milderen Gestaden des Sees gesondert, steinige Waldbäche brausen vorüber, und die riesigen Wände des Alpsteins, dessen Spitzen mit ewigem Schnee umhüllt im Gewölke verschwinden, erheben sich als schirmende Mauer zur Seite.
Es war ein sonderbarer Zug, der jene Glaubensboten von Albion und Erin aufs germanische Festland führte. Genau besehen ist's ihnen kaum zu allzu hohem Verdienst anzurechnen. »Die Gewohnheit, in die Fremde zu ziehen, ist den Briten so in die Natur gewachsen, daß sie nicht anders können13«, schrieb schon in Karl des Großen Tagen ein unbefangener schwäbischer Mann. Sie kamen als Vorfahren der heutigen Touristen, man kannte sie schon von weitem am fremdartig zugeschnittenen Felleisen14. Und ein mancher blieb haften und ging nimmer heim, wiewohl die ehrsamen Landesbewohner ihn für sehr unnötig halten mochten. Aber die größere Zähigkeit, das Erbteil des britischen Wesens, lebensgewandte Kunst, sich einzurichten, und beim Volk die mystische Ehrfurcht vor dem Fremden gab ihren Strebungen im Dienst der Kirche Bestand.
Andere Zeiten, andere Lieder! Heute bauen die Enkel jener Heiligen den Schweizern für gutes eidgenössisches Geld die Eisenbahn15.
Aus der schmucklosen Zelle an der Steinach, wo der irische Einsiedel seine Abenteuer mit Dornen, Bären und gespenstigen Wasserweibern bestand, war ein umfangreich Kloster emporgewachsen. Stattlich ragte der achteckige Turm der Kirche aus schindelgedeckten Dächern der Wohngebäude; Schulhäuser und Kornspeicher, Kellerei und Scheunen waren daran gebaut, auch ein klappernd Mühlrad ließ sich hören, denn aller Bedarf zum Lebensunterhalt muß in des Klosters nächster Nähe bereitet werden, auf daß es den Mönchen nicht notwendig falle, in die Ferne zu schweifen, was ihrem Seelenheil undiensam. Eine feste Ringmauer mit Turm und Tor umschloß das Ganze, minder des Zierats als der Sicherheit halber, maßen mancher Gewaltige im Land das Gebot: »Laß dich nicht gelüsten deines Nachbars Gut!« dazumal nicht allzustrenge einhielt.
Es war Mittagszeit vorüber, schweigende Ruhe lag über dem Tal. Des heiligen Benedikt Regel ordnet für diese Stunde, daß ein jeder sich still auf seinem Lager halte, und wiewohl von der gliederlösenden Glut italischer Mittagssonne, die Menschen und Tier in des Schlummers Arme treibt, diesseits der Alpen wenig zu verspüren, folgten sie im Kloster doch pflichtgemäß dem Gebot16.
Nur der Wächter auf dem Torturm stand, wie immer, treulich und aufrecht im mückendurchsummten Stüblein.
Der Wächter hieß Romeias und hielt gute Wacht. Da hörte er durch den nahen Tannwald ein Roßgetrabe; er spitzte sein Ohr nach der Richtung. »Acht oder zehn Berittene!« sprach er nach prüfendem Lauschen; er ließ das Fallgatter vom Tor herniederrasseln, zog das Brücklein, was über den Wassergraben führte, auf und langte sein Horn vom Nagel. Und weil sich einiges Spinnweb' drin festgesetzt hatte, reinigte er dasselbe.
Jetzt kamen die vordersten des Zuges am Waldsaum zum Vorschein. Da fuhr Romeias mit der Rechten über die Stirn und tat einen sonderbarlichen Blick hinunter. Das Endergebnis seines Blickes war ein Wort: »Weibervölker!?« – er sprach's halb fragend, halb als Ausruf, und lag weder Freudigkeit noch Auferbauung in seinem Worte. Er griff sein Horn und blies dreimal hinein. Es war ein ungefüger stiermäßiger Ton, den er hervorlockte, und war dem Hornblasen deutlich zu entnehmen, daß weder Musen noch Grazien die Wiege des Romeias zu Villingen im Schwarzwald umstanden hatten.
Wenn einer im Wald sich umgeschaut hat, so hat er sicher schon das Getrieb eines Ameisenhaufens angesehen. Da ist alles wohlgeordnet und geht seinen gemeinsamen Gang und freut sich der Ruhe in der Bewegung: itzt fährst du mit deinem Stab darein und scheuchest die vordersten: da bricht Verwirrung aus, Rennen und wimmelnder Zusammenlauf – alles hat der eine Stoß verstört. Also und nicht anders fuhr der Stoß aus Romeias Horn aufjagend ins stille Kloster.
Da füllten sich die Fenster am Saal der Klosterschulen mit neugierigen jungen Gesichtern, manch lieblicher Traum in einsamer Zelle entschwebte, ohne seinen Schluß zu finden, manch tiefsinnige Meditation halbwachender Denker desgleichen; der böse Sindolt, der in dieser Stunde auf seinem SchragenA1 des Ovidius verboten Büchlein »Von der Kunst, zu lieben« zu ergründen pflegte, rollte eiligst die pergamentnen Blätter zusammen und barg sie im schützenden Versteck seines Strohsacks.
Der Abt Cralo sprang aus seinem Lehnstuhl und reckte seine Arme der Decke seines Gemachs entgegen, ein schlaftrunkener Mann; auf schwerem Steintisch stund ein prachtvoll silbern Wasserbecken17, darein tauchte er den Zeigefinger und netzte die Augen, des Schlummers Rest zu vertreiben. Dann hinkte er zum offenen Söller seines Erkers und schaute hinab.
Und er ward betrüblich überrascht, als wär' ihm eine Walnuß aufs Haupt gefallen: »Heiliger Benedikt, sei mir gnädig, meine Base, die Herzogin!«
Sofort schürzte er seine Kutte, strich den schmalen Buschel Haare zurecht, der ihm inmitten des kahlen Scheitels noch stattlich emporwuchs gleich einer Fichte im öden Sandfeld18, hing das güldene Kettlein mit dem Klostersigill um, nahm seinen Abtsstab von Apfelbaumholz, dran der reichverzierte Elfenbeingriff erglänzte, und stieg in den Hof hernieder.
»Wird's bald?«, rief einer der Berittenen draußen. Da gebot er dem Wächter, daß er die Angekommenen nach ihrem Begehr frage. Romeias tat's.
Jetzt ward draußen ins Horn gestoßen, der Kämmerer Spazzo ritt als Herold ans Tor und rief mit tiefer Stimme:
»Die Herzogin und Verweserin des Reichs in Schwabenland entbeut dem heiligen Gallus ihren Gruß. Schaffet Einlaß!«
Der Abt seufzte leise auf. Er stieg auf Romeias' Warte; an seinen Stab gelehnt gab er denen vor dem Tor den Segen und sprach:
»Im Namen des heiligen Gallus dankt der unwürdigste seiner Jünger für den erlauchten Gruß. Aber sein Kloster ist keine Arche, drin jegliche Gattung von Lebendigem, Reines und Unreines, Männlein und Weiblein Eingang findet. Darum – ob auch das Herz von Betrübnis erfüllt wird – ist Einlaßschaffen ein unmöglich Ding. Der Abt muß am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen über die seiner Hut vertrauten Seelen. Die Nähe einer Frau, und wär' sie auch die erlauchteste im Lande, und der hinfällige Scherz der Kinder dieser Welt wär' allzu große Versuchung für die, so zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten müssen. Beschweret das Gewissen des Hirten nicht, der um seine Lämmer Sorge trägt. Kanonische Satzung sperrt das Tor.
Die gnädige Herzogin wird in Trogen oder Rorschach des Klosters Villa zu ihrer Verfügung finden ...«
Frau Hadwig saß schon lange ungeduldig im Sattel; jetzt schlug sie mit der Reitgerte ihren weißen Zelter, daß er sich mäßig bäumte, und rief lachenden Mundes:
»Spart die Umschweife, Vetter Cralo, ich will das Kloster sehen!«
Wehmütig hub der Abt an: »Wehe dem, durch welchen Ärgernis in die Welt kommt. Ihm wäre heilsamer, daß an seinem Hals ein Mühlstein ...«
Aber seine Warnung kam nicht zu Ende. Frau Hadwig änderte den Ton ihrer Stimme: »Herr Abt, die Herzogin in Schwaben muß das Kloster sehen!« sprach sie scharf.
Da ward es dem Schwergeprüften klar, daß weiterer Widerspruch kaum möglich ohne große Gefahr für des Gotteshauses Zukunft. Noch sträubte sich sein Gewissen. Wenn einer in zweifelhafter Lage aus sich selber keine Auskunft zu schöpfen weiß, ist's dem schwanken Gemüt wohltätig, andere zu gutem Rat beizuziehen, das nimmt die Verantwortung und deckt den Rücken.
Darum rief Herr Cralo jetzt hinunter: »Da Ihr hartnäckig darauf besteht, muß ich's der Ratsversammlung der Brüder vortragen. Bis dahin geduldet Euch!«
Er schritt zurück über den Hof, im Herzen den stillen Wunsch, daß eine Sündflut vom Himmel die Heerstraße zerstören möge, die so leichtlich unberufenen Besuch herbeiführe. Sein hinkender Gang war eilig und aufgeregt, und es ist nicht zu verwundern, daß berichtet wird, er sei in selber Zeit in dem Klostergang auf- und abgeflattert wie ein Schwälblein vor dem Gewitter19.
Fünfmal erklang jetzt das Glöcklein von des heiligen Othmar Kapelle neben der Hauptkirche und rief die Brüder zum Kapitelsaal. Und der einsame Kreuzgang belebte sich mit einherwandelnden Gestalten; gegenüber vom sechseckigen Ausbau, wo unter säulengetragenen Rundbogen der Springquell anmutig in die metallene Schale niederplätscherte, war der Ort der Versammlung, eine einfache graue Halle; auf erhöhtem Ziegelsteinboden hob sich des Abtes Marmorstuhl, dran zwei rohe Löwenköpfe ausgehauen, Stufen führten hinauf. Vergnüglich streifte das Auge von dort an den dunkeln Pfeilern und Säulen vorüber ins Grün des Gärtleins im innern Hofe; Rosen und Malven blühten drin empor; die Natur sucht gütig auch die heim, die sich ihr abgekehrt.
In scharfem Gegensatz der Farbe hoben sich die weißen Kutten und dunkelfarbigen Oberkleider vom Steingrau der Wände; lautlos traten die Berufenen ein, flüchtig Nicken des Hauptes war der gegenseitige Gruß; wärmender Sonnenstrahl fiel durchs schmale Fenster auf ihre Reihen.
Es waren erprobte Männer, ein heiliger und Gott wohlgefälliger Senat20.
Der mit dem schmächtigen Körper und dem scharfen, von Fasten und Nachtwachen geblaßten Antlitz war Notker, der Stammler; ein wehmütig Zucken spielte um seine Lippen, lange Übung der Askesis hatte seinen Geist der Gegenwart entrückt. Früher hatte er gar schöne Singweisen erdacht, jetzt war er verdüstert und ging in der Stille der Nacht den Dämonen nach, mit ihnen zu kämpfen; in der Krypta des heiligen Gallus hatte er jüngst den Teufel erreicht und so darniedergeschlagen, daß er mit lautem Auwehschrei in einen Winkel sich barg; und seine Neider sagten, auch sein schwermütiges Lied, »Media vitaA2« sei unheimlichen Ursprungs und vom bösen Feind geoffenbart als Lösegeld, da er ihn in seiner Zelle siegreich zusammengetreten unter starkem Fuße festhielt.
Aber neben ihm lächelte ein gutmütig ehrenfest Gesicht aus eisgrauem Bart herfür; der starke Tutilo war's, der saß am liebsten vor der Schnitzbank und schnitzte die wunderfeinen Bildwerke in Elfenbein, noch gibt das Diptychon mit Marias Himmelfahrt und dem Bären des heiligen Gallus Zeugnis von seiner Kunst. Aber wenn ihm der Rücken sich krümmen wollte von der Arbeit Last, zog er singend hinab auf die Wolfsjagd oder suchte einen ehrlichen Faustkampf zur Erholung, er focht lieber mit bösen Menschen als mit nächtlichem Spuk und sagte oft im Vertrauen zu seinem Freund Notker: »Wer so manchem in Christenheit und Heidenschaft ein blaues Denkzeichen verabreicht, wie ich, kann der DämonomachiaA3 entbehren.«
Auch Ratpert kam herzu, der lang' erprobte Lehrer der Schule, der immer unwillig auffuhr, wenn ihn das Kapitelglöcklein von seinen Geschichtsbüchern abrief. In vornehmer Haltung trug er das Haupt; er und die beiden andern waren ein Herz und eine Seele, ein dreiblättriger Klosterklee, so verschieden auch ihr Wesen21. Weil er unter den letzten in den Saal trat, kam Ratpert neben seinen Widersacher zu stehen, den bösen Sindolt, der tat, als sähe er ihn nicht, und flüsterte seinem Nachbar etwas zu; der war ein klein Männlein mit einem Gesicht wie eine Spitzmaus und kniff den Mund zusammen, denn Sindolt hatte ihm soeben zugeraunt, im großen Wörterbuch des Bischofs Salomo22 sei zu der Glosse: »Rabulista bedeutet einen, der über jeglich Ding der Welt disputieren will«, von unbekannter Hand zugeschrieben worden: »Wie Radolt, unser Denkmann.«
Aus dem Dunkel im Saalesgrund ragte Sintram hervor, der unermüdliche Schönschreiber, dessen Schriftzüge die ganze zisalpinische Welt bewunderte23; die größten von Sankt Gallus Jüngern an Maß des Körpers waren die Schotten, die am Eingang ihren Stand nahmen, Fortegian und Failan, Dubslan und Brendan und wie sie alle hießen, eine untrennbare Landsmannschaft, aber mißvergnügt über Zurücksetzung; auch der rotbärtige Dubduin stand dabei, der trotz der schweren eisernen Bußkette nicht zum Propst gewählt ward und zur Strafe für seine beißenden Schmähverse auf die deutschen Mitbrüder drei Jahre lang den dürren Pfirsichbaum im Klostergarten begießen mußte.
Und Notker, der Arzt, stund unter den Versammelten, der erst jüngst des Abts hinkendem Fuß die große Heilkur verordnet hatte mit Einreibung von Fischgehirn und Umschlag einer frisch abgezogenen Wolfshaut, auf daß die Wärme des Pelzes die gekrümmten Sehnen gerad biege24: sie hießen ihn das Pfefferkorn ob seiner Strenge in Handhabung der Klosterzucht; – und Wolo, der keine Frau ansehen konnte und keine reifen Äpfel25, und Engelbert, der Einrichter des Tiergartens, und Gerhard, der Prediger, und Folkard, der Maler: Wer kennt sie alle, die löblichen Meister, bei deren Aufzählung schon das nächstfolgende Klostergeschlecht wehmütig bekannte, daß solche Männer von Tag zu Tag seltener würden?
Jetzo bestieg der Abt seinen ragenden Steinsitz, und sie ratschlagten, was zu tun. Der Fall war schwierig. Ratpert trat auf und wies aus den Aufzeichnungen vergangener Zeit nach, auf welche Art einst dem großen Kaiser Karl ermöglicht worden, in des Klosters Inneres zu kommen26. »Damals«, sprach er, »ward angenommen, er sei ein Ordensbruder, solang' er in unsern Räumen weile, und alle taten, als ob sie ihn nicht kenneten; kein Wort ward gesprochen von kaiserlicher Würde und Kriegstaten oder demütiger Huldigung, er mußte einherwandeln wie ein anderer auch, und daß er des nicht beleidigt war, ist der Schutzbrief, den er beim Abzug über die Mauern hineinwarf, Zeuge.«
Aber damit war das große Bedenken, daß jetzt eine Frau Einlaß begehrte, nicht gelöst. Die strengeren Brüder murrten, und Notker, das Pfefferkorn, sprach: »Sie ist die Witib jenes Landverwüsters und Klosterschädigers, der den kostbaren Kelch bei uns als Kriegssteuer erhob27 und höhnend dazu sagte: ›Gott ißt nicht und trinkt nicht, was nützen ihm die güldenen Gefäße?‹ Laßt ihr das Tor geschlossen!«
Das war jedoch dem Abt nicht recht. Er suchte einen Ausweg. Die Beratung ward stürmisch, sie sprachen hin und her. Der Bruder Wolo, da er hörte, daß von einer Frau die Rede, schlich leis von dannen und schloß sich in seine Zelle.
Da hob sich unter den jüngeren einer und erbat das Wort.
»Sprechet, Bruder Ekkehard28«, rief der Abt.
Und das wogende Gemurmel verstummte; alle hörten den Ekkehard gern. Er war jung an Jahren, von schöner Gestalt und fesselte jeden, der ihn schaute, durch sittige Anmut; dabei weise und beredt, von klugverständigem Rat und ein scharfer Gelehrter. An der Klosterschule lehrte er den Virgilius, und wiewohl in der Ordensregel geschrieben stund: zum Pörtner soll ein weiser Greis erwählt werden, dem gesetztes Alter das Irrlichtelieren unmöglich macht, damit die Ankommenden mit gutem Bescheid empfangen seien, so waren die Brüder eins, daß er die erforderlichen Eigenschaften besitze, und hatten ihm auch das Pörtneramt übertragen.
Ein kaum sichtbares Lächeln war über seinen Lippen gelegen, dieweil die Alten sich stritten. Jetzt erhob er seine Stimme und sprach:
»Die Herzogin in Schwaben ist des Klosters Schirmvogt und gilt in solcher Eigenschaft als wie ein Mann. Und wenn in unserer Satzung streng geboten ist, daß kein Weib den Fuß über des Klosters Schwelle setze: man kann sie ja darüber tragen.«
Da heiterten sich die Stirnen der Alten, als wäre jedem ein Stein vom Herzen gefallen, beifällig nickten die Kapuzen, auch der Abt war des verständigen Wortes nicht unbewegt und sprach:
»Fürwahr, oftmals offenbart der Herr einem Jüngeren das Dienlichste29, Bruder Ekkehard, Ihr seid sanft wie die Taube, aber klug wie die Schlange, so sollt Ihr des eigenen Rats Vollstrecker sein. Wir geben Euch Dispens.«
Dem Pörtner schoß das Blut in die Wangen, er verbeugte sich, seinen Gehorsam anzudeuten.
»Und der Herzogin weibliche Begleitung?« frug der Abt weiter. Da wurde der Konvent eins, daß für diese auch die freimütigste Gesetzesauslegung keine Möglichkeit des Eintritts eröffne. Der böse Sindolt aber sprach: »Die mögen indessen zu den Klausnerinnen auf den Irenhügel gehen; wenn des heiligen Gallus Herde von einer Landplage heimgesucht wird, soll die fromme Wiborad auch ein Teil daran leiden.«
Der Abt pflog noch eine lange flüsternde Verhandlung! mit Gerold, dem Schaffner, wegen des Vesperimbisses; dann stieg er von seinem Steinsitz und zog mit der Brüder Schar den Gästen entgegen. Die waren draußen schon dreimal um des Klosters Umfriedung herumgeritten und hatten sich mit Glimpf und Scherz des Wartens Ungeduld vertrieben.
In der Tonweise: »Justus germinavit« kamen jetzt die eintönigen schweren Klänge des Lobliedes auf den heiligen Benedictus aus dem Klosterhof zu den Wartenden gezogen, das schwere Tor knarrte auf, heraus schritt der Abt, paarweise langsamen Ganges der Zug der Brüder, die beiden Reihen erwiderten sich die Strophen des Hymnus.
Dann gab der Abt ein Zeichen, daß der Gesang verstumme. »Wie geht's Euch, Vetter Cralo«, rief die Herzogin leichtfertig vom Roß, »hab' Euch lange nicht gesehen. Hinket Ihr noch?«
Cralo aber sprach ernst: »Es ist besser, der Hirt hinke als die Herde30. Vernehmet des Klosters Beschluß.«
Und er eröffnete die Bedingung, die sie auf den Eintritt gesetzt. Da sprach Frau Hadwig lächelnd: »Solang' ich den Scepter führe in Schwabenland, ist mir ein solcher Vorschlag nicht gemacht worden. Aber Eures Ordens Vorschrift soll von uns kein Leides geschehen, welchem der Brüder habt Ihr's zugewiesen, die Landesherrin über die Schwelle zu tragen?«
Sie ließ ihr funkelnd Auge über die geistliche Heerschar streifen. Wie sie auf Notker, des Stammlers, unheimlich Schwärmerantlitz traf, flüsterte sie leise der Griechin zu: »Möglich, daß wir gleich wieder umkehren!«
Da sprach der Abt: »Das ist des Pörtners Amt, dort steht er.«
Frau Hadwig wandte den Blick in der Richtung, die des Abts Zeigefinger wies, gesenkten Hauptes stund Ekkehard; sie erschaute die sinnige Gestalt im rotwangigen Schimmer der Jugend, es war ein langer Blick, mit dem sie über die gedankenbewegten Züge und das wallende gelbliche Haupthaar und die breite Tonsur streifte.
»Wir kehren nicht um!« nickte sie zu ihrer Begleiterin, und bevor der kurzhalsige Kämmerer, der meistenteils den guten Willen und das Zuspätkommen hatte, vom Gaul herab und ihrem Schimmel genaht war, sprang sie anmutig aus dem Bügel, trat auf den Pörtner zu und sprach: »So tut, was Eures Amtes!«
Ekkehard hatte sich auf eine Anrede besonnen und gedachte mit Anwendung tadellosen Lateins die sonderbare Freiheit zu rechtfertigen, aber wie sie stolz und gebietend vor ihm stand, versagte ihm die Stimme, und die Rede blieb, wo sie entstanden – in seinen Gedanken. Aber er war unverzagten Mutes und umfaßte mit starkem Arm die Herzogin, die schmiegte sich vergnüglich an ihren Träger und lehnte den rechten Arm auf seine Schulter. Fröhlich schritt er unter seiner Bürde über die Schwelle, die kein Frauenfuß berühren durfte, der Abt ihm zur Seite, Kämmerer und Dienstmannen folgten, hoch schwangen die dienenden Knaben ihre Weihrauchfässer, und die Mönche wandelten in gedoppelter Reihe, wie sie gekommen, hinterdrein, die letzten Strophen ihres Loblieds singend.
Es war ein wundersam Bild, wie es vor und nachmals in des Klosters Geschichte nicht wieder vorkam, und ließen sich von Freunden unnützer Worte an den Mönch, der die Herzogin trug, ersprießliche Bemerkungen anknüpfen über das Verhältnis der Kirche zum Staat in damaligen Zeiten und dessen Änderung in der Gegenwart ...
Die Naturverständigen sagen, daß durch Annäherung lebender Körper unsichtbar wirkende Kräfte tätig werden, ausströmen, ineinander übergehen und seltsamliche Beziehungen herstellen. Das mochte sich auch an der Herzogin und dem Pörtner bewähren; dieweil sie sich in seinen Armen wiegte, gedachte sie leise: »Fürwahr, noch keinem hat Sankt Benedikts Kapuze anmutiger gesessen als diesem31«, und wie er im kühlen Klostergang seine Bürde mit schüchternem Anstand absetzte, fiel ihm nichts auf, als daß ihm die Strecke vom Tor bis hierher noch niemals so kurz vorgekommen.
»Ich bin Euch wohl schwer gefallen?« sprach die Herzogin sanft.
»Hohe Herrin, Ihr mögt kecklich sagen, wie da geschrieben steht: mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht«, war seine Erwiderung.
»Ich hätte nicht gedacht«, sprach sie darauf, »daß Ihr die Worte der Schrift zu einer Schmeichelrede anwendet. Wie heißet Ihr?«
Er antwortete: »Sie nennen mich Ekkehard.«
»Ekkehard! ich danke Euch!« sagte die Herzogin mit anmutvoller Handbewegung.
Er trat zurück an ein Bogenfenster im Kreuzgang und schaute hinaus ins Gärtlein. War's ein Zufall, daß ihm jetzt der heilige Christophorus vor die Gedanken trat?
Dem deuchte seine Bürde auch leicht, da er anhub, das fremde Kindlein auf starker Schulter über den Strom zu tragen, aber schwer und schwerer senkte sich die Last auf seinen Nacken und preßte ihn hinab in die brausende Flut, tief, tief, daß sein Mut sich neigen wollte zu verzweifeln ...
Der Abt hatte einen köstlichen Henkelkrug bringen lassen, damit ging er selber zum Springquell, füllte ihn und trat vor die Herzogin: »Der Abt soll den Fremden das Wasser darbringen, ihre Hand zu netzen«, sprach er, »und sich samt der ganzen Brüderschaft zur Fußwaschung –«